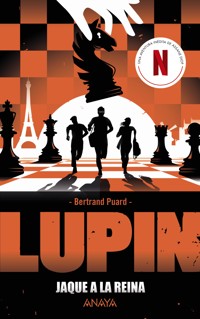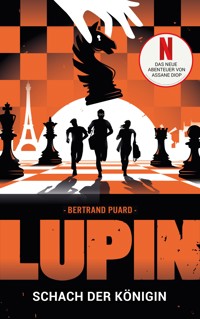
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Belle Epoque Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der neue Lupin-Roman ist da! Offizieller Spin-off zur Serie um den smarten Gauner Assane Diop Eine wilde Nacht in der Pariser Villa der Eltern von Benjamin Férel, einem Antiquitäten- und Kunsthändler. In das Büro von Vater Jules wird eingebrochen, während Mutter Edith auf einen Mann schießt, der in den Garten flüchtet ... Und Jules verschwindet in dieser Nacht ... Benjamin, der zum Tatort gerufen wird, überlässt die Ermittlungen nicht der Polizei. Die Ordnungshüter sollen ihre Nase nicht zu sehr in die Angelegenheiten seiner Familie stecken. Außerdem hat er etwas Besseres als die Polizei: Er hat seinen Jugendfreund Assane Diop, einen Fan von Arsène Lupin, dem Gentleman-Gauner, König der Tricks und Verkleidungen, der immer bereit ist, Rätsel zu lösen und Abenteuer zu bestehen. Die beiden Freunde tun sich zusammen, um Jules zu finden, der sich seit einigen Monaten intensiv mit den Werken der Malerin Rosa Bonheur beschäftigt hat. Warum hat er sich darauf eingelassen? Hat es etwas mit der Schachfigur mit dem seltsam gezackten Sockel zu tun, die Assane unter einem Möbelstück im Büro des Vaters findet? Die Figur stellt ein Pferd dar, im Stil von Rosa Bonheur. Kann es sein, dass es hier um ein Schachbrett geht, das nach den Arbeiten der Künstlerin hergestellt wurde? Von Paris über die Provence bis hin zu einem Archipel vor Los Angeles müssen Benjamin und Assane unerwarteten Feinden mit viel Einfallsreichtum entgegentreten, um ihr Ziel zu erreichen. Als Belohnung winkt vielleicht ein Schatz, aber vor allem müssen sie Ungerechtigkeiten bekämpfen und Abenteuer bestehen, ganz wie der große Arsène Lupin ... Der Roman von Bertrand Puard ist ein offiziell freigegebener Spin-off zur dritten Staffel um Assane Diop. Lizenzausgabe von Hachette Romans. Original: LUPIN - Échec à la Reine.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Schach der Königin
Bertrand Puard
Aus dem Französischen übertragen von Kathrin Wohlgemuth
Impressum
© 2022, Netflix Inc.
©2022, Hachette Livre, 58 rue Jean Bleuzen, 92170 Vanves, France
Titel der Originalausgabe: LUPIN – Échec à la Reine
Lizenzausgabe des Belle Époque Verlags, Inh. G. Pahlberg, Wiesenstr. 7,
72135 Dettenhausen mit freundlicher Genehmigung der Rechteinhaber
Covergestaltung: Julien Rico
ISBN 978-3-96357-371-2
»Wer sind Sie?«
»Ein Abenteurer. Nicht mehr. Ich liebe Abenteuer. Das Leben ist zu langweilig ohne Abenteuer, ob die von anderen Menschen oder die eigenen.«
Prinz Serge Rénine alias Arsène Lupin
Maurice Leblanc, Acht Glockenschläge
Prolog
Los Angeles, Vereinigte Staaten von Amerika, Juli 1907
Archibald Winter wusste, dass er am Beginn einer kuriosen Reise stand.
Die Nachricht hatte er am frühen Nachmittag bekommen. Es war ein dringender Anruf von seinem Chirurgen Morphy aus dem Cedars of Lebanon Hospital gewesen, wo er seine entsetzliche Migräne behandeln ließ. Direktor Winter hatte die Leitung der Verwaltungsratssitzung seines Medienkonzerns seinen Stellvertretern übergeben und sich unverzüglich zum Krankenhaus fahren lassen.
Der Arzt hatte ihn in seinem großen, sonnigen Büro im obersten Stockwerk des Gebäudes empfangen. Durch die Fensterfront nach Norden konnte man das Schachbrettmuster aus Erde und Vegetation des Griffith Parks sehen. Winter hatte die Falten auf Morphys Stirn gezählt und sofort begriffen. Das verschwommene Röntgenbild, das ihm der Mann präsentierte, der im Laufe der Konsultationen zu seinem Freund geworden war, würdigte er keines Blicks.
»Du siehst diesen Klumpen hier rechts, nicht wahr Archie?«
Der Direktor war aufgestanden. Man mochte einer der reichsten und angesehensten Männer der Vereinigten Staaten und gleichzeitig einer der begabtesten Schachspieler einer ganzen Generation sein – die Krankheit konnte einen dennoch in wenigen Zügen mattsetzen.
»Es handelt sich um einen aggressiven Tumor. Es tut mir leid.«
Winter betrachtete den Park in der Ferne, der im Tageslicht märchenhaft vergoldet erschien.
»Gibt es irgendeine Behandlungsmöglichkeit?«, fragte er, ohne sich umzudrehen.
»Der Tumor ist in einem fortgeschrittenen Stadium und ich glaube, ich sehe bereits Metastasen in den Lymphknoten am Hals …«
Dort, vor ihm, an den Hängen des Parks, gäbe es sicher einen perfekten Ort, um ein Observatorium zu errichten und den Himmel zu betrachten.
»Wie viel Zeit habe ich noch?«, fragte Winter.
»Ich weiß es nicht, Archie. Es tut mir leid.«
»Wie lange noch?«
»Erfahrungsgemäß höchstens ein Jahr.«
Der Patient hob eine Hand, damit der Chirurg ihn nicht mit einer weiteren Höflichkeitsfloskel belastete. Er verließ das Büro und dann das Krankenhaus in dem Wissen, dass er nie wieder dorthin zurückkehren würde.
Sein Fahrer brachte ihn zu seinem Schloss Monte Nido in den Bergen nördlich von Malibu. Dort gab er seinem treuen französischen Butler Raoul zwei Anweisungen und verriegelte dann die Tür zu seiner Bibliothek von innen. Die erste Anweisung war, dass er Kennedy sofort sehen wollte, seinen engsten Vertrauten, seine graue Eminenz. Die zweite war, dass er außer Kennedy niemanden sehen oder hören wollte.
Archibald Winter stellte sich vor das riesige, sechzehn mal neun Fuß große Gemälde, das die Backsteinwand seiner kostbaren Bibliothek schmückte. Er wurde es nie leid, das riesige Porträt seines Chihuahuas Danican zu betrachten, gemalt von Rosa Bonheur, der genialen französischen Künstlerin, die er vor kurzem kennengelernt hatte und die er für ihre besondere und sensible Art, Tiere zu malen, bewunderte. Sie schaffte es, ihre Urkraft, ihre Lebendigkeit und ihre Intelligenz wiederzugeben – all das, was die meisten ihrer Quäler, also die Menschen, ihnen absprachen.
Während er auf seinen Vertrauensmann wartete, berauschte er sich an der Leinwand, mit der zusätzlichen Freude, Danican, das Modell, zu streicheln und zu kraulen, der zu ihm gekommen war und der nun seinen Körper voller Leben und Liebe auf den ausgemergelten Knien des Mannes ausstreckte.
Eine halbe Stunde später kreuzte Kennedy schweißgebadet und atemlos auf.
»Ich habe nur noch weniger als ein Jahr zu leben«, sagte Winter zur Einleitung.
Das Gesicht der Eminenz wurde noch grauer, der irische Riese taumelte, schnappte nach Luft und strauchelte, konnte sich aber in letzter Sekunde an der Armlehne des Sessels, in dem sein Chef und Freund saß, abfangen.
Danican bellte.
»Ja aber … Was …«, stotterte er.
Archibald fasste die nötigen Informationen zusammen.
»Du musst kämpfen«, sagte der andere. »Deine letzten Züge sind noch nicht gespielt.«
»Nein, mein Lieber, ich bin schon matt. Der König ist gefallen. Das nützt alles nichts mehr.«
»Du wirst zumindest den Nachlass regeln müssen, damit deine drei Söhne …«
»Nein!«, brüllte Winter ungehalten.
Seine Haare standen wie Flammen zu Berge.
»John, Paul und Winston …«
Der Chihuahua bellte wieder, als Winston die Vornamen seiner drei Söhne aufzählte.
»Nein«, sagte Winter. »Diese Schürzenjäger bekommen nichts. Hörst du, Arthur. Nichts. Keinen Schnippel der riesigen Ländereien, die ich besitze. Nicht einen Cent von den Millionen auf der Bank. Nicht einmal ein Stückchen meines gekauten Tabaks. Alle drei sind Nichtsnutze, die alles von ihrer Mutter haben und nichts von mir. Du weißt sehr wohl, dass sie die Schachregeln nie gelernt haben, aus Trotz, aus einer schwachsinnigen Rebellion heraus! Du weißt besser als jeder andere, mit welcher Kränkung sie von einem Ende des Landes bis zum anderen prahlen. Nun, dann sollen sie weiter tanzen, schmatzen, genießen und mich verhöhnen, ausgestattet mit der monatlichen Rente, die sie seit meiner Scheidung von ihrer Mutter bekommen. Aber wenn der Tumor erst einmal all meine grauen Zellen gefressen hat, Arthur, dann haben sie nichts mehr! Ich werde alles verkaufen. Alles! Wenn ich sterbe, werde ich keinen Cent mehr haben, ich werde nicht einmal mehr das Bett besitzen, auf dem meine sterblichen Überreste liegen. Ich werde dieses Schloss verkaufen, meine Firmen, … alles. Hörst du mir zu, Kennedy? Alles! Und die Früchte all meiner Anstrengungen werde ich irgendwo verstecken. Meinen Schatz. Komme, was wolle!«
Sein Vertrauter nickte. Der Ton, den Archibald Winter angeschlagen hatte, ließ keinen Raum für Diskussionen.
»Aber dieser Schatz … Wird man ihn finden können?«
»Ja«, antwortete Winter entschieden. »Er wird dem gehören, der ihn als Erster findet. Ich werde dir schriftliche Anweisungen dafür hinterlassen. Bei einer so wichtigen Angelegenheit werde ich mich nicht mit einem eigenhändigen Testament begnügen. Mach dir keine Sorgen, Arthur. Ich habe bereits erste Ideen … Jetzt müssen wir nur noch der Schatzsuche Leben einhauchen. Die Regeln festlegen. Wenn die Zeit gekommen ist, wirst du dich um alles kümmern.«
»So spät wie möglich, hoffe ich.«
Winter bat seinen Gesprächspartner, sich zurückzuziehen.
Aber als dieser zur Tür wankte, rief er ihn zurück: »Arthur!«
»Ja, Archibald?«
»Nach reiflicher Überlegung möchte ich meinen drei unfähigen, meinen drei nichtsnutzigen Söhnen doch etwas vermachen …«
»Ich höre, Archibald.«
»Dieses Gemälde«, sagte Winter und zeigte auf das Werk von Rosa Bonheur. »Weil sie Danican so sehr hassen, wie ich ihn liebe. Mit der Auflage, dass es in der Familie bleiben muss. Was den echten Danican betrifft, so wirst du dich um ihn kümmern. Ich bin sicher, dass deine neun Kinder liebend gern mit ihm am Strand von Malibu spielen werden, Arthur.«
»Zweifellos, Archibald.«
Als er mit Danican allein war, stellte sich der Magnat nicht zurück vor Rosa Bonheurs Gemälde, sondern ließ sich in seinen Lieblingslesesessel fallen. Auf einem Sofatisch zu seiner Rechten lag ein gebundenes Buch neben einem hölzernen Schachbrett. Auf dem Einband war eine sehr elegante Gestalt mit feinem Schnurrbart zu sehen, die einen Zylinder trug und einen Stock in der Hand hielt.
»Die außergewöhnlichen Abenteuer von Arsène Lupin, Gentleman-Gauner«, las Winter.
Es war die englische Übersetzung einer Sammlung von Kurzgeschichten, die er im Jahr zuvor in Paris bei einem Schachturnier entdeckt hatte und die nun endlich von M. A. Donohue & Co, einem Verlag in Chicago, veröffentlicht worden war. Das Buch war gerade erst eingetroffen. Es kam gerade im rechten Moment. Er hatte es genossen, die Geschichten auf Französisch zu lesen, aber er war sich sicher, dass ihm aufgrund seiner mangelhaften Beherrschung der Sprache dieses Maurice Leblanc viele der Feinheiten entgangen waren. Er stürzte sich gierig auf die Erzählungen und legte das Buch erst nach der fünften wieder weg.
»Eine erhellende Lektüre, mein lieber Danican«, sagte er dann. »Und eine belebende Inspiration!«
Er hatte gerade die Lösung für seinen Schatz gefunden! Er konnte seinen Nachlass mit dem Schneid regeln, der ihn auszeichnete und den er mit dem französischen Helden teilte, dessen Abenteuer er gerade stellvertretend erlebt hatte. Entspannt ließ er sich in seinen Sessel zurücksinken und streichelte dabei weiterhin seinen Chihuahua.
Und trotz der schrecklichen Nachricht, trotz der Tatsache, dass seine Monate, Wochen, Minuten, Schachpartien und Lektüren gezählt waren, weil das Geschwür in seinem kostbaren Gehirn immer größer wurde, lächelte Archibald Winter wie noch nie zuvor.
1. Kapitel
Paris, Juli 2004
Edith horchte auf.
Eben hatte sie die Nachttischlampe ausgeschaltet, nachdem sie ihre abendlichen zehn Seiten gelesen hatte. Sie las nie eine mehr oder eine weniger. Sie blätterte fünfmal um und klappte das Buch zu. Das war ihr Abendritual. Ihr Mann Jules hatte es sich zur Regel gemacht, nie mitten in einem Kapitel aufzuhören. Das war jedoch nicht der Grund, warum sie in getrennten Schlafzimmern schliefen.
Was ihren Sohn Benjamin betraf … Edith zog es vor, nicht daran zu denken. Ihr einziger Sohn hatte nie gerne gelesen und das war eines der Dinge, die sie als Mutter bedauerte. In der Familie hatten alle ihre eigenen Gewohnheiten, und das war der Grund, warum sie gut miteinander auskamen, oder besser gesagt, warum sie einander ertragen konnten.
Als sie den Schalter ihrer Lampe betätigte, schien es ihr, als hörte sie nach dem üblichen Klick ein seltsames Echogeräusch, eine Art gedämpftes Klacken aus dem Erdgeschoss der Villa.
Edith richtete sich von ihrem Kissen auf. Vielleicht hatte Jules in seinem Büro etwas auf den Boden fallen lassen oder sich wegen seines Zustands gestoßen. Als sie ihren Mann alleine gelassen hatte, der trotz der späten Stunde nicht ins Bett gehen wollte, hätte sie allein aus seinem Atem schließen können, wie viel Single Malt Whisky er an diesem Abend mit seinen Freunden zusammen gebechert hatte.
Auf jeden Fall zu viel.
Ein anderes Geräusch, ein Schrei, ganz kurz nur. In diesem Moment wurde Edith bewusst, dass sie die Fensterläden nicht geschlossen hatte. Das Zimmer lag im Dunkeln, aber ein Mondstrahl beleuchtete das Cover ihres Kriminalromans Requiem für eine Bestie, auf dem die berühmte Frau mit Hut von Matisse zu sehen war, die mit mehreren Dolchstichen gespickt war. Die Klinge der Waffe steckte in einer scharlachroten Feder und glänzte ironisch im Silberstrahl des Mondes.
Edith tastete nach dem Schalter ihrer Nachttischlampe, besann sich aber eines Besseren, als sie nichts weiter hörte. Was, wenn die seltsamen Geräusche aus dem Garten gekommen waren? Ihr Wecker zeigte, dass es nach Mitternacht war. Das schien ihr etwas sehr spät. Um diese Zeit würden die Nachbarskinder der Familie Anfredi nicht im angrenzenden Garten spielen. Edith schüttelte den Kopf. Nein, ganz bestimmt nicht. Die Anfredis waren in jeder Hinsicht anständige Leute, er war Vorsitzender der französischen Niederlassung eines großen italienischen Ölkonzerns, sie eine treue Kundin des Antiquitätengeschäfts Férel, das Edith und ihrem Mann gehörte. Zu gut erzogen also, um ihre beiden Kinder um diese Uhrzeit auf dem Rasen herumtollen zu lassen. Die Nächte waren lau zu Beginn der großen Ferien, aber dennoch …
Um sich zu vergewissern, stand sie auf und ging die paar Schritte zum Fenster. Der Garten nebenan lag wie der ihre im Dunkeln. Man konnte gerade noch die Spitze eines nordamerikanischen Tipis erkennen, ein etwas unförmiges Gebilde aus Holzlatten und Stoff, das der Vater vorherige Woche mit Hilfe von Jules und Benjamin für den Geburtstag von Alessio, dem jüngeren seiner beiden Söhne, aufgestellt hatte.
Edith kehrte zu ihrem Bett zurück, legte sich aber nicht hin. Diese ebenso kurzen wie rätselhaften Geräusche hatten ihre Müdigkeit weggeblasen. Also zog sie ihren seidenen Morgenmantel an und ging über den Flur ins Badezimmer. Ihre Kehle war trocken, viel zu trocken. Sie brauchte ein Glas kaltes Wasser.
Eine Tür knallte heftig im Erdgeschoss. Edith zuckte zusammen und sie duckte sich reflexartig in eine schattige Ecke des Zwischengeschosses. Unten brannte ein Licht, wahrscheinlich das im kleinen Flur, der zu Jules‘ Büro führte.
Sie spürte, wie ihr das Herz bis zum Hals schlug. Eine solche Aufregung um diese Uhrzeit war von ihrem Mann nicht zu erwarten. Sie zögerte, ihn zu rufen. Denn wenn nur er es war, der … Aber in diesem Moment hörte sie ein »Genug!«, gerufen von einer lebhaften, hohen Stimme, die nicht Jules gehörte.
Hatte er Besuch? Nein, er hätte sie über die Anwesenheit eines nächtlichen Besuchers informiert …
Sie zuckte wieder zusammen. Diesmal hörte sie klar und deutlich das Geräusch von splitterndem Glas, das aus dem Büro ihres Mannes kam.
Die Antiquitätenhändlerin versuchte, die Angst, die ihr die Kehle zuschnürte, unter Kontrolle zu bringen. Unten passierte etwas. Etwas Schlimmes. Sollte sie die Polizei rufen? Ihr Mobiltelefon war unten, es blieb ihr also nur der Festanschluss in ihrem Zimmer. Aber dann änderte sie ihre Meinung. Vielleicht handelte es sich lediglich um eine einfache Auseinandersetzung zwischen ihrem Mann und einem Lieferanten oder einem nächtlichen Kunden. Es war nicht das erste Mal, dass Jules mitten in der Nacht heimlich jemanden in seinem Büro empfing, um ein Geschäft abzuwickeln, das Diskretion verlangte. »Eine zwielichtige Transaktion«, wie Benjamin gern scherzte, dachte Edith. Das wäre ja ganz schlau von ihr, der Polizei die Tür zu öffnen, worauf sicherlich eine Inventur der Villa vorgenommen werden würde, was für ihre Geschäfte äußerst hinderlich wäre. Der Handel mit Antiquitäten und Kunst verlangte manchmal, dass man sich am Rand der Legalität bewegte. Eine Selbstverständlichkeit der Branche, die stillschweigend von allen Händlern respektiert, von den Behörden jedoch scharf geahndet wurde.
Unten war eine gedämpfte Diskussion im Gange.
Edith kehrte in ihr Zimmer zurück und schloss die Tür so sanft wie möglich. In ihrer Kehle herrschte eine derartige Trockenheit, dass jedes Schlucken zur Qual wurde. Sie wusste, dass Jules in seinem Nachttisch eine Taschenpistole aufbewahrte. Er hatte ihr immer wieder gesagt, dass die Waffe geladen sei und es genügte, sie zu entsichern, um sie zu nutzen.
Sie ertastete den Griff der Pistole, der sich eisig anfühlte. Edith nahm die Waffe in die Hand, während unten die Stimmen lauter wurden.
»Die zweite!«, hörte sie deutlich.
Das klang nicht nach Jules. Sie entschied sich, hinunterzugehen.
Edith legte den Weg im Dunkeln zurück und verzichtete darauf, auch nur eine einzige Lampe anzuschalten. Glücklicherweise wusste sie genau, wie viele Stufen die Treppe ins Erdgeschoss hatte und ihre Höhe war schon seit langem in ihrem Kopf verankert. Vom Teppich gelangte sie auf den Marmorboden und die kalte Berührung des Steins wirkte auf sie wie ein Elektroschock. Als sie mit dem Rücken zur Wand, und dem Finger am Abzug der Waffe, an der Doppeltür zum Esszimmer vorbeiging, nahm sie den beruhigenden süßlichen Geruch des armenischen Papiers wahr, das Anémone auf ihre Anweisung hin verbrannt hatte.
Edith war nur noch wenige Schritte von der Bürotür entfernt. Sie blieb abrupt stehen.
»Jetzt, Férel!«, donnerte die Stimme.
Die Wörter waren wie ein Schlag. Verunsichert machte sie einen ungeschickten Schritt nach hinten und stieß gegen einen kleinen Beistelltisch, auf dem eine weiß-blaue Ming-Vase mit Blumenmuster aus dem 17. Jahrhundert stand. Das kostbare Stück wurde aus dem Gleichgewicht gebracht und folgte kurz Ediths Schwanken, bevor es auf den Marmor aufschlug und zerbrach.
Dann überstürzten sich die Ereignisse.
Hinter der Bürotür wurde es kurz ruhig. Dann das Geräusch eines Möbels, das verschoben wurde, gefolgt von einem dumpfen Aufprall.
Edith sprang zur Tür und riss sie weit auf, einem Impuls folgende, von dem sie nicht sagen konnte, ob es eine bewusste Entscheidung war.
Die Tür knallte gegen die Wand und sie hörte einen ersten Schuss.
Sie hatte nicht geschossen! Ihr zitternder Finger befand sich immer noch am Abzug.
Edith nahm rechts von sich eine schwarze Gestalt war, die gerade den Raum verlassen wollte.
»Jules!«, rief sie.
Aber war nur er da?
Keine Antwort. Das Licht ging aus. Die Verandatür stand offen. Zwei Schatten huschten bereits durch den Garten. Der Mann, der ihr gegenübergestanden hatte, sprintete auch los. Das war nicht Jules, das war ein Einbrecher!
Edith zielte auf ihn. Aus der Pistole kamen nacheinander zwei Kugeln, was einen ohrenbetäubenden Lärm verursachte. Sie wusste nicht, ob sie den Flüchtenden getroffen hatte oder ob sich die Kugeln verirrt hatten. Sie ließ die Waffe fallen, stolperte drei Schritte zurück und ließ sich in den Sessel ihres Mannes fallen. Sie sah und hörte nichts mehr.
Es hatte keinen Sinn mehr, Jules zu rufen. Sie war allein im Büro. Ihr Mann war verschwunden.
Als Edith einige Augenblicke später wieder zu sich kam und die Halogenlampe einschaltete, stellte sie fest, dass das Büro ihres Mannes perfekt aufgeräumt und die Tür zum Tresor fest verschlossen war.
Wo Anémone, die Köchin, wohl steckte? Und Joseph, der Butler? Die zwei Angestellten schliefen im gleichen Haus. Zwar im Erdgeschoss auf der anderen Seite der Villa, aber die Schüsse hatten doch bestimmt die ganze Nachbarschaft aufgeweckt. Durch die Verandatür konnte Edith vom Schreibtisch aus sehen, wie die Fenster der Häuser nacheinander hell aufleuchteten und eine Art schwarz-weißes Schachbrett um den Montsouris-Park bildeten. Im übernächsten Garten bellte Dufy, der Deutsche Schäferhund einer Nachbarin, wütend.
Mit zitternder Hand griff Edith nach der Whiskykaraffe ihres Mannes und schenkte sich einen großen Schluck ein, den sie in einem Zug herunterstürzte. Der Alkohol gab ihr den Eindruck, auseinandergerissen zu werden. Aber sie fühlte, dass die Kontrolle über ihren Körper zurückkehrte. In den kommenden Stunden, ja sogar Tagen, würde sie viel Mut brauchen.
Edith nahm den Hörer des Festnetztelefons ab, aber der Summton ließ auf sich warten. Sie blickte kurz in Richtung der Wand. Der Stecker war herausgerissen worden. Aber Jules' Mobiltelefon lag gleich neben ihr. Sie nahm es in die Hand. Die Polizei anrufen? Auf keinen Fall. Nein. Zu früh. Oder zu spät. Sie musste Benjamin, ihren Sohn, erreichen. Vielleicht war er auf dem Laufenden, was dieses nächtliche Treffen anging. Vater und Sohn sprachen noch miteinander. Immerhin.
Mit festerer Hand versuchte sie, die sechs Ziffern anzutippen, mit denen sie das Gerät entsperren konnte, aber in ihrem Zustand konnte sie sich nicht an den Code erinnern.
Sie konzentrierte sich und die letzten drei Ziffern fielen ihr ein.
… 813
Sonst nichts.
2. Kapitel
Benjamin Férels kleine runde Brille hatte die ärgerliche Angewohnheit zu verrutschen. Er schob sie höher auf seine markante Nase. Er dachte: Das Gestell ist zu schwer, Schildpatt finden die Kunden im Antiquitätengeschäft ja recht schick, aber hier vor dem Bildschirm ist es mühsam … Ein leichtes Gestell aus Titan und entspiegelte Gläser wären besser.
Während er sich darüber Gedanken machte, tippte er mit rasanter Geschwindigkeit auf seiner Tastatur herum. Er machte eine Pause, ließ beide Hände über den Tasten verharren, atmete aus und nahm einen Druckbleistift, um ein Wort in ein kleines Notizbuch mit schwarzem Einband einzutragen: Optiker.
In diesem Moment begann sein Handy zu vibrieren. Benjamin sah das Display nicht. Die ersten Töne einer Chopin-Sonate – mit Synthesizer erzeugt – erfüllten sein kleines Zimmer.
»Nein«, flüsterte er, während er seine zehn Finger wieder auf der Tastatur herumtanzen ließ. »Nein, Assane, ich werde nicht abheben. Nein, es ist vorbei. Ich begebe mich ins Abseits. Ich verlasse das Spielfeld sogar ganz. Freunde fürs Leben, ja, aber zähle nicht mehr auf mich bei deinen krummen Touren.« Er schob seine Brille wieder hoch und tippte etwas ins Suchfeld dieser neuen US-amerikanischen Suchmaschine mit dem seltsamen Namen »Google«, die er für revolutionär hielt. Sie würde sein Leben verändern, davon war er überzeugt.
Genau aus diesem Grund hatte er sich im Laden seiner Eltern in der Rue de Verneuil, nur etwa hundert Meter vom Musée d'Orsay entfernt, den er verwaltete und wo er im ersten Stock wohnte, einen DSL-Breitbandanschluss einrichten lassen.
Das Handy verstummte, nur um dann wieder heftig loszuschütteln. Der Sohn der Férels warf einen kurzen Blick auf den Rokoko-Rahmen rechts neben dem Bildschirm. Darin befand sich ein Foto von ihm, umgeben von seinen beiden besten Freunden Assane und Claire. Sie kannten sich seit ihrer Jugend und waren unzertrennlich.
»Ein Uhr früh! Das wird so nichts«, entfuhr es Benjamin, der gerne Selbstgespräche führte. »Mein lieber Assane, du musst dich bis zum Morgen gedulden …«
Diese kurze Szene gab ein ziemlich treffendes und knappes Bild von Benjamins Persönlichkeit. Sein lebhafter Geist konzentrierte sich auf zwei Bereiche: die Zuneigung zu alten Dingen – seinen Beruf als Antiquitätenhändler – und seine grenzenlose Leidenschaft für neue Technologien.
Da die Person, die ihn zu erreichen versuchte, nicht aufgab, drehte er das Mobiltelefon schließlich um.
Es war weder Assane noch Claire.
Ein merkwürdiges »Papa« erschien in großen, verschwommenen Pixeln auf dem Display. Mit gerunzelter Stirn drückte er die grüne Taste. Um diese Zeit konnte es sich nur um einen Notfall handeln.
»Papa?«
»Ah, antwortest du doch noch!«
Er erkannte die Stimme seiner Mutter und verzog das Gesicht.
»Benjamin, mit wem war dein Vater heute Nacht verabredet?«
»Wovon redest du da?«, fragte er kühl.
Er hörte, wie Edith geräuschvoll trank, bevor sie antwortete: »Hat dein Vater heute Abend Kunden empfangen? Warst du darüber informiert? Ich hörte Schreie aus dem Büro. Dann einen Schuss … Hörst du mir zu? Einen Schuss. Und dann … Jules ist verschwunden.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ist Vater nicht bei dir? Immerhin hattet ihr heute Abend geplant …«
»Er war in seinem Büro. Es gab einen Tumult … Ich hörte Schüsse und ich habe selber geschossen …«
Benjamin fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Die langsame, ruhige und kühle Stimme seiner Mutter, die eigentlich klang wie immer, und das im besten Fall Zusammenhangslose, was sie sagte, standen in krassem Gegensatz zueinander.
»Du hast geschossen? Aber auf wen? Warum?«
»Ich weiß es nicht. Weißt du es vielleicht?«
»Nein. Ich kenne Papas Kalender nicht auswendig. Warum hast du geschossen?«
»Ich hatte Angst. Ich habe Schreie gehört. Gefährlich klingende Stimmen…«
»Denkst du, das könnte ein Einbruch gewesen sein?«
»Ich weiß es doch nicht«, antwortete seine Mutter. »Das Büro ist aufgeräumt.«
»Aber er ist nicht da …«
»Nein.«
»Und der Safe?«
»Geschlossen.«
Benjamin seufzte. Hatten seine Eltern zu viel getrunken? Hatte eine ihrer elenden Streitereien eine böse Wendung genommen? Was sollte er tun? Es war spät. Er wurde langsam müde. Hatte er noch die Energie, um zur Villa seiner Eltern zu radeln, nur um dort höchstwahrscheinlich Zeuge eines weiteren Ehekrachs zu werden?
Plötzlich hatte er eine Idee.
»Gibst du mir mal Joseph?«
Er würde mit dem Butler reden. Benjamin kannte ihn seit seiner Kindheit und wusste, dass er selbst in den schwierigsten Momenten Besonnenheit bewies.
»Ja, er ist endlich aus seiner Höhle gekrochen«, schimpfte Edith. »Und Anémone auch.«
Sie brüllte den Namen des Butlers und regte damit den Hund der Nachbarn noch mehr auf.
»Ich sehe, dass er gerade aus dem Garten zurückkommt.«
»Gib ihn mir.«
Die einzige Antwort war ein schriller Schrei seiner Mutter.
Dann wurde die Verbindung unterbrochen.
3. Kapitel
Der junge Férel stand wie angewurzelt da. Der Schrei seiner Mutter hallte noch in seinem Ohr nach. Er rief zurück, seine Finger glitten über die Tastatur. Joseph antwortete.
»Benjamin«, flüsterte der Butler.
»Was ist los, Joseph? Warum hat Edith geschrien?«
»Ich bin gerade aus dem Garten zurückgekommen«, erklärte der Hausangestellte mit zitternder Stimme. »Beim Liguster habe ich auf dem Boden ein Taschentuch deines Vaters gefunden. Ein Taschentuch …«
Benjamin hörte ihn schlucken.
»… mit Blutflecken.«
Benjamin war erschüttert. Das war ein Grund, zur Villa zu fahren. Es war Blut geflossen.
»Ich komme. Gib mir meine Mutter.«
Edith kam heftig atmend ans Telefon.
»Du musst die Polizei rufen«, sagte er.
Mit der freien Hand bediente er die Maus, um den Computer herunterzufahren.
»Nein. Komm du erst mal.«
»Ich bin in weniger als zwanzig Minuten da.«
Er trennte die Verbindung und blickte auf seinen Arbeitstisch. Links neben der Tastatur stapelten sich Bündel von Hunderteuroscheinen sowie mehrere Hauptplatinen und andere Computerbestandteile.
Auf dem Regal lag eine Zeichnung von Léon Spilliaert, eine Landschaft von Ostende, die Benjamin am Nachmittag für fünfunddreißigtausend Euro erworben hatte. Er schloss alles in den hohen, gepanzerten Safe ein, der rechts neben seinem kleinen, klösterlichen Bett stand.
Dann eilte er die hölzerne Wendeltreppe hinunter in den abgedunkelten Laden. Er ging zur Seitentür hinaus und schwang sich auf sein Fahrrad mit verchromter Lenkstange, das im hinteren Teil des Hofes abgestellt war. In Paris bewegte sich Benjamin nur mit dem Fahrrad fort.
Er fuhr die Rue de Verneuil entlang und nahm eine Abkürzung zur Metrostation Rue du Bac. Um zur Villa seiner Eltern in der Rue Georges-Braque in der Nähe des Parc Montsouris zu gelangen, musste er den Boulevard Raspail in seiner ganzen Länge bis zum Place Denfert-Rochereau hinauffahren. Es ging ein bisschen bergauf, aber Benjamin fühlte sich gut in Form.
»Mal überlegen«, dachte er, als er den Boulevard du Montparnasse schwungvoll überquerte, wo sich noch einige Touristen vor den Fassaden der Brasserien tummelten. »Papa hat die gemeinsame Wohnung verlassen, ohne Mama etwas zu sagen. Nicht zum ersten Mal. Aber diese Geschichte mit den Schüssen, die Blutflecken auf dem Taschentuch …«
Er fuhr am berühmten Lion de Belfort vorbei, umrundete den Eingang zu den Katakomben, der einige Erinnerungen an Assane weckte, und bog dann in die Avenue René-Coty ein. Er war schnell unterwegs und seine Waden begannen zu brennen. Vor den geschlossenen Toren des Parks bog er nach rechts in die Rue Georges-Braque ein und bremste vor der Hausnummer 8 ab, wo ein großer weißer Lieferwagen stand. Die Pflastersteine schüttelten sein Fahrrad kräftig durch, und damit auch ihn, aber das war er gewohnt. Er hatte seine gesamte Kindheit hier verbracht und kannte diesen kleinen ländlichen Teil von Paris in- und auswendig.
Im Erdgeschoss und in den oberen Stockwerken der Villa brannten Lichter, aber auch in den benachbarten Häusern der Reichen.
»Ist alles in Ordnung, Herr Férel?«, fragte eine Männerstimme, die Benjamin nicht erkannte und die aus der gegenüberliegenden Villa kam. »Wir haben Schüsse gehört und …«
Benjamin beruhigte die Nachbarn rundherum, während er sein Fahrrad in den Garten stellte: »Kein Grund, sich zu sorgen, das verspreche ich Ihnen …«
Er sagte nichts weiter, sondern betrat die Eingangshalle der Villa. Seine Mutter war immer noch in Jules‘ Büro. Als sie ihren Sohn sah, rief sie verblüfft: »Also dieser Bart …!«
»Denkst du nicht, wir haben Besseres zu tun, als über meine Gesichtsbehaarung zu diskutieren?«, sagte Benjamin.
Edith zuckte mit den Schultern. Die beiden Hausangestellten Anémone und Joseph standen neben ihr.
Benjamin begrüßte sie und fragte: »Das Taschentuch?«
Joseph deutete auf den Beistelltisch neben der Verandatür. Benjamin beugte sich über das Stück Stoff, das mit den Initialen seines Vaters bestickt war. Das »F« war in der Tat von einem sehr kräftigen Rot verfärbt, das noch frisch leuchtete. Er wagte nicht, es zu berühren. War dies das Blut seines Vaters? Wahrscheinlich. Und das konnte nichts Gutes bedeuten.
»Hast du versucht, Papa auf seinem Handy zu erreichen?«, fragte er.
»Es ist noch hier.«
»Du weißt doch, dass er zwei hat. Hast du versucht, die andere Nummer anzurufen?«
»Ja. Da kommt nur der Anrufbeantworter.«
Benjamin schüttelte den Kopf, als Edith ihm alles genau erzählte: ihre Angst, wie sie das Büro betrat, ihre Panik und die beiden Schüsse. Oft warf sie ängstliche Blicke auf die Taschenpistole, die noch immer auf dem Schreibtisch lag.
»Hast du jemanden getroffen?«
Seine Mutter stammelte, dass sie es nicht wisse. Sie hatte geschossen. Punkt.
»Das sieht nicht nach einem Einbruch aus«, zog Benjamin den Schluss. »Alles ist da, wo es hingehört.«
Er inspizierte kurz die Räumlichkeiten und fand unter dem Schreibtisch einen Leinenbeutel mit fast fünfzigtausend Euro in kleinen Scheinen.
»Hat Papa Arbeit mit nach Hause genommen?«, fragte er und stand auf.
Das war ein Scherz zwischen ihnen. Für Kunsthändler bedeutete zu Hause zu arbeiten nicht, ein oder zwei Akten heim zu nehmen, sondern oftmals Kunstwerke, die ein Vermögen wert sein konnten.
»Ja«, antwortete Edith. »Er hat von einem Watteau gesprochen, den er begutachten sollte. Auch einen kleinen Philippe de Champaigne. Und etwas Schmuck.«
Sie wandte sich zu einem Bücherregal um, dessen Bretter sich unter dem Gewicht der Kunstbücher bogen.
»Schau … Der Watteau ist hier.«
Benjamin kam näher und entdeckte tatsächlich ein kleines Gemälde, das eine Frau zeigte, die Mandoline spielte.
»Und der Safe ist zu.«
»Er sieht unbeschädigt aus«, fügte Benjamin hinzu.
»Du kennst den Code!«, sagte Edith, lauter als nötig.
Ohne etwas zu sagen, ging Benjamin in die Hocke, um ihn einzutippen. Die Tür sprang auf, und darin befanden sich der Philippe de Champaigne und drei Perlenketten.
Es konnte also wirklich kein Einbruch gewesen sein. Oder aber die Diebe hatten es auf einen bestimmten Gegenstand abgesehen. Aber warum nahmen sie dann nicht wenigstens die Banknoten mit?
»Dein Vater wurde entführt!«, sagte Edith. »Das ist es, was ich denke. Er wurde gekidnappt! Er hat versucht, sich zu wehren. Sie haben auf ihn geschossen. Der erste Schuss, den ich gehört habe …«
»Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen«, schlug Benjamin vor.
Die Köchin und der Butler, die das Treiben ihrer Chefin und ihres Sohnes beobachteten, stimmten mit einem schüchternen Nicken zu.
Es klingelte an der Haustür. Benjamin wechselte einen Blick mit seiner Mutter und dann mit Joseph.
»Das geht schon die ganze Zeit so, Herr Férel«, sagte der Butler.
Benjamin ging an die Tür. Es war Herr Anfredi, der in Jeans und Hemd, aber ohne seine ewige Krawatte, nach dem Rechten sehen wollte.
»Wir haben es knallen gehört«, sagte er mit seinem singenden Akzent. »Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert …« Benjamin beruhigte ihn und zwang sich zu einem Lächeln.
»Mein Vater hat Künstler für eine Performance kommen lassen. Sie wissen ja, wie schelmisch er manchmal ist. Keine Sorge, Herr Anfredi, es ist alles in bester Ordnung.«
Der Italiener wäre gerne eingetreten. Er warf eindringliche Blicke in die Halle, aber Benjamin schloss den Türflügel und ging zu seiner Mutter zurück.
»Du hättest dir eine weniger abgehobene Erklärung als diese zeitgenössische Kunstsache einfallen lassen können«, tadelte ihn Edith.
Benjamin antwortete nicht und ging durch die große Verandatür hinaus auf den gepflegten Rasen. Seltsamerweise kam ihm die Nachtluft weniger warm vor als während seiner Fahrradfahrt. Er ging ein paar Schritte.
»In welche Richtung lief der Typ, als du auf ihn geschossen hast?«
»Da lang«, antwortete sie und deutete auf den Musikpavillon. »Nach rechts … Richtung Ligusterhecke.«
Benjamin ging einen Schritt, dann noch einen, und betrat den Teil des Gartens, den die Lichter der Villa nicht mehr beleuchteten. Für einen kurzen Moment überlegte er, ob es nicht klüger wäre, die Walther PPS seines Vaters zu holen. Aber das war doch absurd … Er würde doch nicht einem Einbrecher in die Arme laufen … oder seinem Vater, der ihnen einen bösen Streich gespielt hatte. Er rief: »Könntest du Joseph bitten, die Scheinwerfer beim Pavillon einzuschalten?«
Ein plötzlicher Windstoß fegte durch die Sträucher. Die Blumen in den Beeten bewegten sich. Benjamin strich sich eine Strähne aus der Stirn und rückte seine schwere Brille zurecht. Er dachte an seinen besten Freund. Dies war eher eine Situation für Assane. Mysteriöse Schüsse, ein Verschwinden … Ein Einbruch, der nicht wie ein Einbruch aussah.
»Licht!«, rief Benjamin, der immer noch im Dunkeln stand.
Die starken Scheinwerfer gingen an. Er stand mitten im Lichtstrahl und wurde geblendet. Der junge Mann blinzelte und konzentrierte sich dann darauf, die Rabatten am Fuß des Ligusters und der etwa eineinhalb Meter hohen Umfassungsmauer zu untersuchen. Dahinter befand sich ein kleiner Weg, der auf der einen Seite zur Rue Nansouty und auf der anderen zum Parc des Institut Mutualiste Montsouris führte.
Man musste nicht in die Haut von Sherlock Holmes – oder, um Assane eine Freude zu machen, von Herlock Sholmès – schlüpfen, um zu sehen, dass die Erde zertrampelt war. Es waren viele Abdrücke von Schuhsohlen in verschiedenen Größen und Formen zu sehen. Benjamin schaltete die Taschenlampe seines Nokia Mobiltelefons ein, um sie zu zählen: drei oder sogar vier Spuren von Fußabdrücken? Mehrere Sträucher sahen verwüstet aus, weil jemand sie als Aufstiegshilfe benutzt hatte, um über die Mauer zu klettern.
Edith hatte nicht gelogen, in diesem Garten war wirklich etwas passiert. Das Taschentuch seines Vaters zeigte, dass er wahrscheinlich von den Angreifern verletzt worden war. Was bedeutete das? War er entführt worden?
Benjamin zog sich schnell ins Büro zurück. Wenn für den Abend ein Termin angesetzt gewesen war, würde er ihn im Kalender seines Vaters finden. Das Notizbuch lag wie üblich ordentlich neben der Zigarrenschachtel, dem Brieföffner und einigen Büchern auf der ledernen Schreibunterlage. Nur die Anwesenheit des Taschenrevolvers, den seine Mutter dort fallengelassen hatte, verriet, dass diese Nacht anders war als alle anderen Nächte.
Benjamin blätterte im Terminkalender, um das aktuelle Datum zu finden. Für den Abend fand er den Eintrag »Umtrunk mit den Planchets«. Sonst nichts. Erst als er das Notizbuch zuklappte, bemerkte er die Einkerbung auf der Schreibunterlage. Er hob das Buch auf und die Luft blieb ihm weg.
Jules Férel hatte ungeschickt kleine Symbole in das schwarze Leder geritzt.
Sein Sohn zog die Halogenlampe heran, um sie zu beleuchten.
Benjamin fasste sich mit beiden Händen an den Kopf. Was war das? Sah er diese Symbole wirklich oder spielte ihm seine Phantasie einen Streich?
4. Kapitel
Ein Sommer Mitte der 1990er-Jahre, ein Landsitz in einem Dorf in der Normandie.
Benjamin hat Assane und Claire für ein paar Tage in das Ferienhaus seiner Eltern eingeladen. Edith ist geschäftlich nach Paris zurückgekehrt, während Jules noch ein paar Tage bleibt, um die letzten Beschreibungen von seltenen Manuskripten für einen Auktionskatalog zu verfassen. Die Versteigerung soll im Herbst im Hotel Drouot stattfinden. Umso besser. Edith ist nicht begeistert vom Umgang ihres Sohnes. Sie hat nie verstanden, wie die Eltern dieser Jugendlichen aus dem Banlieu einen Sinn und sogar die finanziellen Mittel dafür finden konnten, ihre Kinder im vornehmen Bildungsinstitut einzuschulen, in dem sie Benjamin unbedingt hatte anmelden wollen. Jules hingegen stört sich nicht an der Anwesenheit der beiden Jugendlichen. Er sieht, dass sein Sohn sich freut, ein paar Tage Urlaub mit ihnen zu verbringen, und das ist alles, was zählt. Claire ist ein sehr sympathisches, höfliches und keineswegs dummes Mädchen. Er beobachtet an ihr ein großes Einfühlungsvermögen, was in diesem Alter eher selten ist. Aus anderen Gründen schätzt Jules Férel Assane genauso sehr. Der Waisenjunge liest gerne, vor allem Kriminal- und Abenteuerromane, und das trifft sich gut, denn die Bibliothek des Landsitzes enthält eine beeindruckende Sammlung davon. Und Benjamin lässt sie nur verstauben, denn er verbringt die meiste Zeit mit Videospielen. Abends, wenn Claire und Benjamin im Bett sind, bleibt Assane in der Bibliothek. Er überfliegt die Buchrücken und wenn ihn ein Titel anspricht, schnappt er sich den Roman und liest die ersten Seiten. Und mehr, wenn es ihm gefällt. Während seines Aufenthalts entdeckt er die Romane von John Dickson Carr, die voll von unmöglichen Verbrechen in geschlossenen Räumen sind. Besonders interessiert ihn aber ein winziges Taschenbuch mit gewellten Seiten und gelbem Einband, auf dem eine schwarze Maske abgebildet ist, in deren Auge eine Feder steckt. Darin liest er eine faszinierende Geschichte: La Tour, prends garde… von David Alexander, in dem ein Mann, während er im Sterben liegt, um seinen Mörder zu denunzieren, Karten um sich herum anordnet, die den Schuldigen verraten sollen. Assane hat sich schon immer für Geheimcodes interessiert und teilt diese Leidenschaft mit Claire und Benjamin, der die Codes in Videospielen liebt. Das Trio hätte sich jedoch nie träumen lassen, dass Jules Férel Codes ebenso sehr schätzt.
Als der Antiquitätenhändler Assane um 4 Uhr morgens mit müden, aber immer noch lebhaften Augen dabei erwischt, wie er sich in die letzten Seiten von David Alexanders Roman vertieft, setzt er sich einfach neben ihn und zeichnet seltsame, fast kabbalistische Symbole auf einen Papierblock.
»Wenn ich dir sage, dass ein Punkt zwei Quadraten entspricht und dass der Name, den du entschlüsseln musst, der eines Helden aus dem Buch ist, das du gerade fertiggelesen hast, kannst du das Rätsel dann lösen?«
Der Jugendliche versucht es, aber er ist zu müde. Claire hingegen gelingt es am nächsten Morgen, während sie dicke Scheiben Sauerteigbrot mit ungesalzener Butter vertilgt.
»Thomas Pirtle!«
Jules Férel ist beeindruckt. Er schlägt vor, die Beschreibungen für den Katalog einen Tag lang ruhen zu lassen: »Heute setzen wir uns alle zusammen an den Tisch in der Bibliothek. Wir tüfteln gemeinsam unseren ganz persönlichen Geheimcode aus.«
Assane und Claire klatschen Beifall. Das ist eine tolle Idee.
Benjamin ist zurückhaltender.
»Aber wozu?«, will er wissen.
»Für nichts«, wirft Assane ein.
»Für nichts Bestimmtes im Moment«, fügt Jules hinzu. »Aber wer weiß, eines Tages …«
Der Tisch ist übersät von Wörterbüchern, verschiedenen Handbüchern und Dutzenden von Blättern, die nach und nach vollgekritzelt werden. Sie entscheiden sich für einen Code aus Figuren, Dreiecken, Quadraten, Kreisen, Rauten, Trapezen, Punkten und Kreuzen mit einem Entschlüsselungsraster. Also für etwas, das sehr mysteriös erscheint, in Wirklichkeit aber ganz einfach ist. Für die Eingeweihten. Als Claire, Assane, Benjamin und Jules von der Arbeit aufblicken, ist es Zeit für das Abendessen. Ihre Gehirne sind zermartert, aber ihre gemeinsame Freude weckt die Lebensgeister. Zur Feier des Tages lädt Jules sie in ein Sternerestaurant ein. Es ist ein fröhlicher Abend, an dem die Mitglieder der kleinen Gesellschaft einander mit »Raute mit Kreuz darin«, »Trapez und Ausrufezeichen« ansprechen, während die Gäste an den umliegenden Tischen sie erstaunt und sogar tadelnd anblicken.
Ja, ein sehr schöner Abend. Einer der besten, die Benjamin je mit seinem Vater und seinen beiden engsten Freunden verbracht hat.
»Für nichts Bestimmtes – im Moment«, hatte Jules Férel an jenem Sommermorgen in der Normandie gesagt. »Aber wer weiß, eines Tages …«
Dieser Tag war nun also gekommen. Die Entdeckung der Symbole, die der Verschwundene vermutlich mit der Spitze des Brieföffners in die Schreibunterlage geritzt hatte, änderte alles.
Schon zwei Schlussfolgerungen, dachte er. Sein Kumpel Assane wäre stolz auf ihn. Die erste: Wenn Jules Zeit gehabt hatte, die Zeichen einzuritzen, konnte man annehmen, dass das Gespräch ohne viel Aufregung begonnen hatte, obschon mit einer leisen Bedrohung für seinen Vater, da er die Gelegenheit gehabt hatte, einen Brieföffner, also eine potenzielle Waffe, in die Hand zu nehmen, ohne dass seine Gesprächspartner ihn daran gehindert hätten. Und sein Geist war unbelastet genug gewesen, sich an den Code zu erinnern und die Symbole einzuritzen. Gut.
Die zweite: Durch die Verwendung des Codes wollte Jules erreichen, dass sein Sohn als Einziger in der Lage sein würde, die Nachricht zu lesen und damit das Geheimnis seines Verschwindens zu lüften.
Benjamin zog sein Handy heraus und machte ein Foto von der Nachricht.
Der einzige, aber nicht unwesentliche Haken an der Sache war, dass Benjamin sich nicht mehr an den Code erinnern konnte.
Edith, die das Büro verlassen hatte, um sich frisch zu machen, kam zurück. Aus Reflex legte Benjamin den Terminkalender sofort wieder hin. Gleich darauf kam Joseph herein.
»Ich habe noch einen Nachbarn getroffen«, sagte er. »Natürlich machen sich alle Sorgen. Sollten wir nicht die Polizei rufen? Immerhin sind da das Taschentuch, die Fußabdrücke, die kaputten Äste …«
Edith schnitt dem Butler das Wort ab: »Verschone uns mit deiner Aufzählung. Ich denke, es ist keine gute Idee, um diese Uhrzeit die Polizei zu rufen, oder?«
Sie warf einen Blick auf ihren Sohn, der schwieg.
»Es ist gut möglich, dass Jules aus einer Laune heraus das Haus verlassen hat.«
»Das Taschentuch, Madame«, wagte Joseph zu sagen. »Monsieur ist sicherlich verletzt …«
Edith beschloss, das Schweigen ihres Sohnes als Zustimmung zu deuten.
»Wenn er nicht selbst gegangen ist, sondern entführt wurde, wird bald eine Lösegeldforderung kommen. Wir sind reich. Wir werden bezahlen. Es ist unnötig, dass sich die Polizei in unsere Angelegenheiten einmischt.«
Benjamin sagte sich, dass das typisch für seine Mutter war. Kaltblütig und teuflisch pragmatisch. Immer wog sie das Für und Wider ab, bevor sie sich auf etwas einließ. Warum sagte er nichts? Weil auch er die Polizei nicht rufen wollte, bevor er den Code geknackt hatte, der ihm die Lösung des Rätsels ganz oder teilweise liefern würde. Wenn die Polizei käme, wäre es ihm grundsätzlich egal, ob sie ein paar zwielichtige Geschäfte aufdecken würden … Aber sie würden auf jeden Fall den Code bemerken, und Jules hatte diesen verwendet, weil er nur seinen Sohn ins Vertrauen ziehen wollte.
Ihn. Und auch Assane und Claire. Denn der Code nahm das ganze Trio in die Pflicht, nicht wahr?
»Falls er verletzt ist«, fuhr Edith fort, die stets in ihrem Gedankenfluss blieb. »Dann pflegen ihn die Entführer zweifellos. Denn wenn Jules etwas zustößt, hätte das alles ja gar nichts gebracht. Außerdem besteht vielleicht noch die Chance, dass Jules ihnen entwischt. Dann kommt er wieder heim und wir können gemeinsam entscheiden, wie wir unsere Geschäfte am besten schützen.«
»Eure Geschäfte!«, empörte sich Benjamin und drehte sich so schnell um, dass er mehrere Ordner auf dem Schreibtisch umwarf.
»Unsere Geschäfte sind auch deine«, erwiderte Edith. Benjamin antwortete nur mit einem höhnischen Grinsen.
»Spiel hier nicht den Unschuldigen, Benjamin. Ich erinnere mich an Momente in deinem Leben, in denen du nicht so erpicht darauf warst, Uniformierte anzutreffen …«
Das war ein Schlag unter die Gürtellinie. Der Sohn schwieg.
»Versuchen wir doch später noch mal, ihn auf seiner zweiten Nummer zu erreichen«, schlug Edith vor. »Falls ich irgendetwas höre, melde ich mich bei dir. Von dir erwarte ich dasselbe.«
»Du redest mit mir, als sei ich einer deiner Angestellten. Aber ich bin dein Sohn! Und der von Jules.«
»Aber auch das bist du, Benjamin. Ein Angestellter. Unser Angestellter. Wir haben genügend Aspekte deines früheren Lebens bereinigt, dass wir jetzt ein tadelloses Verhalten uns gegenüber erwarten können.«
Benjamins Blick verhärtete sich noch mehr.
»Du ersparst mir jetzt aber deine übliche Assane-Leier, nicht wahr? Du fängst nicht jetzt wieder damit an. Nicht in dieser Situation.«
»Wir drei haben eine Abmachung. Ich werde dich nicht an den genauen Wortlaut erinnern. Du hattest beschlossen, deinem sogenannten Freund mehr Bedeutung beizumessen als deinen eigenen Eltern. Du hast bei seinen krummen Touren mitgemacht. Und du hast den Preis dafür bezahlt. Teuer bezahlt. Und jetzt bezahlst du ihn immer noch, das ist nur normal. Hier bist du bei mir zu Hause. Hier entscheide ich.«
Edith war wieder sie selbst, eine herrische und kalte Frau.
»Wir lassen uns Zeit.