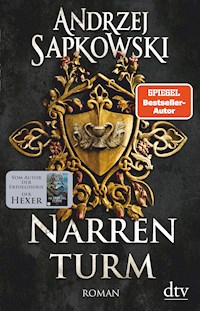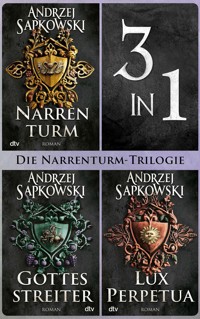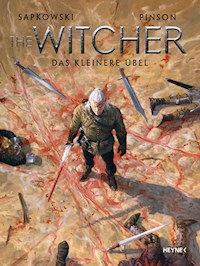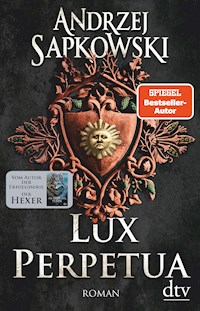
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Narrentum-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Das Finale der fulminanten Mittelalter-Trilogie Reynevan, der Medicus, wird von seinem Erzfeind, dem Bischof von Breslau, wegen »Verbrechen und Zauberei« verdammt. Unser Held verliert dennoch nicht den Mut, sondern sucht weiter nach seiner Nicoletta, die von Anhängern des Bischofs entführt worden ist. Seine Suche führt ihn nach Schlesien, Böhmen und auch in andere Gebiete, durch die sich ein blutiger Glaubenskrieg wälzt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 965
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Über das Buch
Das grandiose Finale der Trilogie um den schlesischen Medicus Reynevan
Reinmar von Bielau, genannt Reynevan, wird von seinem Erzfeind, dem Bischof von Breslau, auf spektakuläre Weise wegen »Verbrechen und Zauberei« verdammt. Der Kräuterkundler und Medicus verliert dennoch nicht den Mut, sondern sucht weiter nach seiner Nicoletta, die von Anhängern des Bischofs entführt worden ist. Vom Liebesleid getrieben, führt ihn seine Suche nach Schlesien, Böhmen und in all die Gebiete, durch die sich der grausame Glaubenskrieg zwischen Hussiten und Katholiken wälzt. Nicht selten gerät Reynevan in höchst missliche Lagen. Anfangs noch ganz von den Idealen der Hussiten überzeugt, durchschaut er mehr und mehr, dass es vorrangig um Macht, Einfluss und Politik geht …
Von Andrzej Sapkowski sind bei dtv erschienen:
Die Abenteuer des jungen Witchers
Der letzte Wunsch
Zeit des Sturms
Das Schwert der Vorsehung
Die Witcher-Saga
Das Erbe der Elfen
Zeit der Verachtung
Feuertaufe
Der Schwalbenturm
Die Dame vom See
Kreuzweg der Raben
Geschichten aus der Welt des Witchers
Etwas endet, etwas beginnt
Das Universum des Andrzej Sapkowski
Alain T. Puysségur: The Witcher. Der Codex
Die Narrenturm-Trilogie
Narrenturm
Gottesstreiter
Lux perpetua
Andrzej Sapkowski
Lux perpetua
Roman
Aus dem Polnischen von Barbara Samborska
Dem Andenken von Jewgeni Wajsbrot, einem großartigen Menschen und hervorragenden Übersetzer, der über ein halbes Jahrhundert unseren russischen Freunden die polnische Literatur nähergebracht hat, widme ich diesen Roman.
Der Autor
Prolog
Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla
teste David cum Sibylla …
Tag der Rache, Tag der Sünden, wird das Weltall sich entzünden, wie Sibyll und David künden. Welch ein Graus wird sein und Zagen, wenn der Richter kommt, mit Fragen streng zu prüfen alle Klagen! Laut wird die Posaune klingen, durch der Erde Gräber dringen, alle hin zum Throne zwingen …
Trararara, trararara, trararara dum, dum dum …
Lacrimosa dies illa
qua resurget ex favilla
iudicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus.
Oo, o weh, o weh, o weh, Ihr werten Herren und Zuhörer, der Tag der Rache naht, der Tag des Verhängnisses, der Tag der Tränen. Der Tag des Gerichts naht und der Tag der Strafe. Wie es im Brief des Johannes steht: Antichristus venit, unde scimus quoniam novissima hora est. Der Antichrist kommt, er zieht heran, unser letztes Stündlein kommt. Das Ende der Welt ist nahe und das Ende jeglichen Seins …
Mit anderen Worten: Es sieht, verdammt noch mal, nicht gut aus.
Der Antichrist, Ihr lieben Herren und Zuhörer, wird vom Stamme Dan sein.
In Babylon wird er geboren werden. Am Weltenende wird er erscheinen, ein halbes Viertel eines Jahres wird er zu herrschen vermögen. In Jerusalem wird er einen Tempel erbauen, die Könige gewaltsam unterdrücken und Gottes Kirche ruinieren. Auf einem Feuerofen wird er daherfahren und überall seltsame Werke tun. Er wird seine Wunden zeigen und damit die gläubigen Christen täuschen. Er kommt mit Feuer und Schwert, Gotteslästerung wird seine Macht sein, seine Schultern die Abtrünnigkeit, sein rechter Arm die Vernichtung und sein linker Arm das Dunkel. Sein Antlitz ist das eines wilden Tieres, mit hoher Stirn und zusammengewachsenen Brauen … Sein rechtes Auge geht auf wie der Morgenstern, das linke ist starr und grün wie das einer Katze und hat statt einer Pupille zwei. Seine Nase ist wie ein Abgrund, der Mund ist eine Elle hoch und die Zähne eine Spanne breit. Seine Finger sind wie eiserne Sensen …
Was denn, was denn! Was schreit Ihr denn einen alten Mann so an, werte Herren? Warum müsst Ihr denn gleich drohen? Wozu, weshalb? Ich erschrecke Euch? Ich lästere? Ich krächze das Unglück herbei wie ein Rabe? Keinesfalls, Ihr werten Herren, ich krächze nichts herbei! Ich sage nur die Wahrheit, die heilige, reinste Wahrheit, wie sie von den Kirchenvätern beglaubigt wird. Ja, sogar in den Evangelien bewiesen wird! In den Apokryphen? Was macht das schon, wenn’s in den Apokryphen ist? Diese ganze Welt ist doch apokryph!
Was bringst du denn herbei, liebes Mädchen? Was schäumt denn da in den Krügen? Doch nicht etwa Bier?
Ach, vorzüglich … Schweidnitzer, da gehe ich doch wohl nicht fehl …
Holla! Schaut doch mal aus dem Fenster, Ihr Herren! Sollte mich, einen alten Mann, etwa mein Blick trügen? Scheint es mir nur so, oder spitzt endlich die Sonne hinter den Wolken hervor? Bei Gott, ja! Endlich, endlich ist’s vorbei mit dem Regen und dem miesen Wetter. Wahrhaftig, seht doch nur, da umhüllt ein Glanz die Welt und strömt in hellem Goldstrahl vom Himmel herab. Und das Licht wird gewaltig sein …
Lux perpetua.
Das wünscht man sich doch. Das ewige Licht. Das wünscht man sich …
Was sagt Ihr? Jetzt, wo der Regen aufhört, reicht’s mit dem Herumsitzen in der Schenke, wird es Zeit, sich auf den Weg zu machen? Und deshalb soll ich nicht herumschwatzen, sondern einen Zahn zulegen, um zum Ende zu kommen? Zu Ende erzählen, wie es weitergegangen ist mit Reynevan und seiner geliebten Jutta, mit Scharley und Samson in jener Zeit, in der Zeit jener grausamen Kriege, als das Blut in Strömen floss und Asche die Erde der Lausitz, Schlesiens, Sachsens, Thüringens und Bayerns schwarz färbte? Sogleich, Ihr Herren, sogleich. Ich werd’s Euch schon erzählen, denn jede Erzählung strebt ja ihrem Ende zu. Aber, auch das muss ich Euch sagen, wenn Ihr auf ein glückliches oder gar fröhliches Ende der Erzählung hofft, muss ich Euch enttäuschen … Was denn? Ich erschrecke Euch schon wieder? Ich krächze? Ach, sagt doch selbst, wie soll man denn da nicht krächzen wie ein Rabe? Wenn sich in der Welt solche entsetzlichen Dinge zutragen? Wenn ganz Europa von Kampfeslärm widerhallt, seht doch nur mal?
Vor Paris wird das Blut auf den Schwertern der Franzosen und Engländer, der Burgunder und der Armagnacs nicht trocken. Immer noch dauern Mord und Brand auf französischer Erde an, immer noch ist Krieg, wie Ovid sagt. Soll der womöglich gar hundert Jahre dauern?
England brodelt über von Revolten, Gloucester liefert sich Kämpfe mit Beaufort. Böses wird daraus entstehen, Ihr werdet noch an meine Worte denken, oh, Böses zwischen York und Lancaster, zwischen der Weißen und der Roten Rose.
In Dänemark donnern die Geschütze, Erich XIII., Herzog von Pommern, streitet mit der Hanse, verbissen bekämpft er die Herzöge von Schleswig und Holstein. Das bewaffnete Zürich hat sich gegen andere Kantone erhoben und bedroht die Einheit der Eidgenossenschaft. Mailand liegt im Kampf mit Florenz. In Neapels Straßen wüten die Eroberer, die Soldaten Aragons und Navarras.
Im Großfürstentum Moskau tanzen Schwerter und Fackeln, Vasilij II. liegt in verbissenem Kampf mit Jurij Dmitrievič, Vasilij Kosoj und Dmitrij Šemjaka. Vae victis! Die Besiegten weinen rote Tränen aus blutigen Augenhöhlen. Der wackere Johannes Hunyadi kämpft erfolgreich gegen die Osmanen. Árpáds Kinder gewinnen die Oberhand! Aber hängt nicht bereits der Schatten des Halbmonds wie ein Damoklesschwert über Siebenbürgen, über den Tälern der Drau, der Theiß und der Donau? Oh, den Magyaren steht womöglich ein ähnlich trauriges Schicksal bevor wie den Bulgaren und Serben.
Venedig zittert, wenn Mura-d II. mit bluttriefendem Krummsäbel Epiros und Albanien verwüstet. Das Byzantinische Reich ist auf die Größe Konstantinopels geschrumpft, Johannes VIII. Palaiologos und sein Bruder Konstantinos XI. Palaiologos blicken verängstigt von den Mauern herab und halten Ausschau, ob der Osmane schon heranzieht. Vereinigt Euch, ihr Christen in Ost und West, angesichts des gemeinsamen Feindes!
Aber es ist wohl schon zu spät …
Der große Tag des Herrn ist nahe, und es wird ein Tag des Zornes, ein Tag der Drangsal und der Plage sein, ein Tag der Vernichtung und der Verwüstung, ein Tag der Dunkelheit und der Dämmerung, ein Tag der Wolken und Gewitter.
Dies irae …
König David hat ihn in den Psalmen vorausgesagt, der Prophet Zephanja hat ihn verkündet, die heidnische Seherin Sibylle hat ihn vorausgesehen. Wenn Ihr seht, dass ein Bruder den anderen dem Tode preisgibt, dass sich die Kinder gegen die Eltern wenden, dass das Weib ihren Mann verlässt und dass ein Volk gegen ein anderes Krieg beginnt, dass Hunger auf der ganzen Erde herrscht, viele Seuchen und zahlreiche Plagen, dann werdet Ihr erkennen, dass das Ende nah ist … Hä? Was sagt Ihr? Dass das, was ich geschildert habe, jeden Tag geschieht, tagtäglich und andauernd? Und nicht nur in letzter Zeit, sondern seit Jahrhunderten, und dass es immer so weitergehen wird? Ha, Ihr habt recht, sowohl Ihr, edler Ritter mit dem Habdank-Wappen, wie auch du, ehrwürdiger Bruder des heiligen Franziskus. Ihr habt recht, die Ihr nickt und gescheit dreinschaut, sowohl Ihr, edle Herren, als auch Ihr, fromme Mönche, und Ihr, gute Kaufleute. Recht habt Ihr. Überall lauern Bosheit und Verbrechen. Tagtäglich ereignet sich der Brudermord, überall wird Treuebruch begangen, ständig wird Blut vergossen. Ich glaube, das Jahrhundert des Verrats, der Gewalt, das Jahrhundert der unaufhörlichen Kriege ist angebrochen. Woran soll man denn ersehen, bei dem, was ringsumher geschieht, ob das nun schon das Ende der Welt ist oder eher nicht? Wie soll man es erkennen? Welche Zeichen sagen es uns, welche signa et ostenta?
Ich sehe, Ihr nickt immer noch, werte Herren, Ihr guten Bürger und heiligen Mönche. Ich weiß, was Ihr denkt, denn auch ich habe schon oft darüber nachgedacht.
Vielleicht, dachte ich mir, geschieht dies ganz ohne ein Zeichen? Ohne Warnsignal? Ohne Vorwarnung? Ganz einfach so, platsch! Und Schluss, finis mundi! Vielleicht gibt es gar kein Erbarmen? Vielleicht gibt es gar keine Gerechten in Sodom? Vielleicht wird uns gar kein Zeichen gesandt, weil wir ein Stamm von Abtrünnigen sind?
Fürchtet Euch nicht. Es wird ein Zeichen geben. Die Evangelisten haben es beschworen. Die echten wie auch die apokryphen.
Es wird Zeichen geben, an der Sonne, am Mond und an den Sternen, und auf Erden die Furcht der Völker vor dem Tosen des Meeres und seiner Stürme. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Die Sonne verhüllt sich, der Mond sendet kein Licht mehr, und die Sterne stürzen vom Himmel herab. Und die vier Winde werden aus ihren Verankerungen gelöst. Movebuntur omnia fundamenta terrae, Erde und Meer werden erzittern, und mit ihnen Berge und Hügel. Und aus den Himmeln wird die Stimme des Erzengels ertönen und bis in die tiefsten Spalten der Erde vernommen werden.
Und sieben Tage lang werden mächtige Zeichen am Himmel sein. Welche das sein werden, sage ich Euch. Hört zu!
Am ersten Tag kommt eine Wolke von Norden her. Und aus ihr fällt ein blutiger Regen auf die ganze Erde nieder.
Am zweiten Tag wird die Erde von ihrem Platz bewegt; die Pforten des Himmels öffnen sich von Osten her, und der Rauch eines gewaltigen Feuers wird den Himmel verdunkeln. Und an diesem Tag wird große Furcht und Schrecken auf der Welt sein.
Am dritten Tag brüllt der Schlund der Erde an allen vier Enden der Welt, und die ganze Weite des Erdkreises wird von Schwefelgestank erfüllt sein. Und so wird es sein bis zur zehnten Stunde.
Am vierten Tag wird sich die Sonnenscheibe verhüllen, und große Dunkelheit wird herrschen. Der Raum wird finster ohne Sonne und Mond, und die Sterne sagen ihren Dienst auf. So wird es sein bis zum Morgen.
Am sechsten Tag bricht ein nebliger Morgen an …
Erstes Kapitel
in dem Reynevan, der versucht, die Spur seiner Liebsten zu finden, mannigfache Widrigkeiten begegnen. In Sonderheit wird er verflucht. Im und außer Haus, stehend und sitzend, und in all seinem Tun. Europa indessen verändert sich. Indem es sich neue Kampftechniken aneignet.
Der Morgen war nebelverhangen, und für Februar war es ziemlich warm. Während der Nacht hatte Tauwetter eingesetzt, seit dem Morgengrauen taute der Schnee, die Abdrücke der Hufeisen und die Spurrinnen der Wagen füllten sich eilends mit schwarzem Wasser. Die Deichseln und die Zugstränge knarrten, die Pferde schnaubten, und die Kutscher fluchten schläfrig vor sich hin. Der nahezu dreihundert Wagen zählende Zug bewegte sich nur langsam vorwärts. Über ihm lag ein schwerer, erdrückender Geruch von Salzheringen.
Sir John Fastolf schaukelte schläfrig in seinem Sattel hin und her.
Nach einigen Frosttagen war plötzlich Tauwetter eingetreten. Der nasse Schnee, der die Nacht über gefallen war, schmolz rasch dahin. Schmelzwasser troff von den Fichten.
»Auf sie! Schlagt zu!«
»Haaaa!«
Ein gewaltiger Kampfeslärm erschreckte die Krähen, die Vögel flatterten von den kahlen Zweigen auf und bedeckten den Himmel mit einem schwarzen, sich fortbewegenden Mosaik, ein Krächzen erfüllte die mit eisiger Feuchtigkeit geschwängerte Luft. Ein Schrei.
Es wurde kurz, aber verbissen gekämpft. Hufe durchpflügten den Schneematsch und vermengten ihn mit Schlamm. Pferde wieherten und stöhnten hell auf, Menschen schrien. Die einen vor Kampfeslust, die anderen aus Schmerz. Es hatte urplötzlich begonnen und endete rasch.
»Hooo! Sammeln! Sammeln!«
Und noch einmal erklang es leiser, schon weiter entfernt.
Dohlen krächzten und kreisten über dem Wald. Das Dröhnen der Hufe wurde allmählich schwächer. Die Schreie wurden leiser.
Blut färbte die Pfützen und sickerte in den Schnee.
Der verwundete Soldat hörte den Reiter, der sich näherte, das Schnauben des Pferdes und das Klirren des Zaumzeugs hatten ihn alarmiert. Er stöhnte und versuchte aufzustehen, aber es gelang ihm nicht, die Anstrengung mehrte nur den Blutschwall, der zwischen den Platten des Brustpanzers in einem karminroten Strahl hervorsprudelte und über das Blech herabfloss. Der Verwundete presste seinen Rücken heftiger gegen einen umgestürzten Baumstamm und zog seinen Dolch. Er wusste nur zu gut, was für eine erbärmliche Waffe dies in den Händen von jemandem war, der nicht aufstehen konnte, weil ein Speer seine Seite durchbohrt und sich sein Bein beim Sturz des Pferdes verdreht hatte. Der herankommende schwarze Junghengst war ein »Trippler«, die eigenartige Bewegung der Beine fiel einem sofort auf. Der Reiter jenes schwarzen Pferdes hatte kein Kelchzeichen auf der Brust, also war er wohl keiner von den Hussiten, mit denen der Trupp, zu dem der Waffenknecht gehörte, kurz zuvor gekämpft hatte. Der Reiter trug keine Rüstung. Auch keine Waffen. Er sah aus wie ein gewöhnlicher Reisender. Der verwundete Soldat wusste jedoch nur zu gut, dass es jetzt, im Februar 1429, auf den Anhöhen um Striegau keine Reisenden gab. Im Februar 1429 reiste niemand über die Anhöhen von Striegau und durch die Ebene von Jauer. Der Reiter betrachtete ihn lange, im Sattel verharrend und auf ihn herabsehend. Lange und schweigend.
»Die Blutung muss gestillt werden«, sagte er schließlich. »Ich kann das tun. Aber nur, wenn du vorher diesen Dolch wegwirfst. Tust du das nicht, reite ich weiter, dann musst du dir allein helfen. Entscheide selbst.«
»Niemand …«, stöhnte der Soldat, »wird Lösegeld für mich zahlen … Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt …«
»Wirfst du nun deinen Dolch weg oder nicht?«
Der Soldat fluchte leise, nahm den Dolch und schleuderte ihn in hohem Bogen davon. Der Reiter stieg vom Pferd, öffnete ungeschickt die Satteltaschen und kniete dann mit einer ledernen Tasche in der Hand neben dem Verwundeten. Mit einem kurzen Klappmesser durchschnitt er die Riemen, mit denen die beiden Platten des Brustpanzers mit der Rückenplatte verbunden waren. Er zog die Brustplatten herunter, zerschnitt den blutgetränkten Hacqueton, schob ihn beiseite, beugte sich weit vor und musterte die Wunde.
»Nicht schön …«, brummte er. »Das sieht gar nicht gut aus. Vulnus punctum, eine Stichwunde. Sie ist tief … Ich werde dir einen Verband anlegen, aber ohne Hilfe kommen wir nicht zurecht. Ich bringe dich nach Striegau.«
»Striegau … wird belagert … Die Hussiten …«
»Ich weiß. Beweg dich nicht.«
»Ich glaub …«, stieß der Soldat keuchend hervor, »ich glaub, ich kenne dich …«
»Denk dir nur, mir kommt deine Visage auch irgendwie bekannt vor.«
»Ich bin Wilkosch Lindenau … Knappe des Ritters von Borschnitz, Gott hab ihn selig … Das Turnier in Münsterberg … Ich hab dich in den Turm geführt … Du bist doch … du bist doch Reinmar von Bielau … nicht wahr?«
»Mhmm.«
»Du bist doch …«, die Augen des Soldaten weiteten sich vor Entsetzen, »Jesus … du bist …«
»Verflucht im Haus und außer Haus? Das stimmt. Jetzt wird es wehtun.«
Der Soldat biss die Zähne zusammen. Gerade noch rechtzeitig.
Eigentlich musste man nach solch einer Salve mit einem Sturmangriff rechnen, aber nichts deutete darauf hin. Die hinter den Schanzen diensttuenden Abteilungen schickten noch eine weitere Salve aus ihren Bögen, Haken- und Tarrasbüchsen hinüber, während sich die anderen an den Biwakfeuern und Kochkesseln dem Müßiggang hingaben. Auch um die Zelte des Stabes, über denen die Standarten mit Kelch und Pelikan recht träge im Wind schaukelten, war keinerlei gesteigerte Aktivität zu beobachten.
Reynevan führte eben das Pferd in Richtung Stab. Die Waisen, an denen sie vorüberkamen, blickten sie gleichgültig an, niemand hielt sie an, keiner rief ihnen etwas zu, keiner fragte, wer sie seien. Die Waisen hätten Reynevan sehr wohl erkennen können, schließlich war er mit vielen von ihnen bekannt. Aber genauso gut konnte es ihnen auch egal sein.
»Den Hals werden sie mir hier abschneiden …«, murmelte Lindenau im Sattel vor sich hin. »Von Schwertern zerhauen … diese Häretiker … die Hussiten … die Teufel …«
»Sie werden dir nichts zuleide tun.« Reynevan versuchte angesichts der sich nähernden, mit Wurfspießen und Stichwaffen ausgestatteten Patrouille, sich selbst davon zu überzeugen. »Aber sag zu deiner eigenen Sicherheit besser ›Böhmen‹. Vitáme vas, bratři!!! Ich bin Reinmar von Bielau, erkennt ihr mich? Wir brauchen einen Medicus! Den felčar! Ruft doch bitte den felčar!«
Als Reynevan beim Stab auftauchte, wurde er von Brázda von Klinštejn sofort mit Umarmungen und Küssen begrüßt, anschließend machten sich Jan Kolda von Žampach, die Brüder Matĕj und Jan Salava z Lipé, Piotr der Pole, Vilém Jeník und andere, die er nicht kannte, daran, seine Hand zu schütteln und ihm auf die Schulter zu klopfen. Jan Královec von Hrádek, der Hauptmann der Waisen und Anführer auf diesem Feldzug, ließ sich nicht zu überschwänglichen Gefühlsbekundungen hinreißen. Und er sah auch gar nicht überrascht aus.
»Reynevan«, sagte er mit Eiseskälte, »sieh an, sieh an. Ich begrüße den verlorenen Sohn. Ich wusste, dass du zu uns zurückkehren würdest.«
»Es wird Zeit, Schluss zu machen«, sagte Jan Královec von Hrádek. Er lotste Reynevan durch die Linien und Stellungen. Sie waren allein. Královec hatte gewollt, dass sie unter sich blieben. Er wusste nicht, wer Reynevan geschickt hatte und womit, er erwartete geheime Nachrichten, die ausschließlich für seine Ohren bestimmt waren. Als er erfuhr, das Reynevan nicht als Sendbote und ohne wichtige Mitteilungen gekommen war, verdüsterte sich seine Miene.
»Es wird Zeit, Schluss zu machen«, wiederholte er und stieg auf die Schanze, um die Temperatur des Bombardenrohrs zu überprüfen, das mit nassen Fellen gekühlt wurde. Er blickte zu den Mauern und Basteien von Striegau hinüber. Reynevan starrte immer noch die Ruinen des zerstörten Karmeliterklosters an. Den Ort, an dem er vor einer ganzen Ewigkeit Scharley zum ersten Mal begegnet war. Eine ganze Ewigkeit, dachte er. Vier Jahre.
»Es wird Zeit, Schluss zu machen.« Královecs Stimme riss ihn aus seinen Gedanken und Erinnerungen. »Höchste Zeit. Wir haben das Unsrige getan. Dezember und Januar haben genügt, um Reinerz, Habelschwerdt, Münsterberg, Strehlen, Nimptsch, das Zisterzienserkloster in Heinrichau und eine Unzahl von kleinen Städtchen und Dörfern zu erobern und zu plündern. Wir haben den Deutschen eine Lehre erteilt, an die sie sich noch lange erinnern werden. Aber Fastnacht ist schon vorbei, es ist Aschermittwoch, verdammt, der neunte Februar. Wir kämpfen nun schon mehr als zwei Monate, und noch dazu Wintermonate! Wir sind an die vierzig Meilen marschiert. Wir schleppen Wagen mit uns mit, die schwer beladen sind mit Beute, ganze Rinderherden treiben wir vor uns her. Aber die Moral sinkt, die Leute sind müde. Schweidnitz hat uns Widerstand geleistet, obwohl wir es fünf Tage lang belagert haben. Ich will dir die Wahrheit sagen, Reynevan, wir hatten keine Kraft mehr zu einem Sturm. Wir haben sie aus unseren Büchsen beschossen, Feuer auf die Dächer gefegt, Angst verbreitet, damit sich die Schweidnitzer vielleicht endlich ergeben oder wenigstens übers Lösegeld verhandeln wollen. Aber Herr von Kolditz hatte keine Angst vor uns, und wir mussten unverrichteter Dinge abziehen. Wie man sieht, hat sich Striegau ein Beispiel daran genommen, denn es hält sich tapfer. Und wir spielen wieder die Schrecklichen, wir erschrecken sie, ballern mit Bombarden, schlagen uns mit den Breslauer Truppen, die ständig versuchen, uns anzugreifen, in den Wäldern herum. Aber ich sag dir die Wahrheit: Auch hier werden wir leer ausgehen. Werden wir abziehen müssen. Nach Hause. Weil’s Zeit ist. Was meinst du?«
»Ich meine gar nichts. Du bist hier doch der Anführer.«
»Der Anführer, der Anführer.« Der Hauptmann drehte sich abrupt um. »Eines Heeres, dessen Moral böse gesunken ist. Und du, Reynevan, zuckst mit den Achseln und meinst gar nichts. Und was tust du? Rettest einen verwundeten Deutschen. Einen Papisten. Bringst ihn her und verlangst von unserem Wundarzt, dass er ihn behandelt. Du erweist einem Feind Barmherzigkeit? Vor den Augen aller? Du hättest ihn im Wald abschlachten müssen, verdammt noch mal!«
»Das meinst du doch nicht im Ernst?«
»Ich hab es mir geschworen …«, presste Královec zwischen den Zähnen hervor. »Nach Ohlau … Ich habe mir geschworen, dass ich nach Ohlau keinem von ihnen mehr Pardon geben werde. Keinem Einzigen!«
»Wir können doch nicht aufhören, Menschen zu sein.«
»Menschen?« Dem Hauptmann der Waisen trat fast der Schaum vor den Mund. »Menschen? Weißt du, was in Ohlau geschehen ist? In der Nacht vor dem Festtag des heiligen Antonius? Wenn du dort gewesen wärest, wenn du das gesehen hättest …«
»Ich war da. Und ich habe es gesehen.«
»Ich war in Ohlau«, wiederholte Reynevan, während er ohne Gefühlsregung das Gesicht des überraschten Hauptmanns erforschte. »Ich bin knapp eine Woche nach dem Dreikönigstag dort angelangt, kurz nach eurem Abzug. Ich war am Sonntag vor dem Tag des heiligen Antonius in der Stadt. Und habe alles gesehen. Ich habe auch den Triumph gesehen, den Breslau wegen Ohlau gefeiert hat.«
Královec schwieg eine Zeit lang und blickte von der Schanze zum Glockenturm der Striegauer Pfarrkirche, in dem eben die Glocke zu läuten begann, volltönend und laut.
»Also warst du nicht nur in Ohlau, sondern auch in Breslau«, stellte er fest. »Und nun bist du hierher nach Striegau gekommen, als wärest du vom Himmel gefallen. Du tauchst plötzlich auf, du verschwindest wieder … Man weiß nicht, woher, man weiß nicht, wie … Die Leute fangen schon an zu reden, dummes Zeug zu schwatzen, zu verdächtigen …«
»Was für einen Verdacht?«
»Bleib ruhig, reg dich nicht auf. Ich vertraue dir. Ich weiß, du hattest Wichtiges zu tun. Als du dich damals bei Altwilmsdorf von uns getrennt hast, am 27. Dezember, auf dem Schlachtfeld, da haben wir gemerkt, dass du es wegen einer wichtigen, einer unerhört wichtigen Sache sehr eilig hattest. Hast du sie erledigen können?«
»Nichts habe ich erledigen können.« Reynevan verbarg seine Verbitterung nicht. »Aber ich bin verflucht. Verflucht im Stehen, im Tun und im Gehen. Auf den Bergen und in den Tälern.«
»Wie das?«
»Das ist eine lange Geschichte.«
»Die mag ich besonders.«
Dass heute im Dom zu Breslau etwas Außergewöhnliches geschehen würde, verkündete den im Gotteshaus versammelten Gläubigen das aufgeregte Stimmengewirr jener, die sich in der Nähe des Querhauses und des Chors befanden. Sie sahen und hörten weit mehr als die anderen, die dicht gedrängt im Mittelschiff und in den Seitenschiffen standen. Sie mussten sich zunächst mit Vermutungen begnügen. Und mit Geschwätz und Gerüchten, die, von anschwellendem Geflüster getragen, von einem zum anderen zogen wie Laubgeraschel im Wind.
Die große Domglocke begann zu schlagen, und sie schlug dumpf und bedächtig, feindselig und düster, der Klöppel, das Herz der Glocke, schlug nur an einer Seite der Glocke an. Elencia von Stietencron ergriff Reynevans Hand und drückte sie heftig. Reynevan erwiderte ihren Händedruck.
Exaudi Deus orationem meam cum deprecor
a timore inimici eripe animam meam …
Das zur Sakristei führende Portal war mit Reliefs verziert, die den Märtyrertod des heiligen Johannes des Täufers, des Schutzheiligen des Domes, darstellten. Singend traten daraus zwölf Prälaten hervor, Mitglieder des Domkapitels. In liturgische Gewänder gekleidet, dicke Kerzen in den Händen haltend, blieben die Prälaten vor dem Hauptaltar stehen, die Gesichter dem Kirchenraum zugewandt.
Protexisti me a conventu malignantium
a multitudine operantium iniquitatem
quia exacuerunt ut gladium linguas suas
intenderunt arcum rem amaram
ut sagittent in occultis immaculatum …
Das Gemurmel der Menge wuchs an und wurde plötzlich stärker. Denn Konrad, der Bischof von Breslau, höchstselbst, ein Piast aus dem Geschlecht der Herzöge von Oels, war auf die Stufen des Altars getreten. Schlesiens höchster kirchlicher Würdenträger, der Statthalter des allergnädigsten Herrn Sigismund von Luxemburg, des Königs von Ungarn und Böhmen.
Der Bischof war in vollem Ornat. Auf dem Kopf die edelsteingeschmückte Infula, in der über die Albe gezogenen Dalmatik, das Kreuz auf der Brust und den oben wie eine Breze gewundenen Krummstab in der Hand, präsentierte er sich als das Idealbild der Würde. Ihn umgab eine derart herrliche Aura, dass man dachte, nicht irgendein Breslauer Bischof schreite da die Stufen herab, sondern ein Erzbischof, ein Kurfürst, ein Metropolit, ein Kardinal, ja sogar der römische Papst selbst. Eine Person, die sogar noch würdiger und heiliger erschien als der derzeitige Papst in Rom. Viel würdiger und noch viel heiliger. So dachte mehr als einer von jenen, die hier im Dom versammelt waren. Der Bischof selbst dachte übrigens ebenso.
»Brüder und Schwestern!« Seine mächtige, klangvolle Stimme elektrisierte und beschwichtigte die Menge, sie schien in das hohe Gewölbe emporzudringen. Nach einem letzten Schlag verstummte die Domglocke.
»Brüder und Schwestern!« Der Bischof stützte sich auf den Krummstab. »Ihr guten Christen! Unser Herr Jesus Christus lehrt uns, dass wir den Sündern ihre Schuld vergeben, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Das ist eine gute und barmherzige Lehre, eine christliche Lehre, aber sie kann nicht auf jeden Sünder angewandt werden. Denn es gibt Schuld und Sünden, für die gibt es keine Vergebung, für die gibt es kein Erbarmen. Jede Sünde und jede Lästerung wird vergeben, nicht aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Neque in hoc saeculo neque in futuro, nicht in diesem Jahrhundert, noch im nächsten.«
Der Diakon reichte ihm eine brennende Kerze. Der Bischof hielt sie in seiner behandschuhten Rechten.
»Reinmar aus dem Geschlechte derer von Bielau, der Sohn des Thomas von Bielau, hat gegen Gott und die Heilige Dreifaltigkeit gesündigt. Er hat gesündigt durch Gotteslästerung, Heiligenschändung, Zauberei, Abfall vom Glauben sowie durch gewöhnliche Verbrechen.«
Elencia, die immer noch Reynevans Hand umklammert hielt, seufzte laut und blickte nach oben in sein Gesicht. Sie seufzte erneut, diesmal aber leiser. Auf Reynevans Gesicht zeichnete sich keinerlei Regung ab. Sein Gesicht war tot. Leblos wie ein Stein. Dieses Gesicht hatte er auch in Ohlau, dachte Elencia erschrocken. In Ohlau, in der Nacht vom sechzehnten auf den siebzehnten Januar.
»Über solche wie Reinmar von Bielau«, die Stimme des Bischofs rief wieder das Echo zwischen den Säulen und Arkaden des Gotteshauses hervor, »sagt die Heilige Schrift: Wenn sie vor der Verderbnis der Welt davonlaufen und ihren Herrn und Erlöser erkennen, sich dann aber wiederum der Verderbnis hingeben, so werden sie bezwungen, und ihr Ende wird schlimmer sein als je zuvor. Denn sie hätten besser daran getan, den Weg der Gerechtigkeit nicht zu kennen, als ihn zu kennen und sich dann von dem ihnen gewiesenen heiligen Gebot abzuwenden. An ihnen erfüllt sich, wie es geschrieben steht: Der Hund kehrt zu seinem eigenen Erbrochenen, das gereinigte Schwein zu seiner Schlammgrube zurück.«
»Zum eigenen Erbrochenen«, Konrad von Oels hob seine Stimme noch stärker, »und in die Schlammgrube ist der Abtrünnige und Häretiker Reinmar von Bielau zurückgekehrt, ein Räuber, Zauberer, Mädchenschänder, Gotteslästerer, Heiligenschänder, Sodomit und Brudermörder, ein Schuldiger durch zahllose Verbrechen, ein Lump, der ultimus diebus Decembris den guten und edlen Herzog Johann, den Herrn von Münsterberg, auf verräterische Weise, durch einen Stoß in den Rücken, ermordet hat.«
»Daher schließen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Namen aller Heiligen des Herrn und kraft der uns anvertrauten Macht den Apostaten Reinmar von Bielau aus unserer Gemeinschaft des Körpers und des Blutes unseres Herrn aus, wir durchschneiden die Bande, die ihn mit dem Schoß der Kirche verbinden, und stoßen ihn aus der Gemeinschaft der Gläubigen aus.«
Die Stille, die in den Kirchenschiffen herrschte, wurde jetzt lediglich durch ein Keuchen und ein Atmen durchbrochen. Jemand hustete unterdrückt. Jemand hatte Schluckauf.
»Anathema sit! Verflucht sei Reinmar von Bielau! Verflucht sei er im Haus und außer Haus, verflucht im Leben und im Sterben, stehend und sitzend, in seinem Tun und Gehen, verflucht in Stadt, Land und Flur, verflucht auf den Feldern, in den Wäldern, auf Wiesen und Weiden, auf den Bergen und in den Tälern. Unheilbare Krankheit, Pestilenz, ägyptische Geschwüre, Hämorrhoiden, Krätze und Räude mögen seine Augen, den Hals, die Zunge, den Mund, die Brust, die Lunge, die Ohren, die Nase, die Schultern, die Hoden und jedes Körperglied vom Kopf bis zu den Füßen befallen. Verflucht sei sein Haus, sein Tisch und sein Bett, sein Pferd, sein Hund, verflucht seien seine Speisen und Getränke und alles, was er besitzt.«
Elencia spürte, wie ihr die Tränen die Wangen hinunterrannen.
»Wir erklären Reinmar von Bielau für mit dem ewigen Anathema belegt, verdammt dazu, in den Höllenschlund mit Luzifer und den gefallenen Engeln zu fahren. Wir zählen ihn zu den dreifach Verdammten, ohne Hoffnung auf Vergebung. Möge sein Licht auf immer und von Ewigkeit zu Ewigkeit erloschen sein zum Zeichen dafür, dass er als Verdammter im Gedächtnis der Kirche und der Menschen gelöscht ist. So soll es sein!«
»Fiat! Fiat! Fiat!«, sagten die Prälaten in ihren weißen Messgewändern mit Grabesstimme.
Der Bischof streckte den Arm aus, drehte die Kerze mit der Flamme nach unten und ließ sie zu Boden fallen. Die Prälaten folgten seinem Beispiel, das Klappern der fallen gelassenen Kerzen auf den Bodenfliesen mischte sich mit dem Geruch von heißem Wachs und dem Rauch der erlöschenden Dochte. Die große Glocke schlug. Dreimal. Dann schwieg sie. Das Echo hallte noch lange nach und erstarb dann im Gewölbe.
Es stank nach Wachs und Rauch, nach feuchter, lange nicht gewechselter Kleidung. Jemand hustete, jemand hatte Schluckauf. Elencia schluckte ihre Tränen hinunter.
Die Glocke der nahen Maria-Magdalena-Kirche kündigte mit einem Doppelschlag die None an. Als Echo antwortete, nur wenig verspätet, St. Elisabeth. Vom Fenster her klangen der Lärm und das Räderrollen in der Schustergasse herauf.
Kanonikus Otto Beess wandte seinen Blick ab von dem Bild, welches das Martyrium des heiligen Bartholomäus darstellte, neben einem Gestell mit Leuchtern und einem Kruzifix der einzige Schmuck der kahlen Wände der Kammer.
»Du riskierst sehr viel, mein Junge«, sagte er. Das waren die ersten Worte, die er sagte, nachdem er die Tür geöffnet und gesehen hatte, wer vor ihm stand. »Du riskierst wirklich sehr viel, wenn du dich in Breslau sehen lässt. Meiner Meinung nach ist das schon kein Wagnis mehr. Das ist eine gefährliche Tollheit.«
»Glaub mir, ehrwürdiger Vater«, Reynevan senkte den Blick, »ich wäre nicht hierhergekommen, wenn ich nicht gute Gründe dafür hätte.«
»Die ich mir durchaus vorstellen kann.«
»Vater …«
Otto Beess schlug mit der flachen Hand auf den Tisch und hieß Reynevan mit einer raschen Bewegung der anderen Hand schweigen. Er selbst schwieg auch lange.
»Nur so unter uns«, fragte er schließlich, »der Mann, den du vor vier Jahren, nach Peterlins Ermordung, auf mein Geheiß hin aus dem Kloster der Striegauer Karmeliter herausgeholt hast … Wie solltest du ihn gleich noch mal nennen?«
»Scharley.«
»Scharley, ha! Hast du immer noch Kontakt zu ihm?«
»In letzter Zeit nicht. Aber ansonsten schon.«
»Wenn du also ansonsten diesen … Scharley triffst, dann richte ihm aus, dass ich mit ihm noch ein Hühnchen zu rupfen habe. Er hat mich sehr enttäuscht. Der Teufel muss ihm wohl seine Vernunft und seine Schläue gestohlen haben, für die er einst so bekannt war. Anstatt nach Ungarn, wie er sollte, hat er dich nach Böhmen gebracht, dich zu den Hussiten geschleppt …«
»Er hat mich nicht dorthin geschleppt. Ich bin von selbst zu den Utraquisten gegangen. Aus eigenem Willen und eigenem Entschluss, nachdem ich mir dies vorher lange und gründlich überlegt hatte. Und ich bin sicher, dass meine Entscheidung richtig war. Die Wahrheit ist auf unserer Seite. Ich nehme an …«
Der Kanonikus hob erneut die Hand und hieß ihn schweigen. Ihn interessierte nicht, was Reynevan vermutete. Sein Gesichtsausdruck ließ diesbezüglich keinen Zweifel zu.
»Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, was dich nach Breslau geführt hat«, sagte er schließlich und hob den Blick. »Ich habe es unschwer erraten, denn deine Gründe sind allgemein bekannt, man spricht von nichts anderem mehr. Deine neuen Brüder im Geist und im Glauben, deine Freunde und Kumpane sind bereits seit zwei Monaten dabei, das Glatzer Land und Schlesien zu zerstören. Seit zwei Monaten morden, brennen und rauben deine Confratres im Kampf um Wahrheit und Glauben, die Waisen unter Královec. Münsterberg, Strehlen, Ohlau und Nimptsch haben sie niedergebrannt, das Kloster von Heinrichau mehr als ausgeplündert, die Gegenden an der Oder ausgeräubert und verwüstet. Jetzt belagern sie Schweidnitz, wie es heißt. Und da erscheinst plötzlich du in Breslau.«
»Vater …«
»Schweig! Sieh mir in die Augen: Wenn du als hussitischer Spion, Saboteur oder Emissär gekommen bist, dann verlass sofort mein Haus. Versteck dich woanders. Nicht hier, unter meinem Dach.«
»Deine Worte haben mir wehgetan, ehrwürdiger Vater.« Reynevan hielt dem Blick stand. »Dass du denken könntest, ich wäre zu solch einer Schandtat fähig. Allein der Gedanke, ich könnte dich einem Risiko aussetzen, dich in Gefahr bringen …«
»Du hast mich bereits einem Risiko ausgesetzt, mich in Gefahr gebracht, indem du hierhergekommen bist. Mein Haus könnte unter Beobachtung stehen.«
»Ich war vorsichtig. Ich kann …«
»Ich weiß, dass du kannst«, unterbrach ihn der Kanonikus ziemlich schroff. »Und was du kannst. Nachrichten verbreiten sich schnell. Sieh mich an. Und dann sag mir auf der Stelle: Bist du als Spion hier oder nicht?«
»Nein.«
»Also?«
»Ich brauche Hilfe.«
Otto Beess blickte nach oben, betrachtete die Wand und das Bild, auf dem die Heiden dem heiligen Bartholomäus mit riesigen Zangen die Haut vom Leibe zogen. Dann bohrte sich sein Blick wieder in Reynevans Augen.
»O ja, die brauchst du!«, erwiderte er ernst. »Die brauchst du sogar sehr. Mehr, als du denkst. Und nicht nur in dieser Welt, auch im Jenseits. Du hast es übertrieben, mein Sohn. Du hast es übertrieben. An der Seite deiner neuen Kumpane und Brüder im Glauben warst du so emsig, dass du berühmt geworden bist. Vor allem seit Dezember letzten Jahres, seit der Schlacht bei Altwilmsdorf. Es ist so gekommen, wie es kommen musste. Wenn ich dir etwas rate, dann, jetzt zu beten, zu Kreuze zu kriechen und zu bereuen. Häufe Asche auf dein Haupt, aber reichlich. Sonst ist dein Seelenheil dahin. Weißt du, wovon ich rede?«
»Ich weiß es. Ich war dabei.«
»Du warst dabei? Im Dom?«
»Ich war dort.«
Der Kanonikus schwieg eine Zeit lang und trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte.
»Du bist überhaupt sehr oft anzutreffen«, sagte er schließlich. »Viel zu oft, wie mir scheint. Wenn ich du wäre, würde ich meine Besuche etwas einschränken. Zurück ad rem: Seit dem dreiundzwanzigsten Januar, seit Septuagesima, stehst du außerhalb der Kirche. Ich weiß, ich weiß, was du dazu sagst, du Hussit. Dass unsere Kirche verdorben und durch und durch verräterisch ist und deine gerecht und rechtmäßig. Und dass dir der Kirchenbann völlig egal ist. Dann sei er dir egal, wenn du es so willst. Hier ist weder der Ort noch die Zeit für theologische Dispute. Du bist nicht hierhergekommen, wie ich annehme, um Beistand für deine Erlösung zu suchen. Dir geht es vermutlich um weltlichere Dinge, mehr ums profanum als ums sacrum. Also sprich. Erzähle. Vertrau mir deinen Kummer an. Und da ich noch vor der Vesper auf der Dominsel sein muss, fass dich kurz. Wenn das möglich ist.«
Reynevan seufzte. Und erzählte. Sich dabei kurz fassend. So weit das möglich war. Der Kanonikus hörte ihn an. Bis zum Ende, dann seufzte er. Tief und schwer.
»Ach, mein Junge, mein Junge«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Du bist schrecklich einfallslos. Ein jedes Problem kommt bei dir aus demselben Fass. Ein jedes deiner Probleme ist, um es vornehm auszudrücken, feminini generis.«
Die Erde erzitterte von Hufschlägen. Die Schar fegte im Galopp über das Feld, wie ein Kaleidoskop glitten Köpfe und Körper im Vorbeisprengen dahin, schwarze, braune, graue, grau- und apfelschimmelweiße und kastanienbraune. Die Schweife und die langen Mähnen wehten, Dampf quoll aus den Nüstern. Dzierżka de Wirsing stützte sich mit beiden Händen auf den Sattelknopf, sie blickte umher, und in ihren Augen erstrahlten Freude und Glück, man hätte meinen können, nicht eine Pferdehändlerin betrachte ihre Fohlen und Stuten, sondern eine Mutter ihre Kinder.
»Es sieht so aus, Reynevan«, sie wandte sich endlich zu ihm um und kehrte wieder zum Thema zurück, »als kämen alle deine Sorgen aus ein und demselben Fass. Jedes deiner Probleme, so sieht’s nun mal aus, trägt einen Rock und einen Zopf.«
Sie trieb ihren Grauschimmel zum Galopp an und folgte der Schar. Reynevan jagte hinterdrein. Sein Pferd, ein wohlproportionierter dunkler Hengst, war ein »Trippler«; Reynevan hatte sich noch nicht an den eigenartigen Rhythmus seiner Bewegungen gewöhnt. Dzierżka gestattete ihm, zu ihr aufzuschließen.
»Ich kann dir nicht helfen«, sagte sie mit Nachdruck. »Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist, dir den Junghengst zu schenken, auf dem du sitzt. Und dir meinen Segen zu geben. Und ein Medaillon mit dem heiligen Eligius am Zaumzeug, dem Patron der Pferde und Pferdehändler. Das ist ein gutes Reitpferd. Kräftig und ausdauernd. Das kannst du gut gebrauchen. Nimm es als Geschenk von mir an. Als ein großes Dankeschön für Elencia. Für das, was du für sie getan hast.«
»Ich habe nur meine Schuld beglichen. Für das, was sie für mich getan hat. Aber für das Pferd danke ich dir.«
»Außer mit dem Pferd kann ich dir nur mit einem guten Rat dienen. Geh zurück nach Breslau, such dort den Kanonikus Otto Beess auf. Oder hast du ihn schon besucht? Als du mit Elencia in Breslau warst?«
»Der Kanonikus ist beim Bischof in Ungnade. Meinetwegen, wie es scheint. Vielleicht nimmt er mir dies übel, freut sich am Ende gar nicht, wenn ich ihm einen Besuch abstatte. Der ihm womöglich schaden kann …«
»Du hast vielleicht Sorgen!« Dzierżka richtete sich im Sattel auf. »Bei deinen Besuchen gibt es immer Probleme. Hast du etwa nicht daran gedacht, als du zu mir nach Schalkau gekommen bist?«
»Doch, ich habe daran gedacht. Aber es ging um Elencia. Ich hatte Angst, sie allein gehen zu lassen. Ich wollte sie sicher hierherbringen …«
»Ich weiß. Ich nehm’s dir nicht übel, dass du mitgekommen bist. Aber helfen kann ich dir nicht. Weil ich Angst habe.«
Sie schob ihre Zobelkappe in den Nacken und wischte sich mit der Hand über das Gesicht.
»Sie haben mir einen Schrecken eingejagt«, sagte sie und blickte zur Seite. »Einen verdammten Schrecken. Damals, am fünfundzwanzigsten September, bei Frankenstein, am Erbsberg. Weißt du noch, was dort war? Da hab ich eine solche Scheißangst gekriegt … Schade um jedes Wort. Reynevan, ich will nicht sterben. Ich will nicht so enden wie Neumarkt, Throst und Pfefferkorn, wie später Ratgeb, Czajka und Poschmann. Wie Kluger, der in seinem Haus zusammen mit seiner Frau und den Kindern verbrannt ist. Ich habe den Handel mit den Böhmen aufgegeben. Ich spreche nicht über Politik. Ich habe an den Dom zu Breslau eine große Spende gegeben. Und eine weitere, nicht geringere, für den Kreuzzug des Bischofs gegen die Hussiten. Wenn es sein muss, gebe ich noch mehr. Das ist mir lieber, als nachts Feuer auf meinem Strohdach zu sehen. Und die schwarzen Reiter im Hof. Ich will leben. Besonders jetzt, wo …«
Sie brach ab und schlang, während sie nachdachte, die Zügel um ihre Hände.
»Elencia …«, fuhr sie fort, den Blick abgewandt, »wenn sie will, kann sie weiterziehen. Ich werde sie nicht aufhalten. Aber sollte sie den Wunsch hegen, hier auf Schalkau zu bleiben … Zu bleiben für … Für lange … Dann werde ich nichts dagegen haben.«
»Behalt sie hier bei dir. Lass nicht zu, dass sie sich wieder irgendwohin als Freiwillige meldet. Dieses Mädchen hat ein Herz und folgt einer Berufung, aber die Spitäler … Die Spitäler sind jetzt auch nicht mehr sicher. Behalt sie hier bei dir in Schalkau, Frau Dzierżka.«
»Ich werde mir alle Mühe geben. Aber was dich betrifft …«
Dzierżka wendete ihr Pferd und ritt so nah heran, dass sich ihre Pferde Kopf an Kopf gegenüberstanden.
»Du, mein Verwandter, bist hier ein gern gesehener Gast. Komm her, wann immer du willst. Aber, beim heiligen Eligius, hab doch auch ein wenig Anstand. Nimm ein wenig Rücksicht auf das Mädchen, hab ein bisschen Herz. Quäl sie nicht.«
»Wie bitte?«
»Weine nicht vor Elencia wegen deiner Liebe zu einer anderen«, Dzierżka de Wirsings Stimme nahm einen schärferen Ton an, »gestehe ihr nicht deine Liebe zu einer anderen. Erzähle ihr nicht, wie groß diese Liebe ist. Und lass sie deswegen kein Mitleid empfinden. Lass sie nicht leiden.«
»Ich versteh ni …«
»Du verstehst schon, du verstehst schon.«
»Du hast recht, Vater«, bekannte Reynevan mit bitterer Miene. »In der Tat ist ein jedes meiner Probleme weiblichen Ursprungs. Und die Probleme vermehren sich wie Pilze nach dem Regen … Das größte allerdings ist momentan Jutta. Und ich stecke in einer verzwickten Situation. Ich weiß absolut nicht, was ich machen soll …«
»Na, dann sind wir ja schon zu zweit«, erwiderte Kanonikus Otto Beess ernst. »Denn ich weiß es auch nicht. Ich habe dich nicht unterbrochen, als du deine Geschichte erzählt hast, obwohl sie sich stellenweise so anhörte wie die Dichtung eines Troubadours, denn sie klang genauso abenteuerlich. Ich kann mir den Inquisitor Gregor Hejncze beim besten Willen nicht als Mädchenräuber vorstellen. Hejncze hat seine Spione und Kundschafter, er unterhält ein eigenes Agentennetz, man weiß auch, dass er seit langem versucht, die Hussiten zu infiltrieren, und dass er, was seine Methoden anbelangt, nicht gerade wählerisch ist. Aber ein Mädchen zu entführen? Irgendwie will mir das nicht recht in den Kopf. Was soll’s, möglich ist alles.«
»Das stimmt nun auch wieder«, brummte Reynevan.
Der Kanonikus heftete seine Augen auf ihn, sagte aber nichts. Er trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte.
»Heute ist Purificatio Mariae«, sagte er schließlich. »Der zweite Februar. Seit der Schlacht bei Altwilmsdorf sind fünf Wochen vergangen. Ich schließe daraus, dass du die ganze Zeit in Schlesien gewesen bist. Wo warst du? Hast du vielleicht dem Kloster in Weißkirchen einen Besuch abgestattet?«
»Nein. Erst wollte ich es … Die Äbtissin ist Magierin, Magie hätte mir bei der Suche helfen können. Aber ich bin nicht hingeritten. Damals … Damals war ich der Grund dafür, dass sie bedroht wurden, Jutta, die Nonnen und das Kloster, beinahe hätte ich ihren Untergang verschuldet. Und dann …«
»Und dann hattest du auch Angst davor, der Äbtissin in die Augen blicken zu müssen, kurz nachdem du ihren Bruder umgebracht hast. Aber damit, dass du Unheil über das Kloster gebracht hast, hast du recht, und wie! Grellenort hat nichts vergessen. Der Bischof hat das Kloster aufgelöst, die Klarissen sind alle einzeln in verschiedenen Klöster untergebracht worden, die Äbtissin hat man fortgeschickt, um zu büßen. Trotz allem hat sie aber noch Glück gehabt. Die Schwesternschaft des Freien Geistes, die Dritte Kirche, Beginen, Katharertum, Magie … Dafür kommt man auf den Scheiterhaufen. Der Bischof hätte sie verbrennen lassen, so gewiss, wie zwei mal zwei vier ist, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Aber irgendwie schien ihm das wohl nicht ganz zusammenzupassen, die Schwester des Johann von Münsterberg, den er damals bereits zum Märtyrer im Kampf um den Glauben erhoben hatte, für dessen Seelenheil er Messen lesen und landauf, landab in Schlesien die Glocken läuten ließ, der Häresie und der Zauberei zu bezichtigen und sie öffentlich hinzurichten. Das Kloster hat also noch mal Glück gehabt, es ist büßend davongekommen. Sie ist eine Magierin, sagst du? Von dir heißt es auch, du seist ein Hexer. Dass du dich auf Zauberei verstehst und dich mit Hexern und Monstern abgibst. Warum hast du damals nicht bei denen Hilfe gesucht?«
»Das habe ich.«
Das Dorf Grauweide hatte man nicht niedergebrannt, es war davongekommen. Auch die eine halbe Meile entfernt gelegene Siedlung Schwerdtfeger war unversehrt geblieben. Dies war ein gutes Zeichen, das einen mit Optimismus erfüllte. Umso tiefer und schmerzlicher war die Enttäuschung.
Von dem Klosterdorf Wolmessen war so gut wie nichts übrig geblieben, den Eindruck von Leere und Verlassenheit verstärkte der Schnee, der in einer dicken Schicht über der Brandstätte lag, der Schnee, aus dessen strahlend weißer Reinheit schwarze, verkohlte Balken, Pfosten und verrußte Kamine ragten. Nicht viel mehr war auch von dem am Dorfrand gelegenen Gasthaus »Zum silbernen Glöckchen« übrig geblieben. Dort, wo es sich einst befunden hatte, schaute ein wüster Haufen aus verkohlten Balken, Sparren und Dachfirsten hervor, der sich auf Mauerreste und Schutt aus geschwärzten Ziegeln stützte.
Reynevan ritt um die Ruine herum und betrachtete die Brandstätte, die immer noch freundliche Erinnerungen an die Zeit vor einem Jahr, an den Winter 1427/1428, in ihm weckte. Das Pferd stapfte vorsichtig durch den mit verbranntem Holz durchsetzten Schnee, stieg, die Hufe hoch anhebend, vorsichtig über die Balken hinweg.
Über einem Mauerrest stieg ein dünnes Fähnchen aus grauem Rauch empor, es stand fast senkrecht in der frostigen Luft.
Als das Pferd schnaubte und der Schnee knirschte, hob der an einem kleinen Feuerchen kniende bärtige Landstreicher den Kopf und schob seine bis zu den Brauen reichende Fellmütze ein wenig nach hinten. Dann wandte er sich wieder seiner vorherigen Tätigkeit zu, nämlich in die von der Hälfte eines Pelzrockes geschützte Glut zu blasen. Gleich daneben, an der Mauer, stand ein verrußter Topf, neben ihm lagen ein Dudelsack, ein Sack und eine mit Riemen umschlungene Kiste.
»Gelobt sei …«, grüßte Reynevan. »Bist du von hier? Aus Wolmessen?«
Der Landstreicher blickte verstohlen auf, dann machte er sich wieder ans Blasen.
»Die Leute von hier, wohin sind sie gezogen? Weißt du das vielleicht? Der Wirt Martin Prahl und seine Frau? Weißt du etwas? Hast du nicht etwas davon gehört?«
Der Landstreicher wusste, wie sich zeigte, entweder nichts oder er hatte nichts gehört, oder Reynevan und seine Fragen waren ihm völlig egal. Oder er war taub. Reynevan wühlte in seiner Tasche, wobei er überlegte, wie viel von seiner ohnehin geringen Barschaft er entbehren könnte. Aus dem Augenwinkel nahm er eine Bewegung wahr. Neben dem breiten Stumpf eines mit Eiszapfen behangenen Baumes saß ein Kind. Ein Mädchen, höchstens zehn Jahre alt, schwarz und dürr wie eine kleine ärmliche Krähe. Auch die auf ihn gerichteten Augen waren Krähenaugen, schwarz und ausdruckslos, unbeweglich. Der Landstreicher blies in die Glut und brummte etwas, dann stand er auf, streckte die Hand aus und murmelte etwas. Krachend schoss Feuer aus dem Reisighaufen hervor. Die kleine Krähe brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck. Mit einem seltsam pfeifenden, nicht menschlichen Ton.
»Jon Malevolt«, sagte Reynevan, der zu begreifen begann, wen er vor sich hatte, laut, langsam und deutlich. »Der Mamun Jon Malevolt. Weißt du nicht, wo ich ihn finden kann? Ich habe eine wichtige Nachricht für ihn, es geht um Leben und Tod … Ich kenne ihn. Er ist mein Freund.«
Der Landstreicher stellte den Topf auf die Steine, die das Feuer umgaben. Er hob den Kopf. Er blickte Reynevan an, als hätte er dessen Anwesenheit jetzt erst wahrgenommen. Er hatte stechende Augen. Wolfsaugen.
»Irgendwo hier in diesen Wäldern haben zwei … zwei Frauen ihre Behausung, die … die Arkana kennen. Ich bin ein Bekannter dieser Frauen, aber ich kenne den Weg nicht. Würdest du ihn mir weisen?«
Der Landstreicher blickte ihn an. Mit Wolfsaugen.
»Nein«, sagte er schließlich.
»Was heißt nein? Weißt du ihn nicht? Kennst du ihn nicht? Oder willst du nicht?«
»Nein heißt nein«, sagte die kleine Krähe. Von oben, vom Mauerrand. Reynevan hatte keine Ahnung, wie sie dorthin gelangt war, welches Wunder bewirkt hatte, dass sie dort hinaufgekommen war, zudem unbemerkt, gerade eben noch hatte sie neben dem Baum gesessen.
»Nein heißt nein«, wiederholte sie pfeifend und barg das Köpfchen zwischen ihren mageren Schultern. Die zerzausten Haare fielen ihr auf die Wangen.
»Nein heißt nein«, bekräftigte der Landstreicher und schob wieder seine Kappe zurecht.
»Warum?«
»Darum.« Der Landstreicher deutete mit einer ausholenden Handbewegung auf die Brandstätte. »Weil ihr frevlerisch wütet. Weil Feuer und Tod vor euch herziehen und hinter euch Brandstätten und Tote zurückbleiben. Und da wagt ihr es, noch Fragen zu stellen? Erkundigungen einzuholen? Nach dem Weg zu fragen? Und euch als Freunde zu bezeichnen?«
»Euch als Freunde zu bezeichnen?«, echote die kleine Krähe.
»Was heißt das schon«, der Landstreicher hörte nicht auf, Reynevan aus seinen Wolfsaugen anzustarren, »was heißt das schon, dass du dereinst als einer von uns auf dem Erbsberg warst? Das war einmal. Heute hast du, habt ihr alle und alles mit Verbrechen und Blut angesteckt, wie mit einer Seuche. Bringt uns nicht eure Krankheiten her, haltet euch fern von uns. Geh fort von hier, Mensch. Geh fort.«
»Geh fort«, echote die kleine Krähe. »Wir wollen dich hier nicht.«
»Was war dann? Wohin bist du dann gegangen?«
»Nach Ohlau.«
»Nach Ohlau?« Der Kanonikus hob plötzlich den Kopf. »Jetzt sage mir nur nicht, dass du dort gewesen bist …«
»Am Sonntag vor dem Festtag des heiligen Antonius? Wann sonst? Ich war dort …«
Otto Beess schwieg lange.
»Dieser Pole, Łukasz Bożyczko«, sagte der Kanonikus, »ist die nächste Merkwürdigkeit in deiner Erzählung. Ich habe ihn ein-, zweimal beim Inquisitor gesehen. Er hing an Gregor Hejnczes Rockschößen und rannte wie ein kleiner Page hinter ihm her. Er hat keinen Eindruck auf mich gemacht. Ich sag’s mal so: Er erscheint einem genauso wenig wie eine allmächtige graue Eminenz wie unser Bischof Konrad als ein frommer und tugendhafter Asket. Er sieht aus, als könnte er kaum bis drei zählen. Und wenn ich ein Nichts malen müsste, dann würde ich ihn holen, damit er mir Modell steht.«
»Ich fürchte«, erwiderte Reynevan ernst, »dass seine äußere Erscheinung eine täuschende Maskerade ist. Ich fürchte es gerade Juttas wegen.«
»Solch eine Maskerade halte ich durchaus für möglich.« Otto Beess nickte. »In letzter Zeit haben vor meinen Augen einige ganz hübsch ihre Pracht entfaltet. Es hat mich geradezu starr vor Staunen gemacht, was ich da so nach und nach gesehen habe. Aber eine Maskerade ist eine Sache, die kirchliche Hierarchie eine andere. Weder jener Bożyczko noch irgendein anderer Bediensteter täte oder unternähme etwas auf eigene Faust, hinter dem Rücken des Inquisitors und ohne sein Wissen. Ergo muss Hejncze den Befehl zur Entführung und Festnahme von Jutta de Apolda gegeben haben. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das passt überhaupt nicht zu dem, was ich über diesen Mann weiß.«
»Menschen ändern sich.« Reynevan biss sich auf die Lippen. »Auch vor meinen Augen haben sich in letzter Zeit einige Maskeraden abgespielt. Ich weiß, dass alles möglich sein kann. Dass alles, was man sich denken kann, geschieht. Auch das, was kaum vorstellbar ist.«
»Das ist wohl wahr.« Der Kanonikus seufzte. »Vieles, was in den letzten Jahren geschehen ist, habe ich mir früher überhaupt nicht vorstellen können. Wie hätte jemand annehmen können, dass ich, der Präpositus des Domkapitels, statt zum Weihbischof, zum Bischof der Diözese oder wenigstens zum Titularbischof aufzusteigen, in partibus infidelium, zum Domherrn degradiert werden würde. Und das wegen des Brudersohnes meines besten Freundes, des unvergessenen Heinrich von Bielau?«
»Vater …«
»Schweig, schweig!« Der Kanonikus winkte verächtlich ab. »Empfinde keine Reue, du bist nicht schuld daran. Ich hätte dir geholfen, selbst wenn ich dies damals hätte voraussehen können. Ich würde dir auch heute helfen, wo mir wegen des Kontakts mit dir, einem verfluchten Hussiten, hundertmal schlimmere Konsequenzen drohen als die Ungnade des Bischofs. Aber ich bin nicht imstande, dir zu helfen. Ich besitze keine Macht mehr. Ich verfüge über keine Informationen, denn Macht und Zugang zu Informationen sind untrennbar miteinander verbunden. Ich habe keine Informanten mehr. Die Treuen und Vertrauenswürdigen wurden erdolcht in dunklen Gässchen aufgefunden. Die Übrigen, darunter auch die Dienstboten, tragen, anstatt mir etwas über andere, den anderen etwas über mich zu. Zum Beispiel Pater Felician … Erinnerst du dich an Pater Felician, den sie die Laus nannten? Der hat mich beim Bischof angeschwärzt, und er denunziert mich weiterhin. Der Bischof hilft ihm dabei, die Ämterleiter emporzuklettern, ohne zu wissen, dass dieser Hundesohn … Ha! Reynevan!«
»Bitte?«
»Da fällt mir etwas ein. Was diesen Felician betrifft. Wegen deiner Jutta … Da gäbe es vielleicht eine Möglichkeit … Vielleicht nicht die beste, aber eine andere kommt mir grade nicht in den Kopf … Aber die Sache braucht Zeit. Ein paar Tage. Kannst du ein paar Tage in Breslau bleiben?«
»Das kann ich.«
Auf dem Schild, das über dem Eingang zum Bad hing, waren die Heiligen Kosmas und Damianus, die Schutzpatrone der Ärzte und Bader, dargestellt, der eine hatte eine Balsambüchse, der andere ein Fläschchen Heilelixier in der Hand. Der Künstler hatte bei den heiligen Zwillingen weder mit Farbe noch mit Goldglanz gespart, daher zog das Schild die Blicke auf sich, die leuchtenden Farben sprachen das Auge sogar von weitem an. Für den Bader hatte sich die Investition in den Künstler reichlich gelohnt, obwohl es in der Mühlgasse mehrere Bäder gab und die Kunden die Auswahl hatten. Bei »Kosmas und Damianus« war es immer voll. Reynevan, den das bunte Schild schon vor zwei Tagen angelockt hatte, musste, wollte er das Gedränge meiden, seinen Besuch vorher vereinbaren.
Im Bad herrschte, wohl weil es früh am Tag war, wahrhaftig kein Gedränge, im Umkleideraum standen gerade mal drei Paar Schuhe, und drei Kleidungsstücke hingen herum, die ein grauhaariger Alter bewachte. Der Alte war abgezehrt und ausgemergelt, aber er machte eine Miene, deren sich auch der Zerberus im Tartarus nicht geschämt hätte, also überließ Reynevan ihm furchtlos seine Kleider und seine Habseligkeiten zur Aufbewahrung.
»Plagen Euch nicht die Zähnchen?« Der Barbier rieb sich hoffnungsvoll die Hände. »Vielleicht sollten wir ein bisschen was ziehen?«
»Nein, danke.« Reynevan schüttelte sich ein wenig beim Anblick der Zangen, die in verschiedenen Größen die Wände der Barbierstube zierten. Die Zangen wurden von einer nicht weniger imponierenden Sammlung von Rasiermessern und großen und kleinen Scheren ergänzt.
»Soll ich Euch zur Ader lassen?« Der Bader gab die Hoffnung nicht auf. »Das kann man sich doch nicht entgehen lassen.«
»Wir haben Februar.« Reynevan sah den Bader von oben herab an. Schon bei seinem ersten Besuch hatte er ihm zu verstehen gegeben, dass ihn dieses und jenes mit der Medizin verband, er wusste, dass Ärzte in Bädern besser bedient wurden.
»Im Winter sollte man niemanden zur Ader lassen«, fügte er hinzu. »Außerdem haben wir Neumond, das verheißt auch nicht das Beste.«
»Ja, wenn das so ist …« Der Bader kratzte sich am Hinterkopf. »Dann also nur eine Rasur?«
»Zuerst ein Bad.«
Die Badestube stand Reynevan, wie sich zeigte, zur alleinigen Verfügung, die anderen Kunden nutzten das Warmbad, das Dampfbad und die Birkenruten. Der sich am Badebottich betätigende Bademeister entfernte, als er den Kunden sah, den schweren Deckel aus Eichenbrettern. Ohne zu zögern, stieg Reynevan in den Bottich, streckte sich behaglich und tauchte bis zum Hals ein. Der Bademeister zog den Deckel wieder ein Stück nach vorn, damit das Wasser nicht abkühlte.
»Ich habe medizinische Traktate im Angebot«, ließ sich der immer noch anwesende Bader vernehmen. »Gar nicht teuer. ›De urinis‹ von Aegidius Corboliensis, ›Regimen sanitatis‹ von Siegmund Albich …«
»Danke. Momentan schränke ich meine Ausgaben etwas ein.«
»Ja, wenn das so ist … Dann also nur die Rasur?«
»Nach dem Bad. Ich werde Euch rufen.«
Das heiße Bad machte Reynevan träge und schläfrig, ohne zu wissen, wie, war er plötzlich eingenickt. Der scharfe Geruch der Seife, Pinsel und Schaum auf den Wangen weckten ihn. Der hinter ihm stehende Barbier zog Reynevans Kopf nach hinten und kratzte ihm über Hals und Adamsapfel, beim nächsten, ziemlich energischen Strich ritzte das Rasiermesser schmerzhaft sein Kinn. Reynevan biss die Zähne zusammen und fluchte.
»Ich habe Euch doch nicht etwa geschnitten?«, erklang es hinter seinem Rücken. »Bitte um Nachsicht. Mea culpa. Das liegt nur an der mangelhaften Ausrüstung. Dimitte nobis debita nostra.«
Reynevan kannte diese Stimme und diesen polnischen Akzent.
Bevor er noch irgendetwas tun konnte, hatte Łukasz Bożyczko den Deckel des Bottichs hinuntergedrückt und ihn so herangeschoben, dass er Reynevan gegen die Wand des Bottichs presste und hart auf seine Brust drückte.
»Wahrhaftig«, sagte der Abgesandte der Inquisition, »du bist wie Majoran, Reinmar von Bielau. Man findet dich in allen Speisen und Gerichten. Bleib ruhig und hab Geduld.«
Reynevan blieb ruhig und hatte Geduld. Der schwere Deckel, der ihn wirksam im Bottich gefangen hielt, half ihm dabei. Und der Anblick des Rasiermessers, das Łukasz Bożyczko immer noch in der Hand hielt, während er ihn mit Blicken durchbohrte.
»Im Dezember bei Münsterberg haben wir dir gegenüber eine Empfehlung ausgesprochen, ich möchte dich daran erinnern.« Bożyczko legte das Messer weg. »Wir haben dir geraten, zu den Waisen zurückzukehren und dort auf weitere Befehle zu warten. Wenn wir dir diverse Aktivitäten, wie etwas zu untersuchen, nach etwas zu forschen oder etwas zu suchen und Spuren zu verfolgen, nicht ausdrücklich untersagt haben, dann deshalb, weil wir dich für einen vernünftigen Menschen hielten. Ein vernünftiger Mensch hätte begriffen, dass derartige Aktivitäten keinen Sinn machen und wenig Aussicht auf Erfolg haben und die ganze Sucherei auch nicht das geringste Ergebnis zeitigt. Denn wenn es unser Wunsch ist, dass etwas verborgen bleibt, dann bleibt es auch verborgen. In saecula saeculorum.«
Reynevan wischte sich mit dem Handtuch, das ihm gereicht wurde, das brennende Gesicht und die feuchte Stirn ab. Er atmete tief durch und nahm all seinen Mut zusammen.
»Welche Sicherheit habe ich denn dafür«, knurrte er, »dass Jutta überhaupt noch am Leben ist? Dass ihr sie nicht bis in alle Ewigkeit auf dem Grund einer Grube verborgen haltet? Ich möchte auch an etwas erinnern: Im Dezember, bei Münsterberg, bin ich auf nichts eingegangen, habe ich euch nichts versprochen. Ich habe nicht versprochen, dass ich Jutta nicht suchen werde, und das aus einem einfachen Grund: Ich werde sie suchen. In eine Zusammenarbeit mit euch habe ich auch nicht eingewilligt. Aus einem ebenso einfachen Grund: Weil ich es nicht tun werde.«
Łukasz Bożyczko betrachtete ihn eine Weile.
»Sie haben dich mit dem Bann belegt«, sagte er schließlich mit gleichgültiger Stimme. »Sie haben ein significavit ausgestellt und eine Belohnung auf dich ausgesetzt, lebendig oder tot. Wenn du weiterhin in Schlesien herumstreifst und dem Wind auf dem Felde hinterherrennst, wird dich der Erstbeste, der dich erkennt, umbringen. Und mit Sicherheit wird dich Birkhart Grellenort, der Zauberer, erwischen und erledigen, der dir immer noch auf der Spur ist. Und selbst wenn du deinen Kopf retten könntest, denk doch mal nach, bist du für uns als Hussit interessant, als einer, der den Anführern der Waisen und Tábors nahesteht. Als Privatmann, der auf eigene Faust Nachforschungen anstellt, bist du für uns von gar keinem Wert. Dadurch verlierst du deine Anziehungskraft. Und wir streichen dich ganz einfach von unserer Liste. Und dann wirst du deine Jutta nie wiedersehen. Du hast die Qual der Wahl: Entweder du arbeitest mit uns zusammen oder du kannst dein Mädchen vergessen.«
»Dann werdet ihr sie töten?«
»Nein.« Bożyczko ließ ihn nicht aus den Augen. »Wir werden sie nicht töten. Wir geben sie den Eltern zurück, wie wir es ihnen versprochen haben. Dem Vertrag gemäß, wonach wir das Fräulein für eine gewisse Zeit isoliert halten. Sobald sich die Unruhe um die ganze Affäre gelegt hat und das Interesse einschläft, geben wir sie den Eltern zurück und gestatten ihnen, das mit ihr zu tun, was sie für richtig halten. Und die sind dann in der Zwickmühle, sie müssen abwägen. Die Tochter, von einem mit dem Kirchenbann belegten Häretiker verführt, besessen und heftig verliebt, noch dazu in das Treiben der ketzerischen Sekte der Schwestern vom Freien Geiste verwickelt … Herr und Frau Mundschenk de Apolda haben also die Wahl, die vom Weg abgekommene Tochter entweder unter die Haube zu bringen oder in ein Kloster zu sperren, wobei sie sich jetzt schon einig darüber sind, dass das Kloster sehr weit entfernt sein oder ein eventuell in Frage kommender Ehemann von sehr weit her kommen sollte. Für dich, Reynevan, ist es im Grunde einerlei, wofür sie sich entscheiden. In beiden Fällen ist die Chance, dass du deine Jutta je zu Gesicht bekommst, gering. Und Aussicht, mit ihr zusammenzukommen, hast du so gut wie keine.«
»Und wenn ich euch gehorche, was ist dann? Gebt ihr sie mir, euch nicht an das Versprechen haltend, das ihr den Eltern gegeben habt, zurück?«
»So ist es. Als ob du’s erraten hättest.«
»Gut. Was soll ich also tun?«
»Hallelujah!« Bożyczko hob die Arme. »Laetentur coeli, Himmel und Erde sollen sich freuen. Wahrlich, die Wege des Herrn sind gerade, die Gerechten schreiten auf ihnen kühn und rasch ans Ziel. Sei gegrüßt auf dem geraden Weg, Reinmar.«
»Was soll ich tun?«
Łukasz Bożyczko wurde wieder ernst. Er schwieg eine Weile und kaute auf seiner Unterlippe.
»Deine böhmischen Freunde, die Waisen«, sagte er schließlich, »haben bis vorgestern, bis Purificatio, noch vor Schweidnitz gelegen. Als sie dort nichts ausrichten konnten, sind sie nach Striegau gezogen und haben die Stadt belagert. Genug, wirklich mehr als genug haben diese zerstörerischen Myrmidonen dem schönen schlesischen Land schon zugesetzt. Du begibst dich also zuerst nach Striegau und überzeugst Královec, dass er die Belagerung aufgibt und abzieht. Nach Hause, nach Böhmen.
»Wie soll ich denn das machen? Wie?«