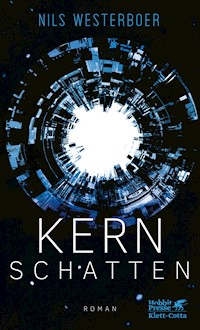13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein Meilenstein hiesiger Science-Fiction« Dietmar Dath, Frankfurter Allgemeine Zeitung »Phantastikpreis der Stadt Wetzlar 2025« Henry Meadows wird zwölf, als die Erde stirbt. Mit seinem Vater und seinen Geschwistern reist er nach Perm, einem urzeitlichen Mond in einem fernen Sonnensystem. Henrys Mutter ist mit einem anderen Raumschiff geflogen. Sie wird von der Familie sehnsüchtig erwartet. Doch plötzlich mehren sich die Zeichen: Sie ist schon hier gewesen, vor langer Zeit. Und sie hat eine Warnung hinterlassen. Mit Hightech trotzt die erste und einzige Kolonie der Menschheit der Natur des Mondes Perm, die faszinierend und bedrohlich zugleich ist. Hier gibt es Berge, die in den Weltraum ragen, zwei Arten von Nächten und eine gefährliche, unsichtbare Tierwelt. Als Henry ankommt, ist die neue Heimat noch nicht "fertig": Die Atmosphäre ist giftig und enthält zu wenig Sauerstoff, ohne Schutz ist ein Aufenthalt im Freien tödlich. Irgendetwas hat das Terraforming Perms verhindert. Henrys Mutter Mildred kennt den Grund. Die Wissenschaftlerin hat sich entschieden, nicht mit ihren Kindern zu fliegen, sondern einen neuen Antrieb abzuwarten, mit dem sie ihre Familie um Jahrtausende überholt. Sie will für die bestmögliche aller Welten sorgen. Dazu legt sie sich mit dem mächtigen Leiter des Unternehmens an, der ein anderes Ziel verfolgt. Ein Kampf entbrennt, der über das Leben von Henry und seiner Familie entscheiden wird – viele tausend Jahre später.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Nils Westerboer
LYNEHAM
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Textbaby Medienagentur, www.textbaby.de
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung zweier Abbildungen von © shutterstock/ Mia Stendal (Planet) und Master1305 (Felsenstruktur)
Karte: Nils Westerboer, unter Verwendung einer Abbildung von © ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98723-2
E-Book ISBN 978-3-608-12404-0
Inhalt
Karte: Golf von Navarrese und westliches Golgo
Karte: Monte Ferru und Umgebung
Prolog
Der Marshmallow-Test
Erster Teil
Die fremde neue Welt
Aus allen Wolken
Nach vorne sehen
Suttaterra
Kartographie
Monte Ferru
Haben-Seite
Dekontamination
Der Einäugige
Der Polmone
Zuhause
Spielplatz
Das Schweigen von der Erde
Bocksgesang
Frau Strom
Widerstand
Ameisendose
Hase
Sprechstunde
Grundgesetz
Zwei Naturen
Banne
Die Heimsuchung
Hasenjagd
Riesenrad
Fische füttern
Sitzordnung
Die Epithymia schweigt
Der Kryptid
Der Sinn des Lebens
Abel Weiner
Die Letzten werden die Ersten sein
Bienenstock
Zuwiderhandlung
Megalithen
Küche
Beta Pegasi
Zweiter Teil
Die Anomalie
Schaumwehen
Der Hühnergott
Schüsselboden
Loyalität
6,13 m/s²
Tunnel
Die wachsenden Türme
Is Piscinas
Die alte Furt
Luftschloss
Der lachende Stern
Transfermodul Fünf
Tiefnacht
Küche
Der Bohrer
Majal
Allein auf der Welt
Thermodynamik
Abstimmungsverhalten
Marshmallows
Ich möchte nicht, dass jemand stirbt
Die Reise
Gairo Vecchio
Gairo
Landzunge
Abschied
Santa Maria Navarrese
In Ruhe
Schiene
Moschops
Zu Hause
Die Pipette
Bestiarium
Notprogramm
Freier Fall
Das Phlegräische Feld
Dritter Teil
Die Windleite
Aus der Tiefe
Dormitorium
Sprechstunde
Adaptive Technologie
Alles in unserer Macht
Epilog
Reservat
Glossar
Danke
lyne (altwal.): See / Gewässerham (altengl.): Siedlung / Heim
Prolog
Der Marshmallow-Test
Als ich fünf Jahre alt war, führten meine Eltern mit mir den sogenannten Marshmallow-Test durch. Sie wollten wissen, wie es um meine charakterliche Reife bestellt war und ob ich meine Impulse unter Kontrolle hatte. Es war an einem Nachmittag im Januar, sie räumten den Küchentisch leer und setzten mich ans Ende. Dann stellten sie einen Teller vor mich hin, auf dem nichts weiter als ein einsames weißes Marshmallow lag.
Sie sagten, unter einem Vorwand, dass sie kurz wegmüssten, so für eine Viertelstunde. Ich sollte am Tisch sitzen bleiben und auf sie warten. Wenn sie wiederkämen und ich das Marshmallow nicht gegessen hätte, würde ich ein zweites bekommen.
Es heißt, dieser Test messe die Fähigkeit einer Person, auf eine schnelle Belohnung zu verzichten, zugunsten einer höheren Sache. Er zeige, schon im frühen Kindesalter, erstrebenswerte charakterliche Eigenschaften wie Durchhaltevermögen, Selbstkontrolle und vorausschauendes Denken.
Ich weiß noch ziemlich genau, wie ich die Viertelstunde verbracht habe. Zuerst bin ich brav sitzen geblieben, habe meine Hände zwischen die Oberschenkel und den Stuhl geklemmt, das Marshmallow angestarrt und mir vorgestellt, es würde sich vor mir fürchten. Später, nach Minute drei, habe ich mich über den Teller gebeugt und versucht herauszufinden, ab welcher Höhe ich das Marshmallow riechen kann, um zu wissen, wo seine Atmosphäre beginnt. Die ganze Zeit über hörte ich meine Eltern hinter der Küchentür tuscheln, verstand aber nicht, was sie sagten. Irgendwann, von Minute acht an, wurde es still. Ich legte die flache Hand auf das Marshmallow und drückte es platt, platter und noch platter. Als ich sicher war, dass es sich nun angemessen fürchtete, nahm ich es hoch und ließ es vor meinem Mund kreisen, hielt es mir mutig unter die Nase und nahm seine gesamte Atmosphäre in mich auf. Gegen Minute vierzehn vernahm ich leise Geräusche hinter der Küchentür, da wurde ungeduldig gewartet.
Ich steckte mir das Marshmallow in den Mund, wenige Sekunden bevor die Tür aufging, und während ich kaute, sah ich in das Objektiv der kleinen Kamera, die mir gegenüberstand und die bis heute meine Erinnerungen an diese Viertelstunde objektiviert. In der Aufzeichnung ist auch die Enttäuschung in den Gesichtern meiner hereinkommenden Eltern festgehalten. Ich hatte den Test nicht bestanden.
Ich erzähle dies, weil ich ernsthaft gefragt wurde, ob die Menschheit oder, genauer, ein Teil von ihr, eine andere Welt in einem anderen Sonnensystem »kolonisieren« sollte. Offenbar hat es einen technischen Durchbruch gegeben, der ein solches Vorhaben in eine Art greifbare Nähe gerückt hat. Da mir die näheren Umstände nicht bekannt sind, derentwegen ich um diese Stellungnahme gebeten wurde, fasse ich mich kurz.
Es ist Unsinn.
Das Leben auf der Erde existiert seit vier Milliarden Jahren. Es hat sich von Anfang an unter den Bedingungen gebildet, die auf diesem Planeten vorherrschen. Wer glaubt, man könne einen vier Milliarden Jahre umfassenden Zeitraum der immer wiederkehrenden Anpassung und Entwicklung ignorieren, irrt. Ich wage daher einen nicht zu vorsichtigen Ausblick, wenn ich sage: Wir werden bis auf Weiteres an diese unsere Heimat gebunden sein. Vermutlich auf alle Zeit und über alle Schandtaten hinaus, die wir ihr angetan haben.
Selbst die unwirtlichsten Orte der Erde sind im Vergleich zum Rest des Universums dem menschlichen Organismus ausgesprochen wohlgesonnen. In der Wüste Dascht-e Lut, im Iran gelegen, kann es in Spitzenzeiten bis zu 88 Grad heiß werden. Dennoch bleibt die Luft atembar, sie enthält keine toxischen Gase, keinen Feinstaub, nichts, auf das die menschliche Lunge nicht vorbereitet ist. Die Zusammensetzung der Atmosphäre ist, trotz aller Beigaben des Anthropozäns, prinzipiell gesund, egal, wo Sie hingehen. Wenn Ihnen der Sauerstoffgehalt auf dem Hindukusch zu niedrig ist, dann steigen Sie einfach etwas tiefer, es wird genug für Sie und alle anderen da sein. Nirgendwo müssen Sie sich Sorgen um kosmische Strahlung machen und auch nicht über die Trinkbarkeit des Wassers, solange Sie nur Ihre Rechnungen bezahlen.
Ich bin keine Freundin rhetorischer Fragen, denn ich mag keine Fragen, deren Antworten bekannt sind. Aber zwei seien mir an dieser Stelle gestattet.
Erinnern Sie sich an die dreckigen Überraschungen, die das Eisreservoir von Rhea den durstigen Saturn-Reisenden bereithielt? Falls nicht, lesen Sie das Protokoll. Und wissen Sie von den körperlichen Verstimmungen am Mars-Hellas, wo Sodbrennen, Nierensteine und allergische Reaktionen zu einer Volkskrankheit geworden sind? Die widrigen Temperaturen, eine hemdsärmelige Schwerkraft und deprimierende Lichtverhältnisse treiben die Hartgesottensten unter den Sternenfahrern zurück in den Schoß der Erde. Lesen Sie die Protokolle.
Die Temperaturskala des Universums umfasst viele Millionen Grad. Ähnliche Spektren gibt es bei den Druckverhältnissen und der Strahlung. Nahezu überall sind sie, außer auf der Erde, tödlich. Die Atemluft, an die wir uns angepasst haben, ist eine sensibel abgestimmte Medikation. Wir alle sind sensibel auf das abgestimmt, was wir hier haben.
Sollte es also einen ernsthaften Grund für meine Stellungnahme geben, dann bitte ich die Auftraggeber um eines: Sie haben bestimmt ein Goldfischglas irgendwo oben in den heiligen Hallen Ihrer Einrichtung. Fangen Sie einen Fisch, legen Sie ihn auf Ihren Schreibtisch und schauen Sie zu, was passiert.
Ich weiß nicht, welchen Durchbruch Sie mir vorenthalten und auf welcher Grundlage Ihre Anfrage fußt. Sollte sich der Durchbruch tatsächlich auf die »Kolonisierung« einer neuen Welt beziehen, so lassen Sie mich klarstellen: Sie werden überall auf der Erde kostengünstigeres und gesünderes Bauland finden als woanders im Universum.
Es wird nach wie vor einfacher sein, die Schäden, die wir hier angerichtet haben, wiedergutzumachen, anstatt irgendwo neu zu beginnen. Wir sollten das erhalten, was das Leben in den vier Milliarden Jahren der Anpassung und Entwicklung für uns errungen hat, anstatt zu verschwinden.
Aus eigener Erfahrung kann ich nämlich sagen: Wenn das erste Marshmallow weg ist, wird kein zweites kommen. Was wir hier nicht schaffen, schaffen wir woanders erst recht nicht.
Im Übrigen hasse ich Marshmallows. Ich mochte sie schon nicht, als ich fünf Jahre alt war. Aber manchmal müssen wir eine bittere Pille schlucken, um Schlimmeres zu verhindern.
Der Grund, warum ich meine Viertelstunde alleine mit dem Marshmallow so gut in Erinnerung habe, liegt nicht in der Kamera-Aufzeichnung, die ich mir später nur ein einziges Mal angesehen habe. Sie liegt in der Frage, die ich mir damals stellen musste: Warum wussten meine Eltern nicht, dass ich keine Marshmallows mag?
In jeder Angelegenheit ist es wichtig, alle Faktoren zu kennen, um den Grund eines Handelns zu verstehen.
Sie wollen Milliarden Kilometer durch das Nichts reisen und einen Ort suchen, an dem Sie etwas Besseres finden als den Tod? Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund.
Oder, besser gesagt, hoffe ich, Sie haben keinen.
Dr. Mildred Meadows
Erster Teil
Die fremde neue Welt
I do not believe in miracles. I have seen too many.
Oscar Wilde
Aus allen Wolken
Wir fielen.
Ich weiß nicht mehr, wie schnell. Es musste irgendetwas mit Metern in der Sekunde gewesen sein. Mit einem Zittern fing es an, doch dann rüttelte es überall, knirschte und ratterte. Mein Sitz, der Boden, alles. Hinter dem kleinen runden Fenster unseres Landungsmoduls, hinter dem man eben noch die Sterne sehen konnte, glühte es rot. Wir tauchten in die Atmosphäre von Perm ein.
»Hört ihr das auch?«, rief Papa zu uns herüber.
Ich versuchte, aus dem schrecklichen Tosen so etwas wie ein Fiepen oder ein Warnsignal herauszuhören. Aber da war nichts als Rattern und Rütteln.
»Was meinst du?«, rief ich zurück.
»Hörst du das wirklich nicht?« Er sah mich sorgenvoll an.
»Nein! Was denn?«
»Na, dieses laute Rütteln!«
Ich musste lachen, hielt mich aber zurück. Mehr als ein müdes Lächeln stand ihm nicht zu.
»Wir sind gleich da!«, rief er.
Ich schüttelte den Kopf, denn ich wusste es besser. Kurz bevor der Lärm und das Glühen anfingen, hatte ich durch das Fenster noch die Krümmung der Oberfläche gesehen. Es bestand kein Zweifel daran, dass wir noch sehr weit oben waren.
Von Chester wusste ich außerdem, was alles möglich war: Eine nicht vorhergesehene feinkörnige Zutat in der atmosphärischen Zusammensetzung Perms konnte reichen, um unsere Außenhülle zum Schmelzen zu bringen, sodass wir aus der Kapsel fielen wie abgeworfene Ballastsäcke. Wenn es in der Atmosphäre schädliche Wasserstoffverbindungen gab, würden wir uns noch während des Sturzes übergeben, erblinden und ohnmächtig werden. Selbst bei einer im Vergleich zur Erde schwachen Fallbeschleunigung von 6,13 m/s² würde schließlich der Aufprall dafür sorgen, dass wir uns mehr brachen als nur den Hals – sofern wir nicht in einem Meer aus Ameisensäure landeten. Im Augenblick war am wahrscheinlichsten, dass wir einfach verglühten.
Dennoch war ich mir sicher, dass nichts davon passieren würde, denn ich hatte Geburtstag. Kein Mensch verglüht, erblindet oder bricht sich den Hals, wenn er Geburtstag hat. Chester war ein Dummkopf, der sich keinen Geburtstag merken konnte, nicht mal den seines Bruders.
Er hatte Loys Kopf in den Händen und versuchte, sie zu beruhigen. So hatten wir das für die Landung vereinbart: Papa sollte sich um mich kümmern, Chester um Loy. Aber nicht einmal das gelang ihm, sie weinte und schrie. Wie so oft war ich neidisch auf sie, da sie genau das machte, was ich am liebsten auch tun wollte.
Meine Schwester war nicht die Einzige, die schrie. Dahlia Brahms war außer sich und hielt Moxie im Arm und Melcher. Kjell Larsen und Undine Battiste schrien, Merril Abdulrazzeq betete laut und einvernehmlich. Es klang drohend, als würde er seinen Gott davor warnen, ihn sterben zu lassen.
Die Luft war so heiß, dass es wehtat, sie einzuatmen, das rote Glühen hinter dem Fenster wurde orange und gleißend. Ich konnte mich nirgends mehr festhalten, ohne mir die Finger zu verbrennen. Zischend verdampfte das Kondenswasser, das sich während des Fluges auf dem Boden und an den Wänden angesammelt hatte, der Teppichboden war eine suppige Pfütze.
Jemand zeigte auf ein plötzliches Leuchten an der Decke. Ein Alarm war angegangen, blaue Lichtzeichen kreisten durch die Kapsel. Neue Lichter erschienen, sie führten in Richtung der Stasiskammern. Der Alarm war trotz des Rüttelns und des Geschreis gut zu hören, ein hohes d, das immer wieder an- und abschwoll.
»Hörst du das?«, rief ich Papa zu.
Er lächelte.
»Wir müssen noch einmal in die Kammern!«
Niemals, dachte ich. Ich wollte da nicht wieder rein.
»Ich will da nicht wieder rein!«, schrie Loy.
»Dann ist das dein schmachvolles Ende«, sagte Chester. Loy sah ihn mit großen Augen an, vergaß sogar das Weinen für einem Moment. Papa nahm sie in den Arm.
»Nur noch ein Mal«, sagte er.
Die Stasiskammern waren nicht nur zum Schlafen da. »Das Deutolecith dämpft jeden Aufprall«, hatte mir Chester erklärt. »Wenn du hundert Meter in der Sekunde fliegst und dein Schiff gegen irgendetwas kracht, und du bist nicht in deiner Kammer, dann wirst du zu einem Gemälde an der Wand.« Mein Bruder, der Poet. Er hatte dazu eine Handbewegung gemacht, die ich am liebsten wieder vergessen hätte.
Papa entsperrte den Verschluss von Loys Kammer. Durch das unkontrollierte Gerüttel quoll etwas von dem Deutolecith aus den Lamellen. Er ließ sie nur so weit aufgehen, dass Loy sich hindurchzwängen konnte.
»Geht es jetzt wieder heim?«, fragte sie, während sie mit den Füßen voran tauchte.
»Ja, genau!«, rief Chester.
Papa warf ihm einen bösen Blick zu.
»Es geht in die fremde neue Welt!« Er lächelte sie an. »Das wird ein großes Abenteuer, versprochen!«
Ich wusste, dass das nichts hieß. Mir hatte er eine Geburtstagsfeier versprochen, gleich nach dem Aufwachen aus der Stasis.
Papa lächelte Loy so lange an, bis sie gar nicht mehr anders konnte, als zurückzulächeln. Dann versiegelte er die Kammer. Durch die Scheibe sah ich Loys aufgerissene Augen, wie sie kurz davor waren, wieder loszuweinen. Doch dann stieg das Gel an, stieg über ihr Gesicht, lief in ihren Mund und in ihre Nase, und sie hörte auf, sich zu bewegen. Da sie ihre Augen offen hielt, sah sie aus wie eine Wasserleiche, aber ich wusste, dass sie lebte. Deutolecith kann man essen, trinken und atmen, wenn die Sauerstoffsättigung hoch genug ist. Ihre Kammer war die mit dem Dornröschensticker.
Ich kroch den Lichtern nach, die zu meiner Kammer führten. Im Durcheinander stieß jemand aus Versehen mit seinem Bein an mein Gesicht. Der dampfende Boden brannte an meinen Handflächen und Knien, und ich schaute noch einmal zum Fenster hoch. Manchmal riss der orangerote Qualm nun ab, und man konnte etwas sehen.
Wir flogen über Wasser. Da waren Wellen, Millionen winziger kleiner Wellen, tief unter uns, vielleicht ein Meer oder sogar ein Ozean. Das Wasser leuchtete türkisfarben und sah schön aus. Ich wollte Chester fragen, ob das vielleicht die Ameisensäure sein konnte. Doch dann fiel mir wieder ein, dass ich Geburtstag hatte.
Ich entsperrte meine Kammer und ließ die Lamellen genauso weit aufgehen, wie Papa es bei Loy gemacht hatte. Er kam zu mir und half mir.
Ich sah zu Chester hinüber, wie er ohne Hilfe in seine Kammer stieg, die am Fenster mit Aussicht, ohne jede Angst und ohne jedes Zögern schloss er sich an, versiegelte die Lamellen von innen, streckte sich lang, ließ sich vollaufen – und schloss sogar die Augen, obwohl hier gleich alles zu explodieren schien. Er hatte die Dinge, vor denen er sich fürchtete, in bildhaften Worten seinen kleinen Geschwistern erzählt, und sie hatten nun an seiner Stelle Angst.
Ein Countdown setzte ein, wir hatten nur noch 60 Sekunden, um in unsere Kammern zu gelangen. Die Zahlen schwebten blau im Raum, und der Alarm schwoll an.
»Sie geht nicht auf!«, rief jemand hinter uns. »Kann uns jemand helfen? Bitte!« Ich versuchte, mich umzusehen, wollte herausfinden, um wen es sich handelte.
Aber Papa nahm meinen Kopf in seine Hände. »Schau zu mir!«, befahl er. »Schau da nicht hin, schau mich an!«
Ich gehorchte, durch seinen harten Griff konnte ich sowieso nicht anders.
»Ist das die fremde neue Welt, Papa?«, fragte ich.
»Ja!«
»Ich hab heute Geburtstag!«
»Ich weiß.«
Ich war mir nicht sicher, ob das stimmte.
»Sie geht nicht auf!«, wimmerte es hinter uns. »Helft uns doch bitte!«
»Henry, versprich mir, zu Loy zu schauen, die ganze Zeit, egal, was passiert! Versprich mir das!«
Aus dem Wimmern wurde ein Schluchzen, dann ein Schreien. Ich wollte hinschauen, aber Papa hatte mich immer noch fest im Griff. Mir war klar, dass er sich selbst in Sicherheit bringen musste. Ich wollte nicht, dass ihm etwas zustieß, wollte aber auch nicht, dass er wegging.
»Henry! Eule!«, rief er plötzlich.
»Was?« Ich konnte nicht glauben, dass er das in diesem Moment ernst meinte. Wir hatten noch vierzig Sekunden.
»Eule!«, wiederholte er und ließ meinen Kopf los. Ich unterdrückte meinen Drang, die Augen zusammenzukneifen und zu verdrehen. Stattdessen öffnete ich sie so weit, wie ich konnte, starrte ihn an und blinzelte nur ganz langsam.
»Sehr gut. Jetzt Huhn!«
Ich starrte ihn weiter an, legte aber den Kopf in schnellen eckigen Bewegungen schief. Die Frau schrie immer noch.
»Und jetzt Fisch!«, befahl er.
Fisch war die schwerste Übung gegen meinen Augentick. Jetzt durfte ich nicht mal mehr blinzeln.
»Schau zu Loy!«
Ohne Vorwarnung presste er seine Hand auf meine Stirn, drückte mich tief ins Gel und drehte schließlich mein Gesicht zur Kammer meiner Schwester. Ich wehrte mich, wollte noch mal hochkommen, zu ihm, kam aber gegen seine Kraft nicht an.
Alles Geschrei verging in Gurgeln und Blubbern. Ich presste die Lippen aufeinander, obwohl ich wusste, dass ich sie früher oder später öffnen musste, um nicht zu ersticken. Über mir schlossen sich die Lamellen, und es wurde still. »Hermetisch« hieß das, wie ich von Chester wusste: Man hörte so gut wie nichts mehr außer die ganz großen, tiefen Schläge.
Der Druck in der Kammer stieg, als würde ich Meter tief tauchen, es stach in den Ohren. Papa verschwand aus meinem Blickfeld. Der Drang, ihm nachzuschauen, war riesig, ich wollte sehen, ob er den anderen half, wollte wissen, wer da geweint hatte und, vor allem, ob er es selbst rechtzeitig in seine Kammer schaffen würde. Aber ich hatte das sichere Empfinden, dass all das nur gelingen würde, wenn ich jetzt gehorchte. Also sah ich dahin, wo ich hinsehen sollte.
Meine Schwester, so klein, mit großen offenen Augen, die wilden Haare grau wie die einer alten Frau. Ich konnte die roten Schlieren in ihrem Deutolecith erkennen. Das war ihr Blut, manches drang während der Aufwachprozesse nach draußen, Chester hatte »Mikroverletzungen der Blutgefäße« dazu gesagt, worunter ich mir immer nicht allzu viel vorstellen wollte.
Dann spürte ich einen Ruck.
Weich und weit entfernt, so fühlte es sich immer an, wenn Loy zu Hause auf den Berg von Sofakissen gesprungen war, unter dem sie mich zuvor eingegraben hatte. Ich hörte auch einen fernen, dumpfen Schlag, nein, es waren viele Schläge. Dazwischen gab es kurze Ruhepausen, dann ruckte und knallte es wieder, und ich beeilte mich, das Gel in meine Lunge zu lassen. Es schoss in mich hinein, als wäre ich ein Vakuum. Sofort legte sich der Drang, Luft holen zu müssen.
Die Stöße kamen nun von allen Seiten und wurden stärker. Kurz darauf war es nicht mehr so, als gäbe es schützende Kissen, und es war mehr Chester als Loy, der der Länge nach auf mich draufsprang, sodass es wirklich wehtat.
Das war die Landung. Was da draußen auf uns einschlug, war die Oberfläche von Perm, der Boden einer fremden neuen Welt. Die Schläge sagten zu mir: Es gibt sie wirklich, sie ist wirklich da, und wir sind jetzt da.
Wir waren weiter in Bewegung, ich fühlte, dass noch ein letzter großer Schlag anstand. Wahrscheinlich der, auf den der Countdown ausgerichtet war. Ich kniff die Augen zusammen, um irgendwie vorbereitet zu sein.
Aber was empfindet ein Fisch, wenn sein Aquarium explodiert? Vielleicht das: einen Knall, so durchdringend, dass eine Weile gar nichts mehr zu hören ist. Irgendetwas platzte. Ich wurde zusammen mit dem Gel in irgendein Draußen gespült, klatschte gegen eine Wand, dann rutschte ich einem Licht entgegen, das unerträglich weiß war, Scherben, die mit mir mitrutschten, glitzerten darin, doch die Angst, dass sie mir die Haut aufschlitzten, ging ins Nichts, denn ich war ganz leicht und spürte sie kaum.
Das Licht verschwand. Ich landete auf einem Felsen, schwarz wie die Nacht um mich herum und zerfurcht wie ein riesiger versteinerter Schwamm. Ich klammerte mich an einem Vorsprung fest, wusste durch die seltsame Leichtigkeit nicht sofort, wo oben und wo unten war. Ein Wasserschwall klatschte in meinen Nacken, kurz darauf ein weiterer auf den Rücken. Dann hörte ich über mir ein Surren, das langsam anschwoll, bis es sich in einem donnernden Schlag entlud, begleitet von einem Blitz, der mehrere Sekunden lang anhielt und in einer gigantischen Horizontalen den Himmel durchschnitt.
Die Luft war erfüllt von faustgroßen Regentropfen, die so langsam fielen, dass ich für einen Moment den Eindruck hatte, sie würden auf der Stelle schweben. Hinter mir ragte das aufgeplatzte Landemodul aus dem schwarzen Gestein, über die gesamte Breitseite war es eigentümlich verformt. Aufgewirbelte Steinsplitter und dichter Rauch verhüllten die Sicht.
Die Stasiskammern, die wie große Ameiseneier verstreut herumlagen, leuchteten weiß im Licht des Blitzes. Manche befanden sich noch im Inneren des Moduls, andere waren, wie meine, nach draußen geschleudert worden. Überall schlüpften Menschen aus ihnen heraus, hustend und würgend, alle waren sie nackt und hatten graue Haare, egal, wie alt sie waren.
Das Letzte, was ich sah, bevor der Blitz erlosch, war der schräge Streifen aus Qualm, der diagonal über den Himmel ging, die Spur unseres Absturzes. In der Ferne standen schwarze Bergspitzen, die allerhöchste mussten wir gestreift haben, denn sie ragte mitten in den Streifen hinein, und darunter stürzten riesige Brocken in die Tiefe, genauso langsam wie der Regen.
Die Luft war mild und hatte einen süßen und stechenden Geruch. Ich konnte atmen, aber es gab mir keine Kraft. Es war, als würde ich eine Tüte vor dem Mund haben und immer wieder dieselbe alte, verbrauchte Luft benutzen. Auf meiner Zunge breitete sich ein bitterer Geschmack aus, mein Rachen schmerzte, und meine Finger begannen zu verkrampfen. Ängstlich versuchte ich, in den vielen bleichen Körpern meine Familie zu erkennen, aber es waren zu viele, die durcheinanderstolperten, sich irgendwo festhielten und Deutolecith aus ihren Lungen husteten.
»Nicht atmen! Auf keinen Fall atmen!«
Jemand riss eine Wandverkleidung des Moduls ab, warf weiß leuchtende Schutzanzüge und Atemmasken in die Menge.
»Zuerst die Masken!«
Die Stimme klang verzerrt und blechern, vermutlich aufgrund der fremden Luft. Ich konnte nicht erkennen, ob genug Masken für alle da waren. Ein Gerangel entstand, jeder hatte Angst, sich zu vergiften oder zu ersticken. Über uns erklang ein anschwellendes Surren.
Im Licht eines neuen, lang andauernden Blitzes erkannte ich zwischen einem abgerissenen Seifenspender und einem dampfenden Stück Teppichboden eine Maske, die unbeachtet in eine löchrige Mulde gerutscht war, »Eigentum von Rayser-Interstellar« stand darauf. Unter zischendem Donner kletterte ich hin und zog sie mir über den Mund. Sie aktivierte sich automatisch und leuchtete an der Seite grün auf. Wir hatten das vor der Reise geübt. Nur für den Notfall. Eigentlich sollte diese Welt fertig sein, wenn wir kamen.
Die Maske informierte mich über die Konzentrationen von Wasserstofffluorid, Schwefeldioxid und Methan, alles Gase, die sie, im Namen von Rayser-Interstellar, für mich aus der Luft filterte und durch einen angenehmen Mentholgeschmack ersetzte, sodass ich nach einigen Atemzügen meine Finger wieder zu spüren begann. Ich sah die großen Regentropfen wabern, Menschen in Anzüge steigen und dann, endlich, Papa.
Er und Chester trugen bereits Masken, Chester war dabei, Loy eine aufzusetzen. Papa erkannte mich, kurz bevor der Blitz erlosch, und plötzlich war er bei mir, ging vor mir in die Knie und packte mich an den Oberarmen. Ein riesiger Tropfen zerplatzte auf seiner Schulter.
»Hast du die Luft geatmet?«
»Nein, Papa!«, schwindelte ich. Mir war schlecht, meine Finger fühlten sich immer noch taub an. Es war seltsam, so leicht zu sein. Papa ließ mich los und schaute mich an.
»Du hast gleich eine Maske bekommen?«
»Ja«, sagte ich. Unsere Stimmen klangen dumpf, als würden wir in ein Baustellenrohr sprechen.
»Hast du dich bedankt?«, fragte er.
»Was meinst du?«
»Für die Maske, Henry! Hast du Danke gesagt?« Er war totenbleich. »Du hast sie doch von jemandem bekommen?«
Ich nickte.
»Und?«
»Ich hab’s vergessen.«
Ein dritter Blitz, dieses Mal nur durch ein sehr kurzes Surren angekündigt, erhellte noch einmal alles. Der lange Streifen aus Rauch, der über den Himmel führte und auf halber Strecke die Bergspitze berührte, löste sich auf.
»Henry, wenn du noch mal vom Himmel fällst und dir danach irgendjemand etwas schenkt, das du gut brauchen kannst, egal wer, dann sagst du Danke!«
»Ja, Papa.«
Nach vorne sehen
Loy musste mal, ich eigentlich auch. Wir waren eingehüllt in Nacht und Regen. Unser Weg, wenn es denn einer war, führte bergauf, über schwarzes tropfendes Gestein, scharfkantig und immer wieder in unwirkliche Tiefen absinkend.
Papa erlaubte uns keine Pause. Ich hielt den Blick auf meine Füße gesenkt, denn wenn ich ihn hob, konnte ich das ganze andere, das auch zu sehen war, nicht ertragen. Das Fortkommen war einfach, denn wir waren leicht, beinahe schwebend, wie unter Wasser, aber ohne den Widerstand, den Wasser erzeugt. Die Stasiskammern, die wir auf den Rücken geschnallt hatten, waren sperrig, aber nicht schwer. Ich trug Loys Kammer, da meine bei der Landung zerstört worden war.
Die Felsspalten verlangten große Schritte, manchmal sogar Sprünge. Sprünge, die auf der Erde unmöglich gewesen wären, hier sehr einfach gingen, aber hier wie da beim Landen auf die Blase schlugen.
»Ich muss wirklich!«, rief Loy.
Papa ignorierte es. Er lief mit Chester voran, auf eine Reihe schwarzer Gipfel zu, über denen eine dichte, von Blitzen durchzuckte Wolkendecke hing. Immer wieder klatschten tennisballgroße Tropfen gegen meine Maske, und der zerrende Wind ließ mich trotz der Wärme frösteln. Zu diesem Zeitpunkt hätte ich schwören können: Irgendwo da oben war unser neues Zuhause, so entschlossen geradeaus, wie Papa lief.
»Wie wäre es mit: Ich packe meinen Koffer?«, fragte er. »Loy, du fängst an.«
»Ich packe meinen Koffer, und ich nehme mit«, Loy überlegte nicht lange, »meine Kugelbahn.«
»Henry?«
»Ich packe meinen Koffer, und ich nehme mit: eine Kugelbahn und Ruske.«
»Chester?«
Papa wandte sich immer wieder um, sah zurück, aber nicht zu mir und Loy, sondern an uns vorbei zur Stelle unseres Absturzes, die nun schon weit unter uns lag. Die Menschen, deren Schutzanzüge im Licht der Blitze aufleuchteten, waren klein wie Ameisen. Papas Blick, den ich im grünen Licht seiner Maske gut sehen konnte, war schrecklich. Ich begriff seine Bedeutung erst nach einer Weile: Er wollte wissen, ob uns jemand folgte.
Wir waren schnell aufgebrochen, um den Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen, die sich kurz nach der Landung angebahnt hatten. Viele Stasiskammern waren bei unserer Bruchlandung zerstört worden, nicht nur meine.
»Hier ist nichts!«, hatte plötzlich jemand gerufen. Das war der Satz, der alles in Aufruhr versetzte.
Displays leuchteten daraufhin auf, Daten wurden geprüft, Karten studiert und Notsignale gesendet.
»Doch«, brüllte Undine Battiste. Sie sah an ihrem Arm herunter, der an mehreren Stellen blutete, als wäre sie gebissen worden. Die Panik, die daraufhin ausbrach, war unkontrolliert und heftig, und Papa traf eine Entscheidung:
»Wir gehen, jetzt«, wies er uns an. »Nicht zurückschauen, einfach gehen. Nehmt die Kammern auf den Rücken! Lasst sie euch auf keinen Fall wegnehmen.«
Dann liefen wir. Erst langsam, dann immer schneller.
Es war unheimlich, die lauten Stimmen im Rücken zu haben und nicht zu wissen, was vielleicht gleich passierte. Doch der Lärm entfernte sich rasch, bald war nichts mehr zu hören außer unseren eigenen Schritten. Durch die unfertige Luft schien man nicht weit hören zu können. Als ich mich doch einmal heimlich umwandte, erschrak ich, wie nah die anderen noch waren, in aller Stille, und ich wandte mich schnell wieder ab.
Die Gipfel, die sich vor uns auftürmten, waren unwirklich weit auf die Seite geneigt, als hätten sie sich dem Wind beugen müssen, der sich gerade legte. Manche von ihnen waren abgebrochen, in die Tiefe gestürzt und lagen auf den Hängen wie aufgeschnittenes Brot. Ich wagte es nicht, den Blick weiter zu heben, denn manchmal zeichnete sich hinter dem Nebel darüber die Windleite ab, die Heimatwelt Perms, und ich wusste, dass mich dieser Anblick bis zur Unkenntlichkeit schrumpfen lassen würde.
»Das ist unheimlich«, rief Loy.
»Was?«, fragte Papa.
»Diese Berge. Und das dadrüber.«
»Das ist die Windleite«, sagte Papa, als würde das Wort reichen, um der Sache den Schrecken zu nehmen. Als er merkte, dass es nicht reichte, rief er: »Schau mal hier, Loy!« Er zeigte auf eine dunkle Stelle zwischen zwei dicht nebeneinanderliegenden Felsbrocken.
»Was meinst du?«
»Na da!« Papa zeigte noch mal hin. »Siehst du das nicht?«
»Was?« Jetzt war auch ich neugierig, obwohl ich wusste, was kam.
»Da ist keine böse Echse.«
Loy rang sich ein müdes Lächeln ab.
»Stimmt, Papa. Und hier«, sie zeigte zu einem anderen Schatten unter einem kleinen Überhang auf der rechten Seite, »hier ist kein bissiger Amniot.«
»Stimmt!«, rief er. »Jetzt sehe ich es auch: kein bissiger Ammniot. Genau, da ist er nicht!«
Loy nahm seine Hand, und sie gingen zusammen weiter.
»Ich muss jetzt«, sagte sie.
»Du bist aber dran!«
Sie seufzte. »Ich packe meinen Koffer und nehme mit: meine Kugelbahn, Ruske, etwas zum Schreiben, Eierkuchen, Mama.«
Zwischen grauschwarzen Felstürmen, die so auf der Erde nicht stehen bleiben würden, öffnete sich noch einmal der Blick zurück. Die Menschen waren nur noch winzige Punkte in der zerklüfteten Weite.
Papa blieb stehen, um sich an der Karte zu orientieren, die er gleich bei unserem Aufbruch aus dem Werkzeugschacht seiner Stasiskammer gezogen hatte. Hier schien es aufgrund eines tiefen Felsspaltes nicht weiterzugehen.
»Haben wir uns verlaufen?«, fragte ich.
»Nein«, sagte er. Ich erschrak, als ich merkte, wie er das sagte. Es klang, als würde nicht er selbst sprechen, als würde irgendeine Automatik in ihm arbeiten. Das kleine leuchtende Display in seiner Hand zitterte.
»Ich muss. Jetzt!«, sagte Loy.
»Geh da drüben!«
Papa zeigte ihr eine Stelle an einem der Türme. Loy ging in die Hocke, hinter ihr füllte die Windleite den halben Himmel aus. Als das Plätschern verstummte, reichte uns Papa die Schutzanzüge, die er bis dahin unter dem Arm getragen hatte.
»Anziehen!«
»Ich muss auch noch«, sagte ich vorsichtig.
»Herrgott, warum bist du nicht gleich mit?«
Papa ging den Felsspalt ein Stück weit entlang, bis er etwas entdeckt zu haben schien, kam dann zu uns zurück, um den Sitz der Anzüge und Masken zu prüfen.
»Statuskontrolle«, sagte er unterdessen. »Chester, du fängst an. Wie fühlst du dich?«
»Meine Haut ist«, er überlegte, »von einem seltsamen Ziehen durchzogen. Es sticht wie tausend Nadeln«, sagte er.
Mein Bruder, der Poet.
»Tut es sehr weh?«, fragte Papa.
»Nein. Nur in der Tiefe des Kopfs.«
»Übelkeit?«
»Ein wenig.«
Papa nickte und wandte sich zu mir. »Und du?«
»Ich könnte kotzen«, sagte ich.
»Nicht in die Maske. Noch etwas?«
»Nein«, antwortete ich. Je poetischer mein Bruder auftrat, desto weniger wollte ich es sein, obwohl meine Haut stach wie mit Nadeln und mir auch der Kopf, in großer Tiefe, wehtat, wenn ich ihn bewegte. Außerdem spürte ich einen seltsamen Druck in den Augen.
Aber ich schwieg.
»Loy?«, fragte Papa.
»Ich hab Hunger.«
»Gut, dir geht es am besten. Henry, du bist dran.«
»Kugelbahn, Ruske, Schreibzeug, Eierkuchen, Mama und ein Luftschloss.«
Die Schutzanzüge leuchteten weiß, waren dünn und eng anliegend. Jetzt stand Rayser-Interstellar auf jedem von uns. Ich starrte auf das Logo, zwei Sterne, zwei Linien, die die beiden Sterne verbanden.
Als ich Mama das letzte Mal sah, stand das auch auf ihr, in blauer Schrift auf weißem Stoff.
Wir befanden uns im Rayser-Terminal unter der Anzeige mit den Abflügen. Es war der Moment, von dem ich erst später begriffen hatte, dass er der endgültige Abschied gewesen war. Sie ging vor uns auf den Boden und sah uns in die Augen. Jedem von uns dreien, nacheinander, aber immer genau gleich lang, sodass uns klar war, dass wir alle drei die gleiche Liebe hatten.
Dann sang sie plötzlich, mitten zwischen den ganzen Menschen, die an uns vorbeihasteten, unser altes Lied, mit dem sie uns früher, bevor der Weltraum gekommen war, in den Schlaf gesungen hatte. Sie begann immer wieder von vorne, bis wir alle drei, sogar Chester, mitsangen.
Reite geschwind
Nach Banbury Cross
Und sieh an die Lady
Auf weißem Ross.
Ringe am Finger
Und Glocken am Zeh
Musik wird klingen
Wo immer sie geht.
Wir weinten, aber sie hatte nicht eine einzige Träne im Auge, nicht einmal dieses glasige Vollwerden des Auges. Ich hatte sie noch nie weinen sehen. Sie gab uns allen dreien einen Kuss, dann drückte sie uns an sich, alle drei gleich lang, dann stand sie auf und ging.
Ich hatte mir gewünscht, durch ihren Hinterkopf hindurchsehen zu können, ob sie vielleicht doch weinte, heimlich, weil sie es uns nur nicht zeigen wollte, aber ich glaube, sie hat nicht geweint, als sie ging.
Ein blaues Dämmerlicht lag auf allem.
Es kam von der Windleite.
»Was machst du da, Loy?«, rief Papa, während er seinen Anzug am Hals mit der Maske zusammenschloss. Loy war dabei, auf Knien herumzurutschen und Geröll vom Boden hochzuheben.
»Ich suche Leben«, sagte sie und hob Steine an, die sie auf der Erde keinen Millimeter hochbekommen hätte. »Das macht man auf fremden Welten, nach Leben suchen.«
Chester, der ihr gleichgültig zugesehen hatte, schien plötzlich etwas zu begreifen. Seine Augen wurden weit, erst sah er mich an, dann unsere Stasiskammern, schließlich heftete er seinen Blick auf Papa. Wie so oft versuchte ich zu verstehen, was in seinem Kopf vorging. Und wie so oft fürchtete ich mich davor.
»Hier ist nichts, oder?«, flüsterte er.
»Leise!«, fuhr Papa ihn an.
Er schien etwas gesehen zu haben, das ihm nicht gefiel. Langsam, Schritt für Schritt, trat er von seinem Aussichtspunkt zwischen den schrägen Felstürmen zurück und gab uns ein Handzeichen, das auch zu tun.
Da kamen zwei.
Sie waren noch weit weg, aber im Licht der Windleite war leicht zu erkennen, dass sie keine Stasiskammern bei sich hatten. Die Schlussfolgerung war einfach: Wir hatten drei Stasiskammern bei uns, sie hatten keine.
Papa packte Loy und riss sie aus ihrer Suche nach Leben.
»Chester, du bist dran«, rief er und ging voran.
Die Felsspalte, in die wir uns herablassen sollten, schien keinen Boden zu haben. Die Wände waren jedoch voller Furchen, Aushöhlungen und Vorsprüngen, sodass man sich überall festhalten und auftreten konnte. Von oben drang nur wenig Licht zu uns.
»Kugelbahn, Ruske, Schreibzeug, Eierkuchen, Mama, Luftschloss, ein Raumschiff«, sagte Chester.
»Warum?«
Chester antwortete nicht.
»Wo sind wir?«, fragte ich.
»Suttaterra!«, sagte Papa.
»Was ist das?«
»Eine Sehenswürdigkeit.«
»Woher weißt du das?«
»Das steht hier.« Er tippte auf seine Karte.
Wir arbeiteten uns weiter nach unten. Loy machte die Kletterei Spaß. »Hü« und »Hopp« sang sie leise, wenn sie von einem Vorsprung auf den anderen sprang, während ich mich der Vorstellung hingab, dass unser neues Zuhause in der Nähe einer Sehenswürdigkeit lag.
Die Felswände kamen näher. Ich erkannte, dass eine Seite immer genau in die andere hineinpasste und wir einen riesigen Bruch durchquerten. An einer Stelle quoll dichter grauweißer Nebel aus der Tiefe und stieg langsam nach oben wie ein aufwärtsfließender Bach. Ich hielt einen Moment inne und sah zu, wie er die Aushöhlungen und Risse entlangkroch, immer weiter nach oben, bis er sich von den Felsen löste und sich mit den Schwaden vermengte, die ab einer gewissen Tiefe immer häufiger vorbeizogen.
Von irgendwoher war ein leises Rauschen zu hören. Ein umgekehrter Wasserfall aus Nebel, ein Nebelfall, dachte ich und freute mich über das Wort. Der Nebelfall von Suttaterra. Es half mir, diesem Anblick einen Namen gegeben zu haben, so wie zu Hause alles einen Namen gehabt hatte, bis der Weltraum gekommen war.
Wir stiegen unter einem großen Felsen hindurch, der später in den Spalt gestürzt sein musste und nun zwischen den Wänden eingeklemmt hing. Einen Boden unter uns konnten wir nicht erkennen. Stattdessen zeigte sich ein weiterer, kleiner Nebelfall, vielleicht ein Nebenarm, der hinter dem eingeklemmten Felsen vorbeiführte. Ich wollte ihn Papa zeigen, doch er war zu sehr damit beschäftigt, den Weg zu suchen und sich gleichzeitig etwas für seinen Koffer zu überlegen.
»Eine Kochmütze«, sagte er irgendwann.
Nachdem wir den Felsen passiert hatten, wurde die Umgebung immer dunkler, und wir mussten schauen, wo wir hintraten.
»Still!«, befahl Papa plötzlich.
Loy hörte sofort auf zu klettern, auch Chester und ich verharrten regungslos. Aber außer dem leisen Rauschen des Nebels war für mich nichts zu hören. Das schmerzhafte Kribbeln meiner Haut machte sich im Moment des Innehaltens sehr bemerkbar, vor allem dort, wo mein Rayser-Interstellar-Anzug eng anlag.
»Papa«, sagte ich.
»Sei leise!«, herrschte er mich an.
Jetzt hörte ich es auch. Da knirschten, wahrscheinlich nicht weit weg von uns, Sand und Steine. Die zwei, die uns folgten, schienen den Eingang in den Bruch gefunden zu haben.
»Papa«, flüsterte Loy. »Da!«
Sie zeigte auf eine dunkle Stelle über einem Felsvorsprung. Ihr Atem raste, ihre kleine Brust hob und senkte sich wie bei einem kleinen Tier in Todesangst.
»Da ist keine böse Echse«, sagte Papa, ohne hinzusehen, und stieg voraus. »Weiter!«
Wir folgten ihm, aber Loy blieb, wo sie war.
»Da«, wiederholte sie und zeigte ins Dunkle.
Ich versuchte, etwas zu erkennen, sah aber nichts.
»Da ist kein Amniot«, sagte ich.
»Seid still jetzt!«, befahl Papa und winkte uns zu sich her. Er hatte eine Felskante ausfindig gemacht, auf der wir gut weiterkommen konnten. Loy fiel es schwer, sich von dem zu lösen, was sie sah. Chester nahm ihre Hand.
Am Ende des Vorsprungs, der wie ein schmaler Balkon die rechte Wand des Spalts entlangführte, verlor sich der Weg in Aushöhlungen, in deren Tiefe an einigen Stellen Lichtpunkte zu sehen waren. Hier schien es wieder herauszugehen.
Papa prüfte etwas auf seiner Karte, dann steckte er sie weg.
»Hier lang.«
»Papa«, rief Loy, »da war –«
»Los jetzt.«
Wir tasteten uns in die Dunkelheit, nahmen die Kammern vom Rücken ab und schoben sie vor uns her. Da es plötzlich steil bergab ging, mussten wir sie festhalten, damit sie uns nicht wegrutschten. Chester passte einmal nicht auf. Knirschend setzte sich seine Kammer in Bewegung, rutschte unwiederbringlich den fernen Lichtern entgegen. Keiner von uns konnte etwas dagegen tun. Das Knirschen wurde leiser und leiser, einmal krachte es, dann verschwand die Kammer im untersten Licht.
Kurz verharrten wir alle.
Papa flüsterte: »Loy, du bist dran. Aber leise!«
»Ich packe meinen Koffer, und ich nehme mit: Kugelbahn, Ruske, Schreibzeug, Eierkuchen, Mama, Luftschloss, Raumschiff, Kochmütze und eine neue Stasiskammer für Chester.«
Wir krochen immer tiefer, auf die Lichter zu. Durch meine eigene Leichtigkeit und die Dunkelheit konnte ich schlecht einschätzen, wie steil der Boden unter uns tatsächlich war. Sicher schien nur, dass wir auf der Erde längst abgestürzt wären. Immer wieder lösten sich Steinchen und kleines Geröll, das mit uns in die Tiefe rieselte.
Wachsende Helligkeit drang durch die Löcher und Spalten zu uns herein, den größten Lichteinfall brachte eine Öffnung, die sich direkt unter uns auftat. Für einen Moment wurde mir schwindelig, als ich einen rostroten Sandboden, ein paar dunkelgraue Felsen und dazwischen Chesters verlorene Stasiskammer erkannte und das Ganze nicht, wie erwartet, vor mir lag, sondern weit unter mir.
Papa und Chester näherten sich mit Loy von hinten. Dadurch wurden wir zu schwer.
Der Boden knackte wie eine brechende Eisdecke, dann löste er sich unter uns auf, zerfiel zu schwarzem grobkörnigem Staub und auseinanderfallenden Brocken.
Ich krallte mich irgendwo fest. Es krachte, als sich weitere Teile des Gesteins lösten und in das fahle Licht stürzten, das von unten einfiel. Mit Schrecken sah ich Papa und Chester, wie sie mit den beiden übrigen Stasiskammern abstürzten, in einem Regen aus kleinen und großen Klumpen. Neben mir hörte ich Loy schreien, auch sie schien sich irgendwo festzuhalten, dann rutschte ich ab.
Es war ein langer, stummer Fall. Als ich unten aufschlug, schrie ich, da meine Haut so empfindlich war und mir alles wehtat, vor allem in der Tiefe des Kopfs. Ich landete neben Chesters verlorener Kammer. Durch die beschädigten Lamellen sickerte das Deutolecith heraus, floss über das Gestein und tropfte durch einen Spalt weiter nach unten. Keuchend folgte ich dem Rinnsal mit meinem Blick, aber nur so lange, bis ich wegsehen musste.
Der Boden, auf dem ich gelandet war, war kein wirklicher Boden. Durch Spalten und Risse erkannte ich einen weiteren Boden und darunter noch einen. Die Ebenen wurden sichtbar, wenn ich den Kopf bewegte und sie sich dadurch gegeneinander verschoben. Tiefere Gründe nannte man solche Stellen auf Perm, wie ich später erfuhr, bekannt, eine Art von Schwindel zu erzeugen.
Alle drei Kammern waren beschädigt. Papa war sichtlich bemüht, seinen eigenen Schwindel zu unterdrücken, während er versuchte, sie so aufzustellen, dass nicht noch mehr von dem Deutolecith verloren ging. Chester richtete sich neben mir auf und sah nach oben. Über uns war Loy, in fünf Meter Höhe, sie kauerte weinend am Rand des Durchbruchs, aus dem wir herausgefallen waren.
Die schiefergraue Felszunge, unter der wir standen, war riesig, ein gigantischer Überhang, der jedoch an manchen Stellen so tief kam, dass ich ihn hätte berühren können. Auf der Erde wäre so etwas längst eingestürzt, aber hier hielt es. Vorne, von wo das Dämmerlicht herkam, berührte das Gestein fast den Boden wie bei einer überschlagenden Welle, bei der im allerletzten Moment die Zeit stehen geblieben war.
»Spring!«, rief Papa zu Loy. »Es tut nicht weh!«
»Du lügst!«, schrie sie.
Sie hatte recht. Mir dröhnte nicht nur der Kopf, sondern auch die Knie, die Zehen und die Brust schmerzten, sogar meine Nase, weil sie gegen die Maske gestoßen war.
Papa ließ die Hände sinken. Ich sah ihm an, wie ihm die Kraft auszugehen schien. Aus allen drei Stasiskammern lief unsere letzte Nahrung aus und tropfte ins Bodenlose. An der Seite von Papas Maske leuchtete ein gelbes Licht, das vor wenigen Augenblicken noch grün gewesen war.
»Können wir sie irgendwie holen?«, fragte er leise.
Chester schüttelte den Kopf: »Da kommen wir nicht rauf!«
Papa atmete tief ein. »Wir können dich nicht holen, Loy! Du musst springen!«
»Wo ist Mama?«
»Sie kommt, wenn du springst!«
»Wirklich?«
Papa schwieg.
»Du lügst die ganze Zeit!«, schimpfte sie.
Ich brauchte einen Moment, bis ich verstand, was Loy da gesagt hatte, und wie so oft kam ich mir so vor, als hätte ich als Einziger nicht begriffen, was vor sich ging. Meine kleine Schwester war weiter als ich. Ihr war längst klar, dass kein Zuhause kommen würde, dass nichts und niemand hier auf uns wartete.
Mein Atem raste. Chester merkte es, nahm mich in den Arm und hüllte mich ein, wie er es lange nicht mehr gemacht hatte. Gleichzeitig sah er zu Loy hoch.
»Loy. Ich schwindle jetzt nicht: Es wird wehtun, wenn du hier unten auftriffst. Und ich kann dir auch nicht sagen, wo Mama ist.«
Loy nickte. »Und du, Papa? Kannst du mir das sagen?«
Papa schüttelte langsam den Kopf.
»Nein, Loy, ich weiß nicht, wo sie ist.«
Sie überlegte stumm, saß ruhig da. Dann fragte sie: »Papa? Was ist mit dem großen Abenteuer, das du versprochen hast?«
Papa sah für einen kurzen Augenblick auf seine Handschuhe, die leer laufenden Stasiskammern und die Blutschlieren, die das Deutolecith auf den Felsen hinterlassen hatte. Er zitterte am ganzen Leib.
»Das Größte, das du dir vorstellen kannst«, sagte er.
Daraufhin sprang sie, mit ausgebreiteten Armen. Die linke Faust hielt sie geschlossen.
Suttaterra
Wir verwischten die Spuren, so gut es ging, schoben Sand über das Deutolecith und kauerten uns zusammen mit den Stasiskammern in einen kleinen Hohlraum, der im Schutz des Überhangs lag und an einer Stelle in die tieferen Gründe führte.
Inzwischen blinkten alle unserer Masken auf Stufe Gelb. In Chesters Kammer befand sich der größte Rest Deutolecith. »Esst etwas!«, sagte Papa, während er die Abdeckung ihrer Seitenverkleidung aufhebelte.
»Warum?«, fragte Chester.
Ich hatte zwar Hunger und Durst, wollte aber auf keinen Fall noch einmal etwas von dem Zeug trinken, auch wenn es sättigte und scheinbar alles beinhaltete, was der Mensch zum Leben braucht. Es war zähflüssig und schmeckte nach rohem Eiweiß, außerdem hatte Chester drin gelegen.
Ich hielt Papa meinen Arm mit dem Portanschluss hin.
»Geht’s auch so?«
»Keine Zeit.«
Papa schob seine Hand durch die Lamellen von Chesters Kammer und schöpfte etwas Gel aus dem wenigen Bodensatz, der noch geblieben war.
»Gib mir deinen Teller!«, befahl er Chester.
»Aber –«
»Gib mir deinen Teller!«
Chester begriff. Er streckte seinen Arm zu ihm hin, formte seine Hand zu einer Mulde, und Papa goss ihm etwas Gel in den Handschuh.
»Guten Appetit!«
Chester öffnete das Trinkschlauchventil am Mundstück seiner Maske und saugte die Flüssigkeit ein.
»Äußerst vorzüglich«, sagte er.
Papa schöpfte erneut aus der Kammer und hielt sie Loy hin.
»Ich mag nicht, Papa«, sagte sie leise.
»Du hast Hunger.«
Loy sah ihn flehend an. Aber als sie einsah, dass sie Hunger hatte, reichte auch sie ihm ihre Hand.
»Was gibt es?«
Papa versuchte sich an einem Lächeln. Er legte seine Hand auf den Rücken wie ein Kellner, beugte sich vor und sagte: »Echse im Loch, Mylady. Mit Ei und Kartoffeln.«
»Hui«, murmelte Loy und begann zu schlürfen. Papa fischte eine kleine Bose-Membran aus der Seitenverkleidung von Chesters Kammer und setzte sie zusammen.
Ich konnte nicht lange zuschauen, wie die anderen aßen. Also machte ich mit, auch wenn es nicht schmeckte. Wir rutschten zusammen, sodass sich unsere Arme manchmal berührten.
Loy aß langsam. »Will jemand noch Echse?«
»Wenn du so fragst«, sagte ich und hielt ihr meine Hand hin.
Papas Maske leuchtete inzwischen rot. Unsere blinkten weiterhin gelb, aber es war nur eine Frage von Minuten, bis sie auf Rot umschalten würden. Uns blieb nicht mehr viel Zeit. Als Chesters Kammer leer war, gingen wir zu den Resten in Loys Kammer über. Sie enthielt, laut Papa, ein ausgezeichnetes Amnioten-Curry.
»Wann gehen wir weiter?«, fragte sie.
»Wenn wir wieder Luft haben.«
Papa war dabei, die Energieversorgung seiner Stasiskammer so einzustellen, dass er mit Hilfe der Bose-Membran Sauerstoff aus der Luft sieben und ihn den Ladetanks zuführen konnte. Der Inhalt der Tanks war durch unseren Absturz aus dem Felsüberhang automatisch verpufft, um eine mögliche Explosion zu vermeiden.
»Und wenn wir Luft haben, schauen wir, wo Mama bleibt«, sagte Loy. Sie spielte mit etwas herum, das sie hinter ihrem Rücken verborgen hielt.
»Was hast du da?«, fragte Chester.
»Nichtsnichts.«
Papa sah zu uns auf. »Seid ihr alle satt?«
Wir nickten.
»Gut.«
Er stöpselte die Trinkschläuche unserer Masken ab und entfernte die Ventile, um mit ihnen die Ladetanks neu zu bestücken. Dann rammte er Raumtrenner in den Boden, sodass die Membran nicht durch uns hindurchging.
Ich wusste, was das hieß. Durch Aufnahmen, die mir Chester einmal gezeigt hatte, habe ich gesehen, was Bose-Membranen mit menschlichen Körpern anrichten konnten. Drei Nächte hatte ich danach bei Mama geschlafen, und sie hatte Chester das Taschengeld für drei Monate gestrichen.
»Achtung«, sagte Papa. »Ohren zuhalten!«
Wir taten wie befohlen.
Der Krach war dennoch ohrenbetäubend. Materie, aus ihrem natürlich angestammten Platz im Raum gerissen, lässt das nur unter einem schrecklichen Geheul mit sich machen.
»Verdammt!«, fluchte Papa, als der Krach abrupt aussetzte und alle Leuchten der Stasiskammer erloschen. Er prüfte den Energiestatus von Loys Kammer, dann Chesters und nickte. »Besser als nichts.«
»Was?«, fragte Loy.
»Halt die Luft an und komm mit deiner Maske her.«
Sie gehorchte. Er verband sie mit dem Tank und füllte sie so weit auf, dass die Anzeige auf Grün sprang. Es zischte leise, als er den Schlauch abzog.
»Jetzt du, Henry!«
Ich ging auf die Knie und näherte mich auf allen vieren wie ein Tier, das zu einer Tränke kommt. Bei mir stoppte er den Ladevorgang bei Gelb, da der Tank schon wieder fast leer war.
Chesters Gesichtsausdruck war schrecklich, als er an der Reihe war. Papa füllte die gesamte restliche Luft in Chesters Maske, es war deutlich zu hören, wie wenig es war.
»Wir teilen sie auf«, sagte er.
Chester hatte Tränen in den Augen. Auch wenn er es als großer Bruder gewohnt war, abgeben zu müssen.
»Jetzt suchen wir Mama«, sagte Loy. »Sie muss ja irgendwo sein.«
Die rote Kontrollleuchte von Papas Maske begann zu blinken. Er hatte nicht mehr lange Luft.
»Sie ist nicht hier, Loy«, sagte er leise.
»Warum?«
»Weiß ich nicht.«
Loy sah ihn durchdringend an. Sie schien zufrieden, dass er die Wahrheit gesagt hatte. »Aber sie kommt später. Das kennen wir doch.«
Papa nickte langsam. Sein Blick wanderte langsam zu ihr. »Du hast recht. Manchmal war es spät.«
»Oft, nicht nur manchmal«, sagte Chester.
Loy tippte auf dem kleinen Geheimnis in ihrem Handschuh herum.
»Papa?«
»Ja?«
»Ist sie trotzdem immer zu mir reingekommen? Auch wenn ich schon geschlafen habe?«
»Ja.«
Loy lächelte. Das Blinken von Papas Maske wurde schneller. Chester weinte, griff nach Papas Arm und wollte sich an ihn drücken, aber der schob ihn sanft von sich weg.
»Übrigens«, sagte Loy und holte etwas hinter ihrem Rücken hervor. »Henry, für dich!«
In ihrer Faust hielt sie einen Strauß vertrockneter Gräser und verblühter Halme, den sie mir mit einem frechen Lächeln hinhielt, als wären es die schönsten Blumen der Welt.
»Alles Gute zum Geburtstag!«
»Oh, wie schön!«, rief ich.
Die Stängel waren schlaff und beinahe durchscheinend dünn, alles hing nach den Seiten herunter. Papa erstarrte.
»Wo hast du das her, Loy?«
»Das war am Weg.«
»Hast du noch mehr?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nur das. Aber es gab noch mehr. Ich hab Leben gefunden!«
»Wo?«
»In dieser Schlucht. Da, wo der Mensch stand.«
Papa und Chester zuckten zusammen.
»Welcher Mensch?«
»Weiß ich doch nicht, Papa. Der stand da, wo es ganz dunkel war. Wo dieser Dampf hochkam, bei dem großen Felsen. Er war ganz ruhig, hat sich überhaupt nicht bewegt.«
»Hatte er eine Maske auf?«
»Nein, ich glaub nicht.«
»Warum hast du nichts gesagt?«
»Ich sollte leise sein!«
Papa schien wie aus einem bösen Traum aufzuwachen. Er zog seine Karte hervor und wollte sie einschalten, aber sie hatte, wie alles andere, keine Energie mehr.
Von draußen drang plötzlich ein Knirschen zu uns, kurz darauf Stimmen.
»Oh Gott«, flüsterte er. Er musste uns nicht sagen, dass wir leise zu sein hatten.
Es war aufgrund der fremden Luft schwer einzuschätzen, wie nah die Schritte kamen, die nun zu hören waren. Ich hoffte, dass wir unsere Spuren ausreichend verwischt hatten. Im Grunde genügten eine kleine abgerissene Lamelle und ein übersehener Deutolecith-Fleck im Sand, um eine Linie direkt zu uns ziehen zu können.
Einmal wurden die Schritte leise, verschwanden aber nicht ganz, sondern kamen zurück, unabwendbar wie eine Brandung. Sie schienen nun direkt auf uns zuzukommen, irgendetwas musste uns verraten haben.
Papas Maske blinkte im Warnmodus. Er ging vor uns auf die Knie und bedeutete uns, da zu bleiben, wo wir waren. Chester weinte immer noch, wollte sich an ihn drücken, aber Papa schob ihn von sich weg.
Die Schritte verstummten.
Draußen wurde gehorcht, abgewartet.
Wir hörten alle vier auf zu atmen.
Dann knirschte es noch einmal.
»Sie haben etwas, das Ihnen nicht gehört, Mr Meadows.«
Papas Augen weiteten sich. Er bedeutete uns, still zu sein und den Blick auf die Felswand zu richten. Dann erhob er sich langsam und nahm einen Stein in die Hand. Bevor er mit ihm die Höhle verließ, zeigte er noch einmal auf die Höhlenwand und wartete, bis wir alle drei gehorchten.
Ich fixierte die poröse schwarze Felswand vor meiner Nase, Chester und Loy taten es mir gleich.
Papas Schritte entfernten sich.
Heute war mein Geburtstag.
Wir hatten ihn nur noch nicht gefeiert, weil es bei unserer Ankunft noch dunkel gewesen war. Doch jetzt begann ein Tag, denn ein immer stärker werdendes Leuchten ließ unsere Schatten auf den Felsen sichtbar werden.
Ich unterdrückte den Impuls, hinter mich zu blicken, um die ersten Strahlen einer fremden Sonne zu sehen. Das Leuchten eines anderen Sterns, jetzt so nah, dass es uns wärmen konnte. Und wer wusste, wie lange das Leuchten blieb, wie lange dieser Tag dauern würde? Auf Perm gab es nicht die Tage, wie wir sie von der Erde her kannten. Wenn dies mein Geburtstag war, konnte er sechzig Stunden dauern, wenn es gut lief, oder nur drei, wenn ich Pech hatte. Mir war, als hätte Chester einmal sogar etwas von vierzigstündigen Perm-Tagen erzählt, mit Unterbrechungen von etwas, das er die »Tiefnächte« genannt hatte. Ganz sicher war ich mir aber nicht mehr.
Von irgendwoher kamen ein Klirren und ein Schrei.
Das Licht schien warm auf meinen Rücken. Eigentlich war heute der Geburtstag aller, die hierhergekommen waren. Denn was zählten hier die Tage und Jahre, die wir mitgebracht hatten?
Wieder Schritte.
Auch wenn ich niemals hätte beschreiben können, wie Papas Schritte klangen, so wusste ich doch, dass diese nicht die seinen waren.
Ein scharf umrissener Schatten erschien auf der Felswand, verharrte eine Weile regungslos. Der Satz, der dann geflüstert wurde, gehetzt, leise und angsterfüllt, galt nicht uns.
»Ich hab auch ein Kind.«
Bewegung kam in den Schatten, er wanderte hastig durch den Raum, dann wurde an unseren zerstörten Stasiskammern gerüttelt und geflucht.
Wir blieben trotz allem so, wie wir waren, hielten unsere Gesichter auf die Felswand gerichtet. Aber gegen meinen Tick konnte ich nichts tun, mein Blick zuckte zur Seite, ob ich es wollte oder nicht. Immer wenn »es mich hatte«, wie Chester es nannte, sah ich Details.
Die Ecken der Namensplaketten auf den Stasiskammern waren abgerundet, schimmerten wie Silber im Licht des hereinfallenden Morgens. Die Gravur der Schrift war schwarz, dadurch konnte ich sie gut lesen, wenn ich die Sekundenbruchteile, in denen ich immer wieder hinsah, zusammenbrachte.
Chester Meadows
Loy Meadows
Ferenc Weiner
Eine Hand legte sich auf meine Schulter und riss mich herum. Ich konnte nur einen kurzen Blick in das verwirrte Gesicht eines bärtigen Mannes werfen, bevor dieser meine Maske packte und zur Seite drehte, um den Füllstand prüfen zu können. Als er festgestellt hatte, dass er nur noch auf Gelb stand, machte er das Gleiche bei Loy und schließlich bei Chester. Er blutete an der Stirn.
»Ich hab ein Kind«, sagte er noch einmal, bevor er Loy die grün leuchtende Maske vom Kopf nahm.
»Wechselt euch ab. Es ist nicht mehr weit. Ich hab’s schon gesehen.«
Dann verschwand er so schnell, wie er aufgetaucht war.
Chester begriff die Situation zuerst. Er nahm seine Maske ab, damit Loy einen Atemzug nehmen konnte.
Vor der Höhle fanden wir Papa.
Er lag zusammengekrümmt auf dem grauen Felsboden und blutete am Kopf. Von den Fremden fehlte jede Spur. Chester stürzte zu ihm hin und presste ihm meine Maske auf den Mund.
Papa atmete, rührte sich aber nicht.
»Papa!«, schrie Chester und rüttelte an ihm. »Papa!«, schrie er immer wieder. Auch Loy und ich packten seine Schultern und versuchten, ihn wach zu rütteln. Aus Angst vergaßen wir, uns mit den Masken rechtzeitig abzuwechseln, ein böser Schmerz schoss in meine Kehle, ich musste husten und spürte, wie meine Finger wieder taub wurden.
Chester gab mir eine Maske. Ich nahm ein paar tiefe Atemzüge und wollte sie ihm wieder zurückgeben, als ich plötzlich einen seltsamen Impuls spürte, der durch meinen ganzen Körper ging und wie statische Elektrizität in meinem Nacken knisterte.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Da!«, sagte Loy und zeigte in einen Felsspalt, der zu einem der tieferen Gründe führte. »Ein bissiger Amniot.« Steinchen lösten sich wie von unsichtbarer Hand und rieselten in die Tiefe. Ich konnte nichts erkennen.
»Wir müssen hier weg«, flüsterte Chester.
Es war mehr eine gespürte als eine gewusste Wahrheit. Chester griff Papa unter den Armen und begann, ihn in Richtung des grellen Morgenlichts zu ziehen, das in den Überhang hineinschien. Loy und ich fassten Papa an den Seiten. Er war leicht, wir konnten ihn anheben.
»Da!«, rief Loy plötzlich und zeigte auf einen Felsen, der neben ihr aufragte. »Glaube ich!«
Ich sah hin, aber erst als ich wieder wegsah, erkannte ich, für den Bruchteil einer Sekunde, eine kleine Gestalt wie eine optische Täuschung, die mit dem Hintergrund verschmolz.
»Oh Gott«, rief Chester.
Auf Papas Anzug bildeten sich rote Flecken, an den Beinen ging es los, kurz darauf erschienen die ersten auf seinem Bauch und dann auf der Brust. Es sah aus, als würden Hunderte winzige, unsichtbare Nadeln auf ihn einstechen.
Chester zerrte Papa mit Gewalt in Richtung des Lichts, immer mehr Stellen seines Anzugs färbten sich rot. Die Ursache war nicht zu sehen, da war nur ein kaum merkliches zitterndes Flirren wie eine Sehstörung, die beißen konnte.
Plötzlich stieß Papa einen Schrei aus, der Schmerz schien ihn geweckt zu haben. »Helft mir doch!«, rief Chester.
Papas Wachwerden löste meine Schockstarre, in die ich nach dem Anblick des Blutes geraten war. Gemeinsam zerrten wir ihn weiter zum Licht, wichen dabei einem Schlund aus, der in die Tiefe führte, versuchten, nicht auf die seltsamen Laute zu achten, die Papa ausstieß, und kämpften uns ins Licht. Wäre nicht alles so leicht auf Perm und würde Papa hier nicht nur so viel wiegen wie ein Sack Wäsche, hätten wir ihn niemals aus der Höhle herausbekommen.
Wir erreichten das vordere Ende der Überhänge, fanden eine Stelle, an der wir auf Knien darunter hindurchkriechen konnten, und zogen Papa hinter uns her.
Das Licht, das uns draußen empfing, war bedrohlich hell, es zwang mich, meine Augen zuzukneifen, den Blick zu senken und nach unten zu sehen. Hätte ich das nicht getan, wären mir die vielen kleinen Spuren entgangen, die sich in diesem Moment im Sand bildeten und zurück in den Schutz der Dunkelheit führten. Noch einmal spürte ich, wie sich die Haare auf meinen Armen aufstellten und das Knistern im Nacken. Was immer Papa angegriffen hatte, es war verschwunden und schien das grelle Licht zu fürchten, in das wir hinaustraten.
»Man spürt sie nur«, sagte Loy leise. »Aber man sieht sie nicht.«
Chester fiel Papa um den Hals und drückte ihn an sich. Dann entsann er sich und presste ihm seine Maske aufs Gesicht. Papa stöhnte immer noch vor Schmerzen, aber er lebte, atmete, nahm einen tiefen Atemzug und stand auf.
»War nicht Henry dran?«, fragte er.
Kartographie
Tag 0 der Impulsmission
Nun bin ich hier und staune.
Wenn die Windleite hochsteht und die Sonne, ich nenne sie der Einfachheit halber so, hinter ihr hervorbricht, ergießt sich ihr Licht ohne Verzögerung und wie aus einem übervollen Kübel auf Länder und Meere. Es dauert nur Sekunden, und die finsterste Nacht weicht einem Mittag, der ein gleißendes Licht auf die Wunder dieser Welt wirft. Unser neuer Heimatstern ist vergleichsweise kalt, steht Perm aber näher als die Sonne der Erde. Solchen Morgen sind die menschlichen Augenlider nicht gewachsen, sie sind zu dünn für diese Helligkeit. Wenn du schaust, ist es, als hättest du pupillenerweiternde Tropfen bekommen.
Gespenstisch und schön sind die Landschaften, über die wir fliegen. Perm ist nur halb so groß wie die Erde, doch die Gebirge türmen sich vielerorts fast zur doppelten Höhe auf, manche Gipfel liegen, wenn man so will, im Weltraum.
Die Küsten sind noch jung und wenig geschliffen. Das türkisfarbene Meer schlängelt sich in spitzigen Buchten und Fjorden weit ins Land. An windstillen Morgen plätschert und gluckst es im löchrigen Gestein, doch in der Nacht überspült es alles mit wilder Rücksichtslosigkeit und wirft weißen Schaum um sich. Manchmal trägt der Sturm den Schaum kilometerweit ins Land, wo er wie Schnee auf den Wipfeln der Stammfarne, Aglaphyten und Schuppenbäume liegen bleibt.
Dem ungeübten Auge erschließt sich die Vegetation nicht sofort. Die Bäume bilden noch keine Wälder, sie konkurrieren noch nicht ums Licht. Zudem ermöglicht ihre geringe Schwere seltsam freiwüchsige Strukturen, die entfernt an Wasserpflanzen erinnern. Die Stämme scheinen biegsam zu sein und verzweigen sich vor allem nach unten hin, um an mehreren Stellen mit dem Boden in Kontakt zu kommen, aus bisher unbekanntem Grund. Holz ist, entgegen landläufiger Meinung, also doch nicht der seltenste Rohstoff des Universums. Die Böden der vielen Schluchten, in denen kaum Tageslicht fällt, sind mit moosigen Arten bedeckt, die sich auf das reflektierte Licht der Windleite eingestellt haben, vielleicht ist »Nachtschatten« ein guter Name.
Sie bedecken auch die Böden der unzähligen Krater, von denen die Kontinente übersät sind. Die Atmosphäre Perms ist noch jung, die volle Schutzwirkung gegen Einschläge aus dem Weltraum besteht noch nicht lange. Es gibt keinen Ort, wo es keine gibt, manche sind riesig im Durchmesser, andere könnten mit einer einzigen Handbewegung zugeschüttet werden.
Über allem steht die Windleite. Sie verdeckt den halben Himmel. Ich habe so etwas immer wieder auf Bildern gesehen, vor allem auf den Anzeigen von Rayser-Interstellar: eine Landschaft und darüber eine weitere Welt. Aber es ist etwas anderes, hier zu sein.