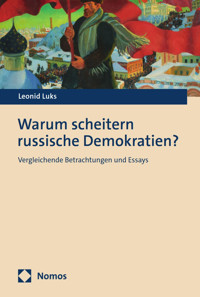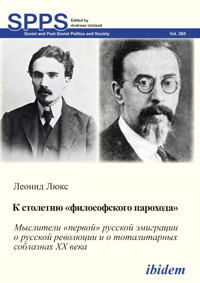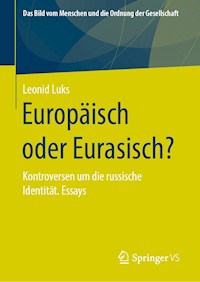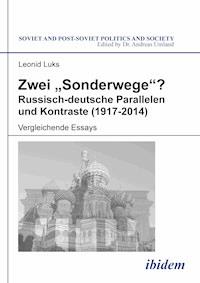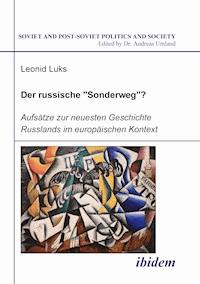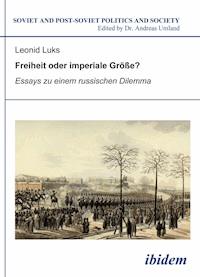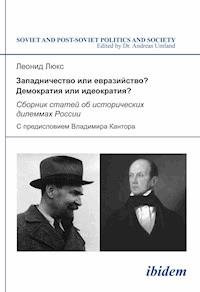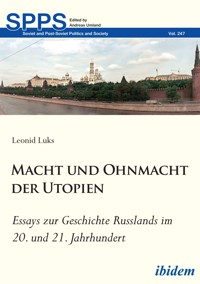
Macht und Ohnmacht der Utopien: Essays zur Geschichte Russlands im 20. und 21. Jahrhundert E-Book
Leonid Luks
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Soviet and Post-Soviet Politics and Society
- Sprache: Deutsch
Im Oktober 1917 errichteten die Bolschewiki in Russland das erste totalitäre Regime der Moderne, den ersten Staat, der die von Marx und Engels bereits im „Manifest der Kommunistischen Partei“ entwickelte Utopie zu verwirklichen suchte. Diese Utopie stellte auch die wichtigste legitimatorische Grundlage des von den Bolschewiki errichteten Systems dar. Denn auf eine demokratische Legitimation hatten sie verzichtet, als sie am 19. Januar 1918 die russische Konstituante mit ihrer nichtbolschewistischen Mehrheit gewaltsam auseinanderjagten. 70 Jahre später erlebte indes die bolschewistische Vision von der „lichten kommunistischen Zukunft“ eine gänzliche Erosion. So gut wie niemand nahm sie noch ernst – weder die Herrscher noch die Beherrschten. Das nun entstandene legitimatorische Vakuum konnte nur durch die Rückkehr der demokratischen Institutionen gefüllt werden, die die Bolschewiki kurz nach ihrer Machtübernahme von der politischen Bühne Russlands verjagt hatten. Dies ist in der Gorbatschow-Periode auch teilweise geschehen. Der Versuch der kommunistischen Dogmatiker, diesen Prozess rückgängig zu machen, scheiterte im August 1991 kläglich. Aber einige Jahre später verspielten auch die siegreichen Demokraten weitgehend ihr Vertrauenskapital. Damals begann man in Ost und West wiederholt, Parallelen zwischen der Weimarer Republik und dem postsowjetischen Russland zu ziehen. Diesen Entwicklungen sind die Beiträge des vorliegenden Bandes gewidmet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Macht und Ohnmacht der Utopien. Einleitende Bemerkungen
I. Zwischen Reform und Revolution – Die Dämmerung des Zarenreiches
Triumph oder Scheitern? Einige Betrachtungen zum „Orden“ der russischen Intelligencija anlässlich des 100. Jahrestages der russischen Revolution
Sergej Vitte vs. Konstantin Pobedonoscev – die russische Selbstherrschaft um die Jahrhundertwende zwischen Reform und Gegenreform
II. Die russische Revolution als epochale Zäsur
Die Entzauberung des russischen Revolutionsideals – einige Bemerkungen zum Sammelband De profundis
Utopie und Terror – warum blieben die Bolschewiki an der Macht?
III. Stalin und der Stalinismus
Stalins „Bauernkrieg“. Zum 90. Jahrestag der Kollektivierung der Landwirtschaft in der UdSSR
Der Stalin-Kult und der „Große Terror“ (1934–1938)
Vasilij Grossmans Roman Leben und Schicksal und die Paradoxien des sowjetischen Sieges über das Dritte Reich
Stalin und die jüdische Frage – Brüche und Widersprüche
IV. Die Dämmerung des Sowjetreiches
Chruščev–Gorbačev: „Tauwetter“ oder Reformpolitik? Ein politischer Strukturvergleich
Zur Renaissance des authentischen politischen Diskurses in der nachstalinschen Sowjetunion am Beispiel der sowjetischen Dissidentenbewegung
Abschied vom Leninismus – Zur ideologischen Dynamik der Perestrojka
Die friedlichen Revolutionen von 1989 aus der Sicht von Michail Gorbačev
Woran scheiterte die UdSSR? Zur Auflösung der Sowjetunion vor 25 Jahren
V. Das postsowjetische Russland
Die „gekränkte Großmacht“: Russland nach dem Krimkrieg und nach der Auflösung der Sowjetunion – eine vergleichende Skizze
„Weimarer Russland?“ – zur Erosion der „zweiten“ russischen Demokratie nach 1991
Putins Macht und Ohnmacht: Betrachtungen anlässlich der neuesten Forbes-Liste der mächtigsten Persönlichkeiten der Welt
Zur Tragik der Reformer. Anlässlich der Ermordung des russischen Regimekritikers Boris Nemcov
VI. „Russland jenseits der Grenzen“
Anmerkungen zur ideengeschichtlichen Entwicklung der „ersten“ russischen Emigration am Beispiel der Eurasierbewegung und der Gruppe Novyj Grad – eine Skizze
Verwirklicht Vladimir Putin das ideologische Vermächtnis der „weißen“ Emigranten?
VII. Repliken
Ist Russland eine europäische Macht? Anmerkungen zu einer Kontroverse
Defensiv und alternativlos? Moskaus außenpolitisches Handeln aus der Sicht Gerhard Schröders und Gregor Schöllgens
Statt eines Nachworts: Der schwere Abschied von der totalitären Vergangenheit. Zum dreißigsten Jahrestag des Moskauer Augustputsches
Soviet and Post-Soviet Politics and Society
Impressum
ibidem-Verlag
Macht und Ohnmacht der Utopien. Einleitende Bemerkungen
Im Oktober 1917 errichteten die Bolschewiki in Russland das erste totalitäre Regime der Moderne, den ersten Staat, der die von Marx und Engels bereits im „Manifest der Kommunistischen Partei“ entwickelte Utopie zu verwirklichen suchte. Dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass dieser Vorgang sich in einem Land ereignete, in dem er aus der Sicht der Klassiker des Marxismus gar nicht stattfinden konnte, weil das Industrieproletariat dort nur ein winziges Segment der Bevölkerung darstellte. So widersprach die russische Revolution von 1917 in eklatanter Weise dem klassischen Satz von Karl Marx: „Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt, ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.“ Diese Revolution hatte sich aber in erster Linie nicht im „Sein“, sondern im „Bewusstsein“, also in den Köpfen angebahnt, und zwar in den Köpfen der russischen Intelligencija – einer Schicht, die weder Maschinen noch Werkzeuge, sondern nur Ideen produzierte. Es gelang dieser zahlenmäßig recht unbedeutenden Gruppe, eine gewaltige Monarchie zu erschüttern und erheblich zu ihrem Sturz beizutragen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sie mit ihrem Glauben an die erlösende Kraft der Revolution den öffentlichen Diskurs im Zarenreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts in einem immer stärkeren Ausmaß zu dominieren begann. Diejenigen, die diesen Glauben nicht teilten, wurden geächtet und in die Kategorie der „Feinde des Volkes“ eingereiht, wie dies der russische Philosoph Semen Frank hervorhebt. Der Auseinandersetzung der revolutionären Intelligencija mit dem Zarenregime und den Versuchen der zarischen Bürokratie, die revolutionäre Gefahr in Russland einzudämmen, ist der erste Abschnitt dieses Bandes gewidmet (Kapitel I).
Zu den erfolgreichsten Vertretern des „Ordens“ der revolutionären russischen Intelligencija gehörten die Bolschewiki. Dies nicht zuletzt deshalb, weil ihnen die von Lenin konzipierte „Partei neuen Typs“ zur Verfügung stand. Diese zentralisierte und straff disziplinierte Organisation war ein Novum in der Geschichte der politischen Parteien, und zwar nicht nur in Russland. „Gebt uns eine Organisation von Revolutionären und wir werden Russland aus den Angeln heben“, schrieb Lenin 1902 in seiner programmatischen Schrift Was tun? – ein Jahr vor der Gründung der bolschewistischen Partei. 15 Jahre später ging Lenins Wunsch in Erfüllung. Die von ihm gegründete Partei hob Russland in der Tat aus den Angeln und wurde zum Alleinherrscher in einem Riesenreich, wenn man von dem kurzen Intermezzo absieht, als die Bolschewiki eine Koalition mit den Linken Sozialrevolutionären eingingen. Zu ihrem wichtigsten Ziel erklärte die alleinherrschende Partei die Verwirklichung der Marxschen „Utopie“ von einer neuen, nie dagewesenen Gesellschaft. Diese Vision stellte auch die wichtigste legitimatorische Grundlage des von den Bolschewiki errichteten Systems dar. Denn auf eine demokratische Legitimation hatten sie verzichtet, als sie am 19. Januar 1918 die russische Konstituante mit ihrer nichtbolschewistischen Mehrheit gewaltsam auseinanderjagten.
70 Jahre später erlebte indes die bolschewistische Vision von der „lichten Zukunft“ eine gänzliche Erosion. So gut wie niemand nahm sie noch ernst – weder die Herrscher noch die Beherrschten. Das nun entstandene legitimatorische Vakuum konnte nur durch die Rückkehr der demokratischen Institutionen gefüllt werden, die die Bolschewiki kurz nach ihrer Machtübernahme von der politischen Bühne Russlands verjagt hatten. Dies ist in der Gorbačev-Periode auch geschehen. Die entmündigte Bevölkerung meldete sich wieder zu Wort, verwandelte sich vom Objekt der Manipulation durch die Führung in ein politisches Subjekt. Der Versuch der kommunistischen Dogmatiker, diesen Prozess rückgängig zu machen, scheiterte im August 1991 kläglich. In der Auseinandersetzung zwischen der unpopulären Macht und der machtlosen Popularität erwies sich die letztere als überlegener Sieger. Aber einige Jahre später verspielten auch die siegreichen Demokraten weitgehend ihr Vertrauenskapital. Die von vielen Russen als Trauma empfundene Auflösung der Sowjetunion, die wirtschaftliche Schocktherapie, die den Lebensstandard der Bevölkerung zunächst beinahe halbierte, und der immer schärfer werdende Konflikt zwischen dem im Juni 1991 gewählten Staatspräsidenten Boris El’cin und dem Obersten Sowjet, der im Oktober 1993 zu bewaffneten Auseinandersetzungen in der russischen Hauptstadt führte, trugen erheblich zur Diskreditierung der demokratischen Idee bei. Damals begann man in Ost und West wiederholt, Parallelen zwischen der Weimarer Republik und dem postsowjetischen Russland zu ziehen. Mit den Ursachen für den Aufstieg und das Scheitern der bolschewistischen Diktatur sowie der Erosion der „zweiten“ russischen Demokratie, die im August 1991 nach der Entmachtung der KPdSU errichtet worden war, befassen sich die Beiträge des zweiten Abschnitts des Buches (Kapitel II-V).
Der nächste Abschnitt des Buches (Kapitel VI) wird auf die politisch-ideologischen Diskurse der Verlierer des russischen Bürgerkrieges – der russischen Emigranten – eingehen. Welche Lehren zogen die Gegner der Bolschewiki aus ihrer Niederlage, wie bewerteten sie die Ursachen und die Folgen der russischen Revolution, wie reagierten sie auf die immer tiefer werdende Krise der europäischen Demokratie in der Zwischenkriegszeit? Diese Fragen werden im Mittelpunkt des Kapitels stehen.
Der Abschnitt „Repliken“, der diesen Band abschließt, befasst sich mit dem „schwierigen Verhältnis“ zwischen Russland bzw. der UdSSR und dem Westen sowie mit der Debatte über die Zugehörigkeit Russlands zu Europa, die seit Jahrhunderten sowohl im Westen als auch in Russland intensiv geführt wird.
Der vorliegende Band enthält Texte, die den Charakter von Essays und Skizzen haben und keinen Anspruch auf eine erschöpfende Beantwortung der gestellten Fragen erheben. Hier soll lediglich eine Annäherung an die Thematik versucht werden. Da dieser Band aus einer Reihe eigenständiger Texte besteht, die bereits an anderer Stelle veröffentlicht wurden, enthält er zuweilen Wiederholungen, die kaum zu vermeiden waren.
Russische Namen und Begriffe werden in diesem Buch transliteriert. Zur Transliteration des russischen Alphabets siehe Duden, Band 1, Mannheim u.a. 1996, S. 86. Abschließend möchte ich mich noch bei Frau Dr. Marina Tsoi für die technische Betreuung dieses Bandes herzlich bedanken.
I. Zwischen Reform und Revolution – Die Dämmerung des Zarenreiches
Triumph oder Scheitern? Einige Betrachtungen zum „Orden“ der russischen Intelligencija anlässlich des 100. Jahrestages der russischen Revolution1
Ein unübersetzbarer Begriff
Kaum eine andere gesellschaftliche Formation Russlands wurde im innerrussischen Diskurs zum Gegenstand so vieler emotionaler Kontroversen wie die im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts entstandene revolutionäre Intelligencija. Aber auch für viele westliche Autoren stellte die Intelligencija ein Faszinosum dar, und zwar sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Die Tatsache, dass der Begriff „Intelligencija“ in westliche Sprachen nicht übersetzbar ist und dort lediglich als Terminus technicus verwendet wird, zeigt, dass es sich bei der Intelligencija um ein spezifisch russisches Phänomen handelt.
Da die Intelligencija bei der Entstehungsgeschichte der russischen Revolution, deren Ausbruch sich nun zum 100. Mal jährt, eine eminent wichtige Rolle spielte, muss man bei der Analyse dieses epochalen Ereignisses auch der Intelligencija einige Aufmerksamkeit widmen.
Die historische Forschung hatte schon immer Schwierigkeiten mit der Definition des Begriffs „Intelligencija“, denn es handelte sich bei ihr weder um eine soziale Schicht noch um eine politische Partei. Sie rekrutierte sich aus vielen gesellschaftlichen Gruppen, politisch waren darin höchst unterschiedliche Orientierungen vertreten. Die Klammer, die alle verband, bestand lediglich in der radikalen Ablehnung der bestehenden Verhältnisse und im Glauben an die heilende Kraft der Revolution. In Anlehnung an solche russischen Denker wie Semen Frank oder Georgij Fedotov kann man die Intelligencija als eine Art „Orden“ bezeichnen. Ihre Regeln waren zwar ungeschrieben, dennoch standen sie an Rigidität den katholischen Mönchsorden kaum nach. Die Aufnahme in die „Gesellschaft der Eingeweihten“ war mit vielen Auflagen verbunden, die Abtrünnigkeit wurde mit öffentlicher Ächtung bestraft.
Ost-westliche Asymmetrien
Es ist in diesem Zusammenhang interessant zu bemerken, wie grundlegend sich die Entwicklung Russlands seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts von derjenigen des Westens unterschied, wie asynchron sich diese beiden Teile des Kontinents von nun an bewegten. So erlebten die westlichen Gesellschaften seit dem Scheitern der Revolution von 1848 einen immer stärkeren Integrations- und Konsolidierungsprozess. Die nationalistische Ideologie wurde dabei zu einer Klammer, die immer breitere Bevölkerungsschichten von den inneren Konflikten ablenkte. Sogar die Arbeiterparteien, die sich am längsten gegen den nationalistischen „Bazillus“ wehrten, gaben letztendlich, wie bekannt, ihren prinzipiellen Widerstand gegen dieses „bürgerliche Vorurteil“ auf und begannen 1914 mit dem Strom zu schwimmen. Durch die Einreihung der Arbeiterschaft in die jeweilige „nationale Front“ (Italien gehörte hier zu den wenigen Ausnahmen) wurden die wichtigsten Voraussetzungen für die Entfesselung eines „Kriegs der Völker“ geschaffen.
Wie anders verlief die Entwicklung Russlands! Die Revolution von 1848/49 ließ das Land praktisch unberührt, deshalb blieb dort auch die Enttäuschung über die revolutionäre Idee aus. Während viele der früheren Revolutionäre im Westen ihre Heilserwartungen immer stärker mit der Nation verknüpften, begann in Russland erst jetzt das revolutionäre Ideal zur vollen Geltung zu gelangen. Jede Kritik daran habe die Intelligencija als einen Verrat angesehen, schrieb 1924 der bereits erwähnte russische Philosoph Frank. Es habe im vorrevolutionären Russland einer ungewöhnlichen Zivilcourage bedurft, um sich offen zur Politik der Kompromisse zu bekennen.2 Was in diesem Zusammenhang verwundert, ist die Tatsache, dass die Intelligencija sich ausgerechnet in der Herrschaftsperiode des reformgesinnten Zaren Alexander II. (1855–1881), der als Zar-Befreier in die russische Geschichte einging, besonders stark radikalisierte.
Manichäisches Weltbild
Alexander II. hatte kurz nach dem verlorenen Krimkrieg (1853–1856) ein ehrgeiziges Reformwerk in die Wege geleitet, das an die Petrinischen Reformen des beginnenden 18. Jahrhunderts erinnerte und das man als die zweite Westernisierung bzw. Europäisierung Russlands bezeichnen kann. Die Leibeigenschaft wurde 1861 abgeschafft, die Zensur erheblich gelockert, die Justizreform von 1864 schuf unabhängige Gerichte und verankerte damit die ersten Ansätze der Gewaltenteilung im Lande. Viele der Forderungen, die seit Generationen von den Kritikern der russischen Autokratie aufgestellt worden waren, waren nun eine nach der anderen erfüllt worden. Für die revolutionäre Intelligencija hatten indes diese Entwicklungen so gut wie keine Relevanz. Im Gegenteil, je liberaler das bestehende System wurde, desto radikaler wurde es von der Intelligencija bekämpft. Dieses inadäquate, völlig irrationale Verhalten wirkt auf den ersten Blick verblüffend. Gehört aber die inadäquate, irrationale Verhaltensweise nicht zum Wesen des ungeduldigen revolutionären Utopismus, der nach einer gründlichen Zerstörung der bestehenden unvollkommenen Welt trachtet, um auf ihren Ruinen so schnell wie möglich ein soziales Paradies auf Erden aufzubauen? In einer besonders radikalen Form trat diese Verhaltensweise in Russland auf. Die Unbedingtheit und die Absolutheit, die den revolutionären Glauben der russischen Intelligencija auszeichneten, seien im Westen praktisch unbekannt gewesen, so der Kölner Historiker Theodor Schieder.3
Im Jahre 1869, also in der Zeit, in der das liberale Regiment Alexanders II. Russland gründlich erneuerte, ja, bis zur Unkenntlichkeit veränderte, verfasste einer der radikalsten Regimegegner, Sergej Nečaev, den sogenannten Revolutionskatechismus, in dem Folgendes zu lesen war:
Der Revolutionär ist ein geweihter Mensch. Er hat keine persönlichen Interessen, [...] Gefühle oder Neigungen, kein Eigentum, nicht einmal einen Namen. [...] Wenn er in dieser Welt fortlebt, so geschieht es nur, um sie desto sicherer zu vernichten [...] Zwischen ihm und der Gesellschaft herrscht Krieg auf Tod und Leben, offener oder geheimer Kampf, aber stets ununterbrochen und unversöhnlich [...] Jene ganze unflätige Gesellschaft teilt sich in mehrere Kategorien. Die erste besteht aus denen, die unverzüglich dem Tode geweiht sind.4
Zu ihnen zählen nach Ansicht Nečaevs die intelligentesten und energischsten Vertreter des bestehenden Regimes.
Erlösungsphantasien der Intelligencija
Die ersten Konturen des künftigen totalitären Charakters – des Urhebers wie auch des Produkts der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts – zeichnen sich anhand dieser Gedankengänge bereits ab. Dieser ist auf totale Konfrontation ausgerichtet. Deshalb sind ihm die „intelligentesten“ Vertreter der bestehenden Regierung, die die menschliche Seite des Regimes verkörpern, besonders verhasst. Denn sie könnten diese unvollkommene, der Zerstörung geweihte Welt in den Augen des Volkes erträglicher machen. Despotische Naturen im Regierungslager sind ihm willkommener, weil sie die sozialen und politischen Gegensätze nicht „künstlich“ abmildern und dadurch eine revolutionäre Explosion beschleunigen können.
Der Revolutionär darf nach Ansicht Nečaevs keine menschlichen Regungen gegenüber den Feinden haben, die für ihn im Grunde keine menschlichen Wesen sind. So verwandelt sich der von Nečaev geschilderte Regimegegner in eine Art Tötungsmaschine, die aus Liebe zur künftigen idealen Menschheit gegen die Träger der bestehenden unvollkommenen Welt einen erbarmungslosen Zerstörungskampf führt.
Im Sinne Nečaevs handelte die 1879 entstandene revolutionäre Verschwörerorganisation Narodnaja volja („Volkswille“ bzw. „Volksfreiheit“), deren wichtigstes Ziel die Ermordung Alexanders II. war. Nečaev schrieb:
An erster Stelle müssen (diejenigen) vernichtet werden, die für die revolutionäre Organisation am verderblichsten sind und deren gewaltsamer und plötzlicher Tod am geeignetsten ist, die Regierung zu erschrecken und ihre Macht zu erschüttern.5
Der reformgesinnte Zar war für diese Rolle aus der Sicht der Narodnaja volja geradezu prädestiniert. Die Organisation leitete eine regelrechte Menschenjagd in die Wege. Mehrere Attentatsversuche scheiterten. Am 1. März 1881 hatten die Terroristen schließlich den gewünschten Erfolg. Die Ermordung Alexanders II. geschah ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als der Zar gemeinsam mit seinem engsten Mitarbeiter Michail Loris-Melikov ein Dokument verfasste, das Russland eine Art Verfassung in Aussicht stellte.
Die Ermordung des Zaren betrachteten die Mitglieder der Narodnaja volja als eine Art Erlösungswerk, und derartige Erlösungsphantasien gehören neben der Tendenz zur Enthumanisierung des Gegners zu den wesentlichsten Bestandteilen des totalitären Charakters. Sein Denken ist manichäisch. Er kennt nur das absolut Böse – im Falle der revolutionären Intelligencija war das die russische Autokratie – oder das absolut Gute – für die Intelligencija war dies das einfache russische Volk. Semen Frank schreibt dazu: Die Intelligencija glaube, dass es möglich sei, das absolute Glück auf Erden zu erreichen, und zwar durch eine bloße mechanische Beseitigung der Feinde des von ihr so vergötterten Volkes. Trotz ihrer Gottlosigkeit bleibe die Intelligencija in religiösen Denkkategorien verhaftet – ihr „Gott“ sei das Volk, ihr „Teufel“ die zarische Selbstherrschaft.6
Lenins „Partei neuen Typs“
Das Erlösungswerk, das der radikale Flügel der russischen Intelligencija aus dem Lager der „Volkstümler“ (Narodniki) anstrebte, war im Wesentlichen auf Russland beschränkt, es war eher partikular als universal. Es ging den Narodniki in erster Linie um die Befreiung des leidenden russischen Volkes, das sie in die paradiesische, „lichte“ Zukunft führen wollten. Eine besondere Explosivität erreichte indes diese chiliastische Sehnsucht der russischen Revolutionäre, als sie im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Verbindung mit dem marxistischen Utopismus einging. Das wichtigste Ergebnis dieser Synthese war die 1903 entstandene bolschewistische Partei – die erste totalitäre Partei der Moderne –, die im Westen keine Entsprechung hatte. Diese zentralisierte, straff disziplinierte Organisation von Berufsrevolutionären unterschied sich grundlegend von allen anderen Parteien der 1889 gegründeten Zweiten Internationale. Als Vorbild für diese Partei diente ihrem Gründer, Vladimir Lenin, keineswegs die SPD als die von der Zweiten Internationale am meisten bewunderte Partei. Eine solche Partei konnte sich nur in einem Staat entfalten, in dem die Opposition über gewisse legale Betätigungsmöglichkeiten verfügte. Russland hingegen war zur Zeit der Gründung der bolschewistischen Partei noch eine autokratische Monarchie ohne Parlament und ohne legale politische Parteien. Erst nach der Revolution von 1905 sollte sich das Zarenreich in eine halbkonstitutionelle Monarchie verwandeln. So suchte Lenin nach organisatorischen Vorbildern für seine Partei nicht im Westen, sondern in Russland selbst. Er fand dieses Vorbild in der Organisation der Narodnaja volja. Als orthodoxer Marxist lehnte Lenin zwar den individuellen Terror ab, die organisatorische Struktur der Narodnaja volja imponierte ihm aber. Es hatte sich bei ihr um eine disziplinierte und zentralisierte Verschwörerorganisation gehandelt. Eine solche Organisation, aber mit einem marxistischen Programm, wollte nun Lenin gründen: „Gebt uns eine Organisation von Revolutionären, und wir werden Russland aus den Angeln heben!“, schrieb Lenin 1902 in seiner programmatischen Schrift Was tun? 15 Jahre später vermochte er mit Hilfe seiner Partei das erste totalitäre Regime der Moderne zu errichten und damit die Geschichte des 20. Jahrhunderts in neue Bahnen zu lenken.
Paradigmenwechsel im „Orden“ der Intelligencija
In der Zeit, als Lenin seine Schrift veröffentlichte, bahnte sich indes innerhalb des Intelligencija-„Ordens“ ein Paradigmenwechsel an. Eine Reihe seiner Mitglieder begann sich, nicht zuletzt unter dem Einfluss der damals in Europa verbreiteten Fin-de Siècle-Stimmung, vom revolutionären Credo zu distanzieren und sich immer stärker für philosophische bzw. religiöse Fragen zu interessieren. Bis dahin galten solche Beschäftigungen innerhalb des „Ordens“ als reine Zeitverschwendung: „Diejenigen, die sich in philosophische Probleme vertieften, wurden der Gleichgültigkeit gegenüber den Interessen der Bauern und der Arbeiter verdächtigt“, so der russische Philosoph Nikolaj Berdjajev.7
Auf die russischen Unterschichten hatte sich diese Tendenzwende indes kaum ausgewirkt. Sie waren damals, nicht zuletzt infolge der unermüdlichen „Aufklärungsarbeit“ der Intelligencija, gerade erst in Bewegung geraten. Auch bei den Unterschichten wurde allmählich die Verehrung des Zaren durch den bedingungslosen Glauben an die Revolution ersetzt. Nicht zuletzt deshalb wurde die Februarrevolution von 1917, die zum Sturz des letzten russischen Zaren geführt hatte, von ihnen euphorisch begrüßt. Ähnliches konnte man damals auch über beinahe alle politischen Gruppierungen im Lande sagen: „In jenen Tagen waren alle, von den Sozialisten bis zu den Schwarzen Hundertschaften (rechtsradikale Gruppierungen – L.L.), Revolutionäre und Demokraten“, schrieb einige Jahre später der russische Philosoph und Akteur der damaligen Ereignisse, Fedor Stepun.8
Solženicyns umstrittene These
Warum hatte aber die im Februar 1917 errichtete „erste“ russische Demokratie etwa acht Monate später so gut wie keine Verteidiger mehr? Wodurch lässt sich das Scheitern dieses wohl freiheitlichsten Systems in der neuesten Geschichte Russlands, wenn man vielleicht von den ersten Jahren der im August 1991 entstandenen „zweiten“ russischen Demokratie absieht, erklären? Aleksandr Solženicyn führt in seinem umstrittenen Buch Zweihundert Jahre zusammen über die Geschichte des russisch-jüdischen Verhältnisses dieses Scheitern auf das aus seiner Sicht verhängnisvolle Wirken des wohl mächtigsten Organs der Revolution – des Exekutivkomitees des Petrograder Sowjets der Arbeiter- und der Soldatendeputierten – zurück. Das Exekutivkomitee hätte danach gestrebt, die Revolution in immer radikalere Bahnen zu lenken. Diesen für Russland schädlichen Radikalismus der Sowjetführung erklärt Solženicyn durch die vorwiegend nichtrussische Zusammensetzung dieses Gremiums, dem die Interessen Russlands gleichgültig gewesen wären.9
Die wahren Sachverhalte werden durch diese Behauptung im Grunde auf den Kopf gestellt. Denn gerade diese angeblich „unrussische“ Führung des Sowjets bemühte sich in den ersten Monaten der Februarrevolution unentwegt um die Eindämmung der radikal-revolutionären Strömung, die damals die von Solženicyn derart verklärten russischen Massen erfasste. Um gemeinsam mit den bürgerlich-liberalen Kräften diese anarchische Woge zu kanalisieren, traten gemäßigte sozialistische Führer des Sowjets Anfang Mai 1917 sogar in die „bürgerliche“ Provisorische Regierung ein. Und gerade deshalb verlor der Sowjet bei den Massen an Popularität: „Es besteht bei den Massen eine Art instinktiver Furcht, dass die Revolution zu früh ende“, sagt in diesem Zusammenhang der erste Außenminister der Provisorischen Regierung und Historiker Pavel Miljukov:„Sie haben das Gefühl, die Revolution würde fehlschlagen, wenn der Sieg von den gemäßigten Elementen allein davongetragen werde“.10
Nicht zuletzt deshalb erzielten solche Parolen Lenins wie „Raubt das Geraubte!“ bei den russischen Bauern eine viel größere Resonanz als Warnungen der gemäßigten Führer des Sowjets vor allzu radikalen Forderungen und Verhaltensweisen.
Das politische Potential der „ersten“ russischen Demokratie
War der Zusammenbruch der „ersten“ russischen Demokratie unvermeidlich? Haben historische Deterministen, nicht zuletzt marxistischer Provenienz, recht, wenn sie den Sieg der Bolschewiki im Oktober 1917 als den einzig möglichen Ausgang der Krise von 1917 bezeichnen? Diese Interpretation möchte ich zumindest partiell in Frage stellen. Denn die russische Demokratie verfügte im Jahre 1917 durchaus über ein politisches Potential, das sie, aus welchen Gründen auch immer, nicht ausreichend nutzte, was letztendlich ihren totalitären Gegnern zugute kam.
So gab es im Lager der gemäßigten Sozialisten, die das Rückgrat des im Februar errichteten Systems bildeten, durchaus Politiker, die das Wesen der bolschewistischen Gefahr rechtzeitig erkannten. Zu ihnen zählte einer der einflussreichsten Führer des Sowjets aus der Fraktion der Menschewiki, Iraklij Cereteli. Cereteli vertrat die Meinung, dass die größte Gefahr, die die russische Revolution nun bedrohe, nicht von rechts komme, wie die Mehrheit im Sowjet annehme, sondern von links: „Die Konterrevolution kann nur durch ein einziges Tor einfallen, das der Bolschewiki“, sagte er im Juni 1917.11
Diese Worte klangen in den Ohren vieler gemäßigter Sozialisten beinahe blasphemisch. Sie betrachteten die Bolschewiki als einen integralen Bestandteil der „revolutionär-demokratischen“ Front. Die Erinnerung an die gemeinsame Zugehörigkeit zum Intelligencija-„Orden“ spielte hier wohl eine wichtige Rolle. Demzufolge galt den demokratisch gesinnten Sozialisten eine eventuelle Entwaffnung der Bolschewiki als Schwächung des eigenen Lagers, als Verrat an der Sache der Revolution. Cereteli setzte sich mit dieser Position unentwegt auseinander. In seinen Erinnerungen schrieb er: Die nichtbolschewistische Mehrheit des Sowjets habe keine Macht gewollt, um nicht gezwungen zu sein, gegen die Bolschewiki nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten vorzugehen.
Diese These Ceretelis bedarf indes einer Korrektur. Im Verlauf des Jahres 1917 gab es durchaus Situationen, in denen die russische Demokratie sich gegen die linksextreme Herausforderung zu wehren suchte, und zwar mit Erfolg. Dies vor allem während eines linksradikalen Putschversuches vom 3.–5. Juli 1917 in der russischen Hauptstadt. Die Entschlossenheit, mit der die russischen Demokraten damals bereit waren, die neue Staatsordnung zu schützen, wirkte geradezu lähmend auf die Rebellen. Schon beim ersten Anblick der regierungstreuen Truppen räumten sie das Feld. Etwa 800 Anführer der Juli-Revolte, darunter viele Bolschewiki, wurden verhaftet, probolschewistische Militäreinheiten wurden entwaffnet.12Um einer Verhaftung zu entgehen, floh Lenin aus der Hauptstadt und lebte bis zum bolschewistischen Staatsstreich vom 25./26. Oktober 1917 in einem Versteck auf finnischem Territorium. Zur Diskreditierung der Bolschewiki trug zusätzlich die Tatsache bei, dass die Regierung eine Reihe von Dokumenten über die Zusammenarbeit der Bolschewiki mit den Deutschen der Öffentlichkeit zugänglich machte. Lenin drohte ein Prozess wegen Hochverrat.
Das Gespenst der „Gegenrevolution“
Warum gelangten dann die Bolschewiki, trotz dieses verheerenden Rückschlags, einige Monate später an die Macht? Dies hatte in erster Linie mit der damaligen Haltung der Mehrheit der nichtbolschewistischen Linken zu tun. Die Tatsache, dass die Bolschewiki während der Juli-Ereignisse versucht hatten, die bestehende Ordnung mit Gewalt zu stürzen, führte keineswegs zu ihrem Ausschluss aus dem Lager der „revolutionären Demokratie“. Sie wurden von ihren sozialistischen Widersachern weiterhin als integraler Bestandteil der sozialistischen Solidargemeinschaft angesehen. Nicht zuletzt deshalb lehnten die Vertreter der Sowjetmehrheit ein allzu hartes Vorgehen gegen die Bolschewiki ab. Diese Milde des demokratischen Staates gegenüber seinen extremen Gegnern wurde von den Bolschewiki als Schwäche interpretiert. Später sagte Lenin, die Bolschewiki hätten im Juli 1917 eine Reihe von Fehlern gemacht. Ihre Gegner hätten dies im Kampf gegen sie durchaus ausnutzen können: „Zum Glück besaßen unsere Feinde damals weder die Konsequenz noch die Entschlossenheit zu einem solchen Vorgehen“.13
Die Bolschewiki profitierten auch von der Tatsache, dass die gemäßigten Sozialisten panische Angst vor einer „Gegenrevolution“ hatten und die Bolschewiki als potentielle Verbündete gegen die Gefahr von rechts betrachteten. Erforderte aber die Bekämpfung der gegenrevolutionären Gefahr wirklich die Mobilisierung aller linken Kräfte, auch solch militanter Antidemokraten wie die Bolschewiki? Das klägliche Scheitern des Putschversuchs von General Kornilov (Ende August 1917) zeigte, dass die Armee zum Kampf gegen die eigene Bevölkerung nicht mehr geeignet war. So brauchte die russische Demokratie keineswegs die Hilfe der Linksextremisten, um der Gefahr von rechts erfolgreich zu begegnen. Dennoch war die Angst der gemäßigten Sozialisten vor der Gegenrevolution derart überdimensional, dass sie ihre eigenen Kräfte maßlos unterschätzen. Nicht zuletzt deshalb gaben sie den Bolschewiki, die infolge des gescheiterten Putschversuchs vom Juli entwaffnet worden waren, erneut die Waffen in die Hand. Dies war wohl die verhängnisvollste Folge der Kornilov-Affäre. 14
Nach dem Scheitern des Kornilov-Putsches verloren die Provisorische Regierung und die mit ihr verbündeten gemäßigten Sozialisten weitgehend die politische Initiative. Wie gelähmt beobachteten sie das entschlossene und zielstrebige Vorgehen der Bolschewiki, die nun meisterhaft zeigten, wie man die demokratischen Freiheiten dazu ausnutzt, um die Demokratie zu beseitigen. Nicht zuletzt deshalb konnten sie praktisch im Alleingang, gegen den Willen der wichtigsten politischen Gruppierungen im Lande, die Alleinherrschaft in Russland erobern.
Das Scheitern der „ersten“ russischen Demokratie wird oft auf die Eigenart der russischen Mentalität oder auf den geschichtlichen „Sonderweg“ Russlands zurückgeführt, der sich vom Weg des Westens grundlegend unterschied. All das spielte bei den Ereignissen von 1917 sicherlich eine wichtige Rolle, allerdings keineswegs eine ausschließliche. Denn das Scheitern des nach der Februarrevolution errichteten Systems hatte auch Ursachen allgemeiner Art, die weit über das spezifisch Russische hinausgingen. So fand im damaligen Russland die erste Konfrontation eines demokratischen Gemeinwesens mit einer totalitären Partei statt, die skrupellos alle Freiheiten der Demokratie ausnutzte, um diese zu zerstören. Man darf nicht vergessen, dass etwa fünf Jahre später die italienische und 15 Jahre später die Weimarer Demokratie, trotz völlig unterschiedlicher Konstellationen, an vergleichbaren Herausforderungen scheitern sollten, und zwar mitten im Frieden und nicht im vierten Kriegsjahr, wie dies in Russland der Fall gewesen war. So hat das Scheitern der „ersten“ russischen Demokratie die tiefe Krise der demokratischen Systeme in ganz Europa bloß um einige Jahre vorweggenommen.
1 Erweiterte Fassung einer Kolumne, die ich 14. Dezember 2016 im Online-Debattenmagazin DieKolumnisten veröffentlicht habe. Dieser Text basiert im Wesentlichen auf meinem Aufsatz „Intelligencija und Revolution. Geschichte eines siegreichen Scheiterns“ (Historische Zeitschrift, Band 249 (1989), S. 265-294). Dort sind die weiterführenden bibliographischen Angaben zu dieser Thematik sowie ausführliche Quellenverweise zu finden.
2 Frank, Semen: Krušenie kumirov, in: ders.: Sočinenija. Moskau 1990. S. 119f.
3 Schieder, Theodor: Das Problem der Revolution im 19. Jahrhundert, in: ders.: Staat und Gesellschaft imWandel unserer Zeit. Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. München 1970, S. 42ff.
4 Zit. nach Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke. Berlin 1959ff. Band 18, S. 427-431.
5 Ebenda.
6 Frank, Semen: Ėtika nigilizma, in: Vechi. Sbornik statej o russkoj intelligencii. Moskau 1909, S. 175–210.
7 Berdjaev, Nikolaj: Intelligentskaja pravda i filosofskaja istina, in: Vechi, S. 2.
8 Stepun, Fedor: Die Misssion der Demokratie in Russland, in: Hochland 2, Band 1, Oktober 1925 – März 1926, S. 417.
9 Solženicyn, Aleksandr: Dvesti let vmeste (1795–1995). Moskau 2001–2002, Band1–2, hier Band 2, S. 42f, 58–63.
10 Miljukov, Pavel: Russlands Zusammenbruch. Stuttgart 1925–1926, Band 1–2, hier Band 1, S. 25.
11 Zit. Nach Pipes, Richard: Die Russische Revolution, Berlin 1992, Band 1–2, hier Band 1, S. 141.
12 Ebenda, S. 170.
13 Ebenda, S. 177.
14 Siehe dazu u.a. Mel’gunov, Sergej: Kak bol´ševiki zachvatili vlast’. London 1983, S. 12ff.
Sergej Vitte vs. Konstantin Pobedonoscev – die russische Selbstherrschaft um die Jahrhundertwende zwischen Reform und Gegenreform
Die Ermordung Alexanders II. durch die Terroristen der „Narodnaja volja“, die das bestehende System nicht reformieren, sondern gänzlich zerstören wollten, zeigte, welche Ausmaße die Polarisierung der russischen Gesellschaft zum damaligen Zeitpunkt bereits erreicht hatte. Dies ungeachtet der Tatsache, dass der liberale Zar bereit war, einen großen Teil der Forderung der Rebellen vom 14. Dezember 1825 zu erfüllen. Unmittelbar nach dem Terroranschlag vom 1. März 1881 entbrannte innerhalb des herrschenden Establishments des Zarenreiches eine Kontroverse um die Frage, welche Mittel man anwenden müsse, um der revolutionären Gefahr den Boden zu entziehen. Dabei wurden zwei völlig unterschiedliche Programme entwickelt. Die Verfechter der einen Strategie meinten, die Revolution von unten lasse sich nur durch eine Revolution von oben eindämmen, also durch eine grundlegende Modernisierung des Landes in Anlehnung an bestimmte westliche Modelle. Ihre Gegner hingegen befürchteten, eine Öffnung des Landes gegenüber der Außenwelt werde die herrschenden Strukturen erschüttern, ja zerstören. Sie meinten, Russland sollte sich gegen die aus ihrer Sicht verderblichen westlichen Einflüsse abschotten und seinen Sondercharakter um jeden Preis bewahren. Mit besonderer Vehemenz vertrat das zweite Konzept der einflussreiche Berater der beiden letzten russischen Zaren und zugleich der Oberprokuror des Heiligen Synod (1880–1905) Konstantin Pobedonoscev. Sein wichtigster Kontrahent im Petersburger Kabinett war Sergej Vitte.
Die Tatsache, dass die russische Autokratie in ihrer Dämmerungsphase gleichzeitig zwei derart unterschiedliche Programme zu realisieren suchte, verlieh ihrer Politik einen widersprüchlichen, in sich gespaltenen Charakter.
In meinem Beitrag werde ich zunächst die Programme Pobedonoscevs und Vittes miteinander vergleichen. Danach werde ich auf die Ursachen für das Scheitern der beiden Konzepte eingehen.
Als erstes möchte ich kurz das bewahrende Konzept des Oberprokurors des Heiligen Synod beschreiben.
Konstantin Pobedonoscevs Kampf gegen die Moderne
Pobedonoscev hielt Reformen und Zugeständnisse der Autokratie an die Gesellschaft für völlig überflüssig, da sie nur von einer verschwindenden Minderheit der russischen Bevölkerung gefordert würden. Die absolute Mehrheit der Russen hingegen wolle mit fester Hand regiert werden, so Pobedonoscev. Im Gegensatz zur russischen Intelligencija sei das einfache russische Volk absolut zarentreu. Damit dies aber so bleibe, müsse die politische und religiöse Eigenart Russlands bewahrt werden.1 Nur sie ermögliche den Fortbestand der Selbstherrschaft.2
Der Erhaltung der traditionellen politischen Vorstellungen der Landbevölkerung diente das von Pobedonoscev entworfene Bildungsprogramm. Dem einfachen Volk dürfe, so der Oberprokuror, kein abstraktes Wissen vermittelt werden. Dieses stifte nur Verwirrung und erhöhe die Unzufriedenheit des Einzelnen mit seiner Stellung innerhalb der Gesellschaft. Man solle den Unterschichten nur Elementarwissen und praktische Kenntnisse vermitteln, die sie dann in ihrem jeweiligen Beruf verwenden könnten.3 Pobedonoscevs Bildungsideal unterschied sich übrigens kaum von den Idealen vieler nichtrussischer Verfechter des alten Regimes. So waren seine Argumente denjenigen der preußischen Konservativen im Vormärz zum Verwechseln ähnlich.4
In dem von ihm energisch ausgebauten Netz von Pfarrschulen versuchte Pobedonoscev sein Bildungsprogramm zu verwirklichen. Die Hälfte der neuentstandenen Grundschulen, in denen die Bauernkinder ihre Ausbildung erhielten, befand sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter der Aufsicht der von Pobedonoscev geleiteten Behörden. Im Ergebnis bedeutete diese Konzeption eine dauerhafte Bevormundung der Unterschichten durch die weltliche und kirchliche Obrigkeit.
Sergej Vitte hielt Pobedonoscev zugute, dass er mit Hilfe der von ihm geförderten Schulen gegen die Unwissenheit der Bauern gekämpft habe.5 Dies ist aber nur ein Teil der Wahrheit. So äußerte sich Pobedonoscev wiederholt positiv über manche Vorurteile, die das Denken der Bauern beeinflussten. Diese Vorurteile, die nicht zuletzt das Resultat der Unwissenheit waren, wollte Pobedonoscev auf keinen Fall antasten. Im Gegenteil, die Pfarrschulen sollten die traditionellen Denkmuster der Bauern bewahren helfen.
In seinem aussichtslosen Versuch, die in Bewegung geratene Welt künstlich aufzuhalten, erinnert Pobedonoscev in gewisser Weise an Metternich. Beide sahen die immer stärker werdenden Kräfte der Moderne auf sich zukommen und wurden deshalb immer pessimistischer. Von ihrem außerordentlichen Pessimismus berichten viele Beobachter. Sie waren sich über die Chancenlosigkeit ihres Unternehmens wohl im Klaren.6 Der englische Historiker Anderson nannte Metternich einen quasi „Fortschrittsgläubigen“, da dieser gespürt habe, dass sein System infolge des weiteren Fortschritts unvermeidlich zusammenbrechen werde.7 Die These Andersons lässt sich auch auf Pobedonoscev übertragen.
Sergej Vittes Modernisierungsvisionen
Aber es waren nicht nur die Kräfte der Moderne an sich, die der Verwirklichung des Programms von Pobedonoscev im Wege standen. Er hatte auch mächtige Kontrahenten innerhalb des Petersburger Kabinetts selbst. Zu den bedeutendsten von ihnen gehörte Sergej Vitte. Im Gegensatz zu Pobedonoscev hatte Vitte keine Angst vor der Zukunft. Er hielt Russland für ein Land mit unerschöpflichen Möglichkeiten, das aber einer grundlegenden Modernisierung bedürfe. Nur so könne es seinen Status als Großmacht bewahren und dringende soziale Probleme lösen.8
1891 kam es in Russland zu einer Hungerkatastrophe, die die wirtschaftliche Rückständigkeit des Landes besonders deutlich offenbarte. Katastrophen dieser Art gehörten im hochentwickelten Westen längst der Vergangenheit an. Nun wurde es vielen Entscheidungsträgern in Petersburg, nicht zuletzt auch dem Zaren Alexander III., klar, dass Russland seine wirtschaftlichen Strukturen so schnell wie möglich modernisieren müsse. Diese Erkenntnis stellte auch für Vitte, dessen administrative Talente dem Zaren seit Jahren bekannt waren, eine Chance dar. 1892 wurde er zum Finanzminister ernannt und nahm sofort sein großangelegtes Programm zur Industrialisierung Russlands in Angriff. Die Quintessenz des Konzepts von Vitte lässt sich aus seiner Aussage, die er einige Jahre später, nämlich 1899 machte, herauslesen: Russland werde sich entweder modernisieren oder es werde sich allmählich in eine wirtschaftliche Kolonie des Westens verwandeln. Es müsse nicht nur politisch unabhängig bleiben, sondern auch nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit streben.9
Vittes Vision von einem modernen, wirtschaftlich unabhängigen Russland begann den Zaren Alexander III. immer stärker zu beeinflussen. Die wachsende Bedeutung Vittes im Staatsapparat führte umgekehrt zur Abnahme des Einflusses von Pobedonoscev. Vitte berichtet in seinen Erinnerungen von einem Gespräch, das er mit Alexander III. führte, in dem sich der Zar recht negativ über Pobedonoscev äußerte. Dieser könne nur kritisieren, er sei aber nicht in der Lage, konstruktive Vorschläge zu machen. Von Kritik allein könne man aber nicht leben. Er, der Zar, höre immer seltener auf den Rat Pobedonoscevs.10
Die Isolierung des Landes von der Außenwelt, die Pobedonoscev anstrebte, war mit dem Programm Vittes unvereinbar.11 Nur eine Zusammenarbeit mit den hochentwickelten westlichen Staaten war geeignet, die Industrialisierung Russlands zu ermöglichen. Der Finanzminister brauchte westliche Spezialisten, vor allem aber das westliche Kapital, um seine ehrgeizigen Projekte, wie etwa den Ausbau des Eisenbahnnetzes oder die Erschließung Sibiriens, in Gang zu bringen. Vitte war davon überzeugt, dass die von Pobedonoscev propagierte Fremdenfeindlichkeit den Interessen Russlands nur schaden könne.
Auch in der Frage der Behandlung nichtrussischer bzw. nichtorthodoxer Völker im Zarenreich vertraten Vitte und Pobedonoscev verschiedene Positionen. Pobedonoscev, für den die Bewahrung der Harmonie zwischen Selbstherrschaft, Orthodoxie und Volk im Vordergrund stand, hielt es für undenkbar, die nichtrussischen Völker bzw. die nichtorthodoxen Religionen und Konfessionen der Zarenmonarchie auf die gleiche Stufe mit den Russen bzw. der Orthodoxen Kirche zu stellen, weil deren Einstellung zum Zarenideal sich grundlegend von derjenigen der Russen unterschied. Daher betrachtete Pobedonoscev diese Völker bzw. Konfessionen, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Reiches, als Bedrohung für das bestehende System. Vitte hingegen hielt eine ungleiche Behandlung der Untertanen des Zaren für unangebracht. Eine große Zahl der Unternehmer, die Vitte bei seinem Modernisierungsvorhaben unterstützten, war nichtrussischer Herkunft. Vitte fühlte sich ihnen gegenüber verpflichtet. Und lehnte insoweit nationale Vorurteile oder restriktive fremdenfeindliche Maßnahmen ab. Auch die Gesetzgebung zur Beschränkung der Rechte der Juden bekämpfte er,12 was im damaligen herrschenden Establishment Russlands keineswegs selbstverständlich war
Ebenso unterschied sich Vittes Bildungsideal grundlegend von demjenigen Pobedonoscevs. Um das Land zu modernisieren, brauchte die Selbstherrschaft aufgeklärte, dynamische, keineswegs aber traditionellen Weltbildern verhaftete Untertanen. 1898 wies er Nikolaus II. auf die Notwendigkeit hin, das Bildungsniveau der Unterschichten zu heben. Zwar würden sie dabei ihre ursprüngliche Naivität verlieren, dies sei jedoch unumgänglich. Das Volk müsse lernen selbst zu laufen, sogar auf die Gefahr hin, dass es dabei hin und wieder hinfalle. Nur eine aufgeklärte Bevölkerung werde den Willen entwickeln, ihren eigenen Wohlstand und damit auch den Wohlstand des Staates zu heben.13
In diesem Zusammenhang ist es auch interessant darauf hinzuweisen, wie sehr sich die Einstellung Vittes zum Individualismus und zum persönlichen Egoismus von derjenigen Pobedonoscevs unterschied. Pobedonoscev hielt übertriebenen Individualismus für eines der Grundübel der Moderne. Der Einzelne halte sich jetzt für das Zentrum des Universums und wolle seine Rechte nicht zugunsten anderer Menschen oder übergeordneter Werte einschränken. Eine solche Einstellung verzerre die Wirklichkeit ähnlich wie dies seinerzeit das geozentrische System von Ptolemäus getan hätte. Wann wird der neue Kopernikus kommen und das menschliche Ich auf den ihm gebührenden Platz zurückführen, fragt Pobedonoscev.14
Vitte vertrat hier einen grundlegend anderen Standpunkt. Das Streben des Einzelnen nach mehr Wohlstand und nach Selbstverwirklichung hielt er für die Triebfeder jeglichen Fortschritts. Obwohl Vitte kein Bewunderer der Lehre von Adam Smith war, ist hier der Einfluss dieser Lehre auf ihn deutlich zu erkennen. Die mangelnde Entwicklung des Individualismus in Russland hielt er für eine der Hauptursachen der Rückständigkeit. Er wollte den Staat dazu veranlassen, die private Initiative der Untertanen mit allen Mitteln zu fördern.15 So schlug er 1898 dem Zaren die Auflösung der Dorfgemeinde (obščina) vor. Vitte hielt die Dorfgemeinde für anachronistisch. Sie widerspreche dem Zeitgeist, der vor allem des Individualismus und der Eigeninitiative bedürfe.16
Vitte legte im Gegensatz zu Pobedonoscev keinerlei Wert auf die Bewahrung der Eigenart Russlands. Ähnlich wie andere Befürworter der Modernisierung des Landes seit Peter dem Großen hielt er Russland nicht für einen eigenartigen, vom Westen grundlegend verschiedenen Staat. Die Eigenart Russlands bestand für ihn ausschließlich in seiner Rückständigkeit. Sobald es diese überwunden habe, werde es sich von den anderen europäischen Staaten in nichts unterscheiden. Auf ein spezifisches Merkmal des russischen Staatswesens wollte Vitte jedoch zunächst nicht verzichten und dies war die uneingeschränkte Macht des Zaren. Er hielt die Selbstherrschaft für ein System, das sich für großangelegte Modernisierungsvorhaben besonders gut eigne. Da sie ohne Parlament regiere, könne sie ihre Entscheidungen unverzüglich in die Tat umsetzen und sich dabei eines gewaltigen bürokratischen Apparates bedienen. Es entstünden hier keine Verzögerungen, zu denen z. B. Parlaments-debatten bzw. die parlamentarische Kontrolle der Exekutive führten.17
Vitte hatte bei seinem Industrialisierungsvorhaben das Beispiel Deutschlands vor Augen. Er stand unter dem Einfluss der Wirtschaftstheorie Friedrich Lists und zugleich der protektionistischen Wirtschaftspolitik Bismarcks.18 Er versuchte einen ähnlichen Wirtschaftskurs auf Russland zu übertragen. Dennoch war seine Lage unvergleichlich schwerer als die der deutschen Politiker. In Deutschland vollzog sich die schnelle Industrialisierung auf der Grundlage eines Bündnisses der preußischen Bürokratie mit dem rheinländischen Unternehmertum. In Russland hingegen blieb die Bürokratie bei ihrem Versuch, das Land zu industrialisieren, praktisch allein.
Vittes Einsamkeit
Die größte Schwäche der Vision Vittes vom modernen und wirtschaftlich mächtigen Russland lag also darin, dass er keine bedeutende gesellschaftliche Schicht für sie gewinnen konnte. Die liberalen Gruppierungen, die ebenso wie Vitte die Überwindung der russischen Rückständigkeit anstrebten, konnte Vitte für seinen Kurs nicht gewinnen, da zwischen den beiden zunächst das Dogma der uneingeschränkten Macht des Zaren stand. Die Arbeiterschaft z. B., deren Zahl erst infolge der Reformen Vittes in die Höhe geschossen war, entwickelte sich sofort zu einem der militantesten Gegner des Regimes. Auch die Bauern wollten vom Industrialisierungsprogramm nichts wissen. Nicht die Größe Russlands, sondern die ungelöste Agrarfrage stand im Zentrum ihres Interesses. Vitte unterschätze aber zunächst die Schärfe dieses Konflikts. So war er der Meinung, der Schwerpunkt der Agrarfrage liege nicht auf wirtschaftlichem, sondern auf rechtlichem Gebiet. Sobald die Bauern die gleichen Rechte genießen würden wie andere Schichten der Gesellschaft, wäre das russische Agrarproblem gelöst. So sollten die Bauern das Recht auf freie Verfügung über ihr Eigentum erhalten. Das Prinzip der Unantastbarkeit des Privateigentums, das für die Bauern in den Dorfgemeinden nicht existierte, wollte Vitte auch auf den bäuerlichen Grundbesitz übertragen. Der russische Exilhistoriker Viktor Leontovitsch pflichtet nachträglich Vitte bei und meint, dass nur auf diese Weise die Agrarfrage in Russland zu lösen gewesen sei.19 Vitte und Leontovitsch unterschätzen allerdings den Umstand, dass die Bauern nicht mehr Rechte, sondern mehr Land haben wollten. Auch das Prinzip der Unantastbarkeit des Privateigentums genoss keine uneingeschränkte Zustimmung bei der russischen Landbevölkerung. Im Gegenteil, sie träumte von einer gänzlichen Enteignung der Gutsbesitzer, von einer „schwarzen Umverteilung“. Dieser Traum war aber ohne eine massive Verletzung des Eigentumsrechts der wohlhabenden Schichten nicht zu verwirklichen.
Da Vitte seine Aufmerksamkeit vor allem auf die Industrialisierung des Landes und nicht auf die Lösung der Agrarfrage richtete, entzog er seinem Vorhaben in gewisser Weise selbst den Boden. Denn statt einer Lösung der Agrarfrage, verschärfte er sie nur. Die Industrialisierung trug nämlich zu ihrer Lösung zunächst nichts bei. Im Gegenteil, sie setzte eine gewisse Durststrecke voraus, da sie ohne eine erhöhte Besteuerung breiter Bevölkerungsschichten nicht zu finanzieren war.20 Die Bauern sahen indes nicht den Sinn hinter den Opfern, die sie bringen mussten. Sie wollten eine weitere Senkung ihres Lebensstandards nicht hinnehmen. 1901 und 1902 fanden als Reaktion auf Vittes Wirtschaftspolitik heftige Bauernunruhen statt, die von konservativen Gegnern Vittes zum Anlass genommen wurden, Vittes ehrgeiziges Programm anzugreifen. Vitte geriet nun innerhalb des herrschenden Establishments in eine weitgehende Isolation. Seine Lage wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass Nikolaus II., der 1894 den Thron bestieg, die Begeisterung seines Vaters für die Pläne Vittes nicht teilte. Die Selbstherrschaft für die Vitte zur Zeit Alexanders III. so uneingeschränkt plädierte, offenbarte nun ihre Schattenseiten, so nicht zuletzt ihre außergewöhnliche Abhängigkeit von der Person des Herrschers. Während der selbstbewusste Alexander III. für die Energie Vittes nur Bewunderung empfand, irritierte diese seinen Sohn. Der charakterschwache Nikolaus II. wollte sich dem Einfluss seines bedeutendsten Politikers entziehen, worin er vom gesamten Hof unterstützt wurde.
Das Schicksal Vittes erinnert in gewisser Weise an das Bismarcks. Beide verteidigten das autokratische bzw. autoritäre System. Beide wollten das jeweilige System dem Einfluss der Gesellschaft entziehen. Damit hing aber das politische Programm beider wesentlich von ihrem Verhältnis zum jeweiligen Herrscher ab. In beiden Fällen mussten die Lotsen von Bord gehen, weil niemand sie vor den Launen der jungen und wenig erfahrenen Herrscher schützen konnte.
Vittes Glaube an die Vorzüge eines autokratischen Herrschaftssystems erwies sich also als unbegründet. In dem Zustand, in dem sich die russische Autokratie um die Jahrhundertwende befand, war sie ungeeignet, grundlegende Modernisierungsvorhaben durchzuführen. Vittes Kurs verschärfte nur die innenpolitischen Probleme des Landes, statt sie zu lösen. Der amerikanische Historiker Theodor von Laue bemerkte in diesem Zusammenhang: Russland habe sich nicht schnell genug industrialisiert, um sich im Konkurrenzkampf mit den hochentwickelten Nationen zu behaupten. Vom innenpolitischen Standpunkt aus sei hingegen die Modernisierung zu heftig gewesen. Sie habe die überlieferten Strukturen in Frage gestellt und die sozialen Konflikte nur verschärft.
1903 musste Vitte sein Amt als Finanzminister abgeben. Sein Programm zur Modernisierung des Landes war somit gescheitert.
Pobedonoscevs Scheitern
Nicht anders erging es aber im Ergebnis auch dem Programm Pobedonoscevs. Mit einer fünfzigjährigen Verspätung begannen die russischen Unterschichten um die Jahrhundertwende an die Entwicklung der Intelligencija anzuknüpfen. Der Zarenglaube und die traditionellen religiösen Vorstellungen der unteren Volksschichten begannen um die Jahrhundertwende zu bröckeln. Der lange Kampf zwischen der Opposition und der Autokratie um die „Seele des Volkes“ sollte sich nun zugunsten der ersteren entscheiden.21 Die Abschaffung der Leibeigenschaft trug ihre Früchte. Eine ganze Generation von Bauern war nun in der neuen, freieren Atmosphäre herangewachsen. Sie ließ sich nicht mehr so leicht bevormunden wie noch ihre Väter. Das Programm Pobedonoscevs setzte indes ihre Unmündigkeit voraus; ihr Streben nach Emanzipation musste es zwangsläufig zu Fall bringen.
So spitzten sich in Russland gleichzeitig drei Konflikte zu, die im Westen bereits weitgehend gelöst worden waren: die Verfassungs-, die Arbeiter- und die Agrarfrage. Dies entzog der Selbstherrschaft ihre soziale Verwurzelung, und die erschreckende Leere, die sie nun umgab, offenbarte sich während des Russisch-Japanischen Krieges von 1904/05. Das militärische Debakel des zarischen Heeres wurde von der Gesellschaft im Großen und Ganzen mit Gleichgültigkeit aufgenommen, von Teilen der Intelligencija sogar euphorisch begrüßt. Nicht das russische Volk, sondern sein größter Feind – die zarische Regierung – sei in diesem Krieg besiegt worden, erklärte Lenin.22 Mit seiner extrem defätistischen Haltung stand er damals im oppositionellen Lager keineswegs allein.
Angesichts ihrer zunehmenden Isolierung im Lande konnte die Selbstherrschaft in ihrer bisherigen Form nicht aufrechterhalten werden. Sie musste auf einen Kompromiss mit der Gesellschaft eingehen. So kam es auf den Rat Vittes am 17. Oktober 1905 zu einem Manifest des Zaren, in dem er seinen Untertanen Grundrechte und die Einberufung eines Parlaments versprach. Dies war das Ende der uneingeschränkten Selbstherrschaft. Das Prinzip der Gewaltenteilung wurde nun auch in Russland eingeführt. Die These Max Webers vom russischen Scheinkonstitutionalismus, die auch von einigen westlichen Historikern geteilt wird, ist sicherlich unberechtigt. Zwar blieb die Macht des Zaren stärker als die Macht jedes westlichen Herrschers. Das russische Parlament war jedoch ein relativ selbständiges Kontrollorgan, nicht ein Werkzeug des Monarchen.
Die Verfassung habe begonnen sowohl auf die Regierung als auch auf die Opposition erzieherisch zu wirken, schrieb der liberale russische Politiker Vasilij Maklakov.23
Auch viele Vertreter der revolutionären Intelligencija wandten sich von ihren früheren Idealen ab. Dieser Umdenkungsprozess kam besonders deutlich in dem 1909 erschienenen Sammelband Vechi zum Ausdruck. 24
Auf die russischen Unterschichten hatte sich indes diese Tendenzwende kaum ausgewirkt. Sie waren damals, infolge der unermüdlichen Aufklärungsarbeit der Intelligencija, erst in Bewegung geraten und ließen sich durch Appelle und Beschwörungen nicht mehr aufhalten. Ihre Ablehnung des alten Regimes erreichte jetzt die gleiche Intensität wie dies ursprünglich nur bei der Intelligencija der Fall gewesen war. Der Glaube an den Zaren wurde allmählich durch den Glauben an die Revolution abgelöst. Aus der wichtigsten Stütze der russischen Monarchie verwandelten sich die russischen Volksschichten nun in ihre größte Bedrohung.
Veröffentlicht in: Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte 15. Jahrgang, 2/2011, S.87-97 (geringfügig revidierte Fassung).
1 Siehe dazu u.a. Byrnes, Robert F.: Pobedonoscev. His Life and Thought. Bloomington 1968; Leontovitsch, Viktor: Geschichte des Liberalismus in Rußland. Frankfurt am Main 1957; Zajončkovskij, Petr A.: Rossijskoe samoderžavie v konce XIX stoletija (političeskaja reakcija 80-ch i načala 90-ch godov). Moskau 1970; Simon, Gerhard: Konstantin Petrovič Pobedonoscev und die Kirchenpolitik des Heiligen Synod 1880-1905. Göttingen 1969; Florovskij, Georgij: Puti russkogo bogoslovija. Paris 1983, S. 410-424; Rogger, Hans: Russia in the Age of Modernisation and Revolution 1881-1917. London / New York 1983, S. 8.
2Pis´ma Pobedonosceva k Aleksandru III., hrsg. v. Pokrovskij, Michail, Band 1-2. Moskau 1925, hier Band 2, S. 335; Graf Vitte, Sergej J.: Vospominanija, Band 1-3. Berlin 1922 f., hier Band 1. Carstvovanie Nikolaja II., S. 296.
3 Pobedonoscev, Konstantin: Moskovskij sbornik. Moskau 1896, S. 67-75, 149 ff., 182 ff.; Florovskij, Puti, S. 412.
4 Nipperdey, Thomas: Volksschule und Revolution im Vormärz. Eine Fallstudie zur Modernisierung, in: ders.: Gesellschaft, Kultur, Theorie. Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte. Göttingen 1976, S. 206-227.
5 Vitte, Vospominanija, Band 3. Detstvo. Carstvovanie Aleksandra II. i Aleksandra III. (1849-1894), S. 350 f.
6 Vgl. dazu Schnabel, Franz: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, Band 2: Monarchie und Volkssouveränität. Freiburg 1933, S. 63 f.; Vitte, Vospominanija, Band 1, S. 233 f. und Band 3, S. 276; Florovskij, Puti, S. 410-413; Rogger, Russia, S. 11; von Laue, Theodor: Sergei Witte and the Industrialisation of Russia. Columbia 1963, S. 206.
7 Anderson, Matthew: The Ascendancy of Europe. Aspects of European History 1815-1914. London 1972, S. 82.
8 Vitte, Vospominanija, Band 3, S. 372 f.; von Laue, Witte, S. I-III, S. 34 f.; Geyer, Dietrich: Die Russische Revolution. Historische Probleme und Perspektiven. Göttingen 1977, S. 23; Löwe, Heinz-Dietrich: Von der Industrialisierung zur ersten Revolution 1890-1914, in: Hellmann, Manfred / Schramm, Gottfried / Zernack, Klaus (Hrsg.): Handbuch der Geschichte Rußlands, Band 3. Stuttgart 1983, S. 213 ff.
9 Kochan, Lionel: Russia in Revolution 1890-1918. London 1970, S. 27.
10 Vitte, Vospominanija, Band 3, S. 333 f.
11 Vitte, Sergej: Samoderžavie i zemstvo. St. Petersburg 1908, S. 45 f.; ders.: Vospominanija, Band 1, S. 467-472; von Laue, Witte, S. 174 f.
12 Vitte, Vospominanija, Band 1, S. 189.
13 Vitte, Vospominanija, Band 2, S. 467-472.
14 Pobedonoscev, Moskovskij sbornik, S. 100
15 Vitte, Vospominanija, Band 2, S. 441 ff., 467-472.
16 Ebenda, S. 467-472.
17 Vitte, Samoderžavie, S. 44 f., 203-211; siehe dazu auch Koni, Anatolij F.: Sergej Jul´evič Vitte. Otryvočnye vospominanija. Moskau 1925, S. 24 f.; Miljukov, Pavel N.: Vospominanija (1859-1917), Band 1. New York 1955, S. 241 f.; von Laue, Witte, S. 161 f., 305.
18 Vitte, Sergej J.: Nacional´naja ėkonomika i Friedrich List. Kiew 1889; siehe dazu auch Thalheim, Karl: Die wirtschaftliche Entwicklung Rußlands, in: Katkov, George u. a. (Hrsg.): Rußlands Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Politik – Gesellschaft – Kultur 1894-1917. Freiburg 1970, S. 99; von Laue, Witte, S. 56 ff.; Löwe, Von der Industrialisierung, S. 214.
19 Leontovitsch, Geschichte, S. 48, 149, 165, 186 f.
20 von Laue, Witte, S. 101 f., 170 f., 222; Thalheim, Die wirtschaftliche Entwicklung, S. 101.
21 Siehe dazu u.a. Bulgakov, Sergej: Dva grada. Moskau 1911, Band 2, S. 159-163; Fedotov, Georgij: Tragedija russkoj intelligencii, in: ders.: Sud´ba i grechi Rossii. Sankt Petersburg 1991, Band 1, S. 66-101; ders., Revoljucija idet, ebenda, S. 127-172.
22 Lenin, Vladimir: Polnoe sobranie sočinenij, Band 1-55. Moskau 1958 ff., hier: Band 9, S. 151-159.
23 Zit. nach Leontovitsch, Geschichte, S. 339, 416.
24Vechi. Sbornik statej o russkoj intelligencii. Moskau 1909.
II. Die russische Revolution als epochale Zäsur
Die Entzauberung des russischen Revolutionsideals – einige Bemerkungen zum Sammelband De profundis1
Im Herbst 2018 erschien im Suhrkamp Verlag die deutsche Übersetzung eines Buches, das bereits kurz nach der Oktoberrevolution in Russland entstanden war. Die Herausgeber der übersetzten Fassung, die Osteuropahistoriker, Ulrich Schmid und Karl Schlögel, hielten dieses Buch für relevant genug, um es der deutschsprachigen Öffentlichkeit hundert Jahre nach seiner Entstehung zu präsentieren. Diesem Band, den der Suhrkamp Verlag als einen „epochalen Band“ charakterisiert und der den Titel „De profundis“ trägt,2 ist dieser Beitrag gewidmet.
Die Oktoberrevolution von 1917 leitete ein neues Zeitalter sowohl in der russischen als auch in der gesamteuropäischen Geschichte ein. Mit ihr begann eine Epoche beispielloser sozialer Experimente, die „Utopie gelangte an die Macht“, wie die russischen Historiker Michail Geller und Aleksandr Nekrič diesen Vorgang später nannten. Wie reagierte die intellektuelle Elite Russlands auf den damaligen Zivilisationsbruch, dem der russische Schriftsteller Vasilij Rozanov die Bezeichnung „Die Apokalypse unserer Zeit“ verliehen hatte? Besonders deutlich spiegelten sich diese Reaktionen im Sammelband De profundis von 1918 wider.3 Aufgrund der Bestimmungen der bolschewistischen Zensur konnte diese Schrift allerdings die breite Öffentlichkeit lange nicht erreichen. Erst im Jahre 1967 wurde der Band publiziert, und zwar im Pariser Exil. Bezeichnenderweise erschien er ausgerechnet in einer Zeit, in der sich in der Sowjetunion die Bürgerrechtsbewegung und mit ihr auch die unabhängige Gegenöffentlichkeit zu konstituieren begann. Teile der nonkonformistisch gesinnten Intelligenz suchten nun nach geistigen Anregungen außerhalb des von oben verordneten marxistisch-leninistischen Kanons und entdeckten dabei die Denker der russischen religiös-philosophischen Renaissance des beginnenden 20. Jahrhunderts, zu denen auch die wichtigsten Autoren des Bandes De profundis gehörten. Durch verschiedene inoffizielle Kanäle begannen die in der UdSSR verbotenen Abhandlungen dieser Autoren, darunter auch die Schrift De profundis, in ihr Heimatland zu gelangen und den sich nun anbahnenden regimekritischen Diskurs zu beeinflussen. Da der Sammelband zu den ersten Reaktionen der intellektuellen Elite Russlands auf die Ereignisse von 1917/18 zählte, möchte ich nun etwas genauer auf ihn eingehen, insbesondere auf den Aufsatz des Philosophen Semen Frank, der wie das gesamte Buch ebenfalls den Titel De profundis trug und in gewisser Hinsicht eine programmatische Bedeutung besaß.
Die Verantwortung der Eliten
Der Aufsatz Franks beginnt mit folgender Zustandsbeschreibung:
Wenn jemand vor einigen Jahren jenen Abgrund vorausgesagt hätte, in den wir jetzt gestürzt sind […], hätte kein Mensch ihm geglaubt. Selbst die düstersten Pessimisten sind in ihren Voraussagen niemals so weit gegangen, sie sind in ihrer Einbildungskraft nicht bis zum letzten Rand der Hoffnungslosigkeit vorgestoßen, an den uns jetzt das Schicksal geführt hat.4
Bei der Suche nach den historischen Analogien für die Katastrophe von 1917/18 kommen Frank vor allem „die furchtbaren Ereignisse voll biblischen Schreckens“ in den Sinn. Auch andere Autoren des Bandes, so der Theologe Sergej Bulgakov und der Philosoph Sergej Askol’dov, betrachten die Entwicklungen von 1917/18, ähnlich wie der bereits erwähnte Vasilij Rozanov, als ein „Ereignis voll biblischen Schreckens“, als eine Art Apokalypse.5
Wie hatte es dazu kommen können? Der Zusammenbruch von 1917/18 hatte sich für Frank zunächst in den Köpfen vollzogen, in den Köpfen der intellektuellen Elite, die das Volk statt zu neuen Ufern ins Verderben führte. Das Gejammer vieler Vertreter der russischen Bildungsschicht über die „Unvernunft“ und die zerstörerische Wut der ungebildeten Massen rief bei Frank kein Mitleid hervor. Die Verantwortung für die Schicksale des jeweiligen Landes trügen in erster Linie seine politischen Eliten und nicht die unteren Volksschichten, denn
in keiner Gesellschaftsordnung und unter keinen gesellschaftlichen Umständen (sind die Volksschichten) Initiator und Gestalter des politischen Lebens. Selbst in einem noch so demokratischen Staat ist das Volk immer ausführendes Organ, Werkzeug in den Händen einer führenden und inspirierenden Minderheit. [...] Nicht die amorphe Masse agiert, sondern nur eine Organisation; jede Organisation aber basiert auf der Unterordnung der Mehrheit unter eine führende Minderheit.6
Nach dieser Feststellung analysierte Frank den geistigen Zustand der russischen Eliten, die aus seiner Sicht die Hauptverantwortung für den „Selbstmord eines großen Volkes“7 trugen. Besonders hart ging er mit den sozialistisch gesinnten Gruppierungen ins Gericht. Sie hätten Russland zu einer Art Experimentierfeld für ihre Programme gemacht, wobei sich deren zerstörerische Kraft besonders deutlich offenbarte. Warum, fragt Frank, habe der Sozialismus in Russland einen ganz anderen Charakter als im Westen angenommen? Während er sich im Westen in eine friedliche ökonomische und politische Bewegung zur Verbesserung des Schicksals der Arbeiterklasse verwandelte, habe er in Russland zum Zusammenbruch des Staates geführt.
Diesen Unterschied führt Frank darauf zurück, dass im Westen konservative und liberale Gruppierungen stark genug waren, um die revolutionäre Wucht der sozialistischen Bewegung einzudämmen und sie in eine friedliche, reformistische Richtung umzulenken. In Russland hingegen hätten sich diese Gegenkräfte als extrem schwach erwiesen. Die russischen Liberalen hätten im Grunde kein geschlossenes weltanschauliches Konzept gehabt. Sie seien deshalb nicht imstande gewesen, „jenes politische Pathos zu entfachen, das die Anziehungskraft jeder großen politischen Partei ausmacht“.8
Bei den russischen Liberalen habe es sich im Grunde nur um gemäßigte, lauwarme Sozialisten gehandelt. Dem Glaubenseifer der sozialistischen Fanatiker hätten sie nichts Wirksames entgegensetzen können. Was den russischen Konservatismus anbetrifft, so befinde sich diese Strömung in einem inneren Zerrüttungsprozess und verliere jeglichen Zugang zu ihren ursprünglich religiösen Quellen. Das konservative Establishment des Zarenreiches, so Frank, sei eine geistlose Bürokratenschicht gewesen, die die revolutionäre Gefahr nicht mit Hilfe von Ideen, sondern lediglich mit Repressalien bekämpfen wollte. Ein aussichtsloses Unterfangen, wie dies das Jahr 1917 gezeigt habe.9
Der Ost-West-Vergleich
Franks schonungslose Analyse schien lediglich den besonderen Charakter der russischen Katastrophe aufgezeigt und die in Ost und West weit verbreitete These von einer tiefen Kluft zwischen Russland und dem Westen bestätigt zu haben. So schrieb z.B. der Kultursoziologe Alfred Weber im Jahre 1925: Die bolschewistische Herrschaft habe die Reasiatisierung Russlands bewirkt. Russland habe nur zeitweise und versehentlich der europäischen Staatengemeinschaft angehört. Sein Wiederausscheiden aus Europa sei seine Rückkehr zu sich selbst.10
Als Alfred Weber diese Worte schrieb, bahnte sich gerade in Deutschland eine Katastrophe an, die den gesamten europäischen Kontinent in einen noch tieferen Abgrund stürzen sollte, als dies die bolschewistische Revolution getan hatte. Das angeblich „asiatische“ Russland hat also viele Entwicklungen des Westens bloß um einige Jahre vorweggenommen. Und gerade deshalb hatte die von Frank 1918 unternommene Analyse der russischen Katastrophe eine Relevanz, die weit über das spezifisch Russische hinausging. Denn die tiefe Krise des Liberalismus und des Konservatismus, die in Russland die wichtigste Voraussetzung für den Siegeszug einer totalitären Partei schuf, erfasste einige Jahre später auch den Westen. So weitete sich die russische Katastrophe zu einer allgemeineuropäischen aus. Nach 1933 begannen einige Autoren auch die deutsche Katastrophe mit biblischen bzw. metaphysischen Begriffen zu beschreiben und von der Dämonie zu sprechen, die den Nationalsozialismus auszeichnete. Für Hannah Arendt stellten die totalitären Regime unter Beweis, „dass es ein radikal Böses wirklich gibt“.11
Zur geschichtlichen Genese des Zivilisationsbruchs von 1917/1918
Ähnlich wie Frank befasste sich auch der Wirtschaftswissenschaftler und Initiator des Bandes, Petr Struve, mit der Verantwortung der russischen Eliten für den Zusammenbruch von 1917/18. In seinem Aufsatz „Der historische Sinn der russischen Revolution und die nationalen Aufgaben“12 geht Struve weit in die russische Vergangenheit zurück. Eine der Ursachen für die russische Revolution stellten für Struve die Ereignisse von 1730 dar, die im kollektiven Gedächtnis der Nation so gut wie keine Rolle mehr spielten. Damals versuchten nämlich die russischen Vertreter des Hochadels die Periode des Interregnums, die nach dem Tode des jungen Zaren Peter II. eintrat, auszunutzen, um Russland in eine konstitutionelle Monarchie zu verwandeln. Die neue Zarin Anna habe indes diesen Freiheitsdrang des Hochadels unterdrückt, und zwar mit Hilfe der Soldateska (Leibgarde) und des mittleren Adels, der sich mit der Initiative seiner besser gestellten Standesgenossen nicht abfinden wollte. So habe die Mehrheit der Adeligen darauf verzichtet, an den politischen Entscheidungsprozessen im Lande zu partizipieren. Dieser Verzicht sei durch die soziale Privilegierung des Adels kompensiert worden. Die Abhängigkeit der Bauern von den Gutsbesitzern sei nach 1730 noch intensiver geworden:
Durch die [Verschärfung] des Leibeigenen-Regiments versuchte sich die Monarchie von der politischen Reform loszukaufen.13
Um seine sozialen Privilegien nicht zu gefährden, habe der Adel seinen unmündigen Status akzeptiert. Die Selbstherrschaft habe viele Generationen lang auf der politischen Rechtlosigkeit des Adels und der sozialen Rechtlosigkeit der Bauern beruht. Dies habe der Monarchie das gefährliche Gefühl vermittelt, von der Gesellschaft völlig unabhängig zu sein.
Dadurch sei ein gefährlicher Teufelskreis in Gang gesetzt worden, setzt Struve seine Ausführungen fort. Die von den Staatsangelegenheiten ferngehaltenen Adeligen hätten antistaatliche Ressentiments entwickelt, die in einer besonders radikalen Form bei der revolutionären Intelligencija auftraten, die sich ursprünglich aus dem Adel rekrutierte. Diese Ressentiments hätten allmählich begonnen, auch die Bauern zu beeinflussen und sie zu einer radikalen Auflehnung gegen den Staat anzustacheln. Und so habe sich der Kreis geschlossen. Die sich gegenseitig bedingenden Laster der russischen Autokratie und der russischen Öffentlichkeit hätten einen Aufruhr verursacht, der den russischen Staat zerstörte.14
Der literarische Prolog zur Revolution
Welche Rolle spielte die russische Literatur bei der Genese der Revolution? Diesem Thema widmete der Philosoph Nikolaj Berdjaev seinen Beitrag, der den Titel „Die Geister der russischen Revolution“ trug.15
Besonders intensiv befasst sich Berdjaev mit dem Werk Fedor Dostoevskijs, der die russische Katastrophe von 1917 mit einer außerordentlichen Einfühlung vorausgesagt hatte. So durch die Beschreibung des sentimentalen moralischen Rigorismus der russischen Revolutionäre, die diese Welt, in der das Böse nicht gänzlich auszurotten sei (die Träne eines gemarterten Kindes), nicht für erhaltenswert hielten. Im Kampf gegen eine unvollkommene Gesellschaft, die das Böse zulasse, seien alle Mittel legitim, erklärt einer der Romanhelden Dostoevskijs, Ivan Karamazov. Dieser moralisierende Amoralismus, so Berdjaev, stellte Generationen lang das Credo der russischen Intelligencija dar. Eines habe sie aber nicht vorausgesehen: nämlich welche Folgen die Devise „Alles ist erlaubt“ haben würde, wenn die einfachen russischen Volksschichten sie verinnerlichten. Der moralisierende Amoralismus der Intelligencija sei nun zum Volksglauben geworden.16
Berdjaev ist voller Bewunderung für Dostoevskij als Visionär und Diagnostiker. Weniger überzeugt ist er allerdings von den therapeutischen Fähigkeiten des großen Schriftstellers. Und in der Tat, die von Dostoevskij propagierte Verklärung des einfachen russischen Volkes, eines „Gottesträgervolkes“, vermochte nicht die mächtige nihilistische Woge aufzuhalten, die den russischen Staat 1917 weitgehend aushöhlte.
Die nihilistischen Ideen verfügten aus der Sicht Berdjaevs nicht zuletzt deshalb über eine beinahe unwiderstehliche Anziehungskraft in Russland, weil sie von Denkern propagiert wurden, die zu den höchsten moralischen Instanzen im Lande zählten. Eine geradezu verhängnisvolle Rolle schreibt Berdjaev hier Lev Tolstoj zu. Dieser wohl einflussreichste russische Schriftsteller spielte für Berdjaev bei der russischen Katastrophe von 1917 eine ganz andere Rolle als Dostoevskij. Er habe sie nicht vorausgesehen, sondern mitverursacht. Als radikaler Moralist habe Tolstoj weder den russischen Staat noch die Kultur als solche akzeptiert, weil sie seiner Meinung nach auf Ungerechtigkeit und Gewalt basierten. Diese Auflehnung gegen Institutionen und Hierarchien aller Art, gegen gesellschaftliche Differenzierung und Arbeitsteilung, habe der alles nivellierenden und zerstörerischen Wut der russischen Volksschichten quasi eine höhere Weihe verliehen. Obwohl Tolstoj Gewalt verabscheute, habe sein nihilistischer Moralismus paradoxerweise zu der 1917 ausgebrochenen Orgie von Gewalt maßgeblich beigetragen.17
Die Verantwortung der Intelligencija
Der Sammelband De profundis stellte bereits den dritten Versuch der Verfechter der bereits erwähnten religiös-philosophischen Renaissance in Russland dar, den bedingungslosen Glauben der russischen Intelligencija an die Revolution in Frage zu stellen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts (1902) taten sie dies im Sammelband Probleme desIdealismus und sieben Jahre später – mit einer besonderen Vehemenz – im Sammelband Vechi (Wegzeichen), der von vielen Vertretern der russischen Bildungsschicht als eine beispiellose Provokation empfunden wurde. 1917 stellte sich indes heraus, dass die Warnungen der Vechi-Autoren durchaus begründet waren. Der Rechtswissenschaftler Pavel Novgorodcev nimmt in De profundis ausdrücklich dazu Stellung: „(Die Vechi