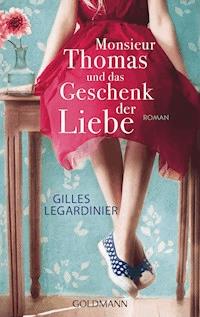5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marie hat von den Männern genug – bis sie die Briefe eines heimlichen Verehrers erhält ...
Nachdem Marie Lavigne von ihrem langjährigen Freund verlassen und aus der gemeinsamen Wohnung geworfen wurde, ist sie am Boden zerstört. Als ihr Scheusal von Chef sie am nächsten Tag auch noch demütigt, werden Marie zwei Dinge klar: Nicht nur ist die Liebe Quelle allen weiblichen Unglücks, sondern es wird auch höchste Zeit, der Männerwelt an sich abzuschwören. Doch das Leben ist voll Zauber, und Maries wunderbare Freunde lassen sie nicht lange an Bitterkeit festhalten. Und als sie geheimnisvolle Briefe von einem charmanten Verehrer bekommt, gerät ihr Entschluss, der Liebe zu entsagen, bedenklich ins Wanken ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Die junge Marie Lavigne ist am Boden zerstört. Nicht nur hat sie herausgefunden, dass ihr langjähriger Freund Hugues eine Affäre hat – nachdem sie ihn damit konfrontiert, schmeißt er sie sogar sang- und klanglos aus der gemeinsamen Wohnung. Mit gebrochenem Herzen und auch noch obdachlos, wird Marie eines klar: Die Liebe ist Quelle allen weiblichen Unglücks. Als ihr Scheusal von Chef sie am nächsten Tag demütigt, fasst sie außerdem einen Entschluss: Es wird höchste Zeit, sich an der Männerwelt zu rächen. Doch das Leben ist voll Zauber, und Maries wunderbare Freunde lassen sie nicht lange an Bitterkeit festhalten. Und als sie geheimnisvolle Briefe von einem charmanten Verehrer bekommt, gerät ihr Entschluss, der Liebe zu entsagen, bedenklich ins Wanken …
Weitere Informationen zu Gilles Legardiniersowie zu lieferbaren Titeln des Autorsfinden Sie am Ende des Buches.
GILLES LEGARDINIER
Mademoiselle Mariehat von der Liebe genug
Roman
Aus dem Französischenvon Karin Ehrhardt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die französische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Ça peut pas rater!«bei Fleuve Noir, département d’Univers Poche, Paris.
1. AuflageDeutsche Erstveröffentlichung Februar 2016Copyright © der Originalausgabe 2014 Fleuve Éditions, département d’Univers Poche, ParisCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, MünchenUmschlagmotiv: FinePic®, MünchenRedaktion: Martina KlüverMR · Herstellung: Str.Satz: DTP Service Apel, HannoverISBN: 978-3-641-16615-1V001www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
1
Es ist dunkel und ziemlich frisch. Ich zittere an der nasskalten Luft, während ich ziellos dem Verlauf des Kanals folge. Die winterlichen Temperaturen sind jedoch nicht der einzige Grund, weshalb ich den Kopf einziehe und meine Hände in den Taschen vergrabe. Vielmehr friere ich innerlich. Ich brauche gar nicht erst nach Wärme in mir zu suchen. Ich bin ein wandelnder Eisblock. Eine neue Eiszeit ist angebrochen, und ich kenne zumindest schon ein Lebewesen, das vom Aussterben bedroht ist.
Was ich hier mache? Normalerweise bin ich um diese Zeit nicht mehr unterwegs. Seit Jahren bin ich nicht mehr abends noch mal eine Runde spazieren gegangen, und vor allem nicht so Hals über Kopf aus der Wohnung gestürmt. Normalerweise hocke ich zu Hause, so wie all die anderen, die ich im Vorübergehen flüchtig durch die erleuchteten Fenster in ihren Häusern sehen kann. Normalerweise bin ich nicht so durcheinander. Normalerweise bin ich nicht allein.
Ich kenne dieses Viertel gut, und doch erkenne ich heute Abend nichts wieder. Nicht der Ort hat sich verändert, ich bin es. Es brauchte nur eine Stunde, ein einziges Gespräch, ein paar Sätze, die mich wie Pfeile trafen, um mein Leben komplett aus den Fugen geraten zu lassen. In letzter Zeit war nicht immer alles rosig gewesen zwischen Hugues und mir, aber dass es so schnell bergab gehen, ja, dass es schließlich aus und vorbei sein würde, das hätte ich mir nie im Leben träumen lassen.
Der Uferweg ist menschenleer, bis auf ein junges Liebespaar und einen Obdachlosen, der auf ein paar alten Kartons sitzt. Diese Botschaft schickt mir wahrscheinlich das Leben: Ich war mal wie das junge Mädchen, das sich verliebt an ihren Freund schmiegt, und ich werde enden wie dieser bedauernswerte Clochard. Mein Leben ist ein bodenloser Abgrund – und ich befinde mich immer noch im freien Fall.
Schnell gehe ich an dem Pärchen vorbei. Er zieht sie näher zu sich heran und flüstert ihr etwas ins Ohr. Aus seinem Mund steigen Atemwolken. Wärme. Es gibt sie also doch noch, und nicht nur in meiner Erinnerung. Mit einem gedämpften Lachen kuschelt sie sich an ihn an. Vielleicht machen sie sich über mich lustig. Bestimmt fragen sie sich, warum ich so vor mich hin trotte, allein, noch nicht mal mit einem Hund an der Leine. Wäre ich ein Mann, würden sie mich wahrscheinlich für einen Perversen halten, aber so ordnen sie mich eher in die Kategorie verrücktes Weib am Rande des Wahnsinns ein. Sie sind zu zweit, und sie haben einander. Sie fühlen sich stark genug, um dem ganzen Universum mit Herablassung zu begegnen. Sie sind unbesiegbar, weil sie sich lieben. Ich sehe das eher so: Die beiden glauben, sich zu lieben. Ob es wahre Liebe ist, stellt sich später heraus. Für diese Erkenntnis habe ich teuer bezahlen müssen. Im Moment noch gedeiht ihr Glück auf der dünnen fruchtbaren Humusschicht der Unschuld, doch wenn die zarten Wurzeln ihrer Liebe weiter in die Tiefe dringen, wird sie dort nichts finden, was sie nährt, und sie wird zugrunde gehen. Jedenfalls ist es mir so ergangen.
Sollte ich das Mädchen warnen? Sollte ich es auf die Gefahren hinweisen? Nein, das wäre idiotisch. Wer bin ich, um ihr das Glück des heutigen Abends zu verderben? Und wer weiß, vielleicht wird sie sich besser schlagen als ich? Ich bin wirklich ein verrücktes Weib am Rande des Wahnsinns.
Ich weiß nicht warum, aber plötzlich überkommt mich die Lust, auf der Umrandung des Uferwegs entlangzulaufen, auf den länglichen behauenen Steinen, die den Kanal einfassen. Normalerweise tun Kinder solche Dinge: Sie strecken die Arme aus wie Seiltänzer auf einem imaginären Seil und stellen sich vor, sich in ein großes Abenteuer zu stürzen, ihr Leben über dem tiefsten aller Abgründe zu riskieren. Meine Neffen taten dies oft. Ich bin eigentlich zu alt dafür. Was mir aber in dem Moment egal ist. Schließlich befinde ich mich am Rand eines der schwindelerregendsten Abgründe, auf dessen Grund mein Leben zu zerschellen droht.
Wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, muss ich zugeben, dass meine Beziehung mit Hugues immer schon kompliziert war. Und doch war am Anfang alles traumhaft schön. Wie im Märchen: die erste Begegnung, der Funke, der überspringt, zwei Wesen, die sozusagen inmitten von Blumen tanzen und singen und sich an den Händen halten. Das war, bevor wir uns tiefer in den Wald hineinwagten.
Ganz am Anfang war er charmant, wir lachten viel, waren leidenschaftlich, konnten nicht genug voneinander kriegen, hatten so viel, was uns verband. Ich bekam Blumen, heiße Blicke, freute mich, wenn er es nicht erwarten konnte, mich wiederzusehen. Wenn er mich in seine Arme nahm, dachte er nur an mich. Himmel, wie sehr ich das liebte!
Wir machten viele nette Wochenendausflüge, zum Skilaufen, ans Meer, ins Ausland, manchmal mit Freunden – wenn, dann aber nur mit seinen. Das Drumherum war mir ziemlich egal; solange er da war, an meiner Seite, fühlte ich mich wohl. Ich mochte es, auf ihn zu warten, wenn er spät nach Hause kam, ich mochte es auch, seine Kleider wegzuräumen oder ihm sein Lieblingsessen zu kochen. Was nicht heißen soll, dass ich unterwürfig war. Ich fand es einfach nur schön, etwas für ihn zu tun. Dann ging die Zeit ins Land, erst Tage, dann Wochen, dann Monate. Wir haben alle unsere Freunde heiraten sehen. Es wurde getanzt, es wurde gelacht, man hat Beifall geklatscht, aber nicht für uns. Schließlich haben wir vergessen, dass Tage Stunden enthielten und Jahre Monate. Wir funktionierten wie ein Dieselmotor, ohne große Beschleunigung, immer gleichmäßig im Takt. Nur der Kilometerstand wuchs. Die Zeit raste dahin, und nichts schien sich zu ändern. Man nannte uns die ewigen Verlobten. Von wegen! Ich hätte mich liebend gern mit einem Ring an ihn gebunden, aber Hugues fand immer einen guten Grund, um es zu verschieben, um noch zu warten, um nicht den nächsten Schritt zu wagen. Ein neuer Job, für den er sich ins Zeug legen musste, das viele Geld, das die Feier kosten würde, die Sinnlosigkeit solch eines formalen Akts »für Leute, die sich so sehr lieben wie wir«. Ja, genau. Wir drehten uns im Kreis. Mein Bauch blieb trostlos flach, seiner nicht. Andere bekamen Kinder, und wir lebten immer noch einfach so zusammen wie Studenten. Nichts entwickelte sich, und ich glaube, im Grunde war dies das Schlimmste. Kein Ziel vor Augen zu haben, nur die Vision eines auf das übernächste Wochenende begrenzten Lebens. Jedes Mal, wenn ich von der Zukunft sprach – ein vager Begriff – oder übers Heiraten – ein ungehöriges Wort –, fand er einen ausgezeichneten Grund, um die Diskussion abzukürzen. Am Ende redeten wir nur noch über Alltägliches: Einkäufe, Schlüssel, Fruchtjoghurt, Filme, was noch im Kühlschrank ist, wann das Auto zur Reparatur muss. Alles, was das Leben ausmacht, außer dem Wesentlichen.
Und dann erschien Tanya wie ein dem Paralleluniversum entsprungener böser Geist. Ich habe es nicht kommen sehen. Es war Emilie, die mich darauf hinwies. Eines Abends, nach einem Essen mit Freunden, flüsterte sie mir zu: »Wenn mein Freund so über die Witze einer anderen Frau lachen würde, wäre ich vorsichtig.« Das war ich dann auch, aber zu spät. Die beiden trieben es schon miteinander, meist dienstagabends. Was war ich doch für eine dumme Nuss. Eine gutgläubige Gans, die sich einen Bären aufbinden ließ.
Als ich Hugues darauf ansprach, meinte er nur, ich hätte eine blühende Fantasie. Er nahm mich in seine Arme, sprach über uns. Er wagte es, mir in die Augen zu sehen und mich dabei anzulügen. Wenn ich nur daran denke … Und wisst ihr was? Ich dumme Kuh habe es geglaubt! Beziehungsweise, ich habe es, auf Teufel komm raus, glauben wollen. Frauen neigen wohl dazu, sich auf ihr Gefühl zu verlassen und die Tatsachen auszublenden. Männer wissen das genau und setzen auf diese Karte. Sie behaupten, das sei unsere Stärke. In dem speziellen Fall war es das Gegenteil. Auf diese Weise haben wir noch ein paar Monate so weitergemacht, nebeneinander, aber nicht mehr miteinander.
Jeden Abend, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, hatte ich einen Kloß im Hals und Tränen in den Augen. Als ich zufällig auf eine SMS von Tanya stieß, haute es mich buchstäblich um. Ich war so was von angewidert, fühlte mich verraten und verletzt. Keine hundert Zeichen. Drei Sekunden, um es zu lesen, ein ganzes Leben, um sich davon zu erholen. Es war nicht nur der Beweis für Hugues’ Untreue, es war ein Schlag ins Gesicht. Ich konnte es nicht über mich bringen, darüber mit Emilie und noch weniger mit meiner Mutter oder meiner Schwester zu reden. Diese wenigen Worte trafen mich wie eine Kugel mitten in die Brust. Sie drang ein, trat aber nicht wieder aus. Vielmehr wanderte sie bei jeder Bewegung, die ich machte, ein Stück näher zu meinem Herzen hin. Und letzten Montag erreichte sie schließlich ihr Ziel.
Als ich nach der Arbeit in die Wohnung kam, war ich entschlossen, das Geschwür aufzuschneiden und das Problem mit Hugues aus der Welt zu schaffen. Ich hatte keine Kraft mehr, den Schein aufrechtzuerhalten. Ich sagte ihm, ich wüsste Bescheid, ich erklärte ihm, wie sehr ich litt, dass ich bereit war zu vergeben, aber dass ich von ihm erwartete, absolut ehrlich zu sein, damit wir einen Neuanfang machen konnten. Ich habe etwas gefaselt von wegen: »Die Liebe ist nur für den Preis der Wahrheit zu haben.« Ein hübscher Spruch! Doch was dann kam, war eine Shakespeare-Tragödie, bloß spielte sie in einer Dreizimmerwohnung ohne Balkon. Dass ich ihn quasi überführt hatte, schien ihn nicht weiter aus dem Konzept zu bringen. Er ließ sich ohne ein Wort aufs Sofa fallen, legte den Kopf nach hinten und seufzte. Ich stand in der Küche in der Ecke, zitterte am ganzen Körper und hing an seinen Lippen. Er ließ sich Zeit mit der Antwort: »Hör zu, Marie. Es ist gut, dass du das Thema anschneidest. Ich glaube, wir sind am Ende unseres gemeinsamen Wegs angekommen. Ich will nicht mehr so weitermachen. Das Leben, das ich gerade führe, gefällt mir nicht. Du und ich, das passt nicht mehr. Es ist besser, wenn wir einen Schlussstrich ziehen. Aber lass es uns positiv sehen: Ein Weltuntergang ist das auch wieder nicht. C’est la vie! Lass uns versuchen, wie Erwachsene damit umzugehen.«
Es war schlimmer als ein Fausthieb ins Gesicht. Und bevor ich etwas darauf sagen konnte, fügte er hinzu: »Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber ich fände es prima, wenn du hier in ein paar Tagen ausziehen würdest. Da du schon Tanya angesprochen hast – es ist mir ernst mit ihr. Und schließlich ist es meine Wohnung.«
»Das Leben, das er gerade führt, gefällt ihm nicht«, und das, obwohl er immer alles allein entschieden hat, ohne mich jemals nach meiner Meinung zu fragen und mich jahrelang von den Menschen, die ich liebte, ferngehalten hat. Die Abfahrt des Zugs steht unmittelbar bevor, er wird aber ohne mich losfahren. »Die Begleitpersonen der Reisenden werden gebeten, den Zug zu verlassen. Achtung, die Türen schließen.« Ich habe keine Fahrkarte mehr.
Wisst ihr, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe? Ich hoffe für euch, ihr wisst es nicht. Ein gebrochenes Herz wünsche ich keinem. Es wird ja oft mit einem Beben oder mit einer Naturkatastrophe verglichen, aber das hier, das war der Urknall. Jedes Molekül meines Seins wurde pulverisiert und in alle Winkel des Universums verstreut. Mein Herz ist ein schwarzes Loch, und die anderen Körperteile machen sich gut als Planeten.
Von da an sprach Hugues mit mir nur noch wie mit einem Flüchtling in einem fremden Land, der die Sprache des Gastlandes nicht versteht, alles versetzt mit ebenso freundlichem wie geheucheltem Lächeln. Er gab Sätze von sich, die nach großen Prinzipien klangen und sein schlechtes Gewissen betäubten. »Es hat einfach nicht sein sollen«, »Wir haben viel Schönes miteinander erlebt, lass uns ein neues Kapitel aufschlagen, ohne die Seiten auszureißen«, »In ein paar Jahren werden wir zusammen darüber lachen können« … Wem will er damit etwas vormachen? Und wie kann er es wagen, den Spruch »Lass uns wie Erwachsene damit umgehen« anzubringen? Er, der nur dem Aussehen nach erwachsen ist! Mistkerl … All die Jahre nur leere Versprechungen. Dabei hat er echt Glück gehabt: Wäre ich nicht so niedergeschlagen gewesen, hätte ich ihn auf der Stelle umgebracht. Aber es scheint mir wieder besser zu gehen, denn ich fange an, an dem Gedanken Gefallen zu finden.
Jedes Mal, wenn er etwas zu mir sagte, jedes Mal, wenn ich ihn sah, erlebte ich einen weiteren Angriff auf mein bereits besiegtes und in den Boden gestampftes Selbstwertgefühl. Seine Worte waren wie Geschosse, seine Blicke wie zwischen Blumen versteckte Flammenwerfer, und seine Gesten wie heimtückische Landminen, die mich jederzeit unerwartet niederstrecken konnten. Ich bin am Ende. Eine Ruinenlandschaft, zu oft bombardiert. Es liegt kein Stein mehr auf dem anderen, es gibt kein Mauseloch mehr, in das meine zerfetzte Seele fliehen könnte. Nach und nach haben sich zwei Gefühle meiner bemächtigt, die sich wie Geier um meinen Kadaver streiten: Schmerz und Wut.
Unsere »Aussprache« hat vor drei Tagen stattgefunden. Seitdem fühle ich mich wie ein Atomkraftwerk, das außer Kontrolle gerät. Die Lämpchen an der Tafel blinken in panischem Rot, der Druck steigt, der Zeiger zittert im schraffierten Bereich der Skala, die Ingenieure rennen durcheinander, jedoch vergeblich: Die Temperatur des Reaktors kann nicht gesenkt werden. Die ganze Gegend muss evakuiert werden, denn es wird gewaltig knallen.
Es bleiben mir noch vier Tage, um meine Kartons zu packen und das zu verlassen, was einmal unser Zuhause war. Unterm Strich habe ich nicht viel einzupacken. Doch! Da ist das Sofa. Wenn ich daran denke, dass dieser Scheißkerl sich auf MEINEM Sofa gemütlich niedergelassen hat, um mir das Ende unserer Beziehung zu verkünden. Typisch! Ich habe das Stück von meinem ersten Gehalt bezahlt, aber er war es, der es ausgesucht hat.
Ein Problem ist, dass ich im Moment nicht weiß, wohin ich gehen soll. Ich kann nicht zu meiner Mutter zurück. Sie würde mir alle paar Minuten mit ihrem Gerede in den Ohren liegen, von wegen sie habe es kommen sehen und dass Hugues schon immer ein unsympathischer Knilch gewesen sei. Das brauche ich nicht. Wenn ich mir ihre eigene Liebesgeschichte mit meinem Erzeuger ansehe, dann weiß ich ohnehin nicht, welche guten Ratschläge sie mir geben könnte. Und meine Schwester hat mit ihrer eigenen kleinen Familie genug zu tun; ich kann mir nicht vorstellen, ihr mit meinen fünfzig Kleenex-Schachteln fürs Ausheulen auf den Pelz zu rücken. Nur noch vier Tage, und dann heißt es: Hotel und Möbellager. Dieses Monster! Emilie hat mir zwar schon angeboten, bei ihr zu schlafen, aber das ist auch keine Dauerlösung. Ich will nicht von Wohnung zu Wohnung irren wie eine Schiffbrüchige, allein, Zeugin des Glücks und der Hoffnungen anderer, ohne das eine oder das andere zu besitzen.
Das Licht der Straßenlaternen auf der anderen Seite des Kanals spiegelt sich in seinen glatten Fluten wider. Es gab Zeiten, wo ich dieses Bild als schön empfunden hätte. Heute Abend kann ich nichts damit anfangen. Ich bin leer. Ich bin immer ein nettes, braves Mädchen gewesen, habe immer gewartet, bis ich an der Reihe war. Von klein an wurde mir eingetrichtert, niemals Wellen zu schlagen, erst an seinen Nächsten zu denken und dann an sich selbst. Und mit welchem Ergebnis? Ich habe den Kürzeren gezogen, mich von Hugues reinlegen lassen. Ich habe unwiederbringliche Jahre meines Lebens mit ihm vergeudet. Und hier stehe ich, an diesem Abend, von einem Gefühl der Einsamkeit überwältigt, das ich nur in schwedischen Filmen für möglich gehalten hätte.
Ich hebe den Blick zu den Sternen. Das könnte als eine verträumte Pose verstanden werden, aber die Wahrheit ist, dass ich den Kopf vor allem deshalb nach hinten lege, um die Tränen zurückzuhalten. Wenn ich mich vorbeuge, ein kleines bisschen nur, werden sie wie ein Wasserfall hervorschießen. Also sehe ich mir die Sterne an, die mir im Übrigen piepegal sind.
Und da erhalte ich die zweite Botschaft, die mir das Leben sendet: Man sollte die Sterne nicht gering achten. Als ich den Blick zum nächtlichen Himmel erhob, haben sich, ich weiß nicht wie, plötzlich meine Füße verknotet, und ich verlor das Gleichgewicht. Wie gesagt, ich stand auf der Uferkante, am Rande des Abgrunds – und da ist er, der Absturz, der ultimative Fehltritt. Mein Freiflug endet mit einem großen Platsch, begleitet von einem lächerlichen Schrei: mein ganzes absurdes Leben, in zwei Geräuschen zusammengefasst. Dumm wie Brot fliege ich in den Kanal.
Es ist Ende Januar, und ich konnte wohl kaum damit rechnen, angenehme Badetemperaturen vorzufinden, was sich leider auch bewahrheitet: Das Wasser ist eiskalt. Zwei Grad weniger, und auf der Oberfläche hätte sich eine Eisschicht gebildet, und ich hätte mir obendrein noch die Zähne ausgeschlagen. Ich schnappe nach Luft und verschlucke mich. Schmeckt ein bisschen wie die Suppe von Großmutter Valentine. Normalerweise kann ich ganz gut schwimmen, aber mit dem Mantel komme ich mir vor wie ein afghanischer Windhund in der Springflut. In meiner Panik lasse ich meine Handtasche los. Wie idiotisch! Plötzlich höre ich ein weiteres Platschen. Wie schrecklich! Ohne es zu wollen, hab ich eine beispiellose Welle kollektiver Selbstmorde in Gang gesetzt. Noch eine verratene Frau? Eine schlechte Welt ist das! Wenn das so weitergeht, wird der Kanal bald voll von verzweifelten Frauen sein, denen das Leben übel mitgespielt hat. Aber nein, wie dumm von mir! Es ist bestimmt der junge Mann, der, in der Absicht, seine Freundin zu beeindrucken, ins Wasser gesprungen ist, um mich zu retten. Wie wunderbar! Wir sind doch eine nette Spezies, alles in allem! Diese menschenfreundliche Tat rührt mich, sie hat was Erhabenes. Inzwischen hat sich mein Mantel komplett mit Wasser vollgesogen und wiegt an die zwei Tonnen. Es fällt mir schwer, meine Arme zu bewegen. Ich drehe mich im Wasser, um meinen Retter willkommen zu heißen. Aber was ist das? Ich verstehe nicht: Er steht am Ufer neben seiner Freundin. Ich glaube, die beiden lachen. Verdorbenes Pack! Was war es dann für ein Platschen? Ein Kerl, der im Schutz der Dunkelheit seine alte Waschmaschine entsorgt? Mafiosi, die eine Leiche im Kanal versenken? Ein Meteorit?
Plötzlich, zwischen zwei chaotischen Schwimmstößen, sehe ich einen zweiten Schwimmer. Aber wieso steigt er schon wieder aus dem Wasser, obwohl er mich noch gar nicht gerettet hat? Und was hält er da in seinen Händen? Ich glaube es nicht! Es ist der Penner, der mit meiner Handtasche abhaut! Eine ungeahnte Kraft steigt aus den Abgründen meiner verdammten Seele auf. Ich mutiere augenblicklich zur Furie. Ich verschlucke mich, spucke das Wasser sogleich wieder aus, aber ich schwimme jetzt wie eine Olympionikin. Meine Wut treibt mich vorwärts. Ich habe die Nase gestrichen voll von den Männern! In welchem Zustand man sich auch immer befindet, sie bringen es fertig, daraus ohne jeden Skrupel Profit zu schlagen. Sieht man gut aus, wird man angebaggert. Ist man halb abgesoffen, wird man ausgeplündert! Nur keine falsche Scheu: Vom Schwein ist alles fein!
Der Obdachlose ist inzwischen aus dem Kanal geklettert. Ich bin dicht hinter ihm, ziehe mich an den Steinen hoch und robbe auf dem Bauch hinaus. Ich habe einen Schuh verloren. Der Mann versucht zu fliehen, aber ich lasse keinen Abstand aufkommen. Trotz Humpelns erwische ich ihn. Ich packe ihn an seiner Jacke, stoße einen tierischen Schrei aus und werfe ihn mit einer Wucht zu Boden, die ich bei mir nicht für möglich gehalten hätte.
»Geben Sie mir sofort meine Tasche wieder! Schämen Sie sich eigentlich nicht?«
»Aber Sie wollten doch sterben! Wozu brauchen Sie da noch eine Handtasche?«
Ich bin geplättet. »Wie kommen Sie drauf, dass ich sterben wollte?«
»Wenn man so ein Gesicht zieht und sich in den Kanal schmeißt, bedeutet das meistens nicht, dass man Erdbeeren pflücken will!«
»Ich war deprimiert und bin ausgerutscht, das ist alles.«
»Das kannst du deiner Oma erzählen, Schätzchen.«
Ich glaube, er hat die Mordlust in meinen Augen blitzen sehen, denn er hebt seine Hände schützend vor sein Gesicht. Aber das reicht bei Weitem nicht. Wie heißt es so schön? Man solle niemanden schlagen, der am Boden liegt. Heute Abend kommt man bei mir mit solchen Sprüchen jedoch nicht weit. Ich beuge mich über ihn und hau ihm eine, dann ein zweites Mal und noch einmal. Das ist nicht gut, tut aber gut.
Meine Tasche hat er schon lange losgelassen. Aber wenn er glaubt, dass er so leicht davonkommt … Ich schreie ihn aus voller Lunge an: »Ich hab die Schnauze voll von euch Typen! Gestrichen voll! Ich hab genug von eurer Hinterhältigkeit! Ihr werdet es mir büßen!«
Das Jüngelchen und sein Liebchen fliehen Hals über Kopf. Das verrückte Weib am Rande des Wahnsinns prügelt sich mit einem Penner. Bestimmt ein Streit unter Suffköpfen, denken sie sich … Das ist nicht fair: Ich hab doch gar nichts getrunken. Das Echo meiner Stimme schallt noch im ganzen Viertel. Hier bin ich, nass bis auf die Knochen, schwankend, erschöpft, und fasse einen Entschluss, den ich, ich schwöre es, nie mehr zurücknehmen werde: Ich werde den Männern nichts mehr durchgehen lassen. Ich stelle den Zähler auf null. Ich reiße das Steuer herum. Hugues, dieser Mistkerl, wird für seine Schandtaten bezahlen. Jeder Spieler hat tausend Ohrfeigen frei. Ich werde mich für alles rächen. Da nicht zu erwarten steht, dass das Glück von einem imaginären Himmel auf mich herniederregnet, werde ich das bisschen, das mir zusteht, in den Tiefen der Hölle suchen. Die nette Marie ist tot, ertrunken in diesem Kanal. Eine böse Marie ist daraus emporgestiegen. Ihre Frisur ist im Eimer, und sie hat nur noch einen Schuh, aber wen kümmert das schon. Ich werde mich revanchieren. Rache ist süß – zuckersüß sogar. Die Wut erstickt mich, der Hass verzehrt mich.
2
Hallo, Marie! Was ist denn mit dir los? Du siehst ja furchtbar aus!«
Ja, hier stehe ich, die Pech-Marie, der das gestrige Abenteuer noch ins Gesicht geschrieben steht. Petula ist das erste menschliche Wesen, das mich nach meinem Tauchgang im Kanal anspricht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich darüber freuen soll. Petula ist Empfangsdame bei der Firma, bei der ich arbeite. Mit vollendeter Anmut erhebt sie sich von ihrem Stuhl, der ein Quietschen von sich gibt, und lehnt sich über die Empfangstheke, um festzustellen, ob ich unten genauso jämmerlich aussehe wie oben. Dabei habe ich alles versucht, um mich einigermaßen herzurichten, ehrlich. Ohne jede Scheu, mit der Treuherzigkeit jener, die in ihrer eigenen Welt leben, beäugt sie mich von Kopf bis Fuß und setzt sich wortlos wieder hin, mit verzogenem Mund, der Bände spricht. Als Nächstes macht ihr Stuhl einen Schwenk, und sie vertieft sich in ihren Computerbildschirm, als hätte ich mich in Luft aufgelöst. Sie sitzt da und liest seelenruhig ihre Mails. Sie hat mich einfach vergessen, abgehakt. Petula hat die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs.
Ich mache einen Schritt auf den Empfangstresen zu, in der Hoffnung, dass sie kapiert, dass es einen Grund geben müsse, weshalb ich immer noch da bin, aber keine Chance. Ihre Finger klappern auf der Tastatur, während sie ihre Mails beantwortet. Ich weiß, sie macht diesen Job nur so lange, bis sie was Besseres findet, aber trotzdem … Petulas wahre Leidenschaft ist der Tanz. Sie tanzt ununterbrochen, Tag und Nacht, und träumt davon, ein Star zu werden. Vor zwei Monaten übte sie in der Empfangshalle eine Choreographie aus Schwanensee und gerade, als sie eine Pirouette drehte, klingelte das Telefon, und sie stieß vor Schreck mit dem Handgelenk gegen den Garderobenständer. Sie wird garantiert verlangen, dass der Eingangsbereich vergrößert und mit Parkett ausgelegt wird und außerdem Wandspiegel und Ballettstangen angebracht werden. … Wie komme ich plötzlich auf so einen Blödsinn?, frage ich mich. Als ob ich nicht andere Sorgen hätte.
»Petula, entschuldige bitte …«
Sie schreckt auf. Unter ihrem Pferdeschwanz scheinen Sprungfedern zu sein.
»Hallo, Marie!«
Sie sieht zu mir hoch und erstarrt plötzlich. »Also, das ist sonderbar. Du siehst haargenau so aus wie gestern. Es ist verrückt, aber man könnte meinen, du hast dich vierundzwanzig Stunden lang nicht von der Stelle bewegt!«
Ich bin geplättet. Das ist schon das zweite Mal in zwölf Stunden. Ich ende noch als Flunder. Trotzdem mache ich mir ein bisschen Sorgen um unsere Petula. Das kommt bestimmt von ihren vielen Pirouetten. Die Zentrifugalkraft wird wahrscheinlich sämtliche Neuronen gegen ihren Schädel gepresst haben, bis unter die Haarwurzeln. Ich beschließe zu tun, als wäre nichts gewesen, und komme direkt zur Sache: »Hallo, Petula. Ich habe mein Namensschild verloren. Kannst du mir mal so ein Ersatzding geben?«
»Ich muss nur einen Begründungsbogen ausfüllen. Weißt du noch, wo du es verloren hast?«
»Schreib einfach, es liegt auf dem Grund des Kanals, oder, der Obdachlose hat’s behalten, oder, der Hund, der hinter mir her war, hat’s gefressen.«
Sie kichert. Sie glaubt, ich mache Witze. Wenn es nur so wäre … Sie zwinkert mir zu. »Mach dir keinen Kopf. Ich schreibe, du hast es auf dem Weg zur Arbeit verloren. Kein Problem. Das schreibe ich jedes Mal, außer für Pierre, als sein Haus abgebrannt ist. Da hab ich geschrieben, es sei geschmolzen.«
Sie zieht eine Schublade auf und holt daraus ein neues Schild hervor. »Da muss noch dein Foto rein.«
»So wie ich gerade aussehe, mache ich besser eine Zeichnung.«
Ich bin im Begriff zu gehen. Wäre ich in Form, hätte ich versucht, auf meinen Fußspitzen trippelnd und mit über meinem Kopf gerundeten Armen die Halle zu verlassen. Da springt Petula auf. »Ach! Marie? Ich hab’s fast vergessen! Supermega wichtig: Monsieur Deblais erwartet dich in seinem Büro!«
Auf die eine Katastrophe mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an. Der Chef erwartet mich gerade an dem Tag, an dem ich zum allerersten Mal eine halbe Stunde zu spät komme. Mal wieder typisch. So war es schon in der Schulzeit: Wochenlang brav wie ein Engelchen und keiner sieht es, aber an dem Tag, an dem ich die Grimasse des Jahrhunderts schneide oder einen Spruch raushaue, den ich besser für mich behalten hätte, öffnen sich wie durch ein Wunder die Vorhänge, die Scheinwerfer und die Mikrofone gehen an, und ich finde mich live vor zehn Millionen Zuschauern wieder! Das Glück hat mich vielleicht im Stich gelassen, doch das Pech ist mir, Gott sei Dank, treu. Der heutige Morgen ist der Beweis. Es fehlte nur noch der schurkische Deblais, um dem Tag einen richtig miesen Start zu geben.
Ein Lieferant materialisiert sich im Empfangsbereich. Nach einem teilnahmslosen Gruß beginnt er sofort, die Kartons im Eingangsbereich aufzuschichten. Petula regt sich auf: »Was soll das? Die können da nicht bleiben. Wenn mal einer ein bisschen Stretching machen will, könnte er sich verletzen!«
3
Ich hoffe, Deblais will mir nicht mit Nichtigkeiten auf den Nerv gehen, weil, in dem Zustand, in dem ich gerade bin, könnte ich seine kleinen krummen Manöver eventuell schlecht vertragen.
Ich kann es kaum glauben, aber ich bin schon seit zehn Jahren bei dieser Firma. Vieles hat sich inzwischen verändert. Ich gehe durch den Flur zwischen den Büros. Die Türen sind geschlossen, doch durch die verglasten Wände sieht man alles, was sich dort abspielt. Ich grüße die Kollegen, das heißt die, die mich bemerken. Dann bleibe ich vor Emilies Zimmer stehen. Sie telefoniert gerade, aber ich mache trotzdem die Tür auf und stecke meinen Kopf hinein. Sie lächelt mir breit zu, während sie sich weiter auf Englisch mit ihrem Gesprächspartner unterhält. Sie zeigt auf den Hörer und verdreht die Augen, ohne dass es ihrem freundlichen Ton anzumerken wäre. Ich zeige in den hinteren Bereich des Büroflurs und artikuliere lautlos: »Deblais will mich sprechen.«
Dann lege ich meine Hände um meinen Hals und stelle pantomimisch Erwürgtwerden dar. Sie lacht lautlos und gibt mir zu verstehen, dass wir uns später sehen werden.
Emilie ist für mich wie eine Schwester. Ein Glücksfall. Nie zuvor habe ich mich so gut mit jemandem verstanden, mit keiner anderen Freundin. Es kommt mir vor, als würden wir uns aus dem Kindergarten kennen. Ich glaube, wenn sie kündigen würde, hätte ich nicht mehr den Mumm, hier weiter zu arbeiten, vor allem in der jetzigen Zeit. Wir haben fast zeitgleich bei Dormex angefangen. Damals arbeiteten hier noch mehr als dreihundert Leute. Die von uns verkauften Luxusmatratzen wurden in der Fabrik direkt hinter dem Verwaltungsgebäude gefertigt. Es war viel los, die Büros waren vielleicht altmodisch, aber keine Tür war verschlossen. Es ging zu wie in einem Bienenstock, man fühlte sich einer riesengroßen Familie zugehörig, draußen fuhren in einem fort die LKWs vor, in der Fabrik ratterten die Maschinen, und in den Büros klingelten die Telefone. Die besten Hotels der Welt sowie anspruchsvolle Privatkunden bestellten unsere superbequemen, in Handarbeit gefüllten und genähten Matratzen. Sogar die Königin von England schlief auf einem unserer Produkte! Wir waren eines der Flaggschiffe der französischen Industrie. Wir hatten Modelle mit Federkern, aus Kaltschaum, mit aufgeschäumtem Latex und, für die verwöhnten Kunden, mit Mohair- oder Alpakabezug. Sie alle wurden hier entworfen, entwickelt, produziert und in die ganze Welt verschickt. Damals war unser Motto: »Vertrauen Sie uns Ihre Nächte an – und Sie werden Ihre Tage genießen!«
Als ich hier anfing, sah ich mir mit Emilie oft die Adressaufkleber der versandfertigen Lieferungen an – und die Fantasie ging auf Reisen: nach New York, Hong Kong, Südafrika, in die Arabischen Emirate, die Paläste des Orients und sogar auf kleine Pazifikinseln … Einige Jahre später verkauften die alt gewordenen Eigentümer den Betrieb, der daraufhin in eine AG umgewandelt wurde. Der neue Aufsichtsrat beschloss prompt, die Rentabilität zu steigern – sprich, die Produktion ins Ausland zu verlagern. Die Näherinnen in Asien sind billiger als in Frankreich, die Rohstoffe dort auch. Heute haben wir eine um die Hälfte reduzierte Produktpalette, und nur noch sechsundzwanzig Angestellte sind übrig geblieben. Die Büros wurden renoviert, alles ist heller, es gibt mehr Blinkblink, überall Glas und damit weniger Privatsphäre, wahrscheinlich, weil das Vertrauen in die Mitarbeiter fehlt. Trotz der schönen Reden sind wir kein Team mehr, sondern nur Firmenangestellte. Die »Alten«, die noch einen anderen Umgang kennengelernt haben, tun sich schwer damit. Der ganze Firmenstolz ist flöten gegangen. Unser Motto heute könnte sein: »Vertrauen Sie uns Ihr Leben an – und Sie werden schneller wieder auf der Straße stehen, als Sie denken.«
Als ich bei der Firma anfing, wurde ich der Personalabteilung zugeteilt. In jener Zeit, die so weit weg scheint, als wäre es zweihundert Jahre her, bedeutete das, die Kollegen zu unterstützen, ihnen bei Schwangerschaft, Ruhestand, Scheidung, Krankheit, Weiterbildungsfragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen … wir waren für sie da. Ich wusste alles über die Leute hier, ich wusste von ihren kleinen Sorgen, von ihren Freuden. Man war offen füreinander. Ich verwaltete das Humankapital, ich war das Bindeglied zwischen der Geschäftsführung und der Belegschaft. Monsieur Memnec, der alte Chef, meinte immer, ich sei eine Krankenschwester ohne Verbandsmaterial, ein Erste-Hilfe-Kasten für die Seele. Diese Definition gefiel mir. Heute, bei den maßlosen Budget- und Stellenstreichungen, bin ich zum ferngesteuerten langen Arm der Chefetage geworden. Ich werde damit beauftragt, Sozialpläne zu verkünden und die Abgänge abzuwickeln, die nur selten freiwillig geschehen. Es ist grauenhaft. Die Fertigungshalle wurde geschlossen und komplett umgebaut; jetzt sind dort Läden und Büros untergebracht, die an andere kleine Firmen untervermietet werden. Es gibt dort ein Internetcafé, eine Relooking-Agentur, ein Sozialkaufhaus – und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Wieso werden die nicht ausgelagert? Und wenn wir schon dabei sind, am besten auf den Pluto.
Ich springe kurz in mein Büro, um meine Sachen abzulegen. Es ist das letzte vor dem »offenen Bereich«. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch behalten werde. Nur noch acht von uns haben Anspruch auf ein eigenes Zimmer, die anderen sind allesamt im Großraumbüro. Am Anfang fanden wir es gut, weil es so nach Gemeinschaft aussah, wie in den amerikanischen Filmen, wo in großen Redaktionsräumen die Wahrheit letztendlich immer ans Licht kommt. Nach nur zwei Wochen haben jedoch alle die tiefe Kluft zwischen Fiktion und Realität erkannt. Man hockt aufeinander, es gibt keine ruhige Minute mehr. Es ist sogar verboten, von einem Büroabteil zum anderen zu sprechen. Wenn die Angestellten kommunizieren wollen, müssen sie sich Mails schicken. Ein Wunderwerk an Technik und Intelligenz ganz im Dienst der Produktivität! Zweitausend Jahre Menschheitsgeschichte, und am Ende redet man nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, was der Geschäftsführung nebenbei einen Blick auf jeden Gedankenaustausch erlaubt. Wieder eine Idee von Deblais und seinem niederträchtigen Handlanger Notelho. Und mich hat man aufgefordert, dieses im Namen des sozialen Fortschritts zu verkünden. Am anderen Ende des Großraumbüros sitzt Deblais in seinem Aquarium und hat den totalen Überblick und die Kontrolle. Neben ihm ist der Ausguck von Notelho, seinem treuen Stellvertreter. Deblais und Notelho bilden das Duo infernale. Anfangs fanden wir den Vizechef noch sympathisch, wahrscheinlich wegen seines leichten brasilianischen Akzents. Sehr schnell haben wir jedoch gemerkt, dass nicht alle Brasilianer nett und charmant sind. Aber vielleicht haben wir auch nur das einzige faule Ei dieses schönen Landes erwischt. Er und Deblais sind exakt auf der gleichen Wellenlänge. Man könnte meinen, sie lieben es, einander mit einer möglichst inhumanen Idee zu überraschen. Auf Notelhos Konto geht die Idee zurück, den Raumtrenner, der vor der Kaffeemaschine stand, zu entfernen. Auf diese Weise kann man sehen, sogar in den Pausen, wer mit wem spricht und wer noch genug Energie zum Lachen hat.
Ich durchquere das Großraumbüro und grüße diskret auf dem Weg die Mitarbeiter, zu denen ich ein etwas engeres Verhältnis habe: Valerie, Florence, Malika und einige andere. Sie wagen es kaum, meinen Gruß zu erwidern. Die Stimmung hier lässt einen an einen Arbeitsraum der Gefangenen von Alcatraz denken. Der Einzige, der eine Ausnahme von der Regel darstellt, ist Florent, der Praktikant vom Marketing. Ich war es, die ihn eingestellt hat. Alle Mädels stehen auf ihn, weil er so hübsch lächelt und gerade mal zwanzig ist. Sein Sixpack, das er bei jeder Gelegenheit zur Schau stellt, ist auch nicht zu verachten; vor allem Lionel, dem Assistenten aus der Designabteilung, scheint dies nicht entgangen zu sein. Und da ist er, mein Praktikant, der mich strahlend anlächelt, mit der Dankbarkeit des Neuen, dem man eine Chance gegeben hat. Er bringt wirklich frischen Wind herein. Wie ein junger Hund rennt er jedem Ball hinterher. Er ist erst seit einer Woche da und hat sich noch nicht verbiegen lassen.
Ich stehe jetzt vor Deblais’ Büro, aber er hat mich noch nicht gesehen. Sein gemeiner Kumpan hat mich jedoch schon entdeckt und mir einen seiner schiefen Blicke zugeworfen. Er hätte sich sicher prächtig mit Hugues, diesem falschen Fünfziger, verstanden. Ich kann es mir lebhaft vorstellen, wie sie zusammen auf meinem Sofa ein Gläschen trinken und über Gott und die Welt lästern.
Als ich an die Tür zu Deblais’ Büro klopfe, sehe ich, wie er, offenbar überrascht, eine blaue Akte in aller Eile wegräumt. Zu dumm, mein Guter, dass die Glasscheiben in beide Richtungen durchsichtig sind! Ja, auch wir können sehen, was du da fabrizierst! Ich verabscheue ihn. Er ist ein überheblicher Heimlichtuer, imstande, von einem Augenblick auf den anderen das Gegenteil des eben Gesagten zu behaupten, wenn es ihm in den Kram passt. Sein größtes Talent im Beruf besteht darin, dass er seinen Job von anderen erledigen lässt und am Ende die Lorbeeren erntet, wenn es gut gelaufen ist. Um das Bild zu vervollständigen, muss man wissen, dass seine Frau und seine zwei Kinder ihn nicht daran hindern, die jungen Frauen in der Abteilung anzubaggern. Dieser Kerl hat vermutlich eine erschöpfende Analyse von den Eigenschaften erstellt, die einen schlechten Chef ausmachen, und bemüht sich nun, eine Karikatur davon zu werden. Er widert mich an. Das war schon so, bevor ich der Männerwelt den Krieg erklärt habe.
»Herein!«
Kaum bin ich in seinem Goldfischglas, reicht er mir, ohne mich eines Blickes zu würdigen, eine Akte – nicht die blaue – und brabbelt: »Seien Sie ein liebes Mädchen, und kopieren Sie mir das.«
Um mir zu verdeutlichen, dass er meine Verspätung sehr wohl registriert hat, sieht er übertrieben auf seine Armbanduhr und fügt hinzu: »Und dann seien Sie so nett, zu den Jungs aus der Qualitätssicherung zu gehen, um sie an die Versammlung morgen früh zu erinnern. Die gehen ja noch nicht einmal ans Telefon. Das geht mir auf die Nerven. Aber diesmal müssen sie da sein. Ich habe der ganzen Belegschaft etwas Wichtiges mitzuteilen, und alle haben zu erscheinen, ausnahmslos.«
Er reicht mir eine Kopie der offiziellen Einladung, die schon am Firmeneingang ausgehängt ist. »Seien Sie deutlich und bestimmt. Sollten die Männer wieder durch Abwesenheit glänzen, werde ich Sie persönlich dafür verantwortlich machen.«
Ich beiße mir auf die Lippen, damit mir nicht rausrutscht, dass er die Nachricht gefälligst selbst hintragen kann. Ich versuche einen Blick auf die blaue Akte zu werfen. Einige Blätter gucken hervor, aber nicht weit genug. Ich kann nicht feststellen, worum es geht. Deblais folgt meinem Blick und legt seinen Unterarm auf das mysteriöse Schriftstück. »Und jetzt, husch, machen Sie mir diese Kopien und dann ab zu den Verrückten. Sie haben auch so schon genug Zeit verschwendet.«
Eines Tages werde ich ihn mir vorknöpfen und genüsslich Stück für Stück auseinandernehmen.
4
In die Qualitätssicherung zu gehen kommt einer Zeitreise gleich. Ich gehe gerne zu ihnen hinüber, auch wenn es mir immer einen kleinen Stich versetzt, weil es die einzige Abteilung in der Firma ist, die nicht umgesiedelt wurde und immer noch unverändert geblieben ist. Seit der Gründung des Unternehmens ist sie in einem separaten Flügel untergebracht, der sich den Modernisierungsbestrebungen entziehen konnte. Es gibt einen eigenen Eingang und auf der anderen Seite, zur Straße hin, ein großes Tor für die ankommenden Lieferungen. Die Eisentür mit rostigen Nieten quietscht, drinnen tritt man auf rohen abgenutzten Betonboden, auf dem die Spurrillen unzähliger Karren zu sehen sind. Das kleine Brett, das über die Schwelle gelegt wurde, damit Waren auf Rollen durch die Tür gelangten, lehnt immer noch in der Ecke, wahrscheinlich seit Jahrzehnten. Die verputzten Wände haben den gleichen Gelbstich, den man früher in Turnhallen und im Eingangsbereich alter Gebäude sah. Es ist eine andere Welt, tröstlich, weil unverändert, die einem jedoch zugleich schmerzlich vor Augen führt, was vergangen ist.
Ich gehe hinein. Es ist schummrig, das schwache Licht der Glühbirnen schafft es nicht, das vorherrschende Halbdunkel zu vertreiben. Während sich meine Augen allmählich an die Lichtverhältnisse gewöhnen, habe ich das jedes Mal neue Gefühl, Ali Babas wundersame Räuberhöhle zu betreten: Regale, die bis zum Dach der Halle reichen, gefüllt mit Kisten und den Restbeständen der noch vor Ort gelagerten Matratzen, nummerierte Gänge in langen Reihen, Schilder mit Zeichen und Nummern. Ich sehe und höre keinen Menschen, auch wenn es zugegebenermaßen nur drei sind, die an diesem Ort arbeiten. Sie kümmern sich um die seltenen Versendungen, aber vor allem nehmen sie die Schaumstoffe und die Federn entgegen, die irgendwo in Asien hergestellt wurden, um zu prüfen, ob sie unseren Anforderungen genügen. Ein Stück weiter, in einem zwischen den Regalen hergerichteten Bereich, liegen auf gewaltigen Böcken drei Matratzen, die von hellen Scheinwerfern angestrahlt werden, als wären es Kunstwerke, die auf ihre Begutachtung warten. Metall- und Kartongerüche schweben in der Luft, mischen sich mit hintergründigeren Düften, Wolle vielleicht, ganz bestimmt Latexschaum. Die Gesamtmischung riecht fast so gut wie Kuchen.
»Ist da jemand?«, rufe ich hinein. »Ich bin’s, Marie, von der Personalabteilung.«
Keine Antwort. Plötzlich, irgendwo in den Gängen, ertönt Kettengerassel, und eine Stimme sagt: »Ihr wart meine besten Freunde. Ich werde euch nie vergessen. Adieu, grausame Welt!«
Ich stürze mich in irgendwelche Gänge. Das musste irgendwann so kommen: Bei diesen elenden Sozialplänen war es nur logisch, dass früher oder später ein Kollege sich das Leben nehmen würde. Ich schreie: »Springen Sie nicht! Sie haben Ihren Job nicht verloren!«.
Ich renne wie eine Verrückte durch die Gänge und halte nach dem Unglücksraben Ausschau. Als ich nach oben sehe, entdecke ich ihn plötzlich dort, wo zwei Gänge sich kreuzen. Er ist ziemlich hoch, ganz oben auf einem Regal, die Arme weit geöffnet, vor sich die Leere. Der Mann heißt Kevin. Ich glaube, er hat zwei Kinder. Eine furchtbare Tragödie. Ich kann noch nicht einmal losrennen, um ihn irgendwie aufzufangen, weil mir ein Berg aus Kartons den Weg versperrt. Und bevor ich ihm auch nur ein Wort zurufen kann, lässt er sich fallen!
Wie furchtbar: Er ist gesprungen! Er ist noch nicht ganz hinter dem Kartonstapel verschwunden, als ich mir schon das erschütternde Bild am Fuße des Regals vorstelle. Ich schließe die Augen. Aber anstatt des ängstlich erwarteten Aufpralls höre ich ein seltsames halbersticktes Geräusch und sehe das Bürschchen aufspringen und wie ein Kind herzhaft lachen.
Ich hab keine Kinder, aber ich habe mir sagen lassen, dass Eltern, die sich um eines ihrer Sprösslinge sehr ängstigen mussten, oft nichts Besseres einfällt, als dem Kind eine zu kleben, um den Stress abzubauen. Gerade jetzt kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich laufe durch das Labyrinth der Regale, umrunde die Kartonbarrikade und sehe, dass Kevin auf eine Anhäufung von Federkernmatratzen gesprungen ist.
Vor dem Matratzenberg, auf einem Empfangsteppich aus reiner Schurwolle, steht Sandro und klatscht Beifall. An seiner Seite nickt Alexandre, der neue Leiter der Abteilung, der erst vor einigen Monaten angefangen hat, anerkennend mit dem Kopf.
»Ein Superflug! Eins minus!«, ruft Sandro.
Kevin verbeugt sich vor seinem Publikum und meint maulend: »Nur eine Eins minus? Das ist aber eine strenge Benotung. Wieso keine glatte Eins?«
»Du hast dich zu früh zusammengerollt. Und an deiner Flughaltung musst du auch noch arbeiten.«
Ich traue meinen Ohren nicht. »Was soll das? Ich dachte, da bringt sich einer um!«, platze ich heraus.
Alexandre dreht sich zu mir um: »Marie! Welch eine Überraschung! Haben Sie sich verlaufen, oder kommen Sie, um uns mitzuteilen, dass man uns durch Roboter ersetzen wird?«
»Ganz und gar nicht. Ich bin gekommen, um Sie daran zu erinnern, dass Sie morgen früh unbedingt bei der Personalversammlung anwesend sein müssen.«
Ich reiche ihm den Zettel und weiche seinem Blick aus, weil er mich irgendwie verlegen macht. Er liest den Wisch, reicht ihn an seine Kollegen weiter und sagt spöttisch: »Unsere lieben Chefs werden uns sicher Gehaltserhöhungen verkünden und uns darüber aufklären, dass die Firma endlich unabhängig von den Interessen der Investmentfonds geführt wird!«
Ich versuche das Gespräch in andere Bahnen zu lenken und sage: »Es ist völlig verrückt, von so weit oben runterzuspringen. Auch wenn da Matratzen liegen, ist es immer noch gefährlich.«
Kevin hebt eine Augenbraue. »Man erwartet von uns, die Qualität mit äußerster Sorgfalt zu prüfen. Dafür setzen wir uns persönlich und mit aller Kraft ein.«
Alexandre beobachtet mich. Dieser Blick haut einen um. Ich schaffe es nie, ihm standzuhalten. Gleich als er bei uns angefangen hat, ist er mir aufgefallen. Manchmal habe ich den Eindruck, ihm schon einmal begegnet zu sein, aber ich wüsste nicht wo, und ich denke auch nicht weiter darüber nach, weil ich öfter diese Art von Déja-vus habe. Sandro zum Beispiel sieht einem Schauspieler aus einer Fernsehserie, die ich immer als Kind sah, unheimlich ähnlich. Ich habe sehr lange gebraucht, um darauf zu kommen, um wen es sich handelte. Aber er kann es nicht sein, weil der Betreffende jetzt ein alter Mann sein müsste, während Sandro eher mein Jahrgang ist.
»Ich muss jetzt wieder an die Arbeit und überlasse Sie Ihren Experimenten. Und versuchen Sie, sich nicht umzubringen.«
»Selbst wenn wir uns hier den Hals brechen«, antwortet Alexandre, »würde es niemand bemerken, es sei denn, das Lager hier wird aufgelöst.«
»Sehen Sie trotzdem zu, dass Sie morgen erscheinen, sonstspringt mir Deblais an die Gurgel.«
»Wir könnten Sie mit Matratzen abschirmen, dann kommt er nicht dran«, lacht Kevin.
Ich lächle gezwungen und verlasse das Gebäude, ungern eigentlich. Wenigstens diese drei sind ein eingeschworenes Team.
Kaum im Bürotrakt zurück, werde ich auch schon von Deblais angeblafft: »Und meine Akte, die Sie kopieren sollten? Haben Sie die vergessen?«
Kleiner Wadenbeißer. Ich stelle die Ohren auf Durchzug, höre nicht mal hin, was er mir zu sagen hat. Sicher eine Mischung aus Moralpredigt und Zurechtweisung, gewürzt mit der Androhung von Strafmaßnahmen. Wieder ein Kerl, der mir sagen möchte, dass ich nicht die richtige Wahl bin, dass unser gemeinsamer Weg hier endet – dass er mir hiermit den Laufpass gibt. Ich kann nicht mehr. Ich würde nur zu gerne angemessen reagieren können, aber ich habe keine Kraft mehr. Total entnervt renne ich zum Kopierraum und bete zum Himmel, nicht vor den Kollegen in Tränen auszubrechen. Wenn die Würde eines Menschen von einer offenen oder geschlossenen Tür abhängt, kann es nur bedeuten, dass es einem ziemlich dreckig geht.
5
Ich weiß nicht, wie lange ich schon in diesem Kopierraum bin, und wann ich mich auf den Boden gehockt habe, mit dem Rücken zum Kopiergerät. Der Ausdruck »tief gesunken« ist heute extra für mich neu erfunden worden. Ich spüre die Wärme der Maschine – so viel schon mal auf der Haben-Seite. Wenn sie mich nur in ihre Arme schließen könnte …
Es fällt mir schwer, zwei zusammenhängende Gedanken zu fassen. Im Wald der Neuronen, mit denen mein Gehirn angefüllt sein sollte, muss ich mich wohl gerade auf einer Lichtung befinden. Ich bin unfähig aufzustehen. Die Tür geht auf, und Emilie steht vor mir. Als sie mich auf dem Boden kauern sieht, macht sie schnell die Tür hinter sich zu.
»Was machst du denn hier? Du siehst aus wie ein angeschossenes Reh. Warum bist du nicht zu mir gekommen?«
»Deblais hat mich in die Qualitätssicherung geschickt. Als ich da war, ließ sich Kevin vom obersten Regal fallen, um die Sprungfedern der Matratzen zu testen, und ich dachte, er wollte sich das Leben nehmen. Als ich wieder zurück war, hat mich Deblais wegen seiner Akten angekläfft. Aber ich kann sie nicht kopieren, weil das Papier alle ist …«
Meine Augen füllen sich wieder mit Tränen. Emilie geht auf die Knie und umarmt mich. »Arme Kleine. Du bist ja mit den Nerven völlig runter. Versuch, ein paar Tage freizunehmen, um wieder auf die Beine zu kommen.«
»Und wohin soll ich gehen?«, schniefe ich. »Zu einem anderen Kerl vielleicht, der mich wieder hinauswirft? Und wo soll ich eine Krankschreibung herbekommen? Soll ich dem Arzt vielleicht sagen, dass ich mich mit einem Penner geprügelt habe oder dass ich überall Kollegen sehe, die sich umbringen wollen? Er wird mich einweisen lassen. Obwohl – dann hätte ich wenigstens ein Dach über dem Kopf.«
»Marie, es ist doch kein Wunder, dass du fix und fertig bist, bei allem, was du gerade durchmachst. Es ist brutal, aber da musst du jetzt durch. Tu dir inzwischen was Gutes. Und ich bin auch noch da.«
Sie hebt mein Kinn an und sieht mir in die Augen. Mit ihrem Daumen wischt sie mir eine Träne von der Wange, aber weitere sind schon unterwegs.
»Wo kommen die denn alle her? Aber, nur raus damit, gut so, lass dich mal so richtig gehen.«
»Ich heule im Moment so viel, dass ich nicht mal mehr Pipi machen muss.«
Und los geht’s mir einer neuen Flutwelle. Sogar mich selbst nervt es, dass ich mich nicht mehr im Griff habe. Emilie fängt an, die auf dem Boden verteilten Akten einzusammeln. »Heul so viel du willst, inzwischen mache ich dir die Kopien.«
»Es ist kein Papier mehr da, Emilie. Kein Papier. Weißt du was? Ich glaube, die Menschheit ist in zwei Lager geteilt: Es gibt Leute, die Papier nachlegen, und andere, die es nicht tun. Es ist erschreckend. Jetzt erst verstehe ich, wie die Welt funktioniert: Auf der einen Seite gibt es Leute, die aus allem nur für sich Profit schlagen wollen, und auf der anderen Seite sind die, die auch ein bisschen an ihre Mitmenschen denken.«
»Es muss dir wirklich mies gehen, wenn du über leere Papierbehälter philosophierst.«
»Das steht für was anderes, Emilie, es ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.«
»Ich an deiner Stelle würde es nicht wollen, wenn mich jemand in diesem Zustand zu Gesicht bekommt. Und behalte deine depressiven Theorien für Saufabende. Selbst wenn du nichts trinkst, würde man dich für genauso knülle halten wie den Rest der Saufgesellschaft.«
Die Tür geht auf. Es ist Patrice, der Assistent aus der Buchhaltung. Er macht ein komisches Gesicht, als er uns so sieht: ich, in Tränen aufgelöst und völlig fertig, als hätte mich ein LKW überrollt, und Emilie, auf allen vieren zwischen meinen Beinen, die Akten zusammenklaubend. Sie springt auf und stellt sich ihm in den Weg: »Das ist kein guter Moment, Patrice. Komm später wieder.«
Er will sich nicht hinausschieben lassen, aber sie gibt nicht nach. Er meckert sie an: »Ich habe hier Bilanzen, die ich kopieren muss! Für eure psychodramatischen Sitzungen gibt es die Damentoiletten!«
»Stell dir vor, der Unterschied kommt uns nur marginal vor, denn auch dort gibt es kein Papier. Also sei so nett und verschwinde!«
Sie schlägt ihm die Tür vor der Nase zu. Ich komme wieder zur Besinnung. »Weißt du was, Emilie? Ich glaube, Heulen allein wird diesmal nicht reichen, um meinen ganzen Frust auszuspülen. Ich bin am Ende, ich schaffe es nicht.«
»Ich hasse es, dich so reden zu hören. Mach bloß keine Dummheiten! Du würdest ihm damit zu sehr schmeicheln, er ist es nicht wert. Und heute Abend gehst du nicht zurück zu ihm, ich verbiete es dir. Tu dir nicht noch einen Abend mit diesem Rüpel an. Komm zu mir.«
»Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich nicht erhängen. Ich werde mich rächen. Das ist sie, meine Therapie. Ich werde ihn mir vorknöpfen und dafür sorgen, dass ihm das Lachen vergeht. Ich weiß nur noch nicht, wie.«
6
Ich weiß, es ist lächerlich, aber ich habe trotz allem gehofft, Hugues würde sich Sorgen machen, wenn ich nicht nach Hause komme. Ich habe mein Handy den ganzen Abend nicht aus den Augen gelassen. Ich holte es immer wieder aus der Tasche hervor, weil ich mir sagte, dass ich vielleicht die Vibration nicht gefühlt habe. Alles was ich wollte, war eine SMS, etwa in der Art: »Wo bist du? Ich hoffe, es geht dir gut.« Obwohl ich weiß, dass das nur der scheinheilige Versuch gewesen wäre, sich ein gutes Gewissen zu verschaffen, wäre ich doch zufrieden gewesen. Dann hätte ich nämlich die Genugtuung gehabt, ihm nicht zu antworten, ihn grausam zu ignorieren in der Hoffnung, dass er panisch werden würde vor Angst, weil er endlich verstanden hätte, was für ein riesengroßes Arschloch er doch ist. Er würde sich wahnsinnige Sorgen machen, mich in allen Krankenhäusern, Leichenhallen, Tierasylen und Zoos mit exotischen Tieren suchen, und im Morgengrauen würde er sich dann – in der Überzeugung, die wunderbare Frau, die ich bin, sei tot – vor Verzweiflung vor einen Zug werfen, und seine Überreste würden meine Initialen formen. Welch ein Zeichen des Schicksals!
Doch nichts dergleichen. Rein gar nichts. Noch etwas aus der Palette der psychologischen Foltern: Ich durfte mir falsche Hoffnungen machen, dank einer SMS meiner Schwester, die mich sprechen wollte, weil sie »eine gute Nachricht« für mich habe. Ich kann mich nicht aufraffen, sie heute Abend zurückzurufen. Obwohl ich mich natürlich frage, was diese »gute Nachricht« im Moment bedeuten könnte. Eine hochansteckende Krankheit vielleicht, die die Reihen der Männer auf unserem Planeten lichtet? Ja, das klingt gut. Morgen wird mir meine große Schwester erzählen, dass die Männer vom Aussterben bedroht sind, mit Ausnahme des Praktikanten, weil der so ein schnuckeliges Lächeln hat, und des kaufmännischen Direktors, weil er wirklich Klasse hat und diese in seine Maßanzüge und die dazu passenden Hemden investiert.
Ich hatte eine furchtbare Nacht. Ich weiß nicht, ob es wegen meiner Sorgen oder wegen des »guten« Essens war, das Emilie glaubte, unbedingt für mich machen zu müssen, um meine Laune zu heben. Wir haben viel gelacht. Wir werden heute bestimmt die gleichen Pickel im Gesicht haben und den gleichen Pesthauch verströmen, der sich trotz mehrfachem Zähneputzen hält, aber es war trotzdem super. Wenn dir jemand etwas Gutes tut, ist das einfach nur schön. Die Spaghetti mit Champignons von Emilie waren der Rettungsring, den sie mir zugeworfen hat, um mich aus dem Sumpf zu holen. Wenn ich auf der Titanic gewesen wäre, hätte ich glatt das Rettungsboot aufgefuttert.
Emilie und ich haben viel geredet. Sie hat es sogar geschafft, dass ich schallend lachen musste. Nur sie bringt so etwas fertig, wenn es mir schlecht geht. Ich glaube sogar, dass sie ihren eigenen Rekord aufgestellt hat, weil wir dermaßen viel gelacht haben, obwohl es mir so schlecht ging wie nie zuvor. Sie hat es mit den Männern auch nicht leicht. Es ist ein wahrer Hindernislauf zwischen denen, die sie wie Dreck behandeln, und denen, die in Ordnung scheinen, sich aber irgendwann nach einer anderen umsehen. Ich frage mich, ob es eine einzige Frau auf Erden gibt, die diesen Fluch brechen kann, die sich bislang noch nicht mit fiesen Kerlen herumschlagen musste? Angefangen bei den Göttinnen der Antike – überall wiederholt sich nämlich die gleiche Geschichte. Meine eigene Mutter wurde verlassen, als ich noch ein Kind war. Alle Frauen haben Probleme, aber keine hat eine Lösung. Ich sehe im Geiste alle Frauen vor mir, die ich kenne: Es gibt keine, deren Beziehung zu Männern einfach wäre. Ich glaube, wir alle schlagen uns mit diesen drei Fragen herum: Wo stecken bloß die guten Männer? Wieso sind sie nicht mit mir zusammen, vor allem an den Wochenenden? Und, wenn sie uns dann doch wie durch ein Wunder geliefert werden – manchmal durch den Transport beschädigt –, wieso liegt ihnen keine Gebrauchsanweisung bei?
Es muss sicher irgendwo eine geheime Kammer oder einen Vorrat geben, der besser bewacht wird als die Goldreserven der USA, wo die coolen Typen heimlich gelagert werden. Von Zeit zu Zeit kann der eine oder andere entkommen, lässt sich aber zwischen den Blindgängern nur schwer ausmachen. Und wenn er dann doch irgendwo seine Deckung verlässt, gibt es immer eine andere Frau, die ihn mir vor der Nase wegschnappt, und das war’s dann.
Emilie und ich müssen nicht einmal beschwipst sein, um über alles und nichts herumzualbern. Und wenn es um die Bilanz unseres Liebeslebens geht, dann kann man getrost eine große Null darunterschreiben. Noch vor einem Monat war Emilie am Boden zerstört und ich verliebt. Jetzt geht die Medaille der Verlassenen an mich, und Emilie kehrt plötzlich mit ihren kurzen Affären ins Rennen zurück. Sie könnte vielleicht sogar den entscheidenden Punkt holen. Es gibt da einen Typen aus dem Wohnhaus gegenüber, der ihr offenbar gefällt, mit dem sie aber noch kein Wort gesprochen hat. Sie hat ihn noch nicht einmal aus der Nähe gesehen, aber von ihrem Küchenfenster aus sieht er »nett« aus. Sie macht sich einen Film nach dem anderen, mit ihm in der Hauptrolle. Bei dem Glück, das wir beide im Moment haben, ist ihr Auserwählter ein Psychopath, dessen zahllose furchtbare Verbrechen bislang unentdeckt geblieben sind. Er lockt seine Opfer an, indem er durch das Fenster vom Haus gegenüber »nett« aussieht. Das macht ihn unwiderstehlich. Seine Opfer sterben wie die Fliegen. Und er hat wieder eine große Romanze in Aussicht, bei der die Frau in Würfeln im Gefrierschrank endet. Die Presse wird sich darauf genüsslich stürzen: »Er liebt sie, Stück für Stück. Mit allen Fotos und einer 3D-Brille gratis.«
Aber am Ende unseres gemeinsamen Abends, als ich mich allein auf Emilies Sofa vor ihrem ausgeschalteten Fernseher wiederfand, in dem sich das Licht der Straßenlaternen spiegelte, war ich die einzige Psychopathin weit und breit. Ich stellte mir vor, was ich alles mit Hugues anstellen könnte. Nach der Lektüre unzähliger Krimis und dem Genuss vieler hirnrissiger Fernsehserien gingen mir die Ideen nicht aus. Ich habe mir Hugues sogar als Puppe vorgestellt, der ich niedliche volkstümliche Trachten anzog und deren Arme ich in alle Richtungen verdrehte. Ich hatte genug Szenarios parat, um ihn zehnmal umzubringen. Und doch, am Ende, in der Stille der Wohnung, als ich mich in meine Decke rollte und daran festkrallte wie ein einsames Kind, das zum ersten Mal weit weg von zu Hause schlief, wurde ich von einer Traurigkeit überwältigt, die mich zum endlosen Leiden verdammte für mein zweifaches Verbrechen: dem Wunsch nach Liebe und gegenseitigem Vertrauen.
Als ich ein Teenager war, liebte ich es, bei meinen Freundinnen zu übernachten. Wir taten genau das Gleiche wie heute Abend: Wir redeten über unser Leben, über die Jungs, wir lachten, stopften uns mit unsäglichen Dingen voll und schliefen schließlich erschöpft ein. Heute Abend ist es anders. Ich bin zwar erschöpft, aber einschlafen kann ich nicht. Ich fühle mich elend, und ich habe Angst. Meine Existenz ist in den Grundfesten erschüttert. Ich hoffe wirklich, dass es die Reinkarnation gibt, weil mein jetziges Leben für mich gelaufen ist, ich aber doch den Verdacht habe, dass es irgendwo Schönes zu erleben gibt. Tja, Pech für mich, es war mir nicht vergönnt. Es ist zu spät. Ich weiß inzwischen zu viel, um noch an das Glück zu glauben. Ich mache mir nichts mehr vor. Die Liebe ist ein Riesenschwindel, eine Falle aus Wunschdenken. Ich bin die Motte, die zu dicht um die Lampe schwirrte. Ich rieche verbrannt. Auf einmal fühle ich mich mit allen Frauen und ihren Leiden verbunden. Heute bin ich eine von ihnen. Ich glaube, wenn ich mit einem anständigen Mann zusammengekommen wäre, hätte ich an die Liebe bis ans Ende meiner Tage glauben können, aber an dem Punkt, an dem ich heute bin, ist das nicht mehr möglich. Ich kenne die Kehrseite der Medaille. Ich weiß, was sich hinter den Worten verbirgt, die uns von Männern zugeflüstert werden, um uns für sich zu gewinnen. Das sind nur Köder. Ich weiß, dass wir in zwei Welten leben, die nebeneinander existieren, aber nichts miteinander zu tun haben. Die Männer zwingen uns ihre Regeln auf und halten uns mit Versprechungen auf Trab, und ihre besten Verbündeten sind unsere eigenen Hoffnungen. Sie bedienen sich unserer Träume. Wie krass ist das denn? Und dies alles nur, damit die Spezies fortlebt und sich reproduziert. Aber mit welchem Ziel? Ich weiß es inzwischen. Der Weihnachtsmann, die Zahnfee, die große Liebe und die Kobolde mit Töpfen voller Gold existieren nicht. Automechaniker, die nicht versuchen würden, alleinstehende Frauen übers Ohr zu hauen, auch nicht. Wie soll man mit diesem Wissen unbeschwert leben? Man hat keinen Spaß mehr, man schläft nicht mehr. Man sucht nach dem Schuldigen, und ich, in meine traurige kleine Geschichte verstrickt, weiß genau, wo er wohnt.
7
Entschuldige bitte, Caroline, aber ich konnte nicht früher zurückrufen. Ich stecke bis zum Hals in Arbeit und habe in zehn Minuten eine Betriebsversammlung, die bestimmt kein Picknick wird. Wie geht’s dir? Und den Kindern und Olivier?«
»Uns geht’s allen gut, danke. Unser Termin in zwei Wochen geht doch klar, oder?«
»Natürlich, ich freue mich schon, euch zu sehen.«
»Halt dich fest – ich habe eine großartige Nachricht für dich. Erinnerst du dich an Veronique, meine Freundin von der Uni, die in der Geschäftsführung einer Kosmetikfirma sitzt?«