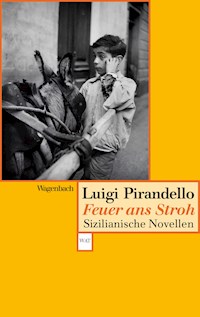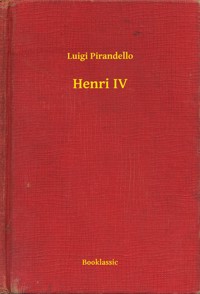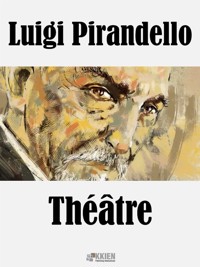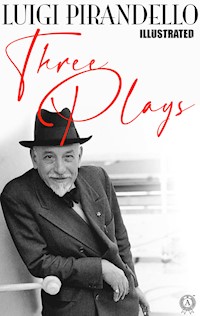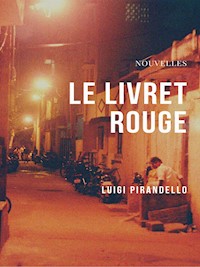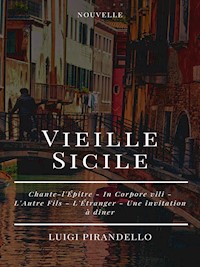8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Luigi Pirandellos reiches Novellenwerk steht in der Tradition der italienischen Novelle seit Boccaccio und enthält zugleich Bravourstücke moderner Prosa. Dieser Band vereint zehn bisher noch nicht übersetzte Novellen, die das Leben in Pirandellos Wahlheimat Rom einfangen – teils ironisch, teils melancholisch, immer hintergründig und mit überraschenden Wendungen. Pirandello führt dem Leser die italienische Gesellschaft vor Augen, ihre Charaktere, Abgründe und Sehnsüchte. Indem seine Geschichten einen unerwarteten Lauf nehmen, kehren sie auch unsere gewohnten Vorstellungen um. Dadurch werden sie trotz ihrer Erzählfreude auch zu philosophischen Miniaturen, die um Glück und Unglück, um die persönliche Identität, um Größe und Niedrigkeit des Menschen kreisen und den Leser in ihre Gedankenspiele verwickeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Luigi Pirandello
MAESTRO AMOR
Römische Novellen
Ausgewählt und übersetztvon Martin Hallmannsecker
Mit einem Nachwortvon Maike Albath
C.H.BECK textura
ZUM BUCH
Luigi Pirandellos Novellen stehen in der großen Tradition der italienischen Novelle seit Boccaccio und sind zugleich Bravourstücke moderner Prosa. Dieser Band vereint zehn bisher nie ins Deutsche übersetzte Geschichten, die das Leben in Pirandellos Wahlheimat Rom einfangen – teils ironisch, teils melancholisch, immer hintergründig und mit überraschenden Wendungen. Pirandello führt dem Leser die römische Gesellschaft vor Augen, ihre Charaktere, Abgründe und Sehnsüchte. Indem seine Geschichten einen oft unerwarteten Lauf nehmen, kehren sie auch unsere gewohnten Vorstellungen um. Dadurch werden sie bei aller Erzählfreude auch zu philosophischen Miniaturen, die um Glück und Unglück, um die persönliche Identität, um Größe und Niedrigkeit des Menschen kreisen und den Leser in ihre Gedankenspiele verwickeln.
ÜBER DEN AUTOR
Luigi Pirandello (1867–1936) ist einer der bedeutendsten Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Berühmt ist er bis heute durch Stücke wie Sechs Personen suchen einen Autor. Daneben schrieb er Romane und über 250 Novellen, die er zu dem unvollendet gebliebenen Zyklus Novelle per un’anno zusammenfasste. 1934 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
Martin Hallmannsecker ist Althistoriker und lebt in Oxford.
Maike Albath arbeitet als Journalistin für den Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur und schreibt u.a. für die NZZ und die Süddeutsche Zeitung. 2002 wurde sie mit dem Alfred-Kerr-Preis ausgezeichnet.
INHALT
AUF DEN LEIM GEGANGEN
MUSIK VON GESTERN
STEFANO GIOGLI EINS UND ZWEI
MAESTRO AMOR
EIN EINSAMER MANN
DAS NACKTE LEBEN
WER WAR’S?
LEICHT BERÜHRT
I
II
OBEN UND UNTEN
FLIEGEN
ANMERKUNGEN
NACHWORT
BIBLIOGRAFISCHE NACHWEISE
AUF DEN LEIM GEGANGEN
Luca Pelletta hätte Santi Currao am Bahnhof in Rom nicht wiedererkannt, wäre dieser nicht unter beständigem Rufen auf ihn zugekommen:
«Pelletta! Mein lieber Pelletta!»
Noch ganz benommen von der Reise schaute er ihn inmitten des schwindelerregenden Gedränges und Durcheinanders der anderen Fahrgäste eine Weile verblüfft an:
«Oh, Santi, du? Wie kommt’s, dass du so …»
«So was?»
«Quantum mutatus ab illo!»
«Abillo, hör schon auf! Die Jahre, mein lieber Pelletta!»
Die Jahre, natürlich, aber auch … Luca musterte ihn im Licht der elektrischen Beleuchtung. Die Jahre? Und diese Kleidung? Ein großer Maestro in einem solchen Hemd, in einem solchen Jackett, solchen Hosen und solchen Schuhen? Kurz, im Elend? Und dieser ungepflegte, gräuliche Bart, der auf den Wangen stärker als am Kinn wuchs? und dieses blasse, dickliche Gesicht? diese wässrigen, geschwollenen Augen? Und wie? War er etwa auch kleiner geworden?
Unter den befremdeten Blicken von Luca Pelletta weiteten sich Curraos Lippen zu einem stummen Grinsen:
«Du bist reich, mein lieber Pelletta, dir kann die Zeit nichts anhaben. Gehen wir, gehen wir! Aber versprich mir: kein Wort über das Nest, in dem ich und du das Unglück hatten geboren zu werden. Wer lebt, der lebt, wer tot ist, ist tot: davon will ich nichts wissen. Wir brauchen keinen Wagen zu nehmen: ich wohne gleich am Ende der Straße. Gib mir den Koffer oder die Kiste.»
«Nein, danke: die trage ich schon selbst; sie sind nicht schwer.»
«Lässt du dein Gepäck am Bahnhof aufbewahren?»
«Welches Gepäck?», sagte Luca Pelletta. «Ich habe sonst nichts dabei: nur Bücher und Wäsche.»
«Dann bleibst du also nicht lange?»
«Doch, warum? Vielleicht bleibe ich für immer.»
«So ganz mit leeren Händen?»
Sie gingen eine Weile schweigend nebeneinander her.
«Und deine Frau?», wagte Luca schließlich zu fragen. Currao senkte den Kopf und murmelte:
«Ich bin alleine.»
«Ist sie nicht mehr in Rom?»
«Doch, mein lieber Pelletta. Das erzähl ich dir zu Hause. Jetzt lass uns über dich sprechen. Aber nur das Wichtigste. Warum bist du nach Rom gekommen? Ich bin ein Trottel. Du hast ja genug Geld, das du aus dem Fenster werfen kannst.»
«Da täuschst du dich …», stellte Pelletta mit einem gutmütigen Lächeln richtig. «Ich habe gerade genug: also wenig; aber ich brauche auch nur wenig. Nichts aus dem Fenster zu werfen. Dafür bin ich jetzt ganz mein eigener Herr. Beinahe hätten wir alles verloren. Wie durch ein Wunder hat das Elend uns dann noch einmal verschont. Aber dafür bin ich jetzt wie gesagt frei und mein …»
«… eigener Herr. Ist schon gut. Aber wenn du nicht mehr reich bist, warum bist du dann nach Rom gekommen?»
«Das wirst du schon sehen!», seufzte Luca und verengte dabei abermals geheimnisvoll seine Augen zu Schlitzen. «Das ist meine Stadt. Ich habe immer von ihr geträumt.»
«Ich habe da so einen leisen Verdacht, mein lieber Pelletta», erwiderte Santi Currao. «Ich kann dich riechen: du stinkst. Sag die Wahrheit, bist du noch schlechter dran als ich?»
«Nein, warum?», sagte Luca reflexhaft, verbesserte sich aber sogleich: «Vielleicht nicht …»
«Und wie viel hast du als dein eigener Herr zur Verfügung?»
«Eine bescheidene, aber gesicherte kleine Rente: fünf Lire am Tag. Das reicht mir.»
Santi Currao lachte höhnisch und schüttelte den Kopf.
«Hundertfünfzig Lire im Monat?! Was machst du denn damit?»
Als sie am Ende der Straße angekommen waren, drängte sich Currao in die kleine Eingangstür des Hauses, und bevor sie hinaufgingen, sagte er zu Luca:
«Sprich bitte leise.»
Ein heruntergekommenes, schmuddeliges, unaufgeräumtes Zimmer, in einer Ecke ein Bett, das seit weiß Gott wie vielen Tagen nicht mehr gemacht worden war; neben dem einzigen Fenster ein einfaches Tischchen ohne Tischdecke; an der Wand ein Kleiderhaken; geflochtene Stühle; ein Waschbecken.
Santi Currao machte die Lampe auf dem Tischchen an und forderte den Freund auf, sich zu setzen.
«Wenn du dich waschen willst, hier ist alles, was du brauchst.»
«Und … einen Spiegel hast du nicht?», fragte Luca bedrückt und befangen angesichts von so viel Armut, während er seinen Blick über die staubigen Wände schweifen ließ.
«Ich zahle zwölf Lire im Monat, mein lieber Pelletta, und genieße dennoch kein Ansehen. Ich gebe einige Stunden Musikunterricht und werde nicht bezahlt; das Ende des Monats kommt, und ich zahle nicht; und je öfter ich nicht zahle, desto weniger Ansehen genieße ich. Dort neben dem Handtuch hatte ich einen Spiegel, wenn mich nicht alles täuscht. Den haben sie mitgenommen.»
«Und was machst du, wenn du dich betrachten willst?», fragte Luca bestürzt.
«Daran denke ich gar nicht!»
«Das ist nicht gut, Santi! Denn das Äußere …»
«Das wahre Äußere ist das Brot, mein lieber Pelletta!», verkündete Currao schroff.
«Einspruch, Einspruch …», sagte Luca. «Non solo pane vivit homo …»
«Und dennoch», schloss Santi, «braucht man zuallererst Brot. Spar dir deinen lateinischen Unsinn.»
Sie verharrten eine Zeitlang in betretenem Schweigen. Santi Currao saß neben dem Tischchen, er ließ den Kopf hängen und blickte starr zu Boden. Luca Pelletta hielt sich aufrecht und musterte ihn finster.
«Und … deine Frau?»
Currao hob den Kopf und blickte seinem Freund eine Weile in die Augen. «Verschon mich mit meiner Frau!» Er entblößte theatralisch sein Haupt; dann schlug er sich mehrere Male auf die breite Stirn, die vom Licht erhellt wurde:
«Siehst du? Gehörnt!», rief er; und seine dicklichen, blassen Lippen, die sich zu einem furchtbaren Grinsen öffneten, entblößten engstehende Zähne, gelb von den langen Entbehrungen.
Luca Pelletta blickte ihn verdutzt an und versuchte, aus Curraos Miene herauszulesen, ob er lachen solle oder nicht.
«Gehörnt! Gehörnt!», wiederholte Santi und nickte dabei mehrmals bekräftigend mit dem Kopf. «Nicht ich habe sie weggejagt, weißt du? Sie ist von sich aus gegangen. So bin ich», fügte er hinzu und raufte sich mit beiden Händen den ungepflegten Bart, «aber meine Frau war eine schöne und äußerst ehrenwerte Dame! Die Armut, mein lieber Pelletta. Wenn die Armut nicht gewesen wäre, hätte sie es vielleicht nicht getan. Im Grunde war sie nicht bösartig. Und ich war ihr wahrhaft ein vorbildlicher Ehemann: ich brachte ihr all das bisschen, das ich verdiente … nur die ein oder andere Lira legte ich für mich selbst zur Seite. Aber dennoch ist ein Mann, auch wenn er ein Schwein ist, gewiss doch tausendmal mehr wert als jede Frau. Findest du nicht, mein lieber Pelletta? Na ja, wer weiß, vielleicht auch nicht. Das lässt sich schwer sagen. Die Armut, verstehst du? Was macht das Eisen im Feuer? Es verbiegt sich. Und du als Ehemann kommst an den Punkt, dass du zu deiner Frau sagst: Du hast mich betrogen? Sie haben dir Brot besorgt? Ja? Dann hast du es richtig gemacht! Gib mir auch einen Bissen!»
Er erhob sich und begann im Zimmer auf und ab zu gehen, den Kopf auf der Brust und die Hände hinterm Rücken.
«Und jetzt … was macht sie jetzt?», fragte Luca vorsichtig.
Currao ging weiter umher, als habe er die Frage nicht gehört.
«Weißt du nicht, wo sie ist?»
Currao blieb vor der Lampe stehen:
«Sie geht auf den Strich!», sagte er. «Wir sollten nicht unnötig Petroleum verschwenden! Wasch dich, wenn es sein muss. Und dann lass uns gehen. Willst du nichts essen?»
«Nein …», antwortete Luca. «Ich habe in Neapel sehr gut zu Mittag gegessen.»
«Das glaub ich dir nicht.»
«Ehrenwort. Sag mal, wie findest du mich so?»
«Bemitleidenswert, mein lieber Pelletta!»
«Nein, ich meine, sehe ich aus, als ob es mir schlecht ginge?»
«Nein: noch sieht man nichts», sagte Santi.
«Ja ja», bekräftigte Luca, «mir bekommt das wenige Essen wirklich ganz gut. Aber vielleicht bin ich heute Abend ein bisschen zu blass, findest du nicht?»
«Du bist blass, weil du arm bist!», gab Currao zurück. «Los, lass uns gehen! Du willst bestimmt das Kolosseum bei Mondschein sehen.»
Luca nahm den Vorschlag begeistert an, und so machten sie sich schweigend auf den Weg.
Vor der Türschwelle hielt Pelletta den Freund am Arm fest, klopfte ihm mit einer Hand auf die Schulter und sagte mit halb geschlossenen Augen:
«Santi, wir werden wieder auf die Beine kommen! Lass mich nur machen!»
«Sei still …», knurrte Currao.
Und die beiden verloren sich im Dunkel.
MUSIK VON GESTERN
Fräulein Milla hantierte vor dem Spiegel hektisch mit unzähligen Wässerchen, Flacons, Pomaden, Brennscheren und war gerade dabei, ihrer Frisur den letzten Schliff zu geben, als es an der Tür läutete.
«Was für eine Hetze!»
Sie lief zur Zimmertür, die zur Eingangshalle führte. Gleich nachdem sie sie geschlossen hatte, öffnete sie sie wieder, streckte den Kopf hinaus und sagte leise zu dem Dienstmädchen, das auf das Klingeln hin herbeigeeilt war:
«Lass ihn eintreten, Tilde. Und sag ihm, er möge sich noch einen Augenblick gedulden.»
Sie stellte sich wieder vor den Spiegel und lächelte sich zu.
Es war ihr ein bisschen Blut in die Wangen geschossen; nichts im Vergleich zu den Hitzewallungen von früher; doch selbst dieses bisschen brachte wieder Leben in ihr ganzes verbrauchtes Puppengesicht mit den zu großen Augen und dem zu kleinen Näschen.
Und wirkte mit diesem belebten Gesicht jetzt nicht auch diese weiße Haarsträhne beinahe anmutig, die über ihrer Stirn, genau dort in der Mitte, abstand? Fräulein Milla hob die Hand, um sie mit dem Kamm zu glätten. Sie vollendete die Bewegung jedoch nicht.
Wer sprach da in der Eingangshalle?
Er war es mit Sicherheit nicht. Wenn er eintrat, erbebte der Fußboden.
Etwas später kam Tilde, mit dem Häubchen auf dem Kopf und der kleinen weißen Schürze über dem schwarzen Kleid, um ihr eine Visitenkarte zu überreichen. Fräulein Milla las darauf einen ihr unbekannten Namen: Maestro Icilio Saporini; sie blickte das Dienstmädchen mürrisch an.
«Und wer ist das?»
«Ein ganz kleines, sehr gepflegtes altes Männlein.»
«Ein altes Männlein? Und was will er?», fragte Fräulein Milla verstimmt. «Weißt du denn nicht, dass ich mit Herrn Begler verabredet bin? Ich dachte, er wäre es. Was machen wir denn jetzt?»
«Ich kann ihm sagen …»
«Was willst du ihm denn jetzt noch sagen? Wer ist er? Was will er von mir?»
«Na ja!», sagte Tilde, wobei sie die Schultern hochzog. «Er spricht so merkwürdig … mit einem Stimmchen wie eine Mücke … Er hat mich gefragt, ob Frau Margherita hier sei.»
«Meine Mutter?», fuhr Fräulein Milla fragend auf.
«Also, ob sie noch am Leben sei», antwortete Tilde. «Ich habe ihm gesagt, dass …»
Ein erneutes, lauteres Klingeln schnitt ihr das Wort ab.
«Das ist er!», entfuhr es Fräulein Milla; dann fügte sie etwas gefasster hinzu: «Herr Begler.»
Das Dienstmädchen schmunzelte in sich hinein. Fräulein Milla schloss die Tür wieder. Ein wenig später kam vom Klavier im Wohnzimmer ein donnernder Notensturm: das sehnsüchtig erwartete Zeichen Isoldes im zweiten Akt des Tristan. Herr Begler rief sie jedes Mal auf diese Weise.
Sie stürmte los. Mein Gott … nein, langsam, langsam! – Ach was, langsam! Herr Begler sprang vom Klavierhocker auf und warf sich ihr mit erhobenen Armen entgegen, wuchtig, breitbeinig, den verbeulten, in den Nacken geschobenen Hut noch auf dem Kopf. Vor der kreisrunden Krempe zeichnete sich das knorrige, purpurrote dickliche Gesicht mit seinen rötlichen borstigen Haaren ab, in dem die Augen unverschämt grinsten.
«Und der Hut? Kein Hut? Sofort den Hut!»
Fräulein Milla hob entschuldigend die Hände und verwies lächelnd auf den anderen Gast, den Herr Begler im Halbschatten des Wohnzimmers, wo neben dem Klavier weitere Saiteninstrumente und etliche Notenständer herumstanden, noch gar nicht bemerkt hatte.
Der winzige Maestro Icilio Saporini war ganz in sich zusammengekauert und fuhr sich mit dem Handschuh, der beinahe wie seine echte Haut wirkte, über die schüttere Silbermähne.
«Maestro … Maestro …», sagte Fräulein Milla, die sich nicht mehr an den Namen ihres Gastes erinnern konnte.
«Saporini … Icilio …», kam ihr der Alte mit seiner Fistelstimme in zwei Anläufen zu Hilfe, wobei er sich mühsam verbeugte.
«Saporini, genau! Maestro Icilio Saporini», wiederholte Fräulein Milla. «Der Cellist Hans Begler. Machen Sie es sich bequem.»
Begler jammerte jedoch mit seinem deutschen Akzent:
«Nein, nein!», und er machte nur wenig Anstalten, den Hut abzunehmen. «Nein, nein! Danke, meine Gute! Ich mache nicht bequem; ich gehe, ich gehe! Ich will nicht Konzert verpassen wegen Besuch dieser Herr. Danke, meine Gute! Ich empfehle, ich empfehle, mein Herr.»
Er verneigte sich zweimal unbeholfen und stürmte fort, wie er gekommen war.
Fräulein Milla, die sein ungestümes Wesen kannte, versuchte nicht einmal ihn aufzuhalten; beschämt, verärgert, niedergeschlagen blickte sie den Alten an, der, nachdem er auf diese Weise erfahren hatte, dass sie mit jenem Herrn zu einem Konzertbesuch verabredet war, sich zu winden begann wie ein Welpe und sie beschwor mitzugehen: um Himmels willen, er würde es sich sonst niemals verzeihen, in einem derartig ungünstigen Moment gekommen zu sein.
«Auf, auf, Ihren kleinen Hut, Ihren kleinen Hut. Mit einem Wagen holen wir den Herrn noch ein. Ich werde Sie bis zum Konzertsaal begleiten. Tun Sie mir diesen Gefallen, ich bitte Sie!»
«Aber zuerst wüsste ich gerne …»
«Später, später …»
«Sie haben nach meiner Mutter gefragt», sagte Fräulein Milla. «Aber Mutter ist nicht mehr hier!»
«Nun ja, das … das dachte ich mir schon», stammelte der Alte. «Ich dürfte ja eigentlich auch nicht mehr hier sein … Einundachtzig Jahre!»
«Einundachtzig?», rief Fräulein Milla. «Meine Mutter ist schon seit sechs Jahren tot.»
Und sie hob eine Hand, um ihm das Porträtfoto an der Wand zu zeigen:
«Das ist sie.»
Maestro Icilio Saporini hob die kleinen Augen, die beinahe zwischen den Lidern verschwanden, und betrachtete eine Weile dieses Porträt einer herausgeputzten alten Dame, das ihm offenbar nichts zu sagen schien: er schüttelte den Kopf, und mit einem gequälten Lächeln begann er zu stammeln:
«Nein … ich kann mich … ich kann mich … Diese, nein … ach! … ich, wissen Sie? ich … nein, nein!»
Während er so herumstammelte, weitete er mit zwei Fingern seinen Kragen, als schnürte sich ihm mit einem Mal die Kehle zu. Er schluckte kurz und fuhr fort:
«Sie, ja Sie … wirklich, ja, Sie … erinnern mich an sie, als sie noch lebte.»
«Ich? Wirklich?», fragte Fräulein Milla erstaunt. «Aber nicht doch! Ich ähnele meiner Mutter nun so gar nicht … Wirklich!»
Der Alte bewegte seinen Zeigefinger verneinend hin und her.
«Das können Sie doch gar nicht wissen», wisperte er. «Sie sehen nur die Gesichtszüge … Aber das Leuchten in den Augen? … die Bewegungen? … das Lächeln? … die Stimme? … Ich habe Ihre Mutter viel, viel früher kennengelernt als Sie, mein Fräulein, in einer ganz anderen Zeit! Und Sie können nicht … können nicht verstehen, was ich fühle, wenn …»
Er konnte nicht fortfahren; er zog ein Taschentuch heraus und führte es an seine Augen. Es war nur ein Augenblick. Er nahm sich sogleich wieder zusammen und drängte Fräulein Milla erneut dazu, ihren Hut aufzusetzen, um noch rechtzeitig zum Konzert zu gelangen. Im Wagen würde er ihr dann weitere Auskünfte über sich geben.