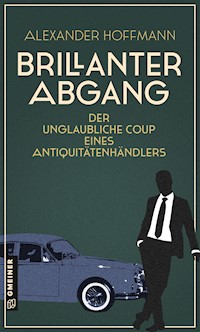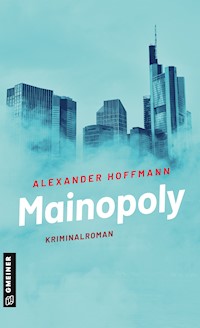
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Firmenchef Köller hat alles geplant - Nachfolger soll sein Geschäftsführer Romberg werden, nicht sein Sohn. Nur Romberg traut er zu, die Firma im traditionellen Stil zu führen, mit Rücksicht auf die Belegschaft und den Standort Schaffenfels im Großraum Frankfurt. Doch fünf Tage vor der notariellen Übertragung stirbt Köller und der Junior erbt alles. Er übernimmt sofort das Kommando und setzt alles daran, Kasse zu machen. Doch Romberg gibt nicht auf und sagt dem Junior den Kampf an, der bald aus dem Ruder läuft …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Alexander Hoffmann
Mainopoly
Kriminalroman
Zum Buch
Tödlicher Machtkampf Friedrich Köller, Inhaber der Köllerwerke in der Kleinstadt Schaffenfels bei Frankfurt, stirbt. Kurz darauf entbrennt ein Machtkampf zwischen dem Geschäftsführer Romberg, der die Firma traditionell und mit Sorge für die Arbeitsplätze weiterführen will, und dem Erben Köller Junior. Dieser erweist sich als Turbokapitalist, der das Unternehmen gewinnbringend zerschlagen will. Der Ausgang der Auseinandersetzung ist existenziell für das wirtschaftliche Schicksal des Städtchens. Als der Streit eskaliert, sind beide Seiten in der Wahl ihrer Waffen nicht zimperlich. Es kommt zu wilden Streiks und verdeckten Operationen, bis ein Köller-Mitarbeiter ermordet wird. Doch wem galt der Anschlag wirklich? Romberg? Oder dem Junior? Welche Rolle spielt die attraktive Unternehmensberaterin Iris Putlitz, welche die biedere Luzie, die den Park rund um die Firmenzentrale pflegt? Und wer ist jener »Heinzelmann«, der Romberg anonym mit wertvollen Informationen versorgt?
Alexander Hoffmann arbeitete lange als politischer Journalist für Qualitätszeitungen wie die »Frankfurter Rundschau« und die »Süddeutsche Zeitung«. Dabei wurde er mit dem Theodor-Wolff-Preis und dem Wächterpreis der deutschen Tagespresse ausgezeichnet. Dann wechselte er als Unternehmensberater in die internationale Wirtschaft und schrieb erfolgreiche Sachbücher zu Zeitgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Medizin. Zu seinen belletristischen Veröffentlichungen zählen ein satirischer Roman, Krimis und Glossensammlungen. Heute ist er auch als Kolumnist aktiv und schreibt Beiträge für Tageszeitungen sowie Magazine. Hoffmann lebt in Wissembourg/Frankreich und Frankfurt am Main. »Mainopoly« ist nach »Brillanter Abgang« sein zweiter Roman im Gmeiner-Verlag.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christine Braun
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © phis halili / unsplash
ISBN 978-3-8392-7410-1
1. Kapitel Warmbadetag
Missmutig musterte Romberg das Telefon auf seinem Schreibtisch. Der sicher geglaubte Auftrag von Airbus hing plötzlich am seidenen Faden. Eben hatte der Mittelsmann aus Toulouse angerufen, ein Konkurrent war offenbar mit einem Dumpingpreis angetreten. Sollten sie das Angebot nachbessern, sollte er kurzfristig nach Frankreich fliegen? Dazu hätte er gerne die Meinung des Alten gehört. Sie hatten am Angebot so gefeilt wie selten – doch solche Sachen scheiterten vorzugsweise auf den letzten Metern. Alles schon erlebt, Geschäftsalltag. Die Zeiten waren schwierig – aber war das je anders gewesen?
Romberg zwang sich zur Ruhe und streckte sich in seinem Stuhl. Noch fünf Tage. Dann trug er allein die Verantwortung. Er würde es schaffen und er brannte darauf. Dr. Gluck hatte den Vertrag fertig aufgesetzt, am Freitag würde Köller senior unterschreiben. Und sobald der Alte heute in der Villa war, würde er ihn sich greifen.
Bis dahin gab es Kärrnerarbeit. Romberg las die Statusberichte der Abteilungen, außerdem hatten sich seit gestern Abend 217 neue E-Mails angesammelt. 90 Prozent waren überflüssig. Er hatte Übung darin, die zehn Prozent mit Substanz herauszufiltern.
Im Büro war es ungewohnt still. 11 Uhr. Normalerweise hatte er um diese Zeit nicht nur mit einem Problem à la Airbus zu kämpfen, sondern mit einer Kakophonie vieler kleiner Katastrophen. Der tägliche Wahnsinn eben, den er brauchte. Der Wahnsinn, die Arbeit – das war sein Leben. »Du liebst diesen Laden mehr als mich«, hatte Marie oft gekrittelt. Ja, der Laden war seine Heimat, vor allem, seit sie nicht mehr lebte.
Romberg war mit den Statusberichten fertig und gönnte sich einen Moment der Entspannung. Die Herbstsonne tauchte sein Büro in warmes Licht. Es war ein heller Raum, die Möbel in kühlem Blau, mit den klaren Linien von USM Haller, ganz nach seinem Geschmack. Der Glasschreibtisch war aufgeräumt, links neben dem Rechner lag die Tagesmappe, rechts stand ein Silberrahmen mit dem Bild von Marie, seiner verstorbenen Frau. Vom Sessel aus hatte Romberg die Breitseite des Büros im Blick, mit der Weltkarte, auf der rote Fähnchen die wichtigsten Kunden markierten, dazu das große Foto. Romberg mit dem Alten beim letzten Werksbesuch des Ministerpräsidenten. Und auf dem Tisch der Sitzecke für Besucher stand die schmale Vase mit den frischen Blumen. Sein kleiner Farbtupfer im Alltag. Luzie brachte ihm wöchentlich einen neuen Strauß, diesmal waren es weiße Dahlien. Sie und die Leute in der Firma mochten und respektierten ihn, sie verbanden große Hoffnungen mit ihm.
Romberg riskierte einen Blick aus dem Fenster auf den kleinen Park mit den alten Kastanien, auf die sorgsam modellierten Buchsbäume und Zypressen, auf die Beete im Farbenrausch. Er konnte sie vom Büro aus bis spät in die Nacht sehen, als ob sie Luzie extra für ihn bepflanzt hätte. Er mochte den Park, in dem die Zeit stillzustehen schien. Und er mochte Luzie Bazinek, die das Grün auf dem Firmengelände schon so lange pflegte, wie er denken konnte, mit einer Hingabe, als ob es ihr eigener Garten wäre. Romberg hatte Luzie am frühen Morgen begrüßt, als er aus Frankfurt nach Schaffenfels gekommen war. Er hatte seinen großen BMW Gran Turismo auf dem Spezialparkplatz hinter der Villa abgestellt, der sein eigenes Reich war. Dort stand auch die Ladesäule für den elektrischen Fiat 500, den er für Fahrten in Schaffenfels nutzte. »Ihre Knutschkugel«, nannte seine Sekretärin, die gute Frau Deuerlein, das kleine Auto. Dann war er über den Kiesweg Richtung Vordereingang der Villa geschritten und hatte wie jeden Tag gesagt: »Guten Morgen, Luzie, ich hoffe, alles wächst und gedeiht?«
Luzies hellblaue Augen in dem runden, rosigen Gesicht strahlten. »Na klar, Herr Romberg. Gibt doch immer was zu tun.«
Es war ein Ritual. Romberg schätzte das verlässlich Wiederkehrende. Momente der Sicherheit in diesen Zeiten.
Wie jeden Morgen hatte er sich auch am Anblick der Villa Köller erfreut, der Zentrale der Köller AG. Der dreigeschossige Bau wirkte inmitten der Fabrikhallen fast verloren. Die Villa war ein Solitär mit der üppigen Fassade im Stil der Gründerzeit, umgürtet vom Park. Über dem Haupteingang mit den schweren Glastüren prangte in dezenten Goldlettern »1888«. Es war im Dreikaiserjahr gewesen, als Friedrich Köller, der Gründer der Motorenfirma, genug verdient hatte, um sich solche Pracht zu leisten. Der Aufstieg der Firma war dann unaufhaltsam gewesen. Der jetzige Chef aus der Köllerschen Linie war wieder ein Friedrich. Der Alte, Mehrheitsaktionär und Vorstandsvorsitzender, war nun 76 und schwächelte. Er musste loslassen, auch wenn es ihm schwerfiel. Der Wechsel kam zur rechten Zeit. Noch waren die Auftragsbücher halbwegs voll, doch das konnte sich über Nacht ändern. Sein Bauch sagte Romberg, dass das mit Airbus in die Hose gehen würde.
Romberg blickte auf seine flache Piaget, die er hütete, seit Marie ihm die Uhr zum zehnten Hochzeitstag geschenkt hatte. Es war schon gegen Mittag. Er drückte am Telefon eine Taste: »Liebe Frau Deuerlein, haben Sie eine Ahnung, wo Köller steckt?«
»Nein, sein Büro weiß auch nichts.«
Claudia Deuerlein war um die 40, von überschaubarem Reiz und verheiratet. Das war die Basis für ein fruchtbares Miteinander, das schon ein Jahrzehnt währte. Sie organisierte ihn, sie wusste, was er wann brauchte, sie erahnte seine Gedanken, wenn er sie noch gar nicht hatte. Und sie hatte ihn unter Aufsicht.
Daran dachte Romberg, als er kurz das Fenster zum Park öffnete und sich eine Zigarette anzündete. Im gesamten Werk herrschte Rauchverbot, es gab nur die übliche Schmuddelecke hinter der Villa neben den Mülltonnen. Das war ihm zu öd, immer dorthin zu laufen. Hastig rauchte er ein paar Züge, um dann die Kippe in einem kleinen Metallaschenbecher auszudrücken, der auf dem Fenstersims seinen wackligen Sitz hatte. Eine blöde, eine gefährliche Angewohnheit, dieses Rauchen. Klar, er würde es bald aufgeben, im nächsten Urlaub, ganz sicher. Oder zum Jahreswechsel, dann aber todsicher. Und außerdem würde er endlich wieder Sport treiben, bombensicher. Romberg seufzte. Alle Welt redete von Selbstoptimierung. Auch er versuchte sich darin, aber das wollte einfach nicht gelingen.
»Das kannst du also auch nicht«, hatte ihn Marie oft liebevoll aufgezogen. Er konnte nicht kochen – die Küche war für ihn ein Raum, aus dem irgendwie Essen herauskam –, keine Schnürsenkel fest binden, er hatte keine Ahnung von klassischer Musik, er verlor ständig Schirme und Kugelschreiber, er vergaß Geburtstage, er konnte nicht abschalten. Er konnte so vieles nicht, gestand er sich wieder mal ein. Aber einen Laden führen wie die Köller-Werke, das konnte er. Immerhin.
Kaum war er wieder mit sich im Lot, klopfte es. Er rief »Herein«, und Claudia Deuerlein betrat sein Büro mit einer Unterschriftenmappe.
Sie hielt vor dem Schreibtisch kurz inne, sog demonstrativ die Luft ein und bedachte ihn mit einem strengen Blick. »Aber Herr Romberg!«
Er murmelte: »Nach dem Urlaub höre ich auf, versprochen.«
Romberg atmete durch, als sie weg war, und vertiefte sich in seine Stichworte für die Mittagslage mit den Abteilungsleitern. Danach würde der tägliche Rundgang durch die Hallen kommen. Die Köllerianer an den Werkbänken wollten ihn um sich wissen, er war hier der Macher und Kümmerer. Er war stolz auf seine Leute, ohne die es keine Köller-Werke und keinen Erfolg gäbe. Viele hatte er selbst eingestellt, viele gefördert, die meisten kannte er beim Namen.
Allerdings war die Zeit der Warmbadetage vorbei. Es musste mehr Schwung in die Firma. Er stand auf, durchquerte das Vorzimmer, öffnete die Tür aus Rauchglas mit den filigranen Schriftzügen »Christof Romberg – Stellv. Vorstandsvorsitzender« und ging mit schnellem Schritt durch den langen dunklen Flur. Für seine 49 war er trotz schleppender Selbstoptimierung noch ganz gut in Form, fand er. Als er die lichte Eingangshalle der Villa betrat, kam ihm wieder die magische Ziffer »50« in den Sinn. Die Zeit zerrann, immer rascher, wie es ihm schien. Es ging ins letzte Drittel seines Lebens, aber das würde er ausschöpfen.
In der Halle verharrte er. Der Stuck an der Decke strahlte verhalten, vor diesem Hintergrund kam das detailverliebte Werksmodell in der Mitte gut zur Geltung. Dazu an der linken Wand die Vitrine mit der Goldmedaille von der Weltausstellung in Paris 1900, rechts die Sammlung mit den Exportetiketten im Schwung des Jugendstils sowie die »Gestattungsurkunde für Anlage und Betrieb« der »Köller & Comp. zu Schaffenfels« aus dem Jahre 1875. Die Besucher schauten sich das gerne an, auch die Stiche von den Verkaufskontoren in New York, St. Petersburg und Bombay. Globalisierung hatten die Köllers schon gelebt, als es den Begriff noch gar nicht gab.
Romberg betrat einen zweiten Flur. Dort begann das Reich Friedrich Köllers, sein Arbeitszimmer mit dem Art-Déco-Schreibtisch, der noch vom Vater stammte, den bauchigen Sesseln, der Kassettendecke. Nur im Vorzimmer stand ein Rechner. Köller weigerte sich hartnäckig, »in einen Kasten zu gucken«, und diktierte der Sekretärin lieber die Mails.
Diese blickte kurz auf, als Romberg hereinschaute, und schüttelte stumm den Kopf.
Wo war nur der Alte, vielleicht auf einem Außentermin? Aber das hätte er ihm gesagt, der Senior war pingelig bis ins Detail.
Romberg machte sich auf den Rückweg, vorbei an dem abgeschlossenen Trakt mit der »Kapelle«. Die Kapelle, wie sie firmenintern hieß, war Heimat der kleinen, exquisiten Gemäldesammlung des Alten. Werke der Klassischen Moderne, darunter einiges von Max Beckmann, Franz Marc und Paul Klee. Wenn es dem Alten wieder einmal zu viel wurde im Alltag, verschwand er gerne für eine Andacht in der Kapelle. Romberg hatte die Werke schon öfter bewundern dürfen, ebenso einige ausgewählte Kunden.
Jetzt war aber keine Zeit für die Klassische Moderne. Zügig ging Romberg zurück in sein Büro. Die Villa war ihm in den letzten Jahren zur zweiten Heimat geworden. Wie Schaffenfels, das Städtchen mit seinen knapp 9.000 Seelen. Er mochte die tägliche Reise von Frankfurt aus hierher. Nur 30 Kilometer auf der A 66 und rechts runter und über den Main. Für seine Frankfurter Bekannten war das unwohnlicher Osten, dunkles Land, Steppe. Manchmal kam ihm die Kleinstadt erstickend vor, doch dann wieder war sie ein wärmender Organismus.
Romberg überflog kurz die FAZ, die Financial Times und das Handelsblatt. Erneut waren einige Traditionsfirmen über Nacht in fremde Hände gefallen. Sie wurden umgepflügt, ausgepresst, namenlos gemacht. Auch um die Köller-Werke kreisten Piraten. Romberg blieb gelassen. Mit uns nicht. Der Alte jagte die Interessenten stets vom Hof, und bald hatte er selbst die Hand drauf. Noch fünf Tage.
2. Kapitel Karl Gustaf
Romberg arbeitete die Telefonliste ab. Froloff, der Lokalchef der »Schaffenfelser Mainglocke«, hatte um Rückruf gebeten.
Der Journalist kam sofort zum Punkt: »Ich hörte von einem fetten Auftrag von Airbus?«
»Das ist noch nichts zum Schreiben. Reden wir in 14 Tagen darüber.«
»Schade, ich hätte gerne mal was über neue Arbeitsplätze gebracht. Sie wissen doch, wie es aussieht im Städtchen. Die Köller-Werke sind unsere letzte Hoffnung.« Froloff verabschiedete sich enttäuscht.
Als ob er das nicht selbst wüsste, dachte Romberg. Doch jeder Auftrag musste den Kunden zäh aus dem Kreuz gewrungen werden. Rombergs schlechtes Gefühl hinsichtlich Airbus verstärkte sich. Die Hightech-Sparte spülte zwar noch Cash in die Kasse, aber das Geschäft mit den Standardprodukten lief immer schleppender. Die Kleinmotoren von Köller hatten Weltruf, sie betrieben Fertigungsstraßen, sie arbeiteten in Flugzeugen und Raumfähren, je winziger, desto besser. Daneben nahmen sich die Standardmotoren für Rasenmäher wie plumpes Riesenwerkzeug aus. Das konnten mittlerweile andere billiger.
Romberg kratzte sich am Kopf. Sie hatten mindestens 100 Leute zu viel an Bord, aber Köller hatte noch nie Leute entlassen, und Romberg würde nicht damit anfangen. Da war er genauso altmodisch wie der Alte. Ansonsten würde er durchaus mit der Zeit gehen, jedoch nicht mit fantasielosen Sparrunden. Im Gegenteil: Sie mussten mehr wagen, mehr in neue Produkte investieren, um später die Ernte einzufahren. Schaffenfels stand mit neun Prozent Arbeitslosen einigermaßen da, dank der Köller-Werke mit ihren 1.200 Arbeitsplätzen. Nicht auszudenken, wenn die wegfielen. Dann könnte man das Städtchen schließen. Romberg fröstelte bei diesem Gedanken.
Das Tempo in der Wirtschaft wurde immer rasanter, stets kämpften sie um den Spitzenplatz, immer einen Millimeter vor der Konkurrenz. Nun, er würde alles dafür tun, damit die Köller AG die Nummer eins bliebe. Sie waren klein, fein und teuer. Und alles Made in Germany, wo sonst? Sie waren Weltmarktführer in ihrem Sektor, sie konnten Sachen, die so keiner konnte. Die Chinesen schon gar nicht.
Frau Deuerlein brachte eine Tasse Tee herein.
»Immer noch nichts?«
»Nein. Soll ich mal auf der Rosenhöhe anrufen?«
»Ja, tun Sie das bitte.«
Romberg fragte sich, was Friedrich Köller trieb, wenn er allein in seinem Bungalow auf der Rosenhöhe saß. Der Alte war Witwer wie er, aber schon seit einem Vierteljahrhundert. Er konnte sich in Köller einfühlen, seit Marie tödlich verunglückt war. Der Schmerz wollte nicht vergehen, auch nach sechs Jahren nicht. Marie fehlte ihm.
Wenigstens hatte er die Firma. Und den Alten. Köller sprach es nie aus, aber Romberg wusste, dass er ihm wie ein Sohn geworden war, nach den Enttäuschungen mit Stefan, dem Erben.
Wann kam Köller endlich? Gestern Abend war er noch in der Villa gewesen. Er tigerte oft nachts durch die Flure und hinterließ auf den Schreibtischen seiner Leute Notizen auf gelben Haftzetteln. Auch heute hatte Romberg einen Zettel gefunden, in jener typischen Handschrift, klar wie ein Stahlstich, mit dem Vermerk: »Was macht die Lieferung für das Dow-Werk in Midland? Ich erwarte Ergebnisse, keine Erklärungen!« Romberg machte sich eine Notiz. Er würde den Herren von der Anwendungstechnik noch heute auf die Sprünge helfen.
Das Telefon blinkte. Frau Deuerlein. Herr Eisele frage, ob er kurz Zeit habe.
Für Eisele hatte er immer Zeit. »Soll reinkommen.«
Herein latschte etwas Dürres in schlabbernden Jeans und weißem T-Shirt. Eine Gestalt, die Romberg an eine gedehnte Ziege erinnerte. Eisele war keine 35, doch dem Cäsarenkopf gingen bereits die Haare aus. Den schütteren Seitenbewuchs hatte er zu einem blonden Zopf gezwungen, hinten gehalten von einer aparten Silberspange. Fremde hielten ihn hin und wieder für den Büroboten, doch Dipl.-Ing. Markus Eisele war Chef der »Spinnerstube« im Werk, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung. Der Alte sprach nur andächtig über ihn. »Unser Eisele, unser Kronjuwel. Er ist ein Gesalbter, auch wenn er mich manchmal in den Wahnsinn treibt.«
Wie immer sah Eisele aus, als liefe er gerade seinem Tod in die Arme. Die Augen glühten, er hatte wohl wieder die Nacht im Technikum zugebracht. Er ließ sich in den Stuhl vor dem Schreibtisch fallen und begann heftig atmend: »KKKarl Gustaf … äh, diese Mmaschine …«
Romberg hob beide Hände, als ob er Eisele segnen wollte: »Langsam, lieber Eisele. Wir haben alle Zeit der Welt.«
Der Sprachfehler des Dipl.-Ing. brach sich Bahn, wenn er unter Stress stand oder der 1. FC Schaffenfels 1893 verloren hatte, es kam wie ein Naturereignis. Dann brauchte Eisele einen wärmenden Schub. Romberg wattierte ihn gerne, schon aus Respekt vor dem Genie. Eisele wirkte in Sphären, die Romberg nur erahnen konnte.
Romberg fragte betont beiläufig: »Es geht also um den Prototypen?«
Eiseles Augen hefteten sich an einen imaginären Punkt an der Zimmerdecke, die Lippen zitterten wie bei einer Forelle, die auf dem Trockenen gelandet war. Dann sprudelte es flüssig aus ihm heraus. »Karl Gustaf läuft im Technikum gut. Aber das System muss stabiler werden, wir brauchen mehr Zeit. Und eine Million mehr brauchen wir auch.«
Genies brauchten immer Geld. Und die Köller AG brauchte die neue Maschine.
Romberg überlegte kurz. Fünf von zehn Ideen Eiseles waren absolut närrisch, vier waren durchwachsen, aber jede zehnte hatte es in sich. So war »Sophie« geboren worden, das Mini-Antriebssystem, mit dem sie Anfang des Jahrtausends die Konkurrenz das Fürchten gelehrt hatten. Sophie war nun sozusagen im Klimakterium, reif und durchaus noch reizvoll, aber keine Früchte mehr tragend. Karl Gustaf musste her, auf ihm ruhten alle Hoffnungen. Romberg fand es schön, dass Eisele seinen Schöpfungen Namen gab. Jetzt hatte er Karl Gustaf im Brutkasten. Das Übermaschinchen. Karl Gustaf war nur halb so groß wie Sophie, aber doppelt so leistungsfähig. Und in gar nicht so weiter Ferne lockte der Gedanke an den Einstieg in die Nanowelt, in den Kosmos der Kleinstroboter. Da würden die Chinesen glotzen, alle 1,4 Milliarden.
Über Rombergs Züge huschte ein leidender Schatten. Der deutsche Ingenieur an sich war schon etwas Seltsames. Er wollte immer die perfekte, die finale Lösung. Ganz besonders der Eisele. »Lieber Eisele, wir wollen mit Karl Gustaf nicht in die Annalen eingehen, sondern Geld verdienen. Also – wann ist die Maschine fertig?«
Eisele zierte sich, er konnte auch eine Diva sein. »Die Maschine ist fertig, wenn sie fertig ist.«
Romberg gab auf. »Meinetwegen, Sie kriegen eine halbe Million. Aber bitte machen Sie Ihrem Genius Beine. Sie wissen, was das Projekt für uns bedeutet.«
Eisele strahlte, sah plötzlich aus wie 25. »Wir schaffen es. Karl Gustaf ist so komplex, dass die Chinesen ein Jahr brauchen, um die Maschine zu kapieren, und noch mal zwei Jahre, um sie zu kopieren. Bis dahin haben wir Karl Gustaf römisch zwo.« Zufrieden schlenderte die Diva aus dem Büro, der helle Zopf wippte fröhlich.
Zwei Dutzend Telefonate später spürte Romberg eine diffuse Unruhe. Ihm schien, als ob irgendetwas die Villa lautlos unterspülte.
Die Tür zu seinem Büro wurde aufgerissen, im Rahmen stand Frau Deuerlein, fahl wie Asche. So hatte er sie noch nie erlebt.
»Was ist denn los?«
Sie stammelte.
»Nun reden Sie schon!«
3. Kapitel Einer kriegt alles
Rombergs Magen vibrierte, die Augen blickten schlierig in den Spiegel. Mühsam sortierte er im Bad den gestrigen Abend. Zu viel Bordeaux im Belrose. Und dann noch diese Tequilas – welche Torheit! Romberg schüttelte sich beim Zähneputzen und schluckte zwei Aspirin. Er fühlte sich wie 80.
Der Absturz war aber verzeihlich nach einem solchen Einschlag wie gestern. Danach hatte es ihn nachts ins Belrose im Gewerbegebiet Ost am Konrad-Adenauer-Ring getrieben. Der Club erinnerte an ein blau illuminiertes Maurenschlösschen und lag sehr diskret hinter den 40-Tonnern eines Lkw-Parkplatzes. Das Belrose war der heimliche Stolz von Schaffenfels, so etwas hatten die in Frankfurt nicht, kamen aber gerne hierher, schon der Diskretion wegen. Die Frauen im Belrose hatten Klasse, auch wenn sich Romberg von ihnen fernhielt, was auch mit Anne-Aymone zu tun hatte.
Die Chefin des Belrose erwartete ihn an der Bar. Die dunkle Schöne war eines Tages in Schaffenfels gelandet, keiner wusste, wie und woher. Angeblich hatte sie zuvor eine Plantage in La Réunion geleitet, dann ein Hotel in Martinique. Es blieb ebenso im schwebenden Ungefähr wie die Auskünfte über ihr Alter. So um die 40, schätzte Romberg. Anne-Aymone hatte Wangen wie Porzellan, unergründliche Augen, die schwarzen Haare im strengen Pagenschnitt. Alles an ihr strahlte zarte Härte aus. An diesem Abend trug sie ein rotes Latexkleid, wie mit der Haut verschweißt. Den Leuten im halb dunklen Barraum nahm es den Atem. An ihr wirkte es keinen Hauch billig, sondern exklusiv.
Während sie Romberg den ersten Wein servierte, brachte sie einen Pulk lärmender Neuankömmlinge mit einem verschatteten Blick zum Schweigen.
»So ein Pech aber auch, mon cher«, sagte sie, als er ihr die Katastrophe schilderte, und nahm seine rechte Hand.
Vor Jahren hatte sie eine kurze, hitzige Affäre verbunden. Er hatte die Schönheit auch abgeschminkt erlebt, im schlampigen Rolli und mit dicken Wollsocken, und ihr den Namen »Madame Lumpi« verpasst, der seitdem in Schaffenfels gültig war. Anne-Aymone fand es süß.
»Madame Lumpi, es ging nur um läppische fünf Tage. Ich fasse es nicht!«
Sie wechselten vom Rotwein zum Tequila, und sie zog die Stirn ein wenig kraus. »Und werde ich jetzt nachbeteiligt?«
Ihre kleinen Fehler fand er hinreißend, wobei er nie den Verdacht loswurde, dass sie eigentlich fließend Deutsch konnte. »Keine Sorge, du wirst nicht benachteiligt. Das Belrose wird immer Konjunktur haben.«
Im Belrose ließen so manche Kunden von Köller den Tag ausklingen. Das Essen im Club war vorzüglich, die Bar gut bestückt, die Saunalandschaft suchte ihresgleichen.
Romberg hatte weiter geklagt, und Madame Lumpi hatte getröstet. Eigentlich mochte sie keine Verlierer, aber mit Romberg war es etwas anderes. »Selbst wenn es dir schlecht geht, siehst du noch gut aus«, hatte sie mit ihrer seidig-rauchigen Stimme gesagt und ihm träumerisch über die grauen Einsprengsel im vollen schwarzen Haar gestrichen.
Nach dem dritten Tequila hatte er einige Tränen über ihre verflossene Liebe verdrückt und sie »Marie« genannt. Sie hatte ihm einen Kuss auf die Wange gehaucht und ein Taxi gerufen, das ihn nach Frankfurt gebracht hatte.
Was für ein Abgang! Nun war es schon halb neun, er musste sich beeilen. Romberg duschte heiß und kalt, bändigte die verworrenen Haare, schauderte noch einmal angesichts der verquollenen Augen. Doch das frisch gebügelte Oberhemd kühlte angenehm, der blaue Anzug aus dem wohlgefüllten Schrank saß so perfekt wie der gestrige graue. Er rückte die Krawatte zurecht und verließ seine Wohnung. Kurz hinter der Tür wäre er fast gestolpert. Der rechte Schnürsenkel hatte sich wieder gelöst. Und wo war sein Schirm? Romberg stöhnte. Linkshänder war er auch noch. Das Leben war nicht fair. »Mein tapsiger Bär«, hatte seine Frau oft zärtlich gespöttelt.
Claudia Deuerlein war schon im Büro, sah noch bleicher aus als er. Im Vorbeigehen sagte er kurz: »Bitte alle Termine für heute absagen. Ich muss zu Gluck.«
Sie nickte wortlos.
Er fuhr mit dem Fiat Richtung Altstadt in die Färbergasse, wo Dr. Paul Gluck, der Firmenanwalt und Notar, seine Kanzlei hatte. Keine zwei Kilometer entfernt, im Städtchen kam man schnell von einem Ende zum anderen. Den Termin hatte er gestern noch gemacht, nachdem die Deuerlein im Türrahmen ihre Sprache wiedergefunden hatte.
Auf der Rosenhöhe hatte die Haushälterin am Morgen den Alten gefunden, zusammengekrümmt vor dem Kamin im Wohnzimmer liegend. Der zweite Herzinfarkt hatte ihn in der Nacht gefällt.
Romberg fuhr wie betäubt, hatte immer noch Mühe, zu begreifen. Friedrich Köller war tot. Nie mehr das vertraute Miteinander in der Villa, nie mehr Streit um den richtigen Weg, nie mehr gemeinsame Erfolge. Eine tiefe Trauer lähmte ihn, er konnte sich kaum auf den Verkehr konzentrieren.
Durch die Frontscheibe seines Autos sah er grau-blaue Wolken über Schaffenfels, wie schwere alte Koggen am Himmel treibend. Der erste Herbststurm kündigte sich an. Am St.-Helena-Platz fand er eine Parklücke und lief zügig in die Färbergasse. Vor dem sorgsam restaurierten Patrizierhaus, in dem Gluck die ganze erste Etage beherrschte, hielt er kurz inne. Er würde um die Köller-Werke kämpfen – gegen alle Finanzhyänen, Wegelagerer und Leichenfledderer. Die mussten erst mal an ihm vorbei! Vielleicht war noch nicht alles verloren.
In der Kanzlei konnte Romberg gleich ins Büro durchgehen. Gluck erwartete ihn an seinem Biedermeier-Schreibtisch, gedrungen und rund wie ein Burgunderfässchen. Der dunkelgraue Anzug mit Weste saß wie angegossen, die weißen Resthaare auf dem polierten Schädel kämpften unverdrossen um ihre Existenz. Gluck las gerade einen Briefentwurf und setzte mit dem mächtigen Montblanc drei große Ausrufezeichen an den rechten Rand. »Meine junge Schreibkraft … ein liebes Kind, aber aus dem Tal der Ahnungslosen. Dass man Widerspruch ohne ›e‹ schreibt, wird sie nie lernen. Und Briefe an meinen Mandanten in Bad Oeynhausen schreibe ich lieber selbst – die drei Vokale hintereinander überfordern sie.«
Romberg nahm vor dem Schreibtisch Platz. »Guten Morgen, Paul. Ich bitte um Nachsicht, dass ich etwas übrig geblieben aussehe.«
Gluck machte eine einladende Geste. »Mein lieber Christof, Sie sind mir in jedem Aggregatzustand willkommen. Wurde wohl spät gestern bei Madame Lumpi. Kaffee?«
In Schaffenfels überholten die Gerüchte den Urheber und kamen ihm frontal entgegen, fiel Romberg wieder einmal auf.
»Danke, lieber ein Wasser. Madame Lumpi lässt übrigens grüßen.«
Während die Sekretärin Kaffee und eine Karaffe mit Wasser anrichtete, schwiegen beide. Gluck war 74 und dem Alten seit Jahrzehnten verbunden. Er gehörte zu dem guten Dutzend, die in Schaffenfels das Sagen hatten. Als Romberg vor zehn Jahren hierhergekommen war, hatte ihn Gluck lange geprüft und dann für gut befunden. Nur ab und zu fragte er, weshalb Romberg immer noch die große Wohnung in Frankfurt unterhalte, »bei denen da«. Romberg hegte die Freundschaft zu dem Anwalt wie einen Schatz. Gluck lief meist gut gelaunt durch die Gegend. Das gebirgige Gesicht und die Krötenaugen strahlten Gemütlichkeit aus, doch das konnte täuschen. Er hatte die Firma durch unzählige Stromschnellen gelotst, gegen ihn lief nicht viel in Schaffenfels. Heute schien er jedoch ratlos und voller Kummer.
Er brach das Schweigen. »Das hat sich Friedrich wohl anders vorgestellt …«
Romberg sagte leise: »Mir kommt es vor, als hätte man mir ein Bein abgehackt. Er war mir zu einem wirklichen Freund geworden, gerade in der letzten Zeit.«
Gluck nickte. »Er war auch mein Freund.«
Beide schwiegen, dann tastete sich der Anwalt ins Gespräch zurück. »Leider haben wir kaum Zeit, um zu trauern.«
»Ich weiß, jetzt gilt das alte Testament.« Romberg ballte die Fäuste. »Himmelherrgott, in vier Tagen wollte er den Vertrag unterschreiben.«
»Exakt, am Freitag. Nachdem er den Termin dreimal verschoben hatte. Er hat wohl gedacht, mit der Unterschrift wäre sein Leben gelaufen. Das ist nicht der erste Fall für mich. Was glauben Sie, wie viele ihre Dinge nicht regeln, bis es zu spät ist.«
»Wenn wir die Sache doch nur beschleunigt hätten!«
»Wenn, wenn! Lieber Christof, wenn der Ochsenfrosch Flügel hätte, würde er nicht mit dem Hintern am Boden schleifen.«
Romberg zwang sich zur Ruhe. Er musste einen kühlen Kopf bewahren. »Wo stehen wir jetzt?«
Glucks Miene legte sich in lange Falten. »Vor dem Nichts. Nach dem gültigen Testament geht alles an den Junior.« Gluck weigerte sich seit Jahren, Stefan Köller, den Erben, beim Namen zu nennen. »Im richtigen Bett geboren zu werden, reicht mir nicht«, sagte er gerne.
Gluck fuhr fort: »Er war schon heute früh bei mir. Kam mit der ersten Morgenmaschine von London rüber.«
»Und?«
»Er wird die Leitung der Firma übernehmen. Ich würde es ihm ja gerne verbieten. Irgendwelche Vorschläge?«
Erst in diesem Moment wurde Romberg richtig klar, was geschehen war. Aus der Traum von der Übernahme. Sie hatten es so gut geplant. Der Junior sollte nur den Pflichtteil des Erbes erhalten und aus dem Privatvermögen des Alten abgefunden werden. Von der Volksbank sollten über den genossenschaftlichen Verbund 500 Millionen fließen. Der Kredit reichte, um zusammen mit dem Vier-Prozent-Anteil, den Romberg schon hatte, auf über 60 Prozent der Köller AG zu kommen. Vor einem Jahrzehnt war der Alte an die Börse gegangen, um die Expansion zu finanzieren. Doch er hatte stets die Mehrheit der Inhaberaktien behalten, die restlichen Aktien waren über viele Kleinanleger verstreut. Rombergs Plan war gewesen, später auch die Belegschaft über Aktien zu beteiligen. Und der Alte hätte sich mit dem Erlös seinen Traum erfüllt: die Friedrich-Köller-Kunststiftung. Den Grundstock dafür sollte die Sammlung in der Kapelle bilden.
Das war nun alles Geschichte. Aus dem Traum war ein Albtraum geworden. Zögernd und ohne große Überzeugung sagte Romberg: »Wir könnten ihm immer noch sein Aktienpaket abkaufen. Die Finanzierung steht.«
Gluck schüttelte den Kopf. »Das wird der Junior nicht machen, nicht nach dieser Vorgeschichte und nicht zu diesem Preis. Er will jetzt selbst in die Speichen greifen.«
Die Vorgeschichte war wie alle Vorgeschichten lang, bitter und verworren.
Gluck lehnte sich zurück: »Er ist ja erstklassig ausgebildet und hochintelligent. Aber es hätte dem Jungen besser getan, wenn er vor dem Studium erst mal Mechaniker gelernt hätte. Das hilft gegen das Abheben.« Gluck nestelte an seiner silbernen Taschenuhr. »Zum Fürchten, was für Geschöpfe aus diesen Elite-Anstalten auf uns zukommen. Lauter kleine Ungeheuer. Wollen nur aus Geld noch mehr Geld machen, und das ohne den anstrengenden Umweg über die Realwirtschaft.«
Romberg nickte mit finsterer Miene. »Manchmal klappt das sogar.«
»Aber in der Finanzkrise sind sie weltweit auf die Nase gefallen. Sie haben sich kurz geschämt, und dann ging es wieder los.«