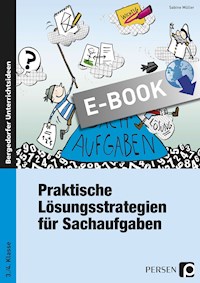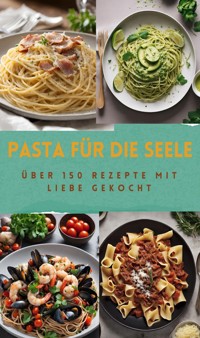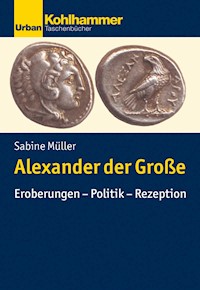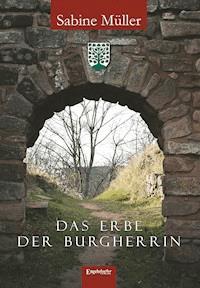Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das antike Makedonien ist untrennbar mit den Namen Philipp II. und Alexander III. verbunden. Unter Philipp stieg das Reich zur Hegemonialmacht auf, unter Alexander erreichte es kurzzeitig die Ausmaße eines Weltreichs. Die beiden herausragenden Herrscher bewegten sich in Strukturen, die ihre Vorgänger etabliert hatten. Seit dem späten 6. Jh. v. Chr. spielte das makedonische Reich auf dem politischen Terrain der mediterranen Welt eine Rolle, auch wenn sie oft limitiert war. Sabine Müller zeichnet die Ereignisgeschichte Makedoniens von den Anfängen der Argeaden bis zum Ende makedonischer Kontrolle durch das Übergreifen Roms nach, wobei sie kulturelle, soziale und ökonomische Aspekte berücksichtigt. Konkret liegt der Fokus auf der Quellenproblematik, der Beziehung Makedoniens zu den Nachbarn, dem Königshof sowie den "royal women" und der Repräsentationspolitik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
00_Titelei
Danksagung
1 Einleitung
Thematik
Forschungsstand
Quellenlage
2 Makedonien und die Makedonen
Geopolitik
Wirtschaft
Kulturelle Aspekte
3 Herrschaft und dynastische Repräsentation
Gründungsgeschichten
Herrschaft
Militär
Handlungsräume makedonischer ›royal women‹
Münzprägung
4 Makedonien unter den frühen Argeaden
Amyntas I., der erste historisch fassbare Argeade
Alexander I. im Spannungsfeld zwischen Perserreich und Athen
Perdikkas II. und der Kampf um die Autonomie
Archelaos und die athenischen Verbindungen
Aëropos II. bis Pausanias
5 Makedonien bis zum Tod Alexanders III.
Die lange Regierung Amyntas' III.
Alexander II.: Unter thebanischem Druck
Zwischen Alexander II. und Perdikkas III.: Ptolemaios von Aloros und Eurydike
Perdikkas III.: Unter athenischem und illyrischem Druck
Der Aufstieg Makedoniens unter Philipp II.
Alexander III.: Das Übergreifen nach Asien
6 Makedonien in den Bürgerkriegen (323–274)
Die Diadochen
Von Babylon nach Triparadeisos
Von Antipatros' Tod bis zum Frieden 311/0
Von der Ermordung Alexanders IV. bis zur Ermordung von Seleukos
Die Zeit der Bürgerkriege von Ptolemaios Keraunos bis Sosthenes
7 Makedonien unter den Antigoniden
Antigonos II. Gonatas und die Durchsetzung der antigonidischen Herrschaft
Demetrios II. und der Demetrios-Krieg
Antigonos III. Doson, der Vormundschaftsregent
Philipp V.: Expansion und Konflikt
Perseus und Rom
Philipp VI. Andriskos: Kampf um die Wiederherstellung der Monarchie
Am Ende
Liste der makedonischen Herrscher
Argeaden
Protohistorische Argeadenherrscher nach Herodots Herrscherliste (8,139)
Historische Argeadenherrscher
Makedonien vor der Durchsetzung der Antigoniden
Antipatriden
Herrscher nach den Antipatriden
Antigoniden
Glossar
Abkürzungen
Bibliographie
Personenregister
Kohlhammer
Reiche der Alten Welt: Ethnien, Länder, Dynastien (RAW)
Herausgegeben von Henning Börm, Udo Hartmann, Sitta von Reden, Robert Rollinger, Roland Steinacher und Timo Stickler.Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/raw
Sabine Müller
Makedonien unter Argeaden und Antigoniden
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.Umschlagabbildung: Detail des »Alexandersarkophags«, Archäologisches Museum von Istanbul. Foto: No machine-readable author provided. Patrickneil assumed (based on copyright claims). (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexander_Sarcophagus.jpg), »Alexander Sarcophagus«, verändert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/legalcode
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-037713-4
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-037714-1epub:ISBN 978-3-17-037715-8
Danksagung
Es war ein schwerer Weg zur Fertigstellung dieses Buchs. Umso herzlicher möchte ich denjenigen danken, die mich unterstützt haben, allen voran Johannes Heinrichs und Beth Carney, zudem Sulo Asirvatham, Waldemar Heckel, Marek Jan Olbrycht, Olga Palagia und Frances Pownall. Von ganzem Herzen danke ich auch Francesca Angiò, Ed Anson, Borja Antela-Bernárdez, Udo Hartmann, Cathy Lorber, Ken Moore, Daniel Ogden, Anneli Purchase, Jeanne Reames, Brigitte Truschnegg und Pat Wheatley.
Ganz herzlich danken möchte ich zudem Sheila Ager, Lee Brice, Monica D'Agostini, Jenn Finn, Miltiades Hatzopoulos, Lisa Hau, Bruno Jacobs, Michael Kleu, Yuri Kuzmin, Franca Landucci, Vassilis Liotsakis, Alex McAuley, Lara O'Sullivan, Yossi Roisman, Alexander Sinitsyn, Giuseppe Squillace, Rolf Strootman, Guen Taietti, Fabio Tanga, Christopher Tuplin, Josef Wiesehöfer, Agnieszka Wojciechowska, Ian Worthington, Graham Wrightson, Hartmut Wulfram und Yiannis Xydopoulos.
1 Einleitung
Thematik
Das antike Makedonien war untrennbar mit der Monarchie verbunden, von den Anfängen der Reichsbildung (geschätzt Mitte des 7. Jhs.) bis zur römischen Eroberung 168.1 Die Argeaden, historisch gesichert seit dem späten 6. Jh., waren der erste Familienclan, der in Makedonien herrschte. Unter ihnen wurde ihr Reich als politische Kraft in der Mittelmeerwelt etabliert, unter Kämpfen behauptet und schließlich zur Hegemonialmacht, kurzzeitig sogar zum Weltreich. 323 endete mit dem Tod Alexanders III. die faktische argeadische Herrschaft. Zwar waren noch Argeaden und Argeadinnen in die Kämpfe um sein Erbe involviert. Doch einen maßgeblichen Einfluss übten nicht mehr sie aus.
In dieser Übergangszeit wurden in Makedonien die Antipatriden prägend, scheiterten jedoch an einer dauerhaften Dynastie-Etablierung. Es folgte eine Phase wechselnder Herrschaften Angehöriger unterschiedlicher Familien. Mit Verzögerung, erst 277/6, konnten sich mit Antigonos II. die Antigoniden als zweite langfristige Dynastie in Makedonien etablieren. Trotz einiger Anknüpfungspunkte an die argeadische Herrschaftstradition begann damit ein eigener, spezifischer Teil makedonischer Geschichte.
Besonders wichtige Phasen der Geschichte Makedoniens waren das Entree auf dem »internationalen« politischen Parkett unter Alexander I. (ca. 499/98/95–450), der Aufstieg zur Hegemonialmacht unter Philipp II. (360/59–336) und die Expansion zum (wenngleich ephemeren) Weltreich unter Alexander III. (336–323). Wendepunkte bedeuteten die Annahme des basileus-Titels durch die Diadochen 306/5, die Durchsetzung Antigonos' II. als Herrscher Makedoniens (277/6, gesichert 272), endlich Perseus'Bezwingung durch Rom 168 und die Einrichtung der Provinz Macedonia nach 148/146.
Im Folgenden wird die Bedeutung Makedoniens in der mediterranen Welt von den historisch fassbaren Anfängen der Argeadenherrschaft im späten 6. Jh. bis zum Ende der antigonidischen Herrschaft behandelt. Ein einführender systematischer Teil beinhaltet grundlegende Informationen, die das Verständnis der folgenden chronologischen Teile erleichtern sollen. Auf einen kurzen Überblick zu Forschungsstand und Quellenproblematik (Kap. 1) folgt die Einführung in geopolitische, ökonomische und kulturelle Aspekte (Kap. 2), politische Strukturen und Institutionen, Kriegswesen und dynastischer Repräsentation (Kap. 3). Es schließt sich die Ereignisgeschichte an: Makedonien unter argeadischer Kontrolle (Kap. 4–5), die Zeit der Diadochen und weiterer Bürgerkriege (Kap. 6) und die Herrschaft der Antigoniden (Kap. 7).
Inhaltliche Schwerpunkte stellen die makedonischen Strategien der Gewinnung, Organisation, Erhaltung, Legitimation und Repräsentation von Herrschaft dar. Ein Augenmerk liegt auf der Bedeutung personeller Netzwerke, der Beziehung Makedoniens zu den Nachbarn, Heiratspolitik, Handlungsräumen makedonischer royal women und dynastischer politischer Ikonographie. Die häufig verformten Darstellungen der griechisch-römischen literarischen Quellen in Fremdsicht auf die Makedonen gilt es zu hinterfragen und im Bedarfsfall zu dekonstruieren.
Forschungsstand
Die Geschichte Makedoniens ist mittlerweise ein international recht beachtetes Forschungsgebiet. Ältere Standardwerke sind N. G. L. Hammonds A History of Macedonia (1972–1988, unter Beteiligung von G. T. Griffith bzw. F. W. Walbank) und The Macedonian State von N. G. L. Hammond (1989). Für die jüngere Zeit sind J. Roisman/I. Worthington (Hgg.), A Companion to Ancient Macedonia (2010) und R. Lane Fox (Hg.), Brill's Companion to Ancient Macedon (2011) sowie die Monographie Ancient Macedonia von C. J. King (2017) zu nennen. Einen umfassenden, profunden Überblick zu Forschungsgeschichte und aktuellen Entwicklungen bietet M. B. Hatzopoulos' Ancient Macedonia (2020).
Bezüglich spezieller Aspekte hat D. Ogden (1999, 2023²) Muster makedonischer Dynastiepolitik untersucht. E. D. Carney, führende Expertin zu makedonischen royal women, hat sich deren Handlungsräumen in zahlreichen Aufsätzen und monographischen Standardwerken (2000; 2006; 2019) gewidmet. Maßgeblich zu politischen Institutionen und Strukturen ist Macedonian Institutions under the Kings (1996) von M. B. Hatzopoulos, der auch in zahlreichen Studien Topographie und Geographie Makedoniens untersucht hat. Über makedonische Militärgeschichte informieren Beiträge in W. Heckel u. a. (Hgg.), Companion to Greek Warfare (2021). Die von E. D. Carney und mir herausgegebenen Kongressakten Know Thy Neighbor – Macedonia and its Environment (2024) behandeln wechselseitige Einflüsse zwischen Makedonien und Epeiros, Thessalien, der Chalkidike und Thrakien.
Hinsichtlich der Argeaden lag der Fokus stets auf Philipp II. und vor allem auf Alexander III. In den letzten Jahren wurde die gesamt-argeadische Geschichte stärker beachtet: S. Müller u. a. (Hgg.), The History of the Argeads – New Perspectives (2017); Lexicon of Argead Makedonia (2020). Studien zu Perdikkas II. und Archelaos liegen vor.2 Doch bleiben Philipp und Alexander im Vordergrund. Schwerpunktthemen sind dabei Quellenproblematik, Repräsentation und Legitimation, Kriegsführung, Personalpolitik und höfische Kultur.
Für die Diadochenzeit zu nennen sind etwa The Legacy of Alexander von A. B. Bosworth (2002), V. Alonso Troncoso/E. M. Anson (Hgg.), After Alexander (2013), J. Roismans Alexander's Veterans (2013), E. M. Ansons Alexander's Heirs (2014) sowie Monographien zu Einzelpersonen wie Antigonos Monophthalmos (Briant 1973; Billows 1990) oder Demetrios Poliorketes (Wheatley/Dunn 2020). W. Heckels zweite Edition seines Who's Who in the Age of Alexander and his Successors (2021) umfasst auch die Diadochenzeit. Athen unter makedonischer Herrschaft behandelt O. Palagia/S. Tracy (Hgg.), The Macedonians in Athens (2003). Hauptthemen der Diadochenforschung sind Chronologie, Repräsentation, Legitimation, Kulturpatronage, Innovation und Tradition, Heerwesen, royal women, philoi und höfische Hierarchien.
Für die Antipatriden maßgeblich sind Franca Landuccis Studien. Sie hat das literarische Negativbild von Kassandros dekonstruiert: Es sei auf die Propaganda seiner Gegner Antigonos und Demetrios zurückzuführen. An deren Hof schrieb Hieronymos von Kardia über die Diadochenkriege und behandelte Kassandros entsprechend antigonidischer Sprachregelung.
Ein Fokus der Antigonidenforschung liegt auf Philipp V., monographisch behandelt von F. W. Walbank (1940), M. Kleu (2015) und M. D'Agostini (2019). Es existieren Einzelstudien zu Antigonos II., Antigonos III. und Perseus.3 Weitere Schwerpunktthemen sind Quellenproblematik (Polybios und Livius), Allianzen, royal women als dynastische Agentinnen, Heerwesen, Münzprägung und Konflikte mit Rom.
Quellenlage
In den vergangenen Jahrzehnten haben epigraphische und archäologische Erkenntnisse unser Bild von Makedonien erweitert. Dennoch bleibt die Quellenlage problematisch. Gravierend ist das Fehlen literarischer Quellen aus makedonischer Perspektive. Griechische und römische Autoren schrieben teilweise erheblich später, und ihre Sicht war jeweils durch ihre eigene Kultur geprägt. Eine notwendige quellenkritische Analyse umfasst: (1) die Hinterfragung der Sekundärquellen hinsichtlich Abfassungszeit, sozio-politischem Hintergrund des Autors, Darstellungsintention, Sprachregelung und Quellen, (2) die identische Behandlung der fragmentarischen Primärquellen, (3) Identifizierung von Tendenzen und Interpolationen und (4) Abgleichung mit zeitgenössischen epigraphischen, numismatischen und archäologischen Zeugnissen, soweit vorhanden.
Vermutlich dominierte in Makedonien oral tradition als Überlieferungsform und eine eigene Historiographie begann erst im 4. Jh. mit dem Aufstieg unter Philipp II.4 Makedonische logoi und die argeadische Herrscherliste überliefert die früheste historiographische Quelle über Makedonien, Herodots Historien (2. Hälfte des 5. Jhs.). Mit weitem Weltblick und eventuell eigenen Reiseerfahrungen in Makedonien schreibend, hielt er sich offenbar an die argeadische Sprachregelung und bewertete die Makedonen nicht klischeehaft aus griechischer Außensicht. Solche Tendenzen zeigt jedoch schon die zweite literarische Hauptquelle für die Argeaden des 5. Jhs., Thukydides – ungeachtet seiner äußerst wichtigen Informationen. Da makedonische Geschichte in ihrem eigenen Recht jedoch nicht sein Anliegen war, behandelte er die Makedonen sporadisch, wenn sie für sein Thema, den Peloponnesischen Krieg, relevant waren.
Zeitgenössische Zeugnisse aus dem 4. Jh. stammen von den attischen Rednern. Isokrates, Demosthenes, Aischines, Demades, Lykourgos, Hypereides und Deinarchos vermitteln Einblicke in Athens Beziehungen zu Makedonien. Indes ist einzurechnen, dass ihre Reden meist vor der Volksversammlung oder dem Volksgericht gehalten wurden und von entsprechender Zuhörerlenkung durch Beschwörung von Emotionen und Gemeinschaftsgefühl geprägt waren. Mitunter sind Informationen über Makedonien eher rhetorische Kniffe als verlässliche Angaben.5 So ist etwa Demosthenes als Insider athenischer Politik eine wichtige Quelle. Doch ist einzurechnen, dass sein Negativporträt Philipps II. als eines verkommenen Erzbetrügers, mit dem ein »anständiger« Grieche sich nicht an den Verhandlungstisch setzen sollte, im Kontext seiner Politik gegen Makedoniens Expansion stand.6 Eine entsprechende Prägung haben etwa seine bekannten Olynthischen Reden und die Philippischen Reden.
Ab dem 4. Jh. entstanden Werke von Makedonen und Griechen zur makedonischen Geschichte, die bestenfalls fragmentarisch erhalten sind: die Makedonika des Nikomedes von Akanthos, wohl Zeitgenosse Philipps II., von proto-historischer Zeit bis mindestens Perdikkas II. (BNJ 772),die Makedonika des höfischen Insiders Marsyas von Pella (BNJ 135) in 10 Bänden von den Anfängen bis mindestens ins Jahr 331 oder die des Theagenes mit Fokus auf Gründungsgeschichten und Etymologie makedonischer Städte. Von einer Geschichte des Illyrerkriegs Perdikkas' III., die Antipatros – vermutlich als Augenzeuge – geschrieben haben soll (BNJ 114 T 1), ist kein Fragment überliefert.7
Verloren sind weiterhin die Philippika des Theopompos von Chios (BNJ 115), die – polemisch und moralisierend – mit Philipps Aufstieg vor dem Hintergrund eines durch innere Konflikte zerrütteten Hellas abrechneten. Ähnlich wie Demosthenes stellte Theopompos Philipp als abgefeimten Schurken und Sittenstrolch dar, der es nur seinen Machenschaften und der Schwäche der griechischen Poleis verdankte, dass er mit seiner makedonischen Verbrecherbande Hellas versklaven konnte.8
Fragmentarisch erhalten ist die Universalgeschichte des Ephoros von Kyme (BNJ 70), der in den letzten Büchern als Zeitgenosse den Aufstieg Philipps II. – unter positiven Vorzeichen als ordnende Hand – beschrieb. Diodor benutzte Ephoros' Werk für seinen Abschnitt zur Expansion Makedoniens unter Philipp II.9 Die Hellenika von Aristoteles' Mitarbeiter Kallisthenes von Olynthos über die Zeit zwischen dem Königsfrieden und dem Dritten Heiligen Krieg inklusive der Berücksichtigung von Philipps Aktionen im Auftrag der Delphischen Amphyktionie (BNJ 124) sind ebenfalls verloren.
Sämtliche Werke der primären Alexanderhistoriographen sind nur fragmentarisch durch die sekundären Alexanderhistoriographen Diodor, Trogus-Justin, Curtius, Plutarch und Arrian erhalten, darunter die Schriften von Zugteilnehmern: der offizielle Propagandabericht in Alexanders Auftrag von Kallisthenes von Olynthos (BNJ 124), die Alexandergeschichte Ptolemaios' I. (BNJ 138), der Periplous zur Erkundungsfahrt der Indusflotte des Nauarchen Nearchos (BNJ 133), Wie Alexander erzogen wurde seines Kollegen Onesikritos (BNJ 134) und das – in Bezug auf östliche Ethnien klischeelastige – Werk von Alexanders Zeremonienmeister (eisangeleus) Chares von Mytilene (BNJ 125).
Arrian (2. Jh. n. Chr.) bewahrte in seiner Anabasis Alexandrou Fragmente der Werke von Ptolemaios und Aristoboulos, einem leitenden Ingenieur des Alexanderzugs (dessen Berichte die offizielle Linie wiedergeben; BNJ 139), und in seinen Indika Fragmente von Nearchos' Periplous.10 Trajans Partherkrieg (114–117 n. Chr.) mochte Arrian das Alexander-Sujet nahegelegt haben. Wahrscheinlich verfasste oder vollendete er die Anabasis jedoch unter Hadrian und wurde durch dessen Rücknahme der unhaltbaren Eroberungen Trajans jenseits des Euphrats geprägt. Dies könnte Arrians skeptische Haltung gegenüber Alexanders Vordringen in die östlichsten Satrapien und das Indusgebiet erklären.11 Er verfasste zudem eine Geschichte der Diadochen, die fragmentarisch erhalten ist.
Hieronymos von Kardia (BNJ 154) schrieb am Hof von Antigonos und Demetrios Poliorketes eine (verlorene) Geschichte der Diadochen. Zu den verlorenen zeitgenössischen Geschichtswerken zählen weiterhin: die Historiai des Atheners Diyllos (BNJ 73) von Mitte des 4. bis Ende des 3. Jhs., Makedonika oder Historiai des Douris von Samos (BNJ 76) von Philipp II. bis zu Lysimachos' Tod, Historiai des Phylarchos von Athen (BNJ 81) als Douris' »Fortsetzer« und die Geschichte Asiens und Geschichte Europas des Anekdotensammlers Agatharchides von Knidos (BNJ 86). Letztere Werke sind moralisierend auf Luxuskritik zur Gestaltung von Gegenbildern ausgerichtet.12 Die zeitgenössischen Erinnerungen des Aratos von Sikyon (2. Hälfte des 3. Jhs.; BNJ 231), führend im Achaiischen Bund, sind verloren, wurden aber von Polybios verwendet.
Diodor aus Sizilien (1. Jh.) verfasste eine nur teilweise erhaltene Universalgeschichte. Traditionell als bloßer Kompilator abgewertet, wurde er zu Recht als eigenständiger Historiograph aufgewertet, der seine zahlreichen Quellen sorgfältig auswählte. In einem ethnisch-teleologischen Zugang machte er ein höheres Wirken in der Weltgeschichte aus: philantropia (Menschenliebe) und sympatheia (Mitgefühl), wurden honoriert, grausame, egoistische und frevelhafte Taten bestraft. Diese Zugangsweise mindert nicht seinen hohen Quellenwert für die makedonische Geschichte.13
Der augusteische Autor Pompeius Trogus beschrieb in einer lateinischen Universalgeschichte von 44 Büchern eine Abfolge von Großreichen bis hin zu Rom als vollendendem Ordnungsfaktor. Moralisierend fokussierte er auf einzelne Herrscher, deren Mäßigung (moderatio) für ihn ein Schlüsselfaktor war. Mangelnde Kenntnis makedonischer Strukturen, Moralisierung und eine Tendenz zur Generalisierung und Übertreibung machen sein Werk problematisch. Überdies ist es nur als Exzerpt des spätantiken Autors Justin erhalten, der Trogus' Sprache und Tendenz jedoch weitgehend wiederzugeben scheint. Justins starken Kürzungen sind indes wohl manche chronologischen Unstimmigkeiten anzulasten.
Q. Curtius Rufus verfasste die einzig bekannte – unvollständig erhaltene – lateinische Alexandermonographie (Historiae Alexandri Magni), deren 10. Buch die Ereignisse in Babylon unmittelbar nach Alexanders Tod beschreibt. Curtius wird von spätaugusteischer Zeit bis zu den Severern datiert, mehrheitlich jedoch ins 1. Jh. n. Chr. Seine rhetorisch geformte Alexanderfigur ist eine Projektionsfläche für Tugenden und Laster gemäß römischen Wertmaßstäben. Vielfach könnte man eine augusteische Sprachregelung vermuten. So stellt Curtius etwa wie Trogus das Arsakidenreich als alter orbis dar, in das ein Vordringen über den Euphrat hinaus fragwürdig ist. Alexander erscheint als von »orientalischen« Lastern korrumpierter Feldherr, der die heimischen Sitten (mos maiorum) verrät und sich mit östlichen Herrscherinnen wie einer Kleophis (wohl ein römischer Seitenhieb auf Kleopatra VII.) einlässt. Da Curtius' Schrift jedoch einige einzigartige Informationen, gerade zum Achaimenidenreich, enthält, wird diskutiert, ob ihm der Bericht eines griechischen misthophoros in persischen, später makedonischen Diensten vorlag, der vielleicht als Bestandteil einer hellenistischen Bibliothek nach Rom gekommen war.14
Polybios aus Megalopolis war Zeitzeuge der römischen Zerstörung des Antigonidenreichs. Als Angehöriger der Führungsschicht des Achaiischen Bunds, der 169 als hipparchos das zweithöchste Kommando innehatte, kämpfte er 168 für den Bund auf antigonidischer Seite bei Pydna. Durch das römische Strafgericht kam er als eine von 1000 achaiischen hochrangigen Geiseln nach Italien, erfuhr jedoch eine Sonderbehandlung. In Rom fand er Eingang in den Scipionenkreis, wurde Freund und Mentor des jüngeren Scipio Aemilianus und sein militärischer Berater im 3. Punischen Krieg. Polybios schrieb eine unvollständig erhaltene Universalgeschichte in 40 Büchern. Zentral ist der Aufstieg Roms zur Weltmacht. Hohen Stellenwert haben bei Polybios Roms Verfassung und Ideale. Zentral ist auch die Tyche, das schicksalhafte Wirken. Sein Werk ist zudem durch seine achaiische Perspektive geprägt. Seine Porträts Philipps V. und Perseus' sind insofern tendenziös.15
Titus Livius schrieb in augusteischer Zeit Ab urbe condita, eine Geschichte Roms von der Stadtgründung bis zu seiner Gegenwart (Tod des Drusus 9 v. Chr.), von der nur ca. ein Viertel erhalten ist. Für die makedonische Geschichte stützte er sich stark auf Polybios. Die Problematik seiner Perspektive zeigt sich etwa anhand seines Alexanderexkurses. In einem Gedankenspiel, was geschehen wäre, wenn Alexander auf der Höhe seiner Kraft gegen ein römisches Heer gekämpft hätte, operiert Livius mit der ganzen Bandbreite von Dekadenz- und Tyrannentopik: Nicht einmal der von Fortuna und östlichen Lastern noch unverdorbene Alexander hätte die tugendhaften Krieger des republikanischen Rom besiegen können.16
Informationen liefern zudem Plutarch (Viten von Demetrios Poliorketes, Eumenes, Pyrrhos, Agis, Kleomenes, Aratos, Philopoimen, Flamininus und Aemilius Paullus), Appian, Strabon, Cornelius Nepos, Pausanias, Athenaios, Ailianos, Diogenes Laertios und Polyainos.
Epigraphische Zeugnisse aus argeadischer Zeit sind rar, stammen meist aus griechischen Städten und weisen griechische Diktion auf. So ist umstritten, ob der Titel basileus für manche Argeaden, zumal vor der Spätzeit Alexanders III., ein Zusatz aus griechischer Außensicht ist.17 Die Inschriften bieten wichtige Einblicke in argeadische Beziehungen zu griechischen Poleis oder zu Funktionären, zu Ökonomie, Onomastik, obermakedonischen Dynasten, Schwurzeugenpraxis, Stiftungs- und Weihungstätigkeit. In der Diadochenzeit und unter den Antigoniden wächst die Zahl inschriftlicher Zeugnisse an, auch aus Makedonien selbst. Sie informieren über königliche Selbstdarstellung, Formulare, Briefwesen, Regierungsjahre, Reichsadministration, Lokalverwaltung, Diplomatie, Städtisches, Kulte, Heer und Sportwettkämpfe.
Aus dem Osten stammen für die Geschichte Alexanders und der Diadochen relevante Keilschriftentexte: für Datierungsfragen die Babylonian King List und die Uruk King List, Verwaltungstexte, Chroniken und astronomische Aufzeichnungen.
In punkto Papyrologie gibt es einige Fragmente zur Geschichte Alexanders III.,18 etwa der stark fragmentierte POxy 1789 (2. Jh. n. Chr.) mit einer anonymen Alexandergeschichte (BNJ 148). Der 2007 publizierte POxy LXXI 4808 enthält kurze Kommentare zu Onesikritos, Chares, Kleitarchos, Hieronymos von Kardia und Polybios. Neu sind die Informationen, wonach Chares mit einer Negativtendenz gegen Alexanders General Parmenion und dessen Kreis schrieb und Kleitarchos der Tutor Ptolemaios' IV. war, was seiner traditionellen Datierung ins 4. Jh. widerspricht.19 Für die hellenistische Zeit sind papyrologische Quellen vor allem für die Ptolemäer zahlreich. Da sich deren Wege regelmäßig mit denen der Antigoniden kreuzten, gilt etwa der Papyrus Hauniensis 6 mit biographischen Informationen zu einzelnen Ptolemäern als Quelle für Antigonos Gonatas' Sieg bei Andros. Relevant für die Rezeption der Argeaden im Ptolemäerreich, vor allem der Kriege Alexanders, ist der Mailänder Papyrus mit 112 Epigrammen, dem makedonischen Dichter Poseidippos von Pella zugeschrieben, der im 3. Jh. am ptolemäischen Hof wirkte.
Die Archäologie hat in den vergangenen Jahrzehnten wichtige Erkenntnisse in unterschiedlichen Bereichen erbracht: zu makedonischen Siedlungen, Infrastruktur und Stadtkultur, Palastbauten und dynastischer Repräsentation, kulturellen Einflüssen auf Architektur, Weihungen, Kulten und Waffen. Auswertungen der Funde nicht-herrschaftlicher Gräber ergaben Einsichten in die Mortalitätsrate, Unterschiede beziehungsweise Ähnlichkeiten von Bestattungen und Grabbeigaben von Männern, Frauen und Kindern.20 Die Ausgrabungen der Gräber der makedonischen Elite, vor allem in Aigai-Vergina, gewähren Einblicke in Bestattungsriten, Grabtypen, Jenseitsglauben, Status von Frauen der Führungsschicht, kulturelle Einflüsse auf Grabdekoration, Kunstgeschmack, materielle Hinterlassenschaften wie Prunkgeschirr und elitäre Repräsentation.
Münzen sind weitere wichtige zeitgenössische Zeugnisse. Grundlegend ist die Information, wer die Prägehoheit hatte. Die Ikonographie der Münzen makedonischer Herrscher informiert über deren Selbstdarstellung: wie wollten sie sich und ihre Herrschaft verstanden wissen, inwiefern stellten sie sich in die Tradition ihrer Vorgänger oder führten neue Motive ein, auf welche Schutzgottheiten und Herrscherqualitäten beriefen sie sich? Der Materialwert, die Nominale und der Standard beleuchten die wirtschaftliche und politische Situation des Prägeherrn, ihre Verbreitung, den kulturellen und ökonomischen Austausch und Kriegsaktivitäten.21
Endnoten
1Im Folgenden sind alle Datierungen, wenn nicht anders vermerkt, v. Chr. Die zitierten Quellenpassagen sind meine Übersetzungen.Die Datierung der Reichsgründung um ca. 650 ist ein modernes Hilfskonstrukt auf Basis von Hdt. 8,139, wonach Alexander I. sechs Vorgänger hatte. Pro Person wurde eine Herrschaft von 25–30 Jahren veranschlagt.
2Perdikkas II.: Müller 2017. Archelaos: Hecht 2016.
3Antigonos II.: Tarn 1913; Gabbert 1997. Antigonos III.: Piraino 1954; LeBohec 1993a; Scherberich 2009. Perseus: Meloni 1953; Burton 2017; Worthington 2023.
4Zahrnt 1984, 327; Heinrichs 2020, 370 f.
5Dies betrifft gerade historische Rückblicke: vgl. Blank 2023: mehr im Sinne von lieux de mémoire zu verstehen.
6Dem. 2,6–7; 18–19; 18,19. 61. 247. 297–298; 4,10; 10,58; 18,68, 71–72. Vgl. Cooper 2022.
7Walsh 2012.
8Theopomp., BNJ 115 F 81, F 162, F 224–225a–b. Vgl. Pownall 2004, 149–175; 2005 und 2020, 487 f.; Scanlon 2015, 179–185.
9Diod. 16,3,8; Pol. 5,33,2. Vgl. Heinrichs 1989, 169 f.; Wirth 2005, 274; Scanlon 2015, 175–178.
10Taietti 2016, 165; Müller 2019a, 8–33; Liotsakis 2019; Pownall 2020, 50–55; Leon 2021.
11Wirth 1985b, 243; Liotsakis 2019, 67. Asirvatham 2024, 446 zum historischen Hintergrund.
12Diyllos: Müller 2016, 55 f.; Hatzopoulos 2018, 28 f. Douris: Landucci 1997; Scanlon 2015, 163–165. Phylarchos und Agatharchides: Scanlon 2015, 164 f.; Hau 2025.
13Wirth 1993b, 6–11 und 2007, 8, 17 f., 34, 57; Hau 2016; Meeus 2022. Diodors Quellenwert: Wirth 1993b, 10.
14Datierungsansätze: Baynham 1998, 213–219; Atkinson 2009, 2–9. These der »Söldnerquelle«: Baynham 1998, 7.
15Nicholson 2023, 27–31, 180–184.
16Liv. 9,17,16. 19,10–11. Alexander in römischer Rezeption: Finn 2022.
17Heinrichs 2020, 135 f.; Billows 2020, 439 f. Bestand: Paschidis 2020, 283–287.
18BNJ 153, F 1, 7–9, 10c.
19Landucci/Prandi 2013. Chares: Djurslev 2024, 411–413. In älterer Forschung klassifizierte man sekundäre Alexanderhistoriographen, denen man Kleitarchos als Hauptquelle zuschrieb (Trogus-Justin, Curtius, Diodor; bei Plutarch war es umstritten), als »Vulgata«-Autoren (romanhaft, sensationsheischend). Diese wenig hilfreiche Kategorisierung mit der problematischen Implikation, dass Arrian mit Ptolemaios und Aristoboulos als Hauptquellen das »nüchtern-sachliche« Gegenstück sei, ist seit längerer Zeit ad acta gelegt. Vgl. Wirth 1993c, 8 f.
20Kosmidou/Malamidou 2004; Kyriakou/Tourtas 2013 und 2015; Saripandi 2017; 2019a–b und 2024; Hatzopoulos 2020, 19–33; Salminen 2024.
21Heinrichs 2012, 134 und 2020, 170–176.
2 Makedonien und die Makedonen
Geopolitik
Bis zur Vereinigung unter Philipp II. in den 350er Jahren war Makedonien politisch zweigeteilt. Niedermakedonien (kato Makedonia), die Gebiete östlich des Olymps mit den zentralen Landschaften Pierien und Bottiaia standen unter argeadischer Herrschaft. Obermakedonien (ano Makedonia), die bergigen Landschaften westlich des Bermion, bestand aus autonomen Lokaldynastentümern. Vermutlich resultierte die Zweiteilung daraus, dass die Makedonen vor der Landnahme in Niedermakedonien (ca. 7. Jh.) aus Obermakedonien kamen. Viele Makedonen blieben aber im Hochland. Eordaia, ein Sonderfall, geographisch eher Obermakedonien zugehörig, unterstand schon früh den Argeaden. Ob Tymphaia vor der Annektion durch Philipp II. zu den Makedonen oder Molossern gezählt wurde, ist unklar.22
Der Umstand, dass die obermakedonischen Lokaldynasten ihre eigenen Interessen vertraten, war ein Problem für die Argeaden, zumal die Lynkestis einen Einfallskorridor nach Niedermakedonien für illyrische Verbände bildete. Personelle Vernetzungen zwischen Ober- und Niedermakedonien, etwa durch Eheallianzen, sollten die Gefahren minimieren.
Ober- und Niedermakedonien hatten Dörfer (komai) und Städte (poleis; polismata). Ausgrabungen haben gezeigt, dass die niedermakedonischen Poleis in klassischer Zeit ähnlich strukturiert waren wie die griechischen: mit befestigten Stadtmauern, Theatern, Heiligtümern und Gymnasien. Auch in den obermakedonischen Hochlanden gab es eine solche Stadtkultur, wie in Aiane, dem Zentrum Elimeias.23
Aigai war die erste Residenz und die Grablege der Argeaden und galt als erste argeadische Gründung. Es wurde durch die Palastanlage – datiert ins 4. Jh. – dominiert. Entweder Archelaos oder Amyntas III. verlegte die Residenz nach Pella am Loudias-See, vermutlich wegen der besseren Anbindung an den Thermaischen Golf durch den See und schiffbaren Loudias-Fluss und wegen der besseren Sicht über die Ebene im Angriffsfall. Pella wurde zur größten Stadt Makedoniens; das Palastareal erstreckte sich über die Akropolis.24 Aigai blieb weiterhin argeadische Grablege, Festveranstaltungs- und Erinnerungsort. Die Antigoniden hatten mehrere politische Zentren: Pella, Aigai, Kassandreia, Pydna und Demetrias in Südthessalien, eine von Demetrios Poliorketes begründete Hafenstadt und Flottenbasis.
Unmittelbare Nachbarn der Makedonen waren Thessaler, Epeiroten, Illyrer, Dardaner, Paionen, Triballer, Chalkidier und Thraker. Geostrategisch war Thessalien mit seinen Marschkorridoren zwischen Makedonien und Zentralgriechenland bedeutend. Im makedonisch-epeirotischen Interesse lag die Abwehr der permanenten Bedrohung durch illyrische Invasionen.25 »Illyrer« ist ein Sammelbegriff aus Außensicht. Im 5. und 4. Jh. war mit Illyrien grob das heutige Nord- und Zentralalbanien gemeint, im 3. und 2. Jh. Albanien, Montenegro und deren Hinterland.26 Paionien war als kontrollierte Pufferzone zwischen Makedonien und den nördlichen Ethnien strategisch wichtig.27 Thrakien, ebenfalls von verschiedenen Ethnien bewohnt, wurde von den antiken Autoren unterschiedlich definiert; die Forschung versteht darunter die Gebiete zwischen Donau und Ägäis und zwischen Strymon und Schwarzmeerküste.28 Zu den Bewohnern der griechischen Städte auf der Chalkidike gab es vielfältige makedonische Kontakte und Verbindungen.29 Der vermutlich um 432 gegründete Chalkidische Bund mit Olynthos als Zentrum entwickelte sich rasch zu einem Konkurrenten der Argeaden, bis Philipp II. ihn 349–348 zerschlug. In Thrakien erlangten im 5. Jh. die Odrysen die Führung. Ihre Beziehung zu den Argeaden war wechselhaft. Archäologische Funde bezeugen Kulturaustausch und gegenseitige Beeinflussung.30 Die von Philipp II. etablierte Kontrolle über thrakische Gebiete reduzierte sich in hellenistischer Zeit.
Wirtschaft
Makedonien war durch drei große, schiffbare Flüsse strukturiert: Haliakmon, Axios und Loudias, die in den Thermaischen Golf flossen. Große Seen wie der Bolbe-, Prasias- und Loudias-See ermöglichten Fischfang; Makedonien war bekannt für seine Aale.31 Landwirtschaftlich ausgerichtet, war Makedonien mit seinen Erzeugnissen selbstversorgend, dennoch nicht reich.
Über die Flüsse konnte das makedonische Hauptexportgut aus dem Landesinneren zu den Häfen gebracht werden: hochwertiges Schiffsbauholz. Der regierende Argeade führte das Holzgeschäft als herrscherliches Monopol, vermutlich als kontrolliertes Leasing-System. Zumindest in späterer Argeadenzeit wurden auch die Transitsteuern und Hafenzölle für die Holzausfuhr verpachtet.32 Die Flottenmacht Athen war der Hauptabnehmer. Als die Thebaner kurzzeitig (371–362) die Hegemonie in Hellas erlangten und Flottenpolitik am Hellespont betreiben wollten, beschafften sie Schiffbauholz vermutlich aus Makedonien, das damals unter ihrem Einfluss stand. Obwohl die Argeaden die nötigen Ressourcen und Werften für den Schiffsbau besaßen, konnten sie aus finanziellen und politischen Gründen keine eigene Flotte aufbauen. Eine solche wurde erst in relativ kleinem Umfang unter Philipp II. geschaffen.
Auch die Ausbeutung von Bergwerken war herrscherliches Monopol, entweder direkt oder mit temporärer Verpachtung von Schürfrechten.33 Wenige Argeaden hatten Zugriff auf Edelmetallminen, dies zudem nur zeitweilig. Philipp II. verdankte das Silber seiner frühen Prägungen seinen Expansionen in den chalkidisch-thrakischen Raum.34
Kulturelle Aspekte
Makedonien besaß eine eigene Kultur, die stark griechisch, aber auch von anderen Nachbarn wie Epeiroten oder Thrakern geprägt war. Während der ungefähr drei Jahrzehnte persischer Oberhoheit zwischen dem Ende des 6. und Anfang des 5. Jhs. bekam auch das persische Vorbild für die herrscherliche Repräsentation Relevanz.
Die griechische Einwirkung auf Makedonien zeigt sich etwa in der Vielzahl griechischer Personennamen, die beliebt waren, wie Alexandros oder Pausanias. Ein weiteres Beispiel ist Makedoniens Pantheon. Verehrt wurden die griechischen Götter wie Zeus, Herakles, Asklepios, Dionysos, Demeter oder Artemis. Zentral war Zeus, Schutzpatron der Argeaden, der laut der Gründungsgeschichte ihre initiale Landnahme unterstützt hatte.35 Die Schutzgottheit war strategisch-legitimatorisch gewählt: Zeus setzte die Herrscher auf Erden ein, trat als Schutz- und Helfergott auf und konnte Militärsiege bescheren. Eine Tradition, wonach Zeus' Sohn Makedon sich im pierischen Gebiet angesiedelt habe und namengebend geworden sei, gab Zeus, seinem Aspekt als Vatergott gemäß, den Zug der väterlichen Gottheit für alle Makedonen.36
Im pierischen Dion am Fuß des Olymps, dem religiösen Zentrum des argeadischen und antigonidischen Makedoniens, befand sich das größte Heiligtum für Zeus. Archelaos richtete in Dion Olympia, 9-tägige Spiele zu Ehren des Zeus und der Musen ein, die im Monat Dios (Okt./Nov.), dem ersten im makedonischen Jahreskreis, stattfanden.37 Sie waren ein Repräsentationsmedium der Argeaden, um sich als kultivierte, hochrangige und gutsituierte Dynastie zu zeigen.
Das Zeus-Heiligtum in Dion war ein eindrucksvoll angelegter repräsentativer Raum mit einem monumentalen Altar. Die Antigoniden veröffentlichten dort offizielle Dokumente wie Friedensverträge, von den Argeaden wird es angenommen. Vor dem Temenos stellten Argeaden und Antigoniden Weihgaben auf.38 Der Ort garantierte eine hohe Effektivität herrschaftlicher Inszenierung. Beständig wurde daran erinnert, dass Zeus die herrschende Dynastie eingesetzt hatte und beschützte. Entsprechend ließ Alexander III. dort eine lebensgroße bronzene Reitergruppe aufstellen, die er nach seinem Sieg am Granikos 334 bei Lysippos in Auftrag gegeben hatte. Gezeigt wurden Alexander und seine 25 in der Schlacht gefallenen Hetairen.39 Das Kunstwerk war zugleich Siegesmonument, pietätvoller Dank an Zeus, Erinnerung an Zeus' legitimierende Unterstützung der Argeaden, Sinnbild des Zusammenhalts zwischen Heer und Herrscher (oder, je nach Betrachter, Elite und Herrscher) und hohe Ehrung für die Toten, die von Alexanders gutem Führungsstil zeugen sollte. Deren Familien kam das dauerhafte Gedenken an den tapferen Einsatz ihrer Verwandten als symbolisches Kapital zugute.
Als proklamierter Urahn der Argeaden besaß Herakles in der makedonischen Kultlandschaft eine besondere Stellung. Die Wahl war geschickt: Herakles wurde mit dem mühsamen, doch redlichen Weg der Tugend und mit Wohltaten für die Menschen assoziiert. Er hatte Monster, Kriminelle und ungerechte Herrscher beseitigt, besaß einen Bezug zu Sport (Begründer der Olympischen und Nemeischen Spiele) und den Gymnasien, Krieg und Militärtraining, Viehzucht und Weidewirtschaft, Unheilsabwehr, kinship diplomacy und Zugänglichkeit (da er vom Menschen zum Gott geworden war).40 Unter den Antigoniden behielt Herakles seine zentrale Stellung, verehrt als Ahnherr (patroios) und als Beschützer und Behüter (peritos, phylakos, propylaios). Seine Keule, gelegentliches Münzmotiv, wird als Symbol seiner Kraft gedeutet, militärische Siege zu bringen (kallinikos, epinikos).41
Dionysos' Bedeutung in Makedonien hing mit Fruchtbarkeit für die Landwirtschaft, Weinanbau, Orphischen Mysterien und chthonischen Elemente zusammen. Seine Relevanz zeigt sich wohl auch darin, dass Euripides' Tragödiendichtung Bakchai über Dionysos' Wirkungsmacht vermutlich unter Archelaos' Patronage entstand.42 Dionysos Pseudanor (falscher Mann) galt ein Kult, der in einer legendenhaften Errettungsgeschichte der Makedonen erwähnt ist. Demnach bediente sich der Argeade Argaios, als ein Angriff der in Überzahl befindlichen Taulanter (im Norden Makedoniens) bevorstand, einer Kriegslist. Er postierte junge Dionysos-Anhängerinnen mit Thyrsoi-Stäben auf einem Berg, die Gesichter mit Kränzen bedeckt. Die Hoffnung, dass sie von weitem wie Krieger mit Lanzen aussahen, erfüllte sich. Die Taulanter zogen sich zurück. Argaios weihte Dionysos Pseudanor einen Tempel und nannte die Priesterinnen Mimallones, »Männer-Nachahmerinnen«.43 Die literarischen Belege stammen erst aus nach-argeadischer Zeit, der früheste von Kallimachos (3. Jh.). Es ist unklar, wie alt der Kult war; inschriftliche Evidenz aus Beroia stammt sogar erst aus dem 3. Jh. n. Chr. Doch meist wird eine lange Kulttradition bis in argeadische Zeit angenommen.44 Umstritten ist auch das Alter des Kults für Zeus Hetaireios, Patron der Kampfgenossenschaft. Kulte, die erst in antigonidischer Zeit bezeugt sind, aber als älter gelten, sind die für Herakles Propator/Patroios (Vorfahr), Herakles Kallinikos, auf militärische Erfolge bezogen, und Herakles Kynagidas (Jäger; Beschützer der elitären Jagd).45
Die makedonische Grabkultur zeugt vom Glauben an ein Leben nach dem Tod. Unterirdische Kammergräber von Elitemitgliedern in Aigai-Vergina (datiert 4.–2. Jh.) enthielten reiche Beigaben wie Grabklinen, Bankettgefäße aus Edelmetall, Waffen, Schmuck und Kleidung. Das wiederkehrende Thema von Persephone in der Grabikonographie gilt als ein weiterer Indikator.46
Für die schwierige Rekonstruktion der makedonischen Sprache stehen Personennamen, Monatsnamen des makedonischen Kalenders (z.B. Daisios), Glossen, vereinzelte literarische Schlaglichter und ein Fluchtäfelchen in Alltagssprache aus Pella (4. Jh.) zur Verfügung. Makedonische Inschriften, ohnehin erst im 4. Jh. einsetzend und rar, sind in koine-Griechisch verfasst, der Kanzleisprache spätestens seit Philipp II. Die aktuelle communis opinio sieht im Makedonischen einen nordwestgriechischen Dialekt mit spezifischen phonetischen und dialektalen Eigenheiten. Der Name Berenike bestätigt Plutarchs Information, dass die Makedonen φ als β aussprachen; die griechische Form lautet Pherenike (Siegbringerin).47 Andere typisch makedonische Namen waren Perdikkas oder Alketas; bei der Namensgebung wandelte sich über die Jahrhunderte wenig. Als makedonische Begriffe gelten etwa sari(s)sa, die typisch makedonische lange Lanze, oder basilissa.48 Curtius' Behauptung, für einen Griechen sei der makedonische Dialekt unverständlich gewesen, gilt als unglaubwürdig.49
Wie sich die Mitglieder des makedonischen Herrscherhauses selbst nannten, ist unklar. Die Bezeichnung Argeaden (Argeadai) ist zuerst im frühen Hellenismus belegt.50 Die These, »Argeaden« leite sich vom protohistorischen Herrscher Argaios ab, überzeugt nicht.51 Ein besonderer Platz in der Erinnerungskultur kam bei Gründungsgeschichten der Gründergestalt zu, in diesem Fall Perdikkas I., nicht Argaios, Perdikkas' Sohn. Der Begriff Argeaden kam daher, dass sie ihre Herkunft auf einen Herakles-Nachkommen, König Temenos von Argos, zurückführten. Daher könnten sie sich entweder Argeaden genannt haben, Herakliden oder Temeniden.52 In jedem Fall spiegelte ihre Selbstbezeichnung ihr genealogisches Prestige wider.
Endnoten
22Eordaia: Hatzopoulos/Paschidis 2004, 794. Tymphaia: Hatzopoulos 2020, 43.
23Aiane: Karamitrou-Mentessidi 2011, 95–99; Hatzopoulos 2020, 24 f.
24Hatzopoulos/Paschidis 2004, 805 f.; Akamatis 2011; Psoma 2020, 393 f.
25Greenwalt 2008, 82 f., 91, 96 f. und 2010a, 288 f., m. A. 27; Carney 2020, 221. Epeiros' Gestalt (kontrovers diskutiert): Beck 1997, 135–144; Meyer 2013 und 2015, 298 f.; Mili 2019.
26Papazoglou 1978; Wilkes 1995, 97; Dzino 2014, 49–61.
27Wright 2012, 7.
28Archibald 2010, 326.
29Heinrichs 2017, 88–91 und 2020, 45 f.
30Archibald 2010, 331–338; Greenwalt 2015. Zur gegenseitigen Beeinflussung von Grabkultur: Palagia 2024, 153–159. Ein getischer Herrscher (3. Jh.) wurde auf einer Grabwand, beeinflusst durch das Alexandermünzporträt auf Lysimachos' Tetradrachmen, mit Ammonshörnern dargestellt.
31Ath. 2,71C.
32Borza 1987; Psoma 2015; Karathanansis 2019; Müller 2020, 506–508.
33Bissa 2009, 33–35, 37 f.; Kremydi 2011, 160 f.; Heinrichs 2020, 345 f.
34Heinrichs 2024, 97–106.
35Hdt. 8,137,3–138,2; Diod. 7,16. Vgl. Voutiras 2006; Rizakis 2022, 123; Santagati 2023.
36Ps.-Hes. Cat. F 7,3.
37Diod. 17,16,3–4; Arr. An. 1,11,1 (irrtümlich in Aigai lokalisiert). Vgl. Mari 2002, 55–60; Rizakis 2022, 123 (letzter inschriftlicher Beleg gegen das Jahr 100 v. Chr., SEG 14,478).
38Pol. 4,62,2–3; Liv. 44,6,3. Vgl. Mari 2020, 203. Zu Dion: Mari 2002; Hatzopoulos/Mari 2004.
39Plin. NH 34,64; Arr. An. 1,16,4; Plut. Alex. 16,8; Just. 11,6,13. Vgl. Stewart 1993, 123–130; Calcani 1997, 31–35; Bowden 2017, 177.
40Iliadou 1998; Tsagalis 2011, 45 f.; Koulakiotis 2017, 205–209; Kravaritou 2023, 101–103. Argeadischer Urahn: Isok. Phil. 34. 111–115; Plut. Alex. 2,1; Hdt. 8,137,1. 138,2. Tugendvorbild: Xen. Mem. 2,1,21–34; Isok. 5,109–112. Retter vor »Bösewichten«: Paus. 6,21,3; Philostrat. Im. 2,21. Vgl. Djurslev 2021. Universales Referenzmodell: Palagia 1986, 138; Tsagalis 2011, 45 f.
41Hatzopoulos 2023, 122.
42Pownall 2020, 228; Stoneman 2021, 46 f.
44Hatzopoulos 1994a, 79–82; Fulińska 2014, 50; Voutiras 2019, 136 f.
45In Beroia gab es die Spiele der Herakleia, wie eine unlängst publizierte Inschrift aus Kibyra (2. Jh.) bezeugt: Hatzopoulos 2021a und 2023, 122.
46Palagia 2016, 79–87; 2018a, 28 und 2020, 42 f., 117; Oikonomou 2021, 652–655. Vgl. Landucci 2015.
47Plut. Mor. 292E. Überblick über die Debatte: Hatzopoulos 2020, 63–79. Namensgebung: Hatzopoulos 2000a, 103–108. Vgl. Tataki 1994 und 2011.
48Kalléris 1954, 116, 256; Heinrichs 2020, 461.
49Curt. 6,9,34–36. Vgl. O'Neil 2006, 206–210.
50Poseidipp. Ep. 31 AB, Z. 3. Vgl. Angiò 2020, 435 f. und 2021.
51King 2017, 17.
52Vgl. Heinrichs 2020, 100 f.
3 Herrschaft und dynastische Repräsentation
Gründungsgeschichten
Gründungsgeschichten, eine spezifische Form, Legitimation zu kommunizieren, rechtfertigen durch eine geformte Vergangenheit die Verhältnisse der Gegenwart. Die Gründungsgeschichte der Argeaden erklärt ihre Herrschaft mit ihren initialen Gründungstaten, göttlicher Legitimation und genealogischen Voraussetzungen.53 In ihrer frühesten fassbaren Form findet sie sich bei Herodot in der 2. Hälfte des 5. Jhs. Er gibt sicherlich die makedonische Sprachregelung wieder, wie sie unter Perdikkas II. bestand und die auf dessen Vater Alexander I. zurückgehen dürfte.54
Demnach stammte der Reichsgründer Perdikkas I. aus dem Haus des Herakliden Temenos, König von Argos in der Peloponnes. Aus Argos geflüchtet, schlug Perdikkas sich mit seinen zwei älteren Brüdern nach Obermakedonien durch. Bei einem lokalen basileus verdingten sie sich als Viehhirten; Perdikkas hütete Ziegen und Schafe. In der frühzeitlichen Tischgemeinschaft von Gleichen unter Gleichen wurde er durch das regelmäßig auftretende Wunder, dass sein Brot doppelt so groß wie das der anderen wurde, herausgehoben, auch über den Herrscher. Alarmiert von diesem Zeichen von Perdikkas' Herrschaftsprädestination wollte der basileus die Brüder vertreiben, vergab aber zuvor dank eines göttlichen Sonnenwunders – Sonnenlicht in Assoziation mit Herrscherheil – sein Herrschaftsrecht, das Perdikkas mit kluger Geistesgegenwart annahm.55 Das dritte Wunder rettete die Brüder auf der Flucht vor den Häschern des basileus: Ihnen schnitt ein anschwellender Fluss, wohl der Haliakmon, den Weg ab. Die Brüder nahmen Landstriche in Niedermakedonien ein. Der göttliche Schutzpatron, dessen Namen Herodot nicht eigens nennt, das Verständnis seines Publikums voraussetzend, war sicherlich Zeus. Die drei Wunder verweisen auf ihn als Sonnen- und Himmelsgott, assoziiert mit Wetterphänomenen, Herrschaftsrechten, Herrscherschutz und Sieghaftigkeit.56 Auch in der argeadischen Münzikonographie spielten Zeus und seine Symbole eine wichtige Rolle.57
Die Gründungsgeschichte ist nach einem kulturell und zeitlich übergreifenden Mythenschema gestaltet: eine Aufstiegsgeschichte über von Geburt her hochrangige Personen, die ausgesetzt, vertrieben und/oder verfolgt werden und aus Armut dank göttlicher Begünstigung, Hilfe durch Personen mit symbolisch herrschaftsvorbereitenden Tätigkeiten (Gärtner; Hirten) und eigener Leistung zur prädestinierten Führungsrolle gelangen. Perdikkas' Rolle als Hüter von Schafen und Ziegen präfiguriert seine Aufgabe als Hirte seiner Reichsbevölkerung. Die Erklärungsansätze sind in eine anschauliche Inszenierung von makedonischer Frühgeschichte gebettet, in die mündlich überlieferte Erinnerungen einflossen.58 Die griechische Abkunft der Argeaden gilt als unhistorische Propaganda. Argos wurde wohl aufgrund des mythologischen Prestiges gewählt.59
Gründungsgeschichten müssen sich dem Wandel politischer Anforderungen und sozialer Wertvorstellungen anpassen. Archelaos beauftragte den griechischen Tragödiendichter Euripides mit einer Neufassung. Das (verlorene) Stück trug Archelaos' Namen und war als Prequel angelegt: Der neue Reichsgründer war ein Vorfahre Perdikkas' I.: Temenos' Sohn Archelaos.60 An den Hauptelementen der von Alexander I. etablierten Sprachregelung (sozusagen dem canon) wurde nicht gerüttelt, ebenso wenig wie bei einer weiteren Revision, die zuerst bei Philipps Zeitgenossen Theopompos fassbar ist. Als neuer Gründer wird Karanos eingeführt, ein griechischer Begriff für einen militärischen Anführer, ebenfalls ein Vorfahr Perdikkas' I.61
Für die Antigoniden ist kein vergleichbares Ursprungsnarrativ erhalten. Sie sollen sich auf eine Abstammung von Herakles und den Argeaden berufen haben, doch ist umstritten, ob dies seit Antigonos II. oder seit Philipp V. der Fall war. Hauptargument für Antigonos II. ist das Bildprogramm seines auf Delos gestifteten (verlorenen) Monuments der Vorfahren, das gemäß rekonstruierter Inschrift einen Perdikkas, somit einen argeadischen Ahnherrn, und mutmaßlich Herakles einbezogen haben soll.62
Bei Philipp V. gibt es verschiedene Bezugspunkte: Polybios' (obgleich tendenziöser) Hinweis, Philipp habe stets als Verwandter (syngenes) Alexanders und Philipps erscheinen wollen; Livius' Aussage zum Wissen im zeitgenössischen Argos, Heimat der makedonischen Könige zu sein; eine Waffenweihung Philipps an die rhodische Athena Lindia in den Fußstapfen Alexanders III. und drei Weihepigramme der Anthologia Palatina.63 Sie schildern Philipps Votivgabe für Herakles, Hörner und Fell eines selbst erlegten Stiers, und porträtieren ihn als Herakles' würdigen Nachkommen.64 Auf seinen Gold- und Silberprägungen erschien das Symbol der Herakleskeule, auf Bronzemünzen ein Herakleskopf mit Löwenexuvie.65 Als weitere Verbindungslinie zu Herakles und den Argeaden wird die Verehrung des Zeussohns Perseus gesehen, der mit Argos (als mythischer Erbe) und Herakles (genealogisch) verbunden war und als entfernter Vorfahr der Argeaden gegolten haben soll.66. Philipp führte Perseus' Kopf mit Helm und harpe (Hakenschwert) als neues Münzaversmotiv ein und nannte seinen Sohn Perseus. Als die Athener indes 201 beschlossen, die Namen Philipps und seiner Vorfahren in öffentlichen Dokumenten zu tilgen, blieben Namen argeadischer Herrscher erhalten.67
Herrschaft
Der argeadische Herrscher war Repräsentant von Reich und Bevölkerung. Eine normierte Nachfolgeregelung wie die Primogenitur gab es offenbar nicht, auch wenn meist ein Sohn des Herrschers nachfolgte. Ansonsten war es der verwandtschaftlich nächste männliche Angehörige. Unabdingbar war die Zugehörigkeit zum Argeadenhaus. Daneben entschieden als weiteres symbolisches Kapital: Rückhalt am Hof zum Zeitpunkt der Vakanz, genealogisches, politisches und ökonomisches Prestige der Mutter, Förderung durch den Amtsvorgänger, militärische und politische Erfahrungen und Fähigkeiten und reichsweite und reichsübergreifende Netzwerke.
Auch ein Vormund (epitropos), der stellvertretend für einen unmündigen oder anderweitig herrschaftsunfähigen Argeaden regierte, musste wohl zum Argeadenhaus gehören, da die Familie so untrennbar mit der Herrschaft verbunden war.68 Soweit erkennbar, prägte ein epitropos keine Münzen im eigenen Namen; ein argeadischer Herrscher trat dagegen wohl frühestmöglich als Prägeherr in Erscheinung.
Der alte Streitpunkt um die Charakterisierung makedonischer Herrschaft ist verknüpft mit der Kontroverse um die Mitspracherechte der – sporadisch bezeugten – makedonischen Heeresversammlung. Eine Richtung sieht sie als regelmäßig einberufenes Organ, das die monarchischen Spielräume begrenzte. Die Gegenrichtung hält sie für ein Instrument von Schaupolitik, das nur in vereinzelten Sonderfällen als legitimierendes Organ für schon vorher gefällte Entscheidungen des Herrschers einberufen wurde. Als plausibler Mittelweg gilt, dass eine Entscheidungsbefugnis der Heeresversammlung theoretisch bestand, praktisch aber von Situation und Stellung des Herrschers abhing.69
Mit Fokus auf die argeadische Eigensicht stellt E. Carney heraus, dass es die Herrschaft eines Familienclans war, dessen männliche und weibliche Angehörige ihr Haus repräsentierten.70 Vor dem schnellen und weitgreifenden Aufstieg unter Philipp II. und Alexander war ein Herrscher ein primus inter pares, limitiert von den führenden Familien. Entsprechend kam es zu inneren Konflikten unter Alexander, als sich die Hierarchien durch seine neue Rolle als Herrscher über ein weltweites Reich entscheidend verschoben.71
Eine Trennlinie zwischen »privat« und »öffentlich« lässt sich bei der makedonischen Herrscherfamilie schwer ziehen. Ihr Leben war dem Primat der Politik untergeordnet und Teil einer legitimatorischen Inszenierung. Die These von der makedonischen Herrschaft als persönlicher Monarchie ist kein Widerspruch.72 »Persönlich« bedeutete nicht »privat«. Die Quellen geben ohnehin nur Einblicke in öffentliche Inszenierungen, auch wenn moralisierende Autoren mitunter vorgeben, ins Schlafzimmer zu spähen. Der Argeadenherrscher war führender Feldherr, Politiker, Diplomat, Gastgeber und der oberste Richter und Oberpriester.73 Politik und Religion waren untrennbar verzahnt. Über die kultischen Rollen der Argeadinnen ist bislang wenig bekannt. Es wird angenommen, dass sie an der öffentlichen Kultausübung beteiligt waren, vielleicht als Priesterinnen.74
Der argeadische Herrscher dominierte die loyalitätsstiftende Distributionspolitik und besaß das meiste Eigentum. Dorea bezeichneten zeitlich begrenzte und deshalb bei Regierungswechsel zu erneuernde Landschenkungen an seine Gefolgsleute zwecks Loyalitätserhalt. Inschriften zeigen, dass der Beschenkte das Land zwar vererben, tauschen oder verkaufen konnte, der Herrscher jedoch seine Eigentumsansprüche behielt und solche Änderungen bestätigen musste. Bei Loyalitätsmangel des Beschenkten konnte er das Geschenk auch zurückfordern.75
Argeadische Ehen waren politische Mittel der Interessenswahrnehmung im Moment der Vereinbarung. Um weit gespannte Heiratsallianzen auszuüben und ein ausreichendes Reservoir an potenziellen Erben zu garantieren, betrieb der Argeadenherrscher Polygamie. Dieses Privileg galt nicht für andere Familienmitglieder oder die makedonischen Führungsschichten. Gesichert ist die polygame Praxis erst für Philipp II. mit sieben Ehefrauen. Doch wird meist angenommen, dass es sich um eine ältere Tradition handelt, vielleicht ab Alexander I.76
Der primus inter pares-Stellung entsprechend bezeichnete sich ein Argeadenherrscher nicht selbst als basileus. Auf den Münzlegenden ist er nur mit seinem Vornamen (im Genitiv) bezeichnet, in Dokumenten mit Vornamen und Patronym.77 Sprechen griechische Autoren bei einem Argeaden von basileus, meinen sie in griechischer Außensicht eine monarchische Herrschaftsform. Nicht einmal für Alexander III., der durch seine Eroberungen eine entscheidende Machtverschiebung gegenüber der Elite bewirkte, ist der basileus-Titel unumstritten. Unklar ist, ob Münzen, die diesen ausweisen, aus seiner letzten Regierungszeit oder postum sind. Ebenso ist ungewiss, ob epigraphische Belege des Titels für Philipp II. und Alexander postume oder aus griechischer Außensicht formulierte Zusätze sind.78
Den Thron als monarchisches Signum kannten die Argeaden vor dem Wandel des Herrschaftskonzepts durch Alexanders Eroberungen wohl nicht. In der griechischen Welt und vermutlich auch in der makedonischen kam ein Thron Göttern zu, allenfalls noch protohistorischen Heroengestalten. Alexander übernahm wohl nach seinem Sieg über Dareios III. den persischen Thron. Daher datiert O. Palagia die in makedonischen Elitegräbern von Vergina gefundenen Marmorthrone erst nach Alexanders Eroberungen: Mit Philipp III. seien Alexanders Thron und die Thronpraxis von Asien nach Makedonien gelangt.79
Die Profilierungszwänge der Diadochen, das Ende argeadischer Herrschaft und die Etablierung neuer Reiche brachten vielfache Neuerungen mit sich, etwa die auch in zeremonielle Form gegossene Distanzierung des Herrschers von seiner Elite durch die Annahme des basileus-Titels. Die Gestalt eines hellenistischen basileus war abhängig von Reich und Individuum.80 Die viel zitierte Passage in der Suda (s. v. basileia β 146 Adler), wonach basileia bedinge, ein Heer führen und gut politisch agieren zu können, ist eine generelle Annäherung, zudem geprägt von der Geschichte der Diadochen. Allgemein ist zu sagen, dass ein makedonischer König weiterhin dem Anspruch nach Landesschützer, Hüter der nomoi und fürsorgender Wohltäter war. Kriegerischer Erfolg blieb Basis seiner Autorität. Die Primogenitur war relevant, jedoch keine feste Regel. Strategien, um dem Wunschkandidaten die Nachfolge zumindest zu erleichtern, waren öffentliche Profilierung und Heraushebung mittels einer besonderen Erziehung. Eine Neuerung war die besonders von den Diadochen praktizierte Ernennung ihres Wunschnachfolgers zum Mitregenten.
Der Hof war politisches, gesellschaftliches und kulturelles Zentrum, Plattform der Kommunikation mit der Elite und Bühne der Visualisierung von Status. Kulturpatronage, Förderung von wissenschaftlicher Erkenntnis und technischen Neuerungen gehörten zur königlichen Außendarstellung.81 Reichsweite Kulte für Antigoniden sind nicht bekannt, jedoch Einzelkulte für individuelle Antigoniden in griechischen Städten, die auf Bürgerinitiative hin eingerichtet wurden.82 Der antigonidische König konnte seine höchsten Funktionäre mit dorea bedenken und kontrollierte den Holzhandel und die Erträge aus Bergwerken.
Die ranghöchsten Makedonen im Argeadenreich wurden als hetairoi, (Kampf-)Gefährten, bezeichnet. Aufgrund intensiver Netzwerkpflege, Heiratspolitik und Nachwuchsförderung konnten sich Familienclans langfristig in der Führungsriege etablieren.83 Der weiter gefasste Begriff philoi (Freunde) eines Herrschers meinte politische Freunde, Angehörige seines inner circle oder persönliche Freunde, insgesamt eine heterogene Gruppe aus Politik, Militär, Administration, Kunst, Literatur oder Sport.84Syntrophos im makedonischen Elitekontext bezeichnete wohl eine mit dem Herrscher aufgewachsene und erzogene Person, bei Alexander etwa Marsyas von Pella, Halbbruder von Antigonos Monophthalmos. Diese Nähe zum Herrscher konstituierte Status und Prestige.85
Die (basilikoi) paides, (herrschaftliche) Jugendliche, Söhne der makedonischen Führungskreise, erhielten eine höfische Ausbildung und waren zugleich Faustpfand für die Loyalität ihrer Familien. Die Einrichtung ist erst für Philipp II. bezeugt, gilt aber meist als älter. Offenbar wurde sie in nachargeadischer Zeit beibehalten.86
Ein wichtiges Forum der Kommunikation zwischen dem Herrscher und seiner Führungsriege war das Symposion, entweder mit dem Herrscher als großzügigem Gastgeber oder als Gast, dessen Anwesenheit den Veranstalter ehrte. Sitzordnung und Nähe zum Herrscher visualisierten den Rang der Teilnehmer. Dies wird jedoch von griechischen und römischen Autoren meist verkannt, die das makedonische Symposion zum Schauplatz von Exzessen und Übergriffen gestalten, als Gegenbilder der eigenen Tafelsitten.87
Der Palast von Aigai, unter Philipp II. datiert, hatte eine ausladende Hochterrasse, auf der sich die Herrscherfamilie bei Großereignissen vermutlich der Öffentlichkeit präsentierte. Gleichzeitig mit dem Palast entstand unterhalb das Theater als Teil des Palastkomplexes. Die Verbindung gilt als symptomatisch für den Repräsentations- und Inszenierungscharakter von Philipps Hof als sozio-politischer Bühne. Die ungewöhnlich große Theaterorchestra soll neben Aufführungen auch Festivitäten gedient haben.88 Ausgrabungen des antigonidischen Palasts in Demetrias haben gezeigt, dass sich dort ebenfalls eine künstliche Terrasse mit Blick über die Stadt befand, sicherlich zu Repräsentationszwecken.89
Militär
Die früheste Erwähnung eines makedonischen Heers im Einsatz findet sich in Herodots Bericht über die Truppen Alexanders I., die ihren persischen Oberherrn Xerxes gegen den Hellenenbund unterstützten.90 Thukydides' Informationen zum Heer unter Perdikkas II. sind spärlich und tendenziös, lassen jedoch erkennen, dass die makedonische Kavallerie bereits die leistungsstarke Offensivkraft war. Entsprechend der üblichen Organisationsform antiker Armeen waren die Truppen wohl regional gegliedert.
Philipp initiierte eine umfassende Militärreform bezüglich Ausrüstung, Waffen, Belagerungstechnik, Strategie, Organisation, Motivation und Drill, die das makedonische Heer zur kampfstärksten und effektivsten Armee der Mittelmeerwelt gestaltete.91 Disziplin, Überwiegen von Makedonen im Heer, eingespieltes Operieren und innere Verbundenheit infolge der andauernden Kriege gelten als das Erfolgsrezept.92 Auch wenn Philipp die Infanterie stärkte, blieb der bedeutendste Heeresteil die Kavallerie mit der Elitereiterei der Hetairen, zusammengesetzt aus regional gegliederten Schwadronen (ilai