
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Mecka Lind erzählt in diesem preisgekrönten Jugendroman die bewegende Geschichte eines obdachlosen Mädchens und ihres Überlebenskampfs inmitten des reichen Europas: Die 13-jährige Sanne lebt in Kopenhagen auf der Straße und muss sich mit Diebstählen und Bettelei durchschlagen. Das ehemalige Heimkind wünscht sich nichts mehr als ein liebevolles Zuhause, doch Sannes Mutter weigert sich, sie wieder bei sich aufzunehmen. Für Sanne scheint eine düstere Zukunft unausweichlich – oder bekommt sie doch noch die Chance auf ein besseres Leben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mecka Lind
Manchmal gehört mir die ganze Welt
Übersezt von Regine Elsässer
Saga
Manchmal gehört mir die ganze Welt
Übersezt von Regine Elsässer
Titel der Originalausgabe: Lilla Vargen och den ensamme
Originalsprache: Schwedischen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1992, 2021 Mecka Lind und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726965841
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
An die Leser
Ich wollte meinen Ohren nicht trauen, als ich das erste Mal davon hörte, daß es in Kopenhagen Straßenkinder gibt – mitten unter uns, im sicheren, sozial perfekt organisierten Skandinavien.
Inzwischen weiß ich nur zu gut, daß es stimmt. Von Januar bis Mai 1988 habe ich mich immer wieder in Vesterbro in Kopenhagen aufgehalten. Und ich weiß inzwischen auch, daß Kopenhagen längst nicht die einzige europäische Großstadt mit solchen Straßenkindern ist.
Es gibt sie in vielen europäischen Großstädten . . .
Vesterbro ist der ärmste Stadtteil von Kopenhagen. Viele Häuser sind heruntergekommen. Es gibt kein warmes Wasser. Die Leute heizen immer noch mit Petroleumöfen, und viele haben das Klo auf dem Hof.
In Vesterbro ist das Leben erschreckend hart. Auf der Istedgade liegen ein Pornoladen und ein Bordell neben dem anderen. Auf dem Strohmarkt prostituieren sich heroinabhängige Mädchen von siebzehn, achtzehn Jahren und älter. In der Umgebung der Mariakirche halten sich die Penner auf, sie sind zwanzig Jahre und älter, sowohl Männer als auch Frauen. Sie haben keine Wohnung und keine Arbeit und sind meistens stark betrunken.
Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, und natürlich ist auch die Kriminalität in diesen Vierteln groß.
Und genau da lebt ein Teil der Straßenkinder von Kopenhagen. Hier schlafen sie in zugigen, schmutzigen Treppenhäusern, auf Speichern, in Kellern, in alten Autowracks, in ausgedienten Eisenbahnwagen auf dem Bahnhof. Eben überall, wo sie etwas halbwegs Geeignetes finden.
Es gibt eigentlich überall im anonymen Großstadtdschungel von Kopenhagen Straßenkinder. Aber die, mit denen ich etwas näher in Kontakt gekommen bin, verbrachten die meiste Zeit auf dem Hauptbahnhof und in Vesterbro. Es sind Kinder, die zu Hause rausgeworfen wurden oder abgehauen sind, oder solche, die noch nie ein Zuhause hatten, sondern ihr ganzes Leben in staatlichen Institutionen zugebracht haben. Es sind Kinder, die so verraten und von den Erwachsenen so schlecht behandelt wurden, daß sie sich lieber dem Hunger, der Gewalt und der Kriminalität auf der Straße aussetzen, als daß sie ein Bett in einem Kinder- oder Erziehungsheim wählen würden.
So ein Leben führt man nicht aus Abenteuerlust. Für diese Kinder ist es blutiger Ernst, und sie haben keine andere Wahl. Sie gehen nicht auf die Straße, weil es ihnen an Nahrung fehlt. Es fehlt ihnen an Liebe und Fürsorge, und es fehlt jemand, dem es wichtig ist, daß es sie überhaupt gibt.
Von einigen dieser Kinder handelt dieses Buch. Die Geschichte ist insofern wahr, als ich reale Berichte als Grundlage verwendet habe und mir dann als Schriftstellerin die Freiheit genommen habe, einen Roman daraus zu machen. Sanne ist also das Produkt aus mehreren Mädchen, die ich kennengelernt habe. Aber alles, was im Buch geschieht, ist irgendeiner von ihnen in Wirklichkeit passiert.
Mecka Lind
1
Sanne sinkt an der Hauswand in sich zusammen. Sie ist müde heute abend. Aber es ist naßkalt, und der eisige Wind zwingt sie, bald wieder weiterzugehen. Wo soll sie bloß hin? Sie war sich so sicher gewesen, bei Lisbeth übernachten zu dürfen, aber um halb zwölf hatte Lisbeths Vater in der Tür gestanden und gesagt, daß es für Sanne jetzt Zeit wäre zu gehen, damit seine Tochter ins Bett käme. Das war also nichts gewesen.
Natürlich kann sie immer noch nach Hause gehen. Nach Hause zu Mama und ihrem neuen Kerl. Gestern abend hat sie offenbar mal wieder eine Eroberung gemacht. Sanne kennt ihn noch nicht, aber sie traf ihren kleinen Bruder Jörgen vor seiner Schule, und er hat ihr erzählt: »Er ist mindestens einen halben Kilometer groß und so mager, daß er mit den Knochen klappert, und er hat unheimliche Augen. Aber Mama ist froh, und ich durfte bis halb eins aufbleiben und Videos gucken.«
Die schwere Tür quietscht widerstrebend, als Sanne sie öffnet. Ein durchdringender Uringestank schlägt ihr entgegen, und aus alter Gewohnheit hält sie die Luft an, bis sie auf den Hinterhof hinaustritt. Sie schaut enttäuscht zu den erleuchteten Fenstern im vierten Stock hoch. Insgeheim hatte sie gehofft, daß es dunkel sein würde, daß Mama und Jörgen allein wären und schon schlafen würden und daß sie selbst in ihr Bett kriechen könnte, ohne sich noch stundenlanges Gemecker und Gelaber anhören zu müssen.
Sie bleibt einen Moment stehen und wartet. Alles, was sie von dort oben hört, ist leise Musik. Sanne versteht sehr gut, daß Mama »einen Mann im Haus haben will, der das Elend mit ihr teilt«, wie sie immer sagt. Was sie allerdings nicht versteht, ist, warum sie nie einen netten ordentlichen kennenlernt, sondern immer nur diese gewalttätigen, unberechenbaren Typen, mit denen sie sich ständig einläßt. Die kalte und scheußlich ungemütliche Februarnacht bringt Sanne schließlich dazu, trotz allem Richtung Hintertreppe zu gehen. Aber sie ist noch nicht richtig im Haus, als Mamas Falsettstimme durch die Dunkelheit dringt und von einer fremden, lallenden Säuferstimme übertönt wird. Dann geht der Streit unbarmherzig hin und her, es hallt nur so zwischen den Mauern.
Frau Sörensen im Erdgeschoß macht Licht, und der Streit wird noch lauter. Sanne treibt es fast wieder auf den Hof hinaus.
Die Sache ist für sie klar. Es kann so kalt sein, wie es will, dort hinauf geht sie auf keinen Fall! Sie wird sich die Nacht über auf den Straßen herumtreiben müssen oder versuchen, ein Treppenhaus zu finden, wo sie sich in einer Ecke verkriechen und ein paar Stunden schlafen kann. Wie schon so oft. Aber das ist ihr immer noch lieber, als in den blödsinnigen Krach da oben hineingezogen zu werden.
Aber kurz bevor die Haustür hinter ihr zuschlägt, hört sie, wie ihre Mutter verzweifelt um Hilfe ruft. Sie erstarrt. Das klang gar nicht gut. Diesmal scheint sie ja einen richtigen Mistkerl erwischt zu haben. Sie rennt wieder auf den Hof und in den Hintereingang hinein, wo sie von der aufgebrachten Frau Sörensen angehalten wird.
»So geht es schon den ganzen Abend«, beschwert sich die alte Dame. »Daß deine Mutter nie ein ordentliches Leben führen kann, Sanne!«
Wenn Sanne eins nicht ausstehen kann, dann ist es, wenn die Leute schlecht über ihre Mutter reden. Da kann sie noch so blöd sein.
»Sie haben keine so große Lippe riskiert, als der alte Sörensen noch lebte«, sagt sie deshalb frech. »Da ging es hier unten auch ganz schön rund, wenn er von seinen Kneipentouren zurückkam.«
Wieder schneidet ein schrecklicher Schrei durch die Nacht. Sanne zuckt zusammen und stürzt die Treppen hinauf.
»Und der arme kleine Jörgen!« ruft Frau Sörensen ihr nach.
»Der hat schon in der Wiege gelernt, den Kopf einzuziehen«, brummt Sanne.
Sie reißt die Küchentür auf. Mama steht zwischen Kühlschrank und Spüle eingeklemmt und hält die Arme schützend über den Kopf. Der Mann wendet Sanne den Rücken zu.
Er gleicht einem großen, mageren Kater, der sich gerade auf seine Beute stürzen will, denkt sie, und gerade als er springen will, schreit sie: »Wenn du meine Mutter anrührst, dann bring ich dich um!«
»Sanne, bitte, halte dich raus«, kommt es kläglich aus der Ecke neben dem Kühlschrank.
»Soll ich vielleicht zusehen, wie er dich totschlägt? Mein Gott, Mama, man hört euch ja in der ganzen Stadt!«
»Wer zum Teufel ist dieses Balg?« brüllt das Knochengestell.
»Meine . . . meine Tochter«, stottert Sannes Mutter entschuldigend. Ihre eine Backe ist feuerrot, bis zum Hals hinunter, die Arme sehen auch mißhandelt aus. Es tut Sanne weh, als sie das sieht, aber es tut noch mehr weh, zu begreifen, daß sie sich lieber von diesem fremden Kerl verprügeln läßt, als Hilfe von Sanne anzunehmen.
»Und wo hast du diesen Saukerl aufgegabelt?« fragt sie verächtlich.
»Hau ab!« zischt ihre Mutter jetzt wütend. »Du machst alles nur noch schlimmer.«
»Aber ich habe doch wohl ein größeres Recht, hier zu sein, als er!«
Der Schlag kommt blitzschnell. Etwas explodiert in ihrem Kopf. Ihre Hand greift automatisch ins Gesicht und wird rot von Blut. Er hat sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen! Das Blut strömt aus ihrer Nase. Sie weiß nicht, ob es das Blut ist oder sein widerliches höhnisches Grinsen oder daß Mama wieder schreit – sie handelt jetzt nur noch. Sie sieht die Bratpfanne auf dem Herd und hat sie schon in der Hand. Der Mann weicht erstaunt zurück, stolpert über die Türschwelle, fällt hin und bleibt liegen. »Ha! Der ist gut, Mama!« lacht Sanne böse. »Legt sich selber um. Auf den kannst du dich verlassen!«
»Du bist ja total verrückt!« jammert die Mutter und läuft zu dem Kerl hinüber. »Du hättest ihn totschlagen können!«
»Ich habe ihn ja gar nicht getroffen. Und außerdem hat er mich zuerst geschlagen«, knurrt Sanne und schaut ihre Mutter böse an, die jetzt ein Handtuch naß macht und dem Typ die Stirn abtupft. Er kommt zu sich, lallt etwas und schläft gleich wieder ein.
»Hilf mir, ihn ins Schlafzimmer zu tragen«, sagt ihre Mutter und packt ihn unter den Armen.
»Kommt nicht in Frage!« murmelt Sanne; sie hat den Kopf in den Nacken gelegt, um das Nasenbluten zu stoppen. »Laß ihn doch liegen. Er ist ja stockbesoffen.« Aber die Mutter gibt keine Ruhe, und Sanne greift schließlich widerwillig nach den dünnen Beinen, und gemeinsam schleppen sie ihn ins Schlafzimmer. Schon bald schnarcht er laut im Doppelbett.
»Das war das«, seufzt die Mutter und dreht sich zu Sanne um. »Und nun zu dir. Ich will mit dir reden. Wir gehen in die Küche.«
Als Sanne das Schlafzimmer verläßt, schließt sie die Tür von außen ab. Sie hat nicht die Absicht, sich heute noch einmal überraschen zu lassen.
Ihre Mutter gießt sich ein Wasserglas voll Wein ein. Sie nimmt einen ordentlichen Schluck und schaut Sanne finster an, die immer noch Nasenbluten hat.
»Sie haben heute schon wieder aus der Schule angerufen«, sagt sie. »Sie haben gesagt, daß du fast nie hingehst.«
»Das kann ich ja wohl auch nicht. In diesem Haus kriegt man ja nie seine Ruhe. Zumindest nicht, solange du solche Schweine wie den da drinnen anschleppst.«
Die Mutter trinkt den Rest Wein in einem Zug aus und gießt sich noch mal ein.
»Sie wollen dich wieder ins Heim schicken, und ich bin völlig damit einverstanden. Ich schaffe es nicht mehr mit dir. Ich will auch eine Chance haben, mein Leben zu leben.«
»Wie zum Beispiel die, sich von einem runtergekommenen Saufbold halb oder ganz totschlagen zu lassen.«
»Ich will auf jeden Fall keine Rotznase hier haben, die kommt und geht, wie es ihr paßt, und sich auch noch in meine Angelegenheiten einmischt! Ich will nicht mehr! Verstehst du?«
Doch, doch, Sanne versteht es ganz genau. Ihre Mutter will sie nicht haben. Sie hat sie nie gewollt. Ja, vielleicht ganz am Anfang . . . sonst hätte sie wohl abgetrieben. Sannes Vater hat sich ja davongemacht, so schnell er nur konnte, als er erfuhr, was los war.
Ihre Tante Kirsten hat ihr erzählt: »Am Anfang ging es ganz gut. Sie war richtig stolz auf dich. Obwohl ich manchmal gedacht habe, daß sie eigentlich mehr spielte . . . ein neues, spannendes Spiel. Aber dann bist du gewachsen und hast immer größere Ansprüche an sie gestellt, und plötzlich war alles so anstrengend, sie war so müde und erschöpft, und als das Sozialamt schließlich ein Heim vorschlug, ließ sie sich sehr schnell dazu überreden. Du warst ungefähr drei Jahre alt.«
Sanne weiß das ganz genau, es ist ihre früheste Erinnerung. Wenn sie will, kann sie die Augen schließen und alles genau vor sich sehen. Eine fremde Tante und ein fremder Onkel stehen über sie gebeugt und reden auf sie ein, wie krank ihre Mama sei, und daß sie allein sein muß, um wieder richtig gesund zu werden. Deshalb muß Sanne eine Zeitlang wegfahren. Dann nehmen sie sie hoch und tragen sie zu einem Auto und fahren davon, und die Angst in ihr ist nachtschwarz.
So ist sie im Kinderheim gelandet. Verängstigt und voller Schuldgefühle. War sie wirklich so schlimm, daß ihre eigene Mama krank davon wurde, sie bei sich zu haben? Die Zeit verging, und ab und zu kam es vor, daß Mama Vibeke den Einfall hatte, es noch mal mit ihrer Tochter zu versuchen. Obwohl die Abstände immer länger wurden. Sanne fühlte sich im Heim nicht wohl, hatte Heimweh und träumte von ihrer schönen jungen Mama. Wenn sie sich dann sahen, mußte es einfach schiefgehen, weil kein Mensch einem Traum entsprechen kann. Und Mama Vibeke hatte wohl auch ihre Träume gehabt, und die Enttäuschung war gegenseitig. Es gab Krach und Geschrei, und es endete immer damit, daß Sanne wieder ins Kinderheim mußte.
Erst als Jörgen geboren wurde, durfte sie längere Zeit zu Hause wohnen. Und Sanne liebte ihren kleinen Bruder, tat alles dafür, daß sie bleiben konnte. Und sie hatte Glück, denn jetzt wurde sie gebraucht. Jörgens Vater war genau wie Sannes abgehauen, und davon wurden die strapazierten Nerven ihrer Mutter auch nicht gerade besser. Sie ging zu verschiedenen Ärzten und bekam verschiedene Pillen. Pillen, damit sie nachts schlafen konnte. Pillen, damit sie durch den Tag kam. Pillen gegen die ständigen Kopfschmerzen und die Übelkeit. Pillen über Pillen. Bestimmt hat sie auch die Gebrauchsanweisungen nicht so genau gelesen, wenn sie die Pillen nahm, denn manchmal war sie morgens so fertig, daß sie kaum aus dem Bett kam. Diese Tage liebte Sanne, denn dann brauchte sie nicht in die Schule zu gehen, sie mußte sich ja um ihre Mutter und ihren kleinen Bruder kümmern, und dabei hatte sie das Gefühl, wichtig zu sein, und sie war überglücklich. Ihr machte es also gar nichts aus, daß diese Tage immer häufiger wurden. In der Schule war man darüber ganz anderer Ansicht. Und man beklagte sich bei ihrer Mutter. Aber dieses Mal ließ sie sich nicht so leicht überreden. Jetzt wußte sie, was sie an ihrem »großen«, tüchtigen Mädchen hatte. Zumindest, bis Jörgen in die Kindertagesstätte kam. Dann, als Sanne immer noch die Schule schwänzte, gab ihre Mutter dem Druck von außen nach.
Diesmal kam Sanne in ein anderes Heim, ein Erziehungsheim. Sie war die Jüngste, als sie dorthin mußte, und hier gab es viele, die ihr gerne alles mögliche und unmögliche beibrachten. Sie lernte Haschisch rauchen, Türen mit wenigen Hilfsmitteln aufzubrechen und manches andere, was man brauchen kann, wenn man Einbrüche macht. Sie lernte, sich zu verteidigen, sowohl mit dem Messer als auch mit den bloßen Fäusten, und natürlich lernte sie auch Karatetritte. Die Bestrafungen ließ sie über sich ergehen wie Hagelschauer. Ausgangsverbot. Kein Taschengeld. Zimmerarrest. Kellerarrest. Schläge und Erniedrigungen. Einmal, als sie heimlich in ihrem Zimmer Haschisch geraucht hatte, hängten sie zur Strafe einfach die Tür aus, damit jeder, der wollte, sehen konnte, was sie machte, auch wenn sie schlief. Sanne haßte das Heim gründlich, und eines Nachts haute sie ab.
Aber zu Hause in Vesterbro war sie nicht willkommen. Hier wohnte fast jedes Mal ein neuer Mann bei ihrer Mutter, und wenn sie kam, dann war sie etwas, das störte und nicht ins Bild paßte. Nach einigen stürmischen Tagen rief ihre Mutter im Erziehungsheim an und ließ sie wieder abholen. So vergingen die Jahre, und sie pendelte wie ein Jojo hin und her. Aber nun ist ihr tatsächlich das Kunststück gelungen, seit über einem halben Jahr zu Hause wohnen zu dürfen, oder zumindest nicht ins Erziehungsheim zurück zu müssen. Sie denkt deshalb überhaupt nicht daran, sich wieder dazu zwingen zu lassen, ins Heim zurückzugehen. Das macht sie ihrer Mutter auch sehr deutlich, als sie zusammen am Küchentisch sitzen.
»Da geh ich lieber in den Untergrund!« sagt sie. »Ich bin bald dreizehneinhalb, und ich werde schon zurechtkommen.«
Ihre Mutter stöhnt und seufzt und starrt auf den Fußboden, als ob sie da eine passende Lösung finden würde. »Du verstehst doch wohl, daß du in die Schule gehen mußt«, sagt sie müde. »Und da sie dich in dieser Schule offenbar nicht mehr haben wollen, bin ich der Meinung, daß du froh sein kannst, wenn du wieder in dieses Heim zurück darfst.«
»Du hättest nie Kinder kriegen sollen«, sagt Sanne ruhig.
»Du kannst ja nicht mal für dich selber sorgen.«
»Ich sorge für deinen Bruder! Und außerdem hat man es wirklich nicht leicht heutzutage als arme, alleinerziehende Mutter.«
»Es ist auf jeden Fall die Hölle, das Kind von so einer zu sein!« sagt Sanne hart. »Auf jeden Fall, wenn sie so ist wie du. Du willst also behaupten, daß du für Jörgen sorgst. Wo ist er denn jetzt? Ist er mal wieder bei Tante Kirsten?«
»Er liegt im Bett und schläft.«
»Schläft!« schnaubt Sanne. »Glaubst du vielleicht, er ist taub? Nein, nein, er hat sich bestimmt unter der Decke verkrochen und ins Bett gemacht aus purer Angst, daß dein Trunkenbold kommt und ihn auch zusammenschlägt. Ich weiß es; in seinem Alter ging es mir genauso, wenn ich mal die Ehre hatte, zu Hause wohnen zu dürfen. Und das nennst du ›für deine Kinder sorgend‹!« Die Mutter leert das Glas in einem Zug. Sie hat ein ganz rotes Gesicht, jetzt aber nicht vom Wein oder den Schlägen, sondern vor Wut.
»Es reicht!« schreit sie verzweifelt. »Hau ab! Du kommst nur her und machst alles kaputt. Raus hier! Geh doch in den Untergrund! Mach doch verdammt noch mal, was du willst, wenn du bloß verschwindest!«
Der Krach hat offenbar den Typen im Schlafzimmer geweckt, er schlägt an die Tür und brüllt und schreit solche Schimpfwörter, daß sogar Sanne beeindruckt ist. »Hast du ihn etwa eingeschlossen?« stöhnt ihre Mutter. »Du bist wirklich noch schlimmer, als ich gedacht habe.« »Und du willst natürlich aufmachen und dich noch mal verprügeln lassen«, sagt Sanne höhnisch. Ihre Mutter antwortet nicht. Sie ist schon unterwegs. Sanne steht auf und geht zur Hintertür. Sie bleibt einen Moment stehen und fährt sich nervös mit der Hand durch ihr halblanges, mausfarbenes, strähniges Haar. Sie ist sehr dünn, aber trotzdem hübsch, dank ihres lieben kleinen Gesichts mit den großen, ausdrucksvollen Augen.
Sie ist vorbereitet, als er kommt. Sie kennt diese Typen in- und auswendig, und sie weiß, daß er zurückschlagen muß, um sein Gesicht zu wahren. Aber sie ist neugierig und will wissen, was er vorhat.
»Du . . . du Satansbraten!« zischt er, als er sie bemerkt. »Ich werde dir eine Lektion erteilen, die du nicht vergißt.«
Erst jetzt sieht sie das Messer in seiner Hand, und ihrer Mutter geht es offenbar genauso, denn sie schreit plötzlich wieder los. Sie hat gute Lust, ihr eigenes Messer zu ziehen und es ihm zu zeigen. Aber sie tut es nicht. Sie weiß nicht, warum. Vielleicht wegen Mama. Statt dessen wartet sie, bis er nahe genug herangekommen ist, dann schlüpft sie blitzschnell aus der Tür und schlägt sie zu, und er kracht mit voller Wucht dagegen.
»Viel Glück in deinem neuen Leben, Mama!« ruft sie so laut wie möglich und verschwindet in der Nacht.
2
Sie geht mit festen Schritten in Richtung Hauptbahnhof. Wenn sie sich beeilt, schafft sie es, bevor sie zumachen, und vielleicht ist dort jemand, den sie kennt und bei dem sie übernachten kann.
Als sie die riesige Bahnhofshalle betritt, ist es dort ungewöhnlich ruhig. Man hört fast nur das Geräusch der Kehrmaschine, die den letzten Schmutz auffegt. Ein paar Penner sitzen in einer Ecke, und ein paar andere liegen auf dem Steinboden und schlafen. Sie sind darauf angewiesen, noch die letzten Minuten Wärme auszunützen. Einer von ihnen ruft Sanne etwas zu, aber sie tut so, als höre sie nichts. Sie weiß nicht, warum, aber es graust sie immer vor diesen versoffenen, heimatlosen Verlierern. »Nein«, sagt sie leise zu sich selbst. »Hier ist heute nichts zu holen.«
Sie dreht sich rasch um und geht wieder auf den Ausgang zu. Zuerst läuft sie aufs Geratewohl im Vesterbroviertel in der Nähe des Bahnhofs herum. Es tut dem Chaos von Gedanken in ihrem Kopf gut, in der Kälte herumzulaufen. Aber sie wird ständig von Männern angemacht, die allein durch die Gegend fahren und Liebe suchen. Sie trifft auch ein paar jüngere Penner, die handgreiflich versuchen, sie zum Mitkommen zu überreden. Bei solchen Gelegenheiten kann sie gebrauchen, was sie im »Heim« gelernt hat.
Schließlich hat sie alles satt, außerdem friert sie so, daß sie am ganzen Körper steif wie ein Stock ist. Als sie vor einem Hauseingang steht, der nicht abgeschlossen ist, nimmt sie die Gelegenheit wahr und geht hinein.
Sie wartet regungslos in der Dunkelheit und lauscht. Als sie ganz sicher ist, daß sie auch nicht das leiseste Husten oder Schnarchen hört, niemanden, der flüstert, nicht einmal ein verdächtiges Atmen, nur das Knacken, das zu solch alten Häusern gehört, tastet sie sich vorsichtig am Handlauf der Treppe entlang nach oben. Sie bleibt erst stehen, als sie auf dem letzten Treppenabsatz angekommen ist. Dort legt sie sich zusammengekauert auf den Holzboden und deckt sich mit ihrer Jacke zu.
Aber es dauert lange, bis sie einschlafen kann. Die Gedanken drehen sich im Kreis und werden bei jeder Runde, die sie in ihrem Kopf machen, schwärzer.
Ich muß halt noch mal nach Hause und mit meiner Mutter reden, morgen, wenn der Typ gegangen ist, dann wird bestimmt alles wieder gut, denkt sie. Vielleicht kann ich im Laden an der Ecke auch ein paar Bier klauen und sie die erst trinken lassen, damit sie bessere Laune bekommt.
So tröstet Sanne sich, wie sie da allein im Dunkeln liegt. Und allmählich entspannt sie sich so weit, daß sie einschläft. Aber erst gegen Morgen fällt sie in einen tieferen Schlaf.
Ein gezielter Tritt weckt sie unsanft. Der Mann, der sich neben ihr aufgebaut hat, trägt Gabardinehosen mit Bügelfalten, einen großen, warmen Lammfellmantel, und er hat kurzgeschnittene Haare.
»Was zum Teufel machst du hier?« fragt er unwirsch.
»Ich versuche zu schlafen«, antwortet Sanne, und erst jetzt sieht sie die Wäsche, die über ihrem Kopf hängt. »Ich werde Ihre Wäsche nicht anrühren«, versichert sie. »Ich will bloß schlafen.«
»Mach, daß du wegkommst, sonst rufe ich die Polizei!«
»Daß wir auch immer noch keine Tür mit Klingel und Drücker bekommen haben«, mault eine Frauenstimme hinter ihm. »Wir werden das Elend so ja nie los.« Sanne versteht sehr wohl, daß mit »Elend« sie gemeint ist. Zumindest im Augenblick.
»Ja, ja. Ich geh ja schon«, stöhnt sie und steht auf.
Da wird die Tür nebenan geöffnet, und eine ältere Dame mit Wicklern im silbergrauen Haar und einem rosa Morgenrock um ihren hageren, alten Frauenkörper kommt heraus.
»Aber so laßt die arme Kleine doch schlafen!« sagt sie. »Wenn sie nur die Finger von meiner Wäsche läßt.«
»Frau Olsen!« protestiert der Lammfellmantel scharf. »Das Treppenhaus ist doch wohl kein Hotel, verdammt noch mal!«
Sanne ist schon auf dem Weg nach unten, gefolgt von Andeutungen darüber, was man mit Leuten machen sollte, die sich die Freiheit nehmen, die Nacht vor anderer Leute Türe zu verbringen. Und das sind nicht gerade angenehme Dinge.
»Aber sie war doch noch ein Kind«, seufzt die alte Frau. Das Schlimmste für Sanne ist, so wie eben hinausgeworfen zu werden. Da fühlt sie sich wie eine Tüte Müll.

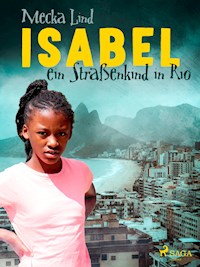
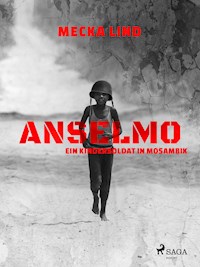














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











