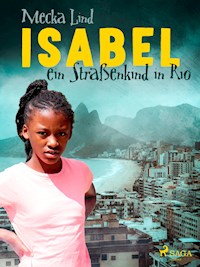
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein ergreifendes Buch über ein Kinderschicksal auf den Straßen Rios! Die achtjährige Isabel lebt mit ihrer Familie in Brasilien; Armut bestimmt ihren Alltag. Nach dem Tod ihres Vaters beschließen Isabel und ihre ältere Schwester Sandra, auf der Suche nach einem besseren Leben nach Rio de Janeiro zu gehen. Doch kaum dort angekommen, werden die beiden mit der unbarmherzigen Realität des Straßenkind-Daseins konfrontiert: Sandra ist gezwungen, für Geld ihren Körper zu verkaufen, während Isabel sich einer Jugendbande anschließt. Gibt es für das junge Mädchen einen Ausweg aus dem Leben voller Gewalt und Entbehrung? -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mecka Lind
Isabel, ein Straßenkind in Rio
Übersezt von Regine Elsässer
Saga
Isabel, ein Straßenkind in Rio
Übersezt von Regine Elsässer
Titel der Originalausgabe: Isabel - en romoan om ett gatubarn i Rio de Janeiro
Originalsprache: Schwedischen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1994, 2021 Mecka Lind und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788711466087
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Für Grasiela
Sie heißt Isabel und ist zwölf Jahre. Genau wie die übrigen Mädchen in der Bande ist sie schwarz. Sie hat ebenso lockige Haare wie die anderen und braune Augen. Große braune, fast schwarze Augen.
Sie geht mit entschlossenem Schritt und gesenktem Kopf. Sie will so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erwecken. Doch dann fällt ihr noch ein Ort ein, wo sie suchen könnte, und plötzlich hat sie es eilig.
Unten an der Copacabana, am Strand, es ist fast lächerlich einfach. Bestimmt hat Luiz den Ort deshalb auch als sein Versteck ausgesucht. Er war so stolz, alseres ihr zeigte. Niemand außer ihr dürfte es kennen, hatte er damals gesagt. Und er würde sie töten, wenn sie es verraten würde. Dummerweise wurde dieser Tourist ausgerechnet da niedergestochen, und seither hat sich keiner von ihnen auch nur in die Nähe getraut.
Aber das ist alles lange her, und sie darf jetzt nichts dem Zufall überlassen.
Um sie herum tobt der Verkehr. Der Pulsschlag dieser Stadt geht schnell. Das ist immer so. Aber gerade jetzt ist er besonders schnell, weil es auf Karneval zugeht und immer mehr Touristen kommen.
Isabel bewegt sich schnell und sicher zwischen den Autos und Bussen. Sie weiß, daß keiner auch nur im Traum daran dächte, wegen ihr auf die Bremse zu treten.
Sie geht eine bestimmte Querstraße hinunter zur Avenida Atlántica. Das ist eine von den Straßen, wo Sidneys Bande sich normalerweise aufhält, aber heute ist keiner da.
Isabel ist übel, und sie ist kurz davor, sich zu übergeben. Es ist eine Weile her seit dem letzten Mal; sie hatte geglaubt, es sei vorbei. Nicht, daß sie ein Kind erwartet, das weiß sie, auch wenn sie immer wieder versucht, es zu vergessen. Aber die Übelkeit. . . sie hatte gehofft, daß das wenigstens vorbei wäre. Es kann natürlich auch eine Reaktion auf die widerwärtige Nacht sein, die sie hinter sich hat.
Es wird besser werden, wenn sie Luiz von dem Kind erzählt. Sie hat sich zuerst nicht getraut, weil sie fürchtete, er würde sie zum Teufel jagen. Seit sie sich prostituiert, kann er zudem behaupten, das Kind sei nicht von ihm, sondern von irgendeinem Freier. Aber jetzt will sie doch einen Versuch wagen. Nach so einer Nacht wird sie es auch ertragen, wenn er »nein« sagt. Wenn sie ihn nur findet.
Die Übelkeit nimmt zu. Sie schaut sich verzweifelt um. Sie darf sich hier nicht übergeben. Hier sind zu viele Touristen. Überhaupt zu viele Leute. Und drüben beim Straßencafé sieht sie einen Wachmann und einen Polizisten.
Sie läuft zu einem Busch, der einigermaßen sicher aussieht und kriecht so tief wie möglich hinein, dann entspannt sie sich und würgt sich die Galle aus dem Leib.
Aber obwohl sie alles getan hat, um nicht gesehen zu werden, sind der Wachmann und der Polizist schon auf dem Weg zu ihr. Sie rennt los, und bald spürt sie den weichen Sand der Copacabana unter den Füßen. Hier unten haben sie keine Chance, sie einzuholen. Sie dreht sich um. Niemand folgt ihr. Aber sie ist sehr vorsichtig, als sie sich den rostigen Tonnen nähert. Sie klettert dahinter und flüstert: »Luiz! Bist du da? Ich bin’s, Isabel.«
Keine Antwort. Für einen Moment wird sie von Angst gepackt, und sie will ihr »Luiz, wo bist du?« hinausschreien. Was ist passiert?Woist er denn? Wo sind die anderen aus ihrer Bande? Und wo sind überhaupt all die anderen Straßenkinder? Was ist passiert heute nacht, als sie mit diesem Schwein zusammen war und all seine Widerwärtigkeiten über sich ergehen lassen mußte? Sie hatte geglaubt, daß sie danach für immer zerstört wäre, aber offenbar gibt es in ihr immer noch etwas, was verletzlich ist. Sonst würde sie nicht diese fürchterliche Angst verspüren.
Aber auch Angst macht müde, und so schläft Isabel schließlich in einer der Tonnen ein.
Heute morgen war sie so sicher gewesen, daß sie unterwegs zu Luiz und den anderen war. Jetzt ist sie überhaupt nicht mehr sicher.
Sie ist seit fast vier Jahren in Rio de Janeiro, aber sie hat sich noch nie so einsam und verlassen gefühlt.
1
Rio de Janeiro. Die große, schöne Stadt. Die weiße und grüne Stadt. Das Paradies. Genau so beschreibt Sandra, Isabels ältere Schwester, Rio. Genau mit diesen Worten erzählt sie ihr davon, als sie zu Hause unter der Palme vor der Hütte sitzen.
Sandra lehnt mit dem Rücken am Baumstamm, Isabel liegt ausgestreckt am Boden, den Kopf auf dem Schoß ihrer Schwester. Sie hört aufmerksam zu, wenn Sandra von all den wunderbaren Dingen erzählt, die sie erleben wird. Sandra wird einen weißen Mann kennenlernen. Einen reichen weißen Mann. Nicht so einen fetten, aufgedunsenen wie den Besitzer der Fazenda 1 und dessen Freunde. Nein, er ist groß und schlank, hat blonde Haare und blaue Augen und kommt aus Amerika. Er ist Tourist, und sie werden sich in Rio de Janeiro begegnen. Er verliebt sich in sie und bittet sie, ihn zu heiraten und mit ihr nach Hause zu kommen. Ohne sie fährt er nicht zurück.
»Und was wird aus mir?« fragt Isabel wie immer an dieser Stelle.
»Wenn ich neue Kleider habe und so elegant bin, daß niemand mich erkennt, nicht einmal die alten Männer von der Fazenda, dann komme ich und hole euch alle. Dann bekommen Mutter und Vater Geld, damit sie sich ein kleines Haus in Amerika kaufen können, und keiner muß mehr arbeiten. Und ihr, ihr bekommt schöne Kleider und besucht alle die Schule, und dann gehen wir jeden Tag ins Restaurant und essen, was und wieviel wir wollen.«
So sitzen sie und träumen abends vor der Wellblechhütte, in der sie zu acht wohnen. Mutter, Vater und die sechs Geschwister. Sandra ist die älteste, und sie ist sehr schön. Sie ist neunzehn Jahre alt, als es passiert. Norman ist sechzehn. Roberto vierzehn. Lili zwölf. Eric zehn, und Isabel ist gerade acht geworden.
Es ist ein drückendheißer Nachmittag. Da kommt völlig unerwartet ein Auto von der Fazenda zur Hütte gefahren. Zwei weiße Männer steigen aus und werfen ihnen den toten Körper des Vaters vor die Füße.
»Es war die Hitze«, sagen sie und fahren wieder weg.
Aber die Familie weiß, wie kraftlos und schwach der Vater war. Es gab lange Zeit nicht genug zu essen. Außerdem sehen sie die Peitschenhiebe auf seinem Rücken.
Keiner von ihnen weint. Nicht einmal die Mutter. Sie faßt sich nur instinktiv an den Bauch, in dem schon wieder ein Kind ist.
Norman und Roberto heben das Grab aus. Mama, Sandra, Lili, Eric und Isabel suchen ein paar Lumpen zusammen, in die sie den Körper einwickeln können. Sie legen ihn vorsichtig in das Loch und schaufeln Erde darüber. Mama spricht ein kurzes Gebet. Dann gibt es keinen Vater mehr. Jetzt haben sie nicht einmal mehr sein kleines Einkommen.
Am nächsten Morgen sind Norman und Roberto verschwunden. Niemand stellt Fragen. Alle wissen, daß die beiden nach São Paulo oder Rio abgehauen sind. Wahrscheinlich werden sie sie nie wiedersehen.
Als die weißen Männer kommen und sich beschweren, daß die Jungen nicht bei der Arbeit sind, zuckt die Mutter nur mit den Schultern. Die Männer schauen sie kritisch an, und dann sagen sie frei heraus, daß sie sie und die Kinder nicht mehr gebrauchen können. Es hilft nichts, als die Mutter beteuert, wie sehr sie arbeiten würden. Sie sollen die Hütte in einer Woche räumen. Und das sei, betont einer der Männer, noch sehr entgegenkommend vom Besitzer der Fazenda. Viele Familien mit großen starken Männern würden schon darauf warten, die Hütte zu übernehmen. Aber da Sandra sich inzwischen im Haushalt des Besitzers nützlich machen könne, würde dieser Gnade vor Recht ergehen lassen.
Sandra weiß genau, was das bedeutet. Sie bekommt die große »Ehre«, abends bei den Saufgelagen auf der Fazenda zu bedienen und sich nachts vergewaltigen zu lassen. Isabel weiß es auch. Sandra hat ihr schon erzählt, wie es dort zugeht.
»Am besten kommst du gleich mit uns«, sagt der Fahrer. Sandras Augen sind schwarz vor Haß, als sie das Umschlagtuch nimmt und sich in den Lastwagen setzt.
»Wenn du zurückkommst, ziehen wir zu Onkel Alberto«, ruft die Mutter ihr nach.
Als ob das ein Trost wäre. Onkel Alberto wohnt und arbeitet mit seiner Familie auf einer anderen Fazenda, hundert Kilometer weiter im Landesinneren. Isabel ist vor zwei Jahren mit ihrer Mutter dort gewesen. Deshalb weiß sie, daß die Verwandten mindestens genauso arm sind wie sie selbst. Außerdem erinnert sie sich, daß Onkel Alberto alle geschlagen hat, die ihm in die Quere kamen. Er schlug seine Frau und seine Kinder, er schlug Isabel und ihre Mutter. Er trank jeden Abend Cachaça 2 , den er von seinem kärglichen Lohn kaufte, und wenn er betrunken war, drehte er durch. Meint die Mutter es wirklich ernst, daß sie dorthin ziehen will? Aber wo sollen sie denn sonst hin?
Isabel glaubt, daß es eine ganze Woche dauern wird, bis sie Sandra wieder zu sehen bekommt. Aber schon in derselben Nacht wacht sie von aufgeregtem Flüstern vor der Hütte auf. Sandra und die Mutter reden miteinander. Isabel spürt sofort, daß etwas nicht stimmt, und die Unruhe treibt sie ins Dunkel hinaus.
Sie versteckt sich in der Nähe, bis zum äußersten angespannt, um alles zu verstehen, was sie sagen.
Sandras Gesicht sieht im Mondschein erschreckend hart aus. Die Mutter sitzt neben ihr, zusammengekauert, als ob sie so klein wie möglich werden wolle, vor etwas viel zu Großem und Schrecklichem.
»Bist du ganz sicher, daß du ihn getötet hast?« fragt sie mit dünner Stimme.
»Ich habe ihm das Messer in den Bauch gestoßen, und er ist zusammengefallen wie ein leerer Sack«, sagt Sandra.
»Hättest du nicht noch ein paar Tage aushalten können. . . uns zuliebe?«
»Ich habe es lange genug ausgehalten, Mama. Und jetzt hau’ ich ab. Euch rate ich, schon heute nacht zu Onkel Alberto aufzubrechen. Ich weiß nicht, was sonst passiert.« Es ist eine Weile still. Dann küßt Sandra die Mutter auf beide Wangen und hebt ein Bündel auf, das neben ihr liegt. Und im nächsten Augenblick ist sie auch schon bei den Zuckerrohrfeldern, die sich bis zur großen Landstraße erstrecken.
Isabel zögert nicht. Sie hat keine Zeit zu verlieren. Aber sie hält Abstand, denn sie ahnt, daß Sandra sie nicht dabeihaben will.
Oben an der Straße duckt sie sich in den Graben. Sandra hat sich auch versteckt, allerdings auf der anderen Seite. Vermutlich wartet sie dort, bereit herauszuspringen, sobald sie ein Auto sieht, das nicht zur Fazenda gehört. Glücklicherweise kennt sie die meisten Autos von da oben.
Es dauert lange, bis überhaupt ein Auto kommt, und als es endlich so weit ist, läßt sie es vorbeifahren.
Kurz nachdem das erste Auto im Dunkel verschwunden ist, hört Isabel in der Ferne Hundegebell. Sie suchen jemanden, und wenn ihre Schwester einem der Männer ein Messer in den Bauch gerammt hat, ist es nicht schwer, sich auszurechnen, wen sie suchen.
Jetzt nähert sich ein kleinerer Lastwagen. Isabel glaubt schon, daß Sandra auch den vorbeifahren läßt, da steht ihre Schwester plötzlich auf der Straße und winkt wild mit den Armen. Die Reifen quietschen beim Bremsen, und während Sandra mit dem Fahrer redet, läuft Isabel schnell auf die Straße. Als Sandra schließlich ins Fahrerhäuschen klettert, ist Isabel schon auf der Ladefläche und versteckt sich zwischen einigen Säcken.
Das Geräusch des Motors und das Rütteln des klapprigen Lastwagens schläfern sie ein. Sie wacht von einem Schrei auf und weiß erst nicht, wo sie ist. Warum spürt sie nicht Lilis oder Mamas warmen Körper neben sich? Sie starrt in den Himmel hinauf, sieht den Vollmond hinter einer Wolke verschwinden und erinnert sich. Sie ist mit Sandra irgendwohin unterwegs. Jetzt weiß sie auch, woher der Schrei kam, und sie merkt, daß das Auto gar nicht mehr fährt.
Hinten im Fahrerhäuschen ist ein kleines Fenster. Dort kriecht Isabel hin. Sie sieht, wie Sandra mit dem Mann da drinnen kämpft. Aber nach einer Weile ist es genauso wie nachts bei Mama und Papa. Sie erinnert sich an Papas Stöhnen und an seinen schweren Atem, an Mamas Jammern und die immer heftiger werdenden Bewegungen, bis es plötzlich wieder ganz still war.
Einmal haben Mama und Papa Isabel hinterher angeschaut, und weil sie merkten, daß sie wach war, hat Mama geflüstert: »So macht man Kinder.«
Isabel hat an der Stimme gehört, daß Mama dabei lächelte. »So bist auch du gemacht worden.«
Als sie es Sandra unter der Palme erzählte, sagte diese kurz und kalt: »Mama und Papa sind verheiratet, und sie mögen sich. Aber wenn die Männer oben im Haus es mit mir machen, dann macht es nur ihnen Spaß, und es ist furchtbar für mich. Das nennt man Vergewaltigung.«
Aber sie erinnert sich auch, daß Sandra gesagt hat: »Manchmal ist es besser, sich dreinzufinden. Es tut dann nicht so weh.«
Instinktiv versteht Isabel, daß Sandra das auch jetzt denkt. Sie findet sich drein, weil sie mit diesem Auto noch weiterfahren will.
Isabel kriecht wieder so leise wie möglich auf ihren Platz zurück. Dort liegt sie und schaut zum Mond hinauf, bis sie auf die Idee kommt nachzusehen, was in den Säcken ist. Die Knoten bekommt sie nicht auf, aber sie trägt immer ein Messer bei sich und schneidet einen großen Schlitz in den Sack, der am nächsten steht. Er ist prallvoll mit Mangos. Isabel muß vor Freude und Überraschung tief Luft holen. Dann liegt sie wieder da, ißt Mangos und denkt, daß bestimmt alles gut werden wird. Sie sind unterwegs nach Rio, dem Paradies, und da wird Sandra ihren Amerikaner finden, der ihnen das Himmelreich auf Erden bereiten wird. Das Auto fährt wieder los, aber Isabel schläft nicht wieder ein. Sie hat Bauchweh von den vielen Mangos und kann nicht mehr liegen. Sie hat die ganze Nacht Bauchweh, bis die Sonne aufgeht. Da sieht sie plötzlich viele, viele Häuser, die immer dichter beieinanderstehen. Obwohl sie noch nie eine Stadt gesehen hat, begreift Isabel, daß sie jetzt in eine große Stadt hineinfahren.
Der Verkehr braust stundenlang um sie herum. Endlich halten sie an. Jesus, wie viele Autos und Busse es hier gibt! Isabel hält sich den Bauch, um die Schmerzen zu lindern, die nicht aufhören wollen. Sie muß jetzt bereit sein. Aber erst als Sandra aus dem Auto steigt und es schon wieder anfährt, springt Isabel hinunter.
2
Sandra ist schon losgegangen. Sie läuft in die gleiche Richtung, in die das Lastauto weiterfährt. Sie geht auf dem Bürgersteig, streift aber fast die angrenzende Hausmauer.
Isabel, die geglaubt hat, ihre Schwester würde hocherhobenen Hauptes wie eine Königin voranschreiten, wenn sie erst einmal in der Stadt ist, wird jetzt ängstlich und schleicht ebenfalls an der Mauer entlang.
Eine Frau kommt ihnen entgegen. Sie trägt eine Reisetasche und ist so schön angezogen, daß Isabel stehenbleibt und sie anstarrt. Nicht einmal auf der Fazenda waren die Frauen so angezogen. Wird Sandra so aussehen, wenn sie einmal reich ist?
Die Frau merkt, daß Isabel sie anstarrt. Ihre Blicke treffen sich, und Isabels Augen leuchten auf. Vielleicht kann sie diese Dame fragen, ob die Stadt Rio de Janeiro ist. Aber die Frau sieht Isabel auf eine Art an, daß diese automatisch auf den Boden und auf ihre nackten, schmutzigen Füße schaut. Sie geht weiter und traut sich kaum noch aufzuschauen, außer um aufzupassen, ob sie immer noch der Schwester folgt.
Plötzlich scheint Sandra zu spüren, daß sie verfolgt wird. Sie bleibt stehen und dreht sich um. Isabel bleibt auch stehen und drückt sich an die Mauer, als sie sieht, wie wütend die Schwester ist.
»Verfluchtes Balg!« schreit Sandra. »Warum zum Teufel hast du mir das angetan?«
»Ich will nicht zu Onkel Alberto, er schlägt uns«, sagt Isabel so leise, daß man es kaum hört. »Ich will bei dir sein.«
Sandra seufzt laut und sieht so abgrundtief enttäuscht aus, daß Isabel sich wegdreht.
»Verstehst du denn nicht, daß ich es nicht schaffe, wenn mir ein Kind an den Fersen klebt?«
Sandra geht weiter. Aber jetzt streicht sie nicht mehr die Wand entlang. Ihre Schritte sind sicherer und schnell.
Isabel folgt ihr hartnäckig. Nach einer Weile dreht Sandra sich wieder um.
»Verdammt noch mal!« brüllt sie.
Isabel sagt nichts. Sie wartet ab. Und schließlich packt Sandra sie fest am Arm und zieht sie hinter sich her.
»Wo sind wir denn?« fragt Isabel. Sie haben mehrere Viertel Wellblech- und Bretterhütten passiert. So eng stehen sie beieinander, als wollten sie sich gegenseitig stützen. Hin und wieder gibt es ganz schmale Gänge aus festgetretenem Lehm. Sie bemerkt, daß sich im Dunkel Menschen bewegen.
»In der Stadt, das siehst du doch«, antwortet Sandra.
»Aber in welcher Stadt?«
»Rio de Janeiro. Es wird besser, wenn wir weiter ins Zentrum kommen. Das hier sind nur die Außenbezirke.«
»Und wohin gehen wir dann im Zentrum?«
»Zum Strand. . . zur Copacabana.«
Sie laufen den ganzen Tag. Nie hätte Isabel geglaubt, daß eine Stadt so groß sein kann.
Aber wenn das hier das Rio de Janeiro sein soll, von dem Sandra so viel erzählt hat, ist sie enttäuscht. Wo sind all die weißen Häuser und grünen Bäume? Die Leute, die in diesen Bretterhütten hausen, sehen nicht aus, als ob sie im Paradies lebten. Sie wohnen ja noch schlechter als zu Hause. Isabel ist ganz wirr im Kopf von all dem Verkehr, der einen tosenden Geräuschmantel um sie legt.
Zweimal hält Sandra an, um auszuruhen. Einmal kauft sie Fleischtaschen und das andere Mal ein paar Bananen. Isabel ist erst darüber erstaunt, daß ihre Schwester Geld hat. Sie hat ein ganzes Bündel mit Geldscheinen. Sicher hat sie es dem Mann gestohlen, den sie niedergestochen hat. Es ist ja gut, daß sie Geld hat!
Als die Sonne hinter den Bergen verschwindet, ist Isabel überzeugt davon, daß sie sich verirrt haben. Warum fragt Sandra nicht, wo dieser Strand liegt?
Schließlich läßt ihre Schwester sich neben einem Bretterzaun auf den Boden fallen.
»Wir gehen morgen weiter«, sagt sie.
Sollen sie hier schlafen? Mitten auf dem Weg? Ja, offensichtlich, Sandra hat schon ein Kissen aus ihrem Bündel gemacht und sich der Länge nach ausgestreckt.
Das Dunkel breitet sich über sie. Sie sind nicht die einzigen, die neben dem Bretterzaun übernachten wollen. Ein paar Leute haben ein Feuer gemacht und wärmen etwas in einer Blechbüchse. Isabel bekommt wieder Hunger, als sie es riecht, sagt aber nichts. Sie rollt sich zu Füßen ihrer Schwester zusammen und schläft ein.
Als Sandra am nächsten Morgen bei einer Frau Brot kauft, fragt sie endlich nach dem Weg. Die Frau zeigt in eine Richtung, und sie gehen los.
Nach ein paar Stunden werden die Häuser größer und schöner, und am Nachmittag kommen sie zu einem offenen Platz zwischen riesigen Glaspalästen. Das ist prächtiger, als Isabel es sich in ihren wildesten Phantasien hätte vorstellen können. Was sie jedoch am meisten fasziniert, sind die Schaufenster. Noch nie in ihrem Leben hat sie ein Schaufenster gesehen, und hier gibt es so viele und mit so merkwürdigen und spannenden Dingen darin. Sandra muß ihre Schwester ziehen, damit sie weiterkommen.
Isabel hat auch noch nie so viele Leute auf einmal gesehen. Es wimmelt nur so von Menschen. Und fast alle sind sehr schön angezogen. Sie müssen sehr reich sein. Natürlich gibt es auch Leute wie Sandra und sie selbst. Aber für die interessiert sie sich nicht.
Nach einer Weile bleiben die Schwestern gleichzeitig stehen. Sie sagen kein Wort. Sandra hält Isabels Hand und drückt sie fest. Es ist ein magischer Augenblick. Sie sehen beide zum ersten Mal das Meer.
Dann laufen sie über die große Straße und den grünen Park hinunter zu dem glitzernden Blau.
»Ist das die Copacabana?« fragt Isabel.
»Ich glaube nicht. Ich habe gehört, daß es an der Copacabana Sand gibt.«
Jetzt ist Sandra wieder zuversichtlich und fragt die erstbeste Frau, die vorbeikommt. Aber die Frau tut so, als sähe sie sie nicht. Dabei ist auch sie schwarz. Isabel merkt, daß Sandras Lächeln verschwindet. Da sieht sie eine Mutter mit Kindern, die vor einem Restaurant sitzt und bettelt. Sie läuft zu ihnen und kommt bald zu Sandra zurück, über das ganze Gesicht strahlend.
»Sie sagt, wir sollen dem Meer folgen, dann kommen wir zu einem Sandstrand, dann zu noch einem anderen, dann sollen wir zur Straße hinauf und durch einen Tunnel, und dann sind wir auf der Copacabana!«
Genau wie die Frau gesagt hat, kommen sie zuerst zu einem Sandstrand und dann zu noch einem, und Isabel findet ihn so schön, daß sie am liebsten hierbleiben würde. Aber Sandra ist fest entschlossen weiterzugehen, und nachdem sie noch einmal gefragt haben, sind sie im Tunnel. Das ist gruselig, denn die Autos donnern vorbei, und Isabel wird es übel von den Abgasen.
Sie treffen eine Gruppe Jungen und Mädchen verschiedenen Alters. Ein älterer Junge sagt unverschämte Sachen zu Sandra, aber sie geht weiter, ohne ihn auch nur anzuschauen. Plötzlich bemerkt Isabel, daß eines der älteren Mädchen ihnen nachgeht. Ein Messer blitzt auf.
»Her mit dem Geld!« sagt das Mädchen zu Sandra. »Sonst werde ich dich kennzeichnen, daß du nie mehr im Leben eine Chance hast, als Hure dein Geld zu verdienen.«
Schnell durchsucht das Mädchen Sandras Kleidertaschen, holt triumphierend das Bündel Geldscheine heraus und läuft zurück zu den anderen.
Sandra zuckt mit den Schultern und geht weiter. Isabel spürt einen grimmigen Hunger, als sie daran denkt, was sie alles für das Geld hätten essen können.
Schließlich stehen sie wirklich auf der Avenida Atlántica mit all den Restaurants, Nachtclubs, Straßencafés und Geschäften, und der ganze Strand liegt vor ihnen. Die blaugrünen Wellen kommen ihnen entgegen und brechen in weißen Schaumbergen, benetzen den Sand und verschwinden wieder im Meer.
»Die Copacabana«, sagt Sandra feierlich.
Isabel sieht es, nickt und versteht.
»Hier wirst du ihn also finden«, sagt sie.
»Wen denn?«
»Na, den reichen Amerikaner.«
»Ach ja, genau.« Sandra lacht, und dann rennen die beiden Mädchen, so verschwitzt und abgekämpft, wie sie sind, zum Meer hinunter und werfen sich mit ihren Kleidern ins Wasser. Sie scheren sich nicht um die Touristen, die sie mißtrauisch anstarren. Endlich sind sie angekommen.
3
Sie schaffen es, trocken zu werden, bevor die Sonne untergeht. Dann setzen sie sich auf die Mauer, die am Strand entlangläuft, und schauen zu, wie die Neonlichter angehen, Reklameschilder blinken, und es langsam dunkel wird. Bald ist die Strandpromenade voll mit Leuten, die auf- und abschlendern.
»Wie lange, meinst du, wird es dauern, bis er dich findet?« fragt Isabel.
Sandra antwortet nicht. Sie schaut statt dessen das Mädchen an, das direkt auf sie zukommt. Es ist ein Mädchen in Sandras Alter, vielleicht ein bißchen älter. Ihr rotgeschminkter Mund leuchtet wie eine Blume. Ihre Augen sind völlig ausdruckslos. Sie trägt einen kurzen, engen Rock und ein Top, das fast nichts bedeckt. Und was für Schuhe sie anhat! Schuhe mit sehr hohen und sehr dünnen Absätzen. Sie bleibt vor ihnen stehen und glotzt sie an. Ihre Kiefer bearbeiten heftig ein Kaugummi.
»Ihr kommt direkt aus der Pampa, wie ich sehe.«
»Das geht dich wohl nichts an«, antwortet Sandra so dreist wie möglich.
»Nein, aber du solltest wissen, daß hier bestimmte Regeln herrschen, wenn du keinen Ärger kriegen willst.«
Sie deutet auf ein erleuchtetes Haus.
»Das Restaurant und die Bar sind besetzt, damit du es nur weißt. Und ich glaube auch nicht, daß eins von den anderen frei ist. Wenn wir dich hier erwischen, dann gute Nacht.«
»Uns interessiert das blöde Restaurant überhaupt nicht«, sagt Sandra, »wir warten auf einen Freund.«
Das Mädchen schaut von Sandra zu Isabel und lacht laut und heiser.
»Wenn man so aussieht wie ihr, dann hat man nicht viele Freunde. Wenn ich du wäre, würde ich das Balg nehmen und wieder dahin verschwinden, wo ich hergekommen bin, und zwar so schnell wie möglich.«
»Das kann ich nicht«, sagt Sandra. »Ich habe dort einem ein Messer in den Bauch gerammt.«
Das Mädchen hebt nicht einmal eine gezupfte Augenbraue. »Mir ist es ja scheißegal, wo du arbeiten willst, aber sieh zu, daß du zuerst was zum Anziehen bekommst. Hier unten hast du keine Chance, so wie du aussiehst. Die Rotznase soll dir helfen. Sie hat die richtigen Augen, groß und traurig, sie sieht auch bedauernswert genug aus, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.«
Sandra schaut dem Mädchen lange nach.
»Sie hat recht«, sagt sie dann. »Ich brauche neue Kleider.« Dann mustert sie Isabel.
»Du könntest es wenigstens versuchen«, sagt sie. »Guck, wie die anderen Kinder es machen. Die da drüben zum Beispiel. Guck, wen sie sich aussuchen zum Anbetteln und wie sie sich dabei anstellen. Mach es genauso. Es müßte gehen. Du siehst wirklich mindestens so bedauernswert aus wie sie.«
Es tut Isabel weh, daß ihre Schwester so etwas sagt. Zu Hause unter den Palmen hat Sandra immer geschwärmt, daß Isabel so schöne Augen hat, daß sie fast neidisch werden könnte.
»Ich will nicht betteln«, sagt sie leise.
»Du wolltest unbedingt mitkommen, also kannst du auch mithelfen. Ich geh’ mal eine Runde, und du probierst es wenigstens!«
Sandra schlendert die Promenade entlang. Isabel steht verlassen da und schaut ihr nach. Zuerst ist sie außer sich vor Angst. Wenn Sandra nicht zurückkommt, sondern einfach in der Menschenmenge verschwindet, was dann? Voller Panik läuft sie ihr nach.
»Du darfst mich nicht allein lassen«, bittet sie, und Tränen steigen ihr in die Augen, ohne daß sie es verhindern kann.
Sandra wird weich.
»Ich lass’ dich nicht allein«, beruhigt sie Isabel. »Aber wir müssen uns gegenseitig helfen, Geld zu verdienen. Was du tun kannst, ist betteln, und das geht besser, wenn du allein bist. Da siehst du so klein und hilflos aus, daß sie dir einfach was geben müssen!«
»Was soll ich denn sagen?«
»Streck einfach die Hand aus.«
Sandra zeigt auf ein Touristenpaar, das ihnen gerade entgegenkommt.
»Versuch’s mit denen!«
Isabel geht unsicher auf sie zu, sie muß blinzeln, um die Tränen zurückzuhalten. Deshalb sieht sie die zwei alten Damen nicht und läuft direkt in sie hinein. Sie entschuldigt sich und steht dann wie versteinert da, als das Touristenpaar näher kommt. Sie ist mitten in einer Bewegung stehengeblieben, mit ausgestreckter Hand, und nach der Entschuldigung kriegt sie kein Wort mehr heraus.
Die eine der Damen sagt etwas in einer Sprache, die sie nicht versteht, aber der Klang der Stimme ist so warm, daß sie sich gleich ein bißchen besser fühlt und die Damen anlächelt. Beide drücken ihr einen Schein in die Hand. Die eine streicht ihr sogar über die Haare, bevor sie weitergeht. Isabel schaut erstaunt die Scheine an. Sie kann noch nicht zählen, aber es ist bestimmt viel Geld.
»Gut«, hört sie Sandras Stimme. »Weiter so, wir werden es schon schaffen!«
Sie reißt Isabel die Scheine aus der Hand, und das ist auch gut, denn es nähert sich eine ganze Bande Jugendlicher, angeführt von einem Jungen, der so ungefähr elf Jahre alt ist. Trotz der Wärme hat er eine pelzgefütterte Wildlederjacke an, die ihm bis zu den Knien reicht. Die Shorts, die ihm auch zu groß sind, hat er mit einer Schnur zusammengebunden, damit sie oben bleiben. An den Füßen hat er ein Paar alte Plastiksandalen. Seine Haare sind ein einziger schwarzer Wuschelkopf.
Er tut so, als sähe er Isabel überhaupt nicht und fixiert Sandra.
»Gib das Geld her!« sagt er. »Das hier ist unser Viertel, und hierher kommen keine Landpomeranzen und stehlen unser Geld.«
Sandra sieht zuerst ein bißchen überrumpelt aus, fängt sich aber schnell und hat plötzlich das Messer in der Hand.
»Hau lieber ab, ehe ich dich aufschlitze, so wie ich es mit dem letzten Kerl gemacht habe, der mich geärgert hat«, droht sie.
Da lacht er laut auf.


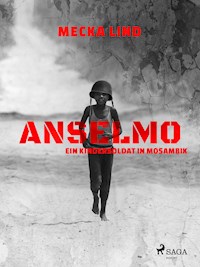













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












