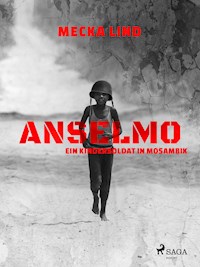
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein aufrüttelnder Jugendroman über das Leben eines Kindersoldaten in Afrika! Der zehnjährige Anselmo lebt mit seinen Eltern und Geschwistern in Mosambik. Als Rebellen sein Heimatdorf überfallen, wird Anselmo gefangen genommen und dazu gezwungen, als unfreiwilliger Soldat für die Rebellen zu kämpfen. Doch eines Tages findet er den Mut, einen riskanten Fluchtversuch aus seinem von Gewalt geprägten Leben zu wagen. Kann Anselmo seine Freiheit zurückerlangen?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mecka Lind
Anselmo - Ein Kindersoldat in Mosambik
Übersezt von Regine Elsässer
Saga
Anselmo - Ein Kindersoldat in Mosambik
Übersezt von Regine Elsässer
Titel der Originalausgabe: Anselmo - barnsoldaten
Originalsprache: Schwedischen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 2000, 2021 Mecka Lind und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726922462
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Der Krieg
1
Die Machete saust durch die Luft, Anselmo arbeitet sich langsam auf dem Hirsefeld vorwärts. Die Hirse steht dieses Jahr gut. Die Halme wachsen ihm über den Kopf, die Rispen hängen schwer und voll.
Es ist Mittag. Die Hitze liegt drückend und feucht über der Machamba, dem kleinen Stück Acker. Anselmo arbeitet schon seit dem Morgengrauen, er wird allmählich müde und will sich gerade ein bisschen ausruhen, als er über dem Dorf oben auf dem Hügel eine große schwarze Wolke sieht. Sie breitet sich aus, wird schnell größer und sieht gegen den blauen Himmel beängstigend aus.
»Es brennt«, sagt er leise vor sich hin.
Er denkt sofort an die Guerilla, und dieser Gedanke erfüllt ihn mit Entsetzen. Sein Onkel Miguel, der in der Stadt wohnt und das Haus eines weißen Mannes bewacht, spricht portugiesisch und berichtet, er habe gehört, sie greifen nur nachts an. Und jetzt ist ja helllichter Tag.
Es ist bestimmt ein Unfall, denkt er. Vielleicht hat ein Kind beim Spielen ein Stöckchen aus dem Feuer genommen und ist damit zu nahe an die Strohwand einer Hütte gekommen.
Bisher ist das Dorf vom Krieg verschont geblieben. Man hat den Krieg vor allem an der Sorge um die Männer gespürt, die weggezogen sind, um auf der Seite der Regierung zu kämpfen.
Aber es sind auch Fremde gekommen und haben Geschichten erzählt von der Grausamkeit der Banditen . . . wie sie plündern, alles niederbrennen und die Menschen töten. Und diese Geschichten leben weiter in denen, die sie gehört haben. Manchmal hatte Anselmo solche Angst, dass er nicht schlafen konnte. Er hat sich auf seiner Bastmatte gewälzt und sich vorgestellt, wie es ist, wenn sie kommen. Er hat sie sich meistens wie böse Geister gedacht, die durch die Nacht sausen . . . nicht wie Menschen.
Es ist jedoch nichts passiert, das Leben geht weiter wie bisher, und für diese Wolke gibt es sicher auch eine einfache Erklärung.
Wenn er nur nicht ganz allein hier unten wäre. Aber er ist allein, Vater ist auf dem Markt im Nachbardorf und verkauft Holzkohle. Er ist schon vor der Dämmerung mit Anselmos bestem Freund Paolo losgezogen. Mutter und die große Schwester Rosa waschen, während die kleine Schwester Lucinda auf die noch kleineren Geschwister Julio und Agosto aufpasst. Die Leute, die sonst auf den benachbarten Machambas arbeiten, sind vermutlich auch auf dem Markt. Hier sind sie auf jeden Fall nicht, und das ist nicht schön. Er hätte sich besser gefühlt, wenn er jetzt mit jemandem hätte reden können. Wenn er mit Reden die Angst wegen dieser Wolke hätte vertreiben können.
Plötzlich raschelt es im hohen, trockenen Gras am Weg. Als ob ein Windhauch hindurchführe. Der schwere, heiße Tag ist jedoch völlig windstill.
Instinktiv duckt Anselmo sich und kriecht hinunter zum ausgetrockneten Flussbett, durchquert es und versteckt sich hinter einigen Büschen auf der anderen Seite. Kurz darauf hört er jemanden in der Machamba, die er gerade verlassen hat. Ihm bricht vor Angst der kalte Schweiß aus, aber er ist auch neugierig. Langsam erhebt er sich, um sofort wieder blitzschnell ins Gras abzutauchen.
In der Hirse waren drei Jungen. Drei fremde Jungen. Sie waren nicht viel älter als er selbst, und doch hatten zwei von ihnen Maschinengewehre. Der dritte hatte eine Machete. Ihre Kleider waren verblichen und zerlumpt. Die Gesichter waren beängstigend hart und angespannt.
Er spürt neben sich eine Bewegung. Jemand kommt. Jemand hat ihn entdeckt. Er bleibt wie gelähmt hocken und schaut zu Boden. Er traut sich nicht aufzuschauen, um zu sehen, wer es ist. Eine Hand packt ihn am Arm und zerrt ihn hoch. Es ist die Hand eines erwachsenen Mannes. Vor ihm steht ein Regierungssoldat. Anselmo erkennt ihn an der Uniform. Die Soldaten, die das Dorf besucht hatten, trugen die gleichen Uniformen. Aber diesen Mann hat er noch nie gesehen.
»Erschieß mich nicht, ich . . . ich komme aus dem Dorf da drüben«, stammelt er.
»Hast du jemanden vorbeigehen sehen?«, fragt der Soldat. Anselmo zeigt in Richtung der Machamba.
»Sie waren zu dritt, da drüben. Zwei hatten richtige Gewehre, obwohl sie nicht älter waren als ich.«
»Es ist jetzt ruhig im Dorf, du kannst nach Hause gehen«, sagt der Soldat. »Bleib aber sicherheitshalber im Gras neben dem Weg.«
2
Der Weg nach Hause ins Dorf führt den Hügel hinauf und ist in der Hitze immer anstrengend zu gehen. Es ist jedoch eine Qual, wenn man außerdem noch gebückt durchs hohe Gras schleichen muss, immer gewärtig sein muss, auf jemanden zu treffen, der einen töten will. Und doch beeilt Anselmo sich, so gut er kann. Die Sorge um die Mutter und die Geschwister treibt ihn an.
Er nähert sich den ersten Hütten. Überall stehen Männer, Frauen und Kinder in Gruppen zusammen. Einige stehen schweigend da, das Entsetzen hat sie stumm gemacht. Andere weinen und schreien ihre Trauer und Klage heraus. Etwas Schreckliches muss geschehen sein, aber Anselmo bleibt nicht stehen, um nachzufragen. Er eilt nach Hause, er läuft, so schnell er kann.
Jetzt sieht er ihre Hütte.
Zumindest hat sie nicht gebrannt, denkt er erleichtert.
Und da steht auch seine Mutter. Sobald sie ihn erblickt, läuft sie ihm entgegen. Als er ihre Arme um sich spürt, fängt er an zu weinen. »Ich habe sie gesehen«, schluchzt er. »Ich habe drei von ihnen gesehen, sie sind über unsere Machamba gegangen. Ich hatte mich versteckt.« Plötzlich hört er auf zu sprechen und schaut um sich. Die Nachbarn haben sich versammelt, um zu hören, was er zu erzählen hat.
»Sie hatten Waffen, aber es waren keine Soldaten«, sagte er. »Sie waren nicht älter als ich.«
»Es waren auch Soldaten da«, sagt Atisha, Paolos Mutter.
»Es war das reine Glück, dass eine Regierungspatrouille in der Nähe war«, sagt Anselmos Großvater. »Sonst würde keiner von uns mehr hier stehen.«
»Aber was ist denn passiert . . . was hat denn gebrannt?«, fragt Anselmo.
Alle sind verängstigt und aufgeregt und reden durcheinander. Anselmo muss sich Mühe geben, dass er mitkommt, aber als er sich schließlich zusammenreimen kann, was geschehen ist, weiß er, dass nun der Krieg auch in sein Dorf gekommen ist.
Der Lehrer, Senhor Eduardo, hatte in der Schule gerade Portugiesisch unterrichtet, als die Banditen plötzlich dastanden und Maschinengewehre auf ihn und die Kinder richteten. Es waren vier Männer und drei Jungen. Einer der Männer, vermutlich der Anführer, sagte zu den Kindern, alles, was sie bisher in der Schule gelernt hätten, seien nur Lügen gewesen. Der Lehrer stünde auf Seiten der Regierung, und es sei eine Schande für das Dorf, einen Verräter als Lehrer zu haben. Er müsse sterben, und die Kinder sollten froh sein, von ihm befreit zu werden. Dann hatte er auf Emilio gezeigt und gesagt, er solle vorkommen und seine Kameraden vom Verräter befreien. Emilio war der älteste Junge in der Klasse, aber er war auch der Sohn des Lehrers.
Gerade als der Anführer dem entsetzten Emilio die Waffe gegeben und ihm gezeigt hatte, wie er zielen und abdrücken müsse, war einer der Jungen angerannt gekommen, er hatte einen brennenden Zweig in der Hand und rief dem Mann etwas zu. Der riss Emilio die Waffe aus der Hand und erschoss Senhor Eduardo. Der Junge hatte den brennenden Zweig an die strohtrockenen Wände der Schule gehalten, dann waren alle ebenso leise und plötzlich verschwunden, wie sie gekommen waren.
Die Leute in der Nähe hatten das Schreien der Kinder gehört und die Flammen gesehen und waren zur Schule gelaufen. Einige der Kinder konnten sich selbst aus den Flammen befreien. Die anderen hatte man aus dem Feuer herausholen müssen. Den armen Emilio mussten sie heraustragen. Den Körper seines Vaters hatte man zurücklassen müssen. Mitten im Chaos war eine Soldatenpatrouille auf den Platz vor der Schule gefahren. Einige der Männer nahmen sofort die Verfolgung der Banditen auf. Die anderen halfen, das Feuer zu löschen, ehe es sich ausbreiten konnte.
Aber jetzt gab es keine Schule und keinen Senhor Eduardo mehr.
3
Es ist schon Abend, als die Soldaten zurückkommen. Sie haben einen Jungen dabei. Einen von den dreien, die Anselmo bei der Machamba gesehen hat. Er sieht jetzt ganz anders aus. Das Angespannte und Bedrohliche in seinem Gesicht ist verschwunden.
Er hat Angst, denkt Anselmo. Genau solche Angst, wie ich hatte. Die Leute versammeln sich um sie. Einige Frauen bespucken den Jungen.
»Lasst das! Er ist doch noch ein Kind!«, hört Anselmo seinen Vater sagen.
»Das sind die Allerschlimmsten«, ruft jemand aus der Menge, die ständig größer wird . . . alle wollen den Gefangenen sehen.
»Er könnte genauso gut einer von uns sein«, sagt der Vater. »Sie entführen und trainieren sie, dann werden sie auf Drogen gesetzt und gezwungen, die abscheulichsten Grausamkeiten zu begehen. Wenn einer von ihnen es auch nur wagt zu widersprechen, wird er getötet.«
Einige der Frauen schnauben verächtlich über seine Worte. Die meisten hören ihm gar nicht zu. Als die Soldaten den verängstigten Jungen mit auf dem Rücken gefesselten Händen auf die Ladefläche des Wagens werfen, jubeln sie. Das Auto startet und verschwindet in einer Wolke aus Staub.
Einige der Soldaten bleiben im Dorf. Die Banditen hatten ja keine Gelegenheit gehabt, etwas zum Essen zu rauben, vielleicht kommen sie wieder. Es gibt zurzeit viel Hirse und Mandioka im Dorf.
Auf dem Markt hatte der Vater gehört, dass mehrere Dörfer in der Nähe überfallen worden seien. Er erzählt darüber, als sie am Abend um das Feuer sitzen.
»Ich kann nicht mehr warten«, sagt er schließlich und schaut sie ernst an. »Ich schließe mich den Soldaten an, wenn sie wegfahren.«
Lucinda und Rosa schauen ihn erschrocken an. Die Mutter steht auf, wendet ihnen den Rücken zu und trifft die Vorbereitungen für die Nacht.
»Und wenn sie wieder kommen«, sagt Anselmo erregt. »Was könnte ich denn machen?«, fragt der Vater. »Sie sind bewaffnet. Das hast du selbst gesehen. Was glaubt ihr, wäre passiert, wenn nicht zufällig die Soldaten in der Nähe gewesen wären? Sie hätten das ganze Dorf niedergebrannt!«
Die Mutter schweigt noch immer. Der Vater spricht weiter, als ob er sich selbst überzeugen müsste.
»Es werden Soldaten gebraucht. Ich weiß es! Ich werde keine Ruhe mehr haben, wenn ich da unten in der Machamba arbeite. Was hätte ich heute machen können? Mich zusammen mit Anselmo hinter einem Busch verstecken? Nein, so geht es nicht weiter. Ich werde in der Armee gebraucht. Ich habe mich entschieden. Und habe gehört, dass auch andere Männer so denken.«
Am nächsten Morgen sagt der Vater zu Anselmo, dass er nicht in die Machamba gehen soll. Er wolle mit ihm reden.
Sie setzen sich unter den Mangobaum vor der Hütte. Der Vater ist sehr ernst. Es muss etwas sehr Wichtiges sein. »Du bist zwar noch nicht ganz zehn Jahre alt«, beginnt er, »aber du bist stark und du bist klug für dein Alter, außerdem bist du mein ältester Sohn. Deshalb möchte ich, dass du mir dein Ehrenwort gibst, alles in deiner Macht Stehende zu tun, um die Familie zusammenzuhalten. Wenn ihr aus irgendeinem Grund nicht im Dorf bleiben könnt, dann will ich, dass ihr alle zusammen zu Onkel Miguel in die Stadt geht. Er wird euch helfen.«
Anselmo fühlt sich im Moment wahrlich weder sehr stark noch besonders klug. Am liebsten wäre ihm, wenn der Vater bei ihnen bliebe. Aber er ist auch stolz, dass er ihm eine solche Verantwortung überträgt, und mit größtem Ernst gibt er dem Vater sein Ehrenwort.
Schon am gleichen Nachmittag werden die Dorfbewohner zur Versammlung am Brunnen gerufen. Einer der Soldaten spricht zu ihnen und sagt, viele der Männer aus dem Dorf würden mit den Soldaten zum Stützpunkt kommen, wo sie eine Ausbildung erhielten. Er ermahnt die Zurückbleibenden, und das sind fast nur Frauen, Kinder und Ältere, ganz besonders vorsichtig zu sein. Sie müssen sich nachts im Busch verstecken, sagt er. Das machen sie auch in anderen Dörfern. Man arbeitet tagsüber auf seiner Machamba und schläft nachts im Busch, wenn die Gefahr eines Überfalls besonders groß ist.
Einige Stunden später fahren sie ab. Anselmo bleibt noch lange stehen und schaut der Wolke nach, die die Autos auf der trockenen Schotterstraße hinterlassen.
Wird er seinen Vater je wieder sehen?
In der ersten Zeit nach dem Überfall gehorchen viele dem Rat der Soldaten und halten sich nur tagsüber im Dorf auf. Anselmos Familie macht es auch so, sie nehmen jede Nacht auch die Großeltern mit zum Schlafen in den Busch. Aber als die Zeit vergeht und nichts passiert, kehrt man wieder zu den alten Gewohnheiten zurück und versucht, so normal wie möglich zu leben.
Vom Vater hören sie nichts. Sie wissen nicht, wo er ist und ob er überhaupt noch lebt.
Onkel Miguel kommt jedoch ab und zu auf Besuch, was Anselmo ganz besonders freut, weil er von ihm Portugiesisch lernt. Er bringt auch den älteren Geschwistern bei, ihren Namen zu schreiben. Keiner von ihnen ist besonders oft in die Schule gegangen, als es sie noch gab, sie wurden zu Hause und auf der Machamba gebraucht. Einmal kommt eine größere Regierungspatrouille ins Dorf. Die Frauen geben den Soldaten zu essen und überschütten sie mit Fragen nach ihren Männern, aber die Soldaten kommen aus weit entfernten Dörfern und können nichts berichten. Sie gehen lieber zu Senhor Fernando, der sie zu selbst gebrautem Bier einlädt. Nach vielen Stunden, in denen laut gelacht und geredet wurde, kehren sie zu den Hütten der Frauen zurück. Als die Soldaten, die bei Anselmos Familie gegessen hatten, durch die Türöffnung getorkelt kommen, sagt die Mutter, Anselmo solle mit den Geschwistern in den Busch gehen und dort schlafen.
Einer der Männer grinst Rosa schmeichelnd an, sie ist schon eine junge Frau.
»So ein hübsches Mädchen braucht doch nicht im Busch zu schlafen, wenn es hier genug Männer gibt, die sie beschützen können«, lallt er.
Rosa schaut schüchtern zu Boden und sagt mit leiser Stimme: »Julio schläft nicht, wenn ich nicht bei ihm bin. Ich komme zurück, wenn er eingeschlafen ist.«
»Ich warte auf dich«, sagt der Fremde.
Dann wendet er sich der Mutter zu und fängt mit ihr zu schmusen an. Anselmo will protestieren, aber der Mann ist groß und stark, und er versteht, dass die Mutter um jeden Preis Rosa schützen will. Deshalb schweigt er, beißt die Zähne zusammen und geht mit seinen Geschwistern in den Busch. Sie kommen erst zurück, als sie die Autos der Patrouille in der Feme verschwinden hören. Da ist schon wieder Tag, und die Sonne steht hoch am Himmel.
Die Mutter stößt Mais, als sie zurückkommen. Sie schaut sie nicht an, und sie stellen keine Fragen. Aber es schmerzt Anselmo, als er einen neuen Zug von Müdigkeit und Resignation in ihrem Gesicht bemerkt.
Das Dorf ist wieder seinem Schicksal überlassen worden. Auf Gedeih und Verderb.
4
Wenn Anselmo nicht auf der Machamba arbeitet oder seinen Schwestern hilft, dann ist er mit seinem besten Freund Paolo zusammen.
Paolos Vater wurde vor einigen Jahren im Krieg getötet. Paolo ist der älteste von drei Geschwistern. Die anderen beiden sind Mädchen. Graça ist ungefähr sechs und Tamara ungefähr vier Jahre alt. Paolo ist ein bisschen älter als Anselmo. Er muss seiner Mutter Atisha viel helfen, weil die Schwestern noch so klein sind. Er muss auch bei Arbeiten helfen, die Männer sonst nicht machen, aber Paolo kämpft sich durch, und Anselmo schaut zu ihm auf wie zu dem großen Bruder, den er nicht hat.
Eines Abends, es ist einige Mondumläufe her, dass Anselmos Vater weggegangen ist, fragt er seine Mutter, ob er nicht bald zehn Jahre alt sei. Sie denkt eine Weile nach, dann nickt sie nachdenklich und sagt, dass es wohl so weit sei.
»Dann bin ich jetzt ein Mann«, sagt er feierlich, aber seine Mutter lacht ihn nur aus.
Als sie gegessen haben, geht er gleich zu Paolo.
»Meine Mutter sagt, dass ich jetzt zehn Jahre alt bin«, sagt er stolz.
»Dann bin ich zwölf«, sagt Paolo.
Dann machen sie ihre übliche Runde durch das Dorf, um zu sehen, was los ist.
Drüben bei Fernando sitzen wie immer einige Männer und trinken Bier. Sie sind sich offenbar uneinig über etwas, sie reden laut und ärgerlich. Die Jungen sind neugierig, und im Schutz der Dunkelheit schleichen sie sich bis ganz nahe an die Hütte, um heimlich zu lauschen.
Der Streit dreht sich natürlich um den Preis für das Bier. Da Fernandos Kunden normalerweise kein Geld haben, lässt er sie ihre Schulden auf seinen Machambas abarbeiten. Er besitzt mehrere Machambas, und einige gehören ihm nur deshalb, weil die Männer sie vertrunken haben. Im Moment sieht es besonders schlecht aus für den alten Ernesto. Die anderen haben Mitleid mit ihm.
»Wenn er seine einzige Machamba verliert, dann wird er nichts zu essen haben«, sagt einer von ihnen.
Aber Fernando ist unerbittlich und sagt, er habe Ernesto unzählige Male gewarnt. Und wenn jemand im Dorf zählen kann, dann ist es Fernando. Aber ebenso viele Male hat Ernesto ihn überredet, ihm noch eine Flasche Bier zu geben.
»Armer Ernesto«, flüstert Paolo. »Heute Abend scheint es richtig schlimm um ihn zu stehen.«
Da sieht Anselmo zwei Flaschen, die an der Palme direkt neben ihnen lehnen. Er stößt Paolo in die Seite und zeigt darauf.
»Wenn Fernando sein Bier so herumstehen lässt, ist er selber betrunken«, sagt er. »Man kann es ja einfach mitnehmen.«
»Dann nehmen wir es«, schlägt Paolo vor. »Wenn er dem alten Ernesto seine Machamba wegnimmt, dann nehmen wir ihm sein Bier weg.«
Anselmo ist einverstanden. Ernesto wird dieses Bier morgen früh dringend brauchen, wenn er aufwacht und feststellen wird, dass er seine einzige Machamba verloren hat. Dann braucht er ganz bestimmt etwas, um seine Sorgen zu ertränken.
Es dauert nur Sekunden und dann sind die beiden Flaschen und die Jungen weit weg. Sie laufen in den Busch, um sie zu verstecken.
»Dort . . . unter den Büschen da vorne . . . da verstecken wir sie«, sagt Anselmo.
Der Mond scheint nicht, aber die Jungen sind es gewohnt, sich im Dunkel unter den Sternen zurechtzufinden.
Während sie die Flaschen verstecken, fragt Paolo: »Hast du schon einmal Bier getrunken?«
Anselmo schüttelt den Kopf.
»Du?«
»Ein-, zweimal«, sagt Paolo. »Ich finde, es schmeckt ganz gut.« Seine Augen glänzen.
»Sollen wir einen Schluck trinken? Schließlich bist du zehn, und da musst du es wenigstens versucht haben.« Er sieht, dass Anselmo zögert.
»Es wird auch noch für Ernesto reichen«, sagt Paolo und holt die eine Flasche. Er zieht den Korken heraus, trinkt einen Schluck und reicht Anselmo die Flasche.
Paolo hat Recht, denkt Anselmo. Wenn man zehn ist, muss man es wenigstens versucht haben.
Er setzt die Flasche an den Mund und trinkt einen ordentlichen Schluck. Es schmeckt überhaupt nicht gut. Es schmeckt eklig. Aber laut sagt er: »Nicht übel.«
»Fernando ist zwar böse und gemein, aber er braut ein gutes Bier«, sagt Paolo und nimmt noch einen Schluck, bevor er die Flasche wieder Anselmo zurückgibt, der findet, dass es immer besser schmeckt, je mehr man davon trinkt. Außerdem genießt er diese merkwürdige, wohlige Wärme, die sich in seinem Körper ausbreitet.
Ich bin zehn Jahre alt, denkt er glücklich. Ich habe versprochen, mich um die Familie zu kümmern, und das werde ich tun, da kann Mama lachen, so viel sie will.
Er muss pinkeln und steht auf. Verblüfft und nicht wenig überrascht, merkt er, wie der ganze Busch sich um ihn dreht. Er schließt die Augen und öffnet sie wieder, aber das hilft nicht.
»Ich glaube, ich bin betrunken«, stellt er sachlich fest.
»Ich auch«, sagt Paolo lachend.
»Mutter wird böse werden«, sagt er. »Sehr böse.«
»Sie ist eine Frau«, sagt Paolo. »Frauen mögen es nicht, wenn Männer trinken. Meine Mutter mag es auch nicht.« »Sie werden bestimmt miteinander sprechen, und dann werden sie noch ärgerlicher sein«, sagt Anselmo seufzend.
»Wir schlafen heute Nacht hier«, schlägt Paolo vor. »Morgen sind wir wieder nüchtern, dann denken wir uns eine gute Ausrede aus und gehen wieder nach Hause.«
»Dann können sie nicht böse werden«, sagt Anselmo.
»Wenn sie bloß wüssten, wie rücksichtsvoll wir sind«, fährt Paolo fort. »Wir sind wirklich gute Söhne, wir wollen den Schlaf unserer Mütter nicht stören.«
»Ja, sie können wirklich froh sein, dass sie uns so nicht zu sehen brauchen«, fügt Anselmo hinzu.
»Mein Vater wäre sehr stolz auf mich«, sagt Paolo.
»Meiner auch«, sagt Anselmo.
Sie denken an ihre Väter und vermissen sie. Sie sind plötzlich sehr ernst.
»Ich ziehe vielleicht auch in den Krieg«, verkündet Paolo.
»Ich auch«, schließt Anselmo sich an.
Tief ergriffen von ihren großartigen Überlegungen, holen sie die zweite Flasche hervor.
»Ich glaube, es ist wirklich nicht gut für den alten Ernesto, so viel zu trinken«, sagt Anselmo.
»Nein«, pflichtet Paolo ihm bei. »Er ist selber schuld.«
5
Die Sonne weckt sie auf. Als Anselmo den Kopf bewegt, explodiert er fast vor Schmerz. Er hat das Gefühl, als ob sein Magen sich nicht entscheiden könnte, in welchen Teil des Körpers er gehört, falls er überhaupt da hingehören will. Paolo scheint es nicht viel besser zu gehen.
»Meine Mutter kann sagen, was sie will«, stöhnt Anselmo. »Ich gehe jetzt nach Hause.«
Paolo brummt zustimmend.
Sie kämpfen sich den Pfad entlang, der zum Dorf führt. Aber egal, wie schlecht Anselmo sich fühlt, er wundert sich doch darüber, dass er niemanden auf einer Machamba arbeiten sieht, es ist auch niemand unterwegs dahin. Die Sonne steht schon hoch am Himmel. Und was riecht denn so schlecht? Es stinkt. Wie nach . . . nach verbranntem Fleisch.
»Wir verlassen den Pfad«, schlägt er vor, und Paolo stellt keine Fragen.
Gespannt und unruhig gehen sie weiter im Schutz des hohen Buschgrases. Für Anselmo ist es wie eine schauerliche Wiederholung. Die gleiche Angst, die gleiche Unruhe, die gleiche Vorsicht. Nur dass er dieses Mal nicht alleine ist.
Als sie die ersten niedergebrannten Hütten sehen, bleiben sie stehen. Sie trauen sich nicht, ins Dorf zu gehen. Sie gehen außen herum durch den Busch. Alles ist zerstört. Große Teile des Dorfs sind bis auf den Grund niedergebrannt. Auf dem Boden liegen verstümmelte Körper. Viele erkennen sie. Zumindest an der Kleidung. Dort liegt Dolores. Ihre Capulana ist nicht zu verkennen. Sie war die Einzige im Dorf, die eine Capulana mit so einem Muster hatte. Sie hatte sie von einem Verwandten bekommen, der sie ihr in einer großen Stadt weit weg von hier gekauft hat. Sie war sehr stolz darauf gewesen. Sie sehen auch den alten Ernesto. Er wird nie mehr Durst auf Bier haben. Und auch seine Machamba wird er nicht mehr brauchen.
Die Angst vor dem, was sie bei sich vorfinden werden, pocht ihnen in den Adern. Sie können nirgendwo ein Lebenszeichen entdecken. Bis sie den Teil des Dorfes erreichen, in dem sie selbst wohnen. Da hören sie Spatenstiche.
Jemand gräbt ein Grab, denkt Anselmo.
Sie gehen auf das Geräusch zu, und jetzt begegnen ihnen Überlebende, aber die eilen an ihnen vorbei. Beide sehen von weitem, dass ihre Hütten noch stehen. Die Erleichterung spült wie eine Welle über Anselmo hinweg, und er beginnt zu laufen. Er läuft vorbei am Mangobaum, vorbei am Arbeitstisch, auf dem noch einige gespülte Töpfe stehen und weiter zur Hütte.
Die klapprige Bambustür steht offen, und ihm fällt ein, dass er der Mutter versprochen hat, eine neue zu machen.
»Mama«, ruft er vorsichtig in der Türöffnung.
Kein Laut.
»Rosa, Lucinda.«
Das Einzige, was er hört, ist der Wind in der Krone des Mangobaums.
Sie haben noch fliehen können, denkt er und tritt ins Dunkel.
Er bleibt erstarrt stehen.
Vor seinen Füßen liegen die Körper seiner Mutter und des kleinen Agosto.
Er wird sich an nichts anderes mehr erinnern. Er weiß nicht einmal mehr, wo er den Spaten herbekommen hat. Erst als er das Grab unter dem Mangobaum gräbt, beginnt sein Gehirn wieder zu arbeiten, und er überlegt, wo Rosa, Lucinda und Julio wohl sein mögen und ob und wie die Großeltern es wohl überlebt haben.
Er arbeitet mechanisch. Als er tief genug gegraben hat, geht er zur Hütte zurück und schleppt den Körper seiner Mutter heraus und hinüber zum Baum. Dann holt er den kleinen Agosto. Er trägt ihn auf dem Arm und legt ihn neben die Mutter ins Grab.
Dann setzt er sich mit dem Rücken an den Baumstamm und ruft die Geister der Ahnen mit dumpf leiernder Stimme, die sich zu einem verzweifelten Gesang steigert, herbei. Er bittet sie, sich der Seelen von Mutter und Agosto anzunehmen. Er singt davon, wie viel Gutes die Mutter im Leben getan habe und wie lieb Agosto gewesen sei in den drei Jahren, die er gelebt habe, und wie grausam der Krieg sei, der ihnen dies angetan habe.
Er sitzt mit gebeugtem Kopf und geschlossenen Augen da und sieht sie deshalb nicht kommen. Er hört auch ihre Schritte nicht. Erst als ein Schatten über ihn fällt, schaut er auf und blickt in Rosas Augen. Lucinda steht neben ihr. Julio sitzt im Tuch auf dem Rücken der großen Schwester.
Rosa starrt in das frische Grab.
»Sie hat es also nicht geschafft«, sagt sie mit einer Stimme, die so dünn ist wie ein Spinnfaden.
»Warum sind sie zurückgeblieben?«, fragt Anselmo. »Warum seid ihr nicht gemeinsam geflohen? Ihr seid doch geflohen, oder?«
»Agosto«, flüstert Rosa. »Ist Agosto auch . . .?«
Sie scheint erst jetzt zu verstehen, dass die Mutter nicht alleine im Grab ruht. Sie weint lautlos und schaut hilflos auf das frische Grab. Lucinda drückt sich an sie. Dann setzen auch sie sich hin. Nach einer Weile berichtet Rosa: »Agosto wurde gestern Abend krank. Er bekam sehr hohes Fieber. Mutter wollte zuerst mit ihm zum Curandeiro gehen, aber dann schlief er ein, und sie wollte lieber warten. Aber sie war unruhig und hat wahrscheinlich sehr leicht geschlafen, denn sie wachte von den fürchterlichen Schreien auf. Zu mir sagte sie sofort, ich solle Julio auf den Rücken und Lucinda an der Hand nehmen und weglaufen. Sie wickelte Agosto in die Capulana, unter der er schlief, sie musste ihn ja tragen. Er hatte so hohes Fieber, dass er nicht gehen konnte. Das ist das Letzte, was ich von ihr gesehen habe. Sie stand über den kleinen Agosto gebeugt. Sie müssen ganz kurz darauf gekommen sein, sonst hätte sie noch fliehen können.«

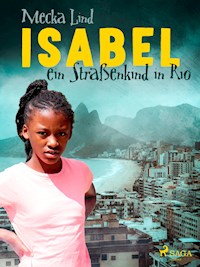














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












