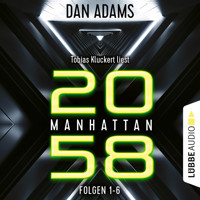4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
New York in naher Zukunft - eine Stadt am Abgrund!
Die Cops Liberty Capriso und Mike Quillan verrichten ihren Dienst in Manhattan, dem gefährlichsten Teil der Stadt. Schlimmer noch: Eine neue, brandgefährliche Droge verbreitet sich rasant. Die Polizei sucht fieberhaft nach den Hintermännern.
Da wendet sich Bürgermeisterin Goldberg an die Ermittler: Sie konnte nur knapp einem Anschlag auf ihr Leben entgehen! Steckt das organisierte Verbrechen dahinter? Oder hat ihre scharfe Kritik an Präsident Stoddard sie zum Ziel gemacht? Schon einmal haben Liberty und Mike dessen Pläne durchkreuzt. Doch während Mike im Umfeld der Bürgermeisterin ermittelt, soll Liberty weiter die Drogenflut bekämpfen. Allerdings gibt es da noch etwas, das sie nicht loslässt: die Suche nach ihrem untergetauchten Bruder ...
Manhattan 2059 - Eternity: Mike und Liberty ermitteln wieder! Dieser Band enthält drei brandneue, bisher unveröffentlichte Folgen der SF-Thriller-Serie.
Auch als Hörbuch bei allen gängigen Streaming-Anbietern und Online-Shops erhältlich!
eBooks von beBEYOND - fremde Welten und fantastische Reisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Teil 1
Prolog
Manhattan
Miami
Manhattan
D.S.O.-Hauptquartier
Teil 2
Manhattan
Ein neuer Tag …
Ein neuer Morgen …
Teil 3
Manhattan
Mitternacht
Weitere Titel des Autors
Manhattan 2058
Three Oaks – Stadt ohne Gesetz
Als Jürgen Bärbig:
Wikingerblut – Die Rache des Kriegers
Wikingerblut – Schlacht der Nordmänner
Über dieses Buch
New York in naher Zukunft – eine Stadt am Abgrund!
Die Cops Liberty Capriso und Mike Quillan verrichten ihren Dienst in Manhattan, dem gefährlichsten Teil der Stadt. Schlimmer noch: Eine neue, brandgefährliche Droge verbreitet sich rasant. Die Polizei sucht fieberhaft nach den Hintermännern.
Da wendet sich Bürgermeisterin Goldberg an die Ermittler: Sie konnte nur knapp einem Anschlag auf ihr Leben entgehen! Steckt das organisierte Verbrechen dahinter? Oder hat ihre scharfe Kritik an Präsident Stoddard sie zum Ziel gemacht? Schon einmal haben Liberty und Mike dessen Pläne durchkreuzt. Doch während Mike im Umfeld der Bürgermeisterin ermittelt, soll Liberty weiter die Drogenflut bekämpfen. Allerdings gibt es da noch etwas, das sie nicht loslässt: die Suche nach ihrem untergetauchten Bruder …
Manhattan 2059 – Eternity: Mike und Liberty ermitteln wieder! Dieser Band enthält drei brandneue, bisher unveröffentlichte Folgen der SF-Thriller-Serie.
Über den Autor
Dan Adams ist das Pseudonym von Jürgen Bärbig, geboren 1971. Er war Stipendiat der Bastei Lübbe Academy und nahm 2014 an der einjährigen Masterclass teil. Für Bastei Lübbe schrieb er die spannende Western-Serie »Three Oaks«. Unter seinem Klarnamen erscheint die »Wikingerblut«-Saga um die Wikingerbrüder Kjelvar und Thorvik. Mit dem actionreichen SF-Thriller »Manhattan 2058« und der Fortsetzung »Manhattan 2059« entwirft er ein düsteres, packendes Szenario der nahen Zukunft.
DAN ADAMS
MANHATTAN2059
ETERNITY
beBEYOND
Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Langenbuch & Weiß Literaturagentur.
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Uwe Voehl
Lektorat/Projektmanagement: Lukas Weidenbach
Covergestaltung: Guter Punkt GmbH Co. KG unter Verwendung von Motiven von © ivanmollov / iStock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1628-4
be-ebooks.de
lesejury.de
Teil 1
Prolog
November 2058
Hunters Point lag direkt am East River in Queens. Die Häuser, die bis an das Ufer reichten, gehörten zu einem der zahlreichen gescheiterten Projekte, in denen die Stadt der Armut entgegenwirken wollte und Häuser für die sozial Schwachen gebaut hatte. Jetzt war Hunters Point eines der vielen Viertel, in denen Gangs das Sagen und die Polizei es aufgegeben hatte, für Recht und Ordnung sorgen zu wollen.
Der grauhaarige Mann, der auf einem der Dächer stand und auf die Straßen hinuntersah, dachte daran, während er wartete. Es war kalt. Es hatte etwas geschneit. Der Mond stand als Sichel am Himmel.
Gegen die Kälte trug der Mann einen schwarzen Mantel und Handschuhe. Er suchte in den Taschen nach einem Kaugummi, den er sich in den Mund schob. Der Geschmack von Minze und Chili breitete sich mit angenehmer Schärfe in seinem Mund aus.
Er streifte den Handschuh zurück, um auf seine Comwatch sehen zu können. Bereits fünf Minuten über der Zeit. Seine Verabredung verspätete sich.
Irgendwo in den Straßen hallten Schüsse wider. Ein Hund jaulte, jemand schrie, dann wurde es still.
Fünf weitere Minuten vergingen, bis die rostig quietschende Dachtür dafür sorgte, dass er sich umdrehte.
Eine in einem langen Mantel gehüllte Gestalt, die eine Kapuze trug, kam auf ihn zu. »Tut mir leid, Mr Charon. Ich bin spät.«
»Ist schon in Ordnung. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind.«
»Es klang dringend.«
Der Mann, den der Fremde Mr Charon genannt hatte, wandte sich erneut dem Fluss zu, auf dem die Lichter Manhattans ihr Spiegelbild fanden. »Ich schätze, das ist es wohl auch.« Er seufzte. »Wir hatten Hoffnung, um die wir betrogen wurden.«
Der Fremde kam zu ihm und stellte sich neben ihn. »Weswegen bin ich hier?«, fragte er.
»Ich weiß, dass Sie sich rächen wollen. Das will ich auch.«
»Warum?«
»Wegen meines Sohnes. Er war ein Ghul. Niemand wusste es. Er ist tot. Ich musste ihn erschießen, als er meine Frau angriff.«
Der Fremde legte die Arme auf die Dachbrüstung und starrte nach Manhattan hinüber. »Hat sie überlebt?«
»Nein.«
»Tut mir leid.«
»Danke.«
»Woher wissen Sie von mir?«
»Ich kenne New York sehr gut«, erwiderte Charon. »Und wenn ich auch im Ruhestand bin, verfüge ich immer noch über zahlreiche Kontakte.«
»Nehmen wir beide mal an, ich traue Ihnen. Wie wollen Sie mir helfen?«
»Sagen wir es so: Sie sagen mir, was Sie brauchen, und ich kümmere mich darum, dass Sie es bekommen.« Charon bot seinem Gegenüber einen Kaugummi an. Der lehnte ab und fragte: »Was wollen Sie dafür? Geld?«
»Geld, ja. Aber nicht für mich. Nur die Leute, die ich kontaktieren werde, müssen bezahlt werden, und die sind nicht billig.«
»Ich brauche mehr als Ihr Wort.«
»Das dachte ich mir. Daher habe ich etwas für Sie.« Charon reichte ihm einen Datastick.
»Was ist da drauf?«
»Das Rezept für eine neue Droge, die nie auf den Markt kam. Sie brauchen Geld, und damit lässt es sich verdienen. Nehmen Sie es als Beweis dafür, dass ich es ernst meine. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie es sich überlegt haben.« Er gab ihm eine Nummer, die er auf einem Stück Papier notiert hatte. »Die ist sicher.« Damit wandte sich Charon ab, ging zu dem Air C, stieg ein und flog davon.
Der Fremde sah ihm nach, bis er verschwunden war, bevor er den Blick auf den Datastick in seiner Hand richtete.
Manhattan
Fünf Monate später …Mai 2059
Die Zwillingstürme des Monterey gehörten zu den luxuriösesten Hotels auf der South Side von Manhattan. Mit Blick auf den Atlantik, Lady Liberty, Ellis Island und den Küstenverlauf von Staten Island erhob es sich zweihundert Stockwerke über den nahen Battery Park.
Auf jeder zehnten Etage verbanden Brücken die Türme miteinander.
Die Luft über der Bay und zwischen den Wolkenkratzern war erfüllt vom Summen unzähliger Luxus-Air-Cs.
Im Financial District galt der Schein mehr als das Sein.
Armut existierte hier nicht. Nicht offiziell. Die Selbstmordrate lag allerdings höher als in jedem anderen District.
Wer im Monterey abstieg, gehörte zur reichen Oberschicht. Zwar reichte es immer noch nicht, um sich mit denen von Staten Island auf eine Stufe zu stellen, aber es war ein Leben, von dem die Armen aus den Randzonen nicht einmal zu träumen wagten.
Das Monterey war ein Mikrokosmos, in dem man alles bekommen konnte, was es für Geld zu kaufen gab.
Neben einem Wellnessbereich lockten zahlreiche Geschäfte und Walk-in-Kliniken für die schnelle Schönheits-OP zwischen zwei Terminen. Und auch für die pikanten Wünsche seiner Gäste stellte es einen eigenen Escort Service zur Verfügung.
Es war Abend geworden.
Die Kerzen auf den Tischen in der luxuriösen Businesslounge in der hundertfünfundachtzigsten Etage waren bereits zur Hälfte heruntergebrannt.
Diskrete Farbspiele verwandelten die Wände von weich fließendem Wasser nacheinander in einen Bach, zu schäumender Gischt an einem Strand, zu weiß vorbeiziehenden Wolken an einem blauen Himmel.
Die adrett gekleideten Kellner servierten teuren Rot- und Weißwein, dazu Champagner und Whiskey, der goldgelb in phosphoreszierenden Gläsern schimmerte.
Die Algencremesuppe war verspeist worden, der Hummer war köstlich gewesen. Nun warteten die Gäste auf den Nachtisch und die Ansprache von Bürgermeisterin Goldberg, die sie in ihrer Einladung angekündigt hatte.
Sie waren zu zwölft. Alle stammten aus New York oder aus der nahen Umgebung. Es waren Politiker, Konzernbosse, TV-Leute und Influencer.
Die Gespräche waren ebenso tiefgründig wie heiter, es wurde gelacht. Der Lauteste von allen war Tab Pembroke. Er war die Stimme Amerikas. Seine Net Show Ghulhunter wurde im ganzen Land gesehen. Todesmutige Kandidaten mussten ein Labyrinth voller Ghule durchqueren. Gelang ihnen das, winkten hunderttausend Dollar Preisgeld. Schafften sie es nicht, waren sie tot und wurden zerfleischt. Nur Premiumkunden konnten die Kameras freischalten, die bis zum Ende draufhielten.
Pembroke war ein selbstverliebter Arsch ohne Benehmen, den die Bürgermeisterin nicht leiden konnte, aber er war ein Meinungsmacher, der bei den Leuten gut ankam.
Seine ordinären Witze gingen den anderen Gästen gehörig auf die Nerven.
Aber er war wichtig für die Sache, also wurde peinlich gelächelt, und man war darum bemüht, nicht allzu verstimmt dreinzuschauen.
Nur zwei Männer, die Pembroke gegenübersaßen, machten aus ihrer Abneigung keinen Hehl. Der eine war der ehemalige Sicherheitschef von New York, Terence Milldale, der andere der New Yorker Police Commissioner William Stafford. Während Milldale jede Bemerkung Pembrokes mit einem bissigen Kommentar kommentierte, verdrehte Stafford nur die Augen und konzentrierte sich auf die Klaviermusik von Jordan Halfred III, der ein weiterer Gast war.
Dessen Finger flogen über die Tasten des Flügels, der extra für ihn in die Lounge geschafft worden war. Er spielte seine eigenen Stücke. Eine Mischung aus Klassik und Jazz. Am Flügel lehnte seine Begleitung, eine wunderschöne Frau in einem rückenfreien roten Kleid. Sie trug eine lange Kette um den Hals, die bis zum Bauchnabel reichte. Ihren linken Arm schmückte eine verchromte Dornenranke, die in die Haut eingearbeitet worden war und in einer Blüte auf der Schulter endete. Die Blätter änderten im Takt der Musik ihre Farbe. Halfred hatte sie der Bürgermeisterin als Anabelle Silk vorgestellt, die als Modedesignerin Cyberware und Biotechimplantate gestaltete.
Die Gastgeberin des Abends – Bürgermeisterin Goldberg – saß zusammen mit ihrem Mann Steven am Kopfende des Tisches.
Sie trug ein blau-rotes Kostüm, ergänzt durch einen mattweißen Stern als Anhänger. Die Farben waren bewusst ausgewählt, zeigten sie doch auf raffinierte Weise die Farben des Sternenbanners.
Goldberg stand auf, nickte Halfred zu, der zu spielen aufhörte und tippte mit dem Dessertlöffel gegen das Champagnerglas.
Die Gespräche verstummten, alle Aufmerksamkeit richtete sich auf sie. »Meine lieben Freunde«, sagte sie lächelnd. »Ich habe euch eingeladen, um euch Danke zu sagen. Danke, dass ihr mich in meinem Kampf gegen das Verbrechen in New York unterstützt und mithelft, diese Stadt wieder zu einem lebenswerten Ort machen zu wollen. Ich weiß, es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber ich bin zuversichtlich, dass wir erreichen werden, was wir uns vorgenommen haben.«
Zustimmender Applaus, den Goldberg mit einer beschwichtigenden Geste entgegennahm.
»Aber das ist es nicht allein. New York soll erst der Anfang sein. Ein Zeichen für Veränderung … zum Besseren. Für die Stadt und für unser Land.«
Fragend sahen die Gäste einander und dann Goldberg an, die ihr Champagnerglas erhoben hatte. »Auf New York, auf Amerika!«
Man prostete ihr zu und trank.
Nachdem Goldberg einen angemessen langen Augenblick gewartet hatte, fuhr sie fort: »Ich möchte mit euch über etwas sprechen, einen Gedanken … einen Wunsch, den ich schon seit geraumer Zeit mit mir herumtrage. Er betrifft unseren Präsidenten.«
Goldbergs Gäste schwiegen in gespannter Erwartung.
Sie atmete tief ein und entspannte die Hände, die sie unbeabsichtigt zu Fäusten geballt hatte. »Meine Freunde. Ich will ein Zeichen setzen, für die Einheit unseres Landes. Für den Frieden, und daher habe ich beschlossen, bei den Wahlen im nächsten Jahr gegen Präsident Stoddard anzutreten. Unser Land braucht eine Veränderung. Zwölf Jahre Stoddard sind genug. Die zurückliegenden Ereignisse haben mir gezeigt, was für ein verdammungswürdiger Mensch er ist. Er tritt alles, wofür unser großartiges Land steht, mit Füßen.
Zu lange habe ich seinen Lügen geglaubt. Als er den Weststaaten versprochen hat, sie im Kampf gegen die Dürre nicht im Stich zu lassen, habe ich ihm geglaubt. Selbst als er die Mauer bauen ließ, um uns gegen Plünderer und destruktive Elemente zu schützen, glaubte ich ihm.« Sie stellte das Champagnerglas zurück auf den Tisch. »Ich glaubte ihm sogar die fröhlichen Kindergesichter in den Flüchtlingslagern, denen er eine neue Heimat und eine neue Zukunft versprochen hatte. Inzwischen muss ich erkennen, dass er nie vorhatte, seine Versprechen einzuhalten! Ich sah nicht, was für ein Mann er ist, und vielleicht … vielleicht wollte ich es auch nicht sehen. Aber dann kam der Tag, an dem mir die Augen geöffnet wurden.« Sie rang um Fassung. »Jeder von euch erinnert sich bestimmt an die Übertragung und an Enzym 13. Erdacht von einem pervertierten System und einer Wissenschaft, die jegliche Moral verloren hat. Erinnert ihr euch an die ausgezehrten Gesichter der zum Tode Verdammten?« Sie sah von einem zum anderen. Viele nickten.
»Ich auch. Diese Gesichter verfolgen mich in der Nacht. Es sind weder die Black Guard noch LaMaar Bionetics, die die alleinige Schuld an dem tragen, was vorgefallen ist. Es ist Stoddard, der dafür die Verantwortung trägt. Wie üblich wäscht er seine Hände in Unschuld. Aber seiner Politik der Grausamkeit haben wir es zu verdanken, dass sich die Weststaaten von uns abgewendet haben und uns ein Bürgerkrieg droht. Wenn wir unser Land davor bewahren und Stoddard in seiner Machtgier aufhalten wollen, müssen wir etwas tun. Helft mir die Mauern einzureißen, die er aufgebaut hat, und reichen wir unseren Brüdern und Schwestern im Westen die Hand.« Sie sah erwartungsvoll von einem zum anderen. In vielen Gesichtern lag Skepsis, in manchen Ablehnung, in anderen Zustimmung. Goldberg ließ den kämpferischen Ton fallen und fuhr demütig fort. »Gelingt es uns, New York vom Verbrechen zu befreien, es zu einer freien Stadt zu machen, so wird es uns auch gelingen, Amerika von Ungerechtigkeit zu befreien. Aber ich werde nichts davon alleine schaffen, ich brauche euer Vertrauen, eure Freundschaft und euren Rückhalt. Kann ich auf euch zählen?«
Zuerst war da nur nachdenkliche Stille, und Goldberg spürte, wie ihr heiß wurde. Aber dann applaudierte man ihr.
»Präsidentin Goldberg!«, rief Pembroke, »sie soll hochleben. Zuerst retten wir New York, und dann treten wir Stoddard in den fetten Hintern!« Viele stimmten in den Applaus mit ein, aber nicht alle.
Goldberg entging nicht, dass ihr eigener Mann nur stumm dasaß und auf das Whiskeyglas in seinen Händen starrte. Auch Ex-Sicherheitschef Milldale klatschte nicht und verabschiedete sich kurz nach dem Ende ihrer Rede. Benice Pryde, die Vorstandsvorsitzende von Glale Aero Tank, machte ihre Verstimmung deutlich, indem sie Goldberg sagte, dass sie diese Art von Überraschungen überhaupt nicht schätze, und die Party daraufhin ebenfalls verließ.
Die anderen Gäste verbrachten den restlichen Abend damit, Nachtisch zu essen, zu reden, zu trinken und sie zu beglückwünschen. Es wurden Pläne geschmiedet und Vorschläge für das weitere Vorgehen gemacht.
Pembroke versicherte ihr, in seiner Show weiter Stimmung für ihre Kampagne gegen das Verbrechen und die Ghule zu machen. Und wenn das erledigt sei, würde er Stoddard fertigmachen. So wie er es sagte, schien ihr Vorhaben nicht schwerer zu sein, als ein Glas Scotch zu trinken.
In einem ruhigen Moment, in dem die Gespräche leiser wurden, bat die Bürgermeisterin Commissioner Stafford an ihre Seite und trat mit ihm auf den Balkon hinaus. »William, ich möchte gleich zum Punkt kommen. Die Kampagne hat nicht die Dynamik entwickelt, die ich mir erhofft habe. Die Kriminalstatistik zeigt weiter nach oben, und ich sehe keinen Trend zur Besserung.«
»Sie erwarten ein Wunder, Madam. Vor drei Monaten haben Sie Ihre Kampagne begonnen. Davor ging hier viele Jahre alles den Bach runter. Sie verlangen Unmögliches.«
»Ich erwarte auch nicht, dass alle Probleme gelöst werden können, das wäre utopisch, und das verstehe ich auch. Aber ich erwarte Erfolge, sichtbare Ergebnisse, die ich der Öffentlichkeit präsentieren kann. Sie wurden mit großzügigen Mitteln ausgestattet, William. Mit neuer Ausrüstung, neuer Technik, neuen Fahrzeugen. Aus Mitteln, die ich anderweitig streichen musste. Das hat mir viel Ärger eingebracht, den ich mich nicht umsonst ausgesetzt haben will.« Mit einem Kopfnicken wies sie in Richtung ihrer Gäste. »Denken Sie, es war einfach, diese Leute von meiner Kampagne zu überzeugen? Das war es nicht. Was glauben Sie, wird passieren, wenn ich nicht liefern kann, was ich versprochen habe?«
Stafford zögerte, und Goldberg gab die Antwort selbst. »Ich werde es Ihnen sagen. Ich werde meinen Job als Bürgermeisterin los sein, und meine Präsidentschaftskandidatur kann ich dann vergessen. Ich brauche Erfolge, William! Keine Munition, mit der Stoddard gegen mich schießen kann.« Sie verschränkte die Arme. »Verschaffen Sie mir die, oder ich finde jemanden, der es kann.«
Stafford holte tief Luft.
Goldberg sagte: »Holen Sie diese neuen Drogen von den Straßen. Blue Balls und Bleeding Bells. Das wäre schon ein guter Anfang. Ich gebe Ihnen zwei weitere Monate. Dann ist Deadline, Commissioner. Sie wissen, was das für Sie bedeutet?«
»Ja, Madam.«
»Dann haben wir uns ja verstanden.« Sie verließ den Balkon und kehrte in die Lounge zurück.
Der Morgen graute bereits, als sich die Gäste verabschiedeten und die Goldbergs die Party verließen. Ihre beiden Leibwächter, die den Korridor zur Businesslounge bewacht hatten, begleiteten sie zum Aufzug.
Als sich die Türen öffneten und Mrs Goldberg eingestiegen war, blieb ihr Mann stehen. »Ich komme nicht mit«, sagte er kühl.
Ihre Augen zuckten unmerklich. Ihre geröteten Wangen wurden blass. »Oh. Ich … hatte gehofft, wir könnten … reden. Über heute.«
»Tut mir leid. Ich bleibe, ich habe noch eine Verabredung.«
Sie nickte und wurde wütend. Doch statt ihn zu beschimpfen, trat sie nah an ihn heran und sagte: »Lass dich nicht bei deiner ›Verabredung‹ erwischen. Ich lasse nicht zu, dass du meine Karriere ruinierst.«
Er grinste herablassend. »Eine aufstrebende Politikerin mit Eheproblemen. Wie würde das denn aussehen? Du brauchst mich.«
Ihre Hand schoss vor und gab ihm eine Ohrfeige. »Sei dir da nicht so sicher.« Sie trat in den Aufzug zurück.
»Parkdeck 186«, sagte die Leibwächterin, und sie fuhren nach oben.
»Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Mam?«
»Ja, Bonny. Alles bestens.« Goldberg betrachtete sich in ihrem Taschenspiegel und tupfte sich die Tränen weg, die das Mascara verschmiert hatten. Als sie fertig war, sah sie auf ihr blau-rotes Kleid. »Genug von der Flaggenparade. Mir ist gerade nicht nach Patriotismus.« Sie tippte auf den Stern. Die leuchtenden Farben ihres Kleides verblassten und veränderten sich in ein gleichfarbiges tiefdunkles Grün. Ihre Lieblingsfarbe.
Auf Parkebene 186 standen nur drei Air Cs geparkt.
Die beiden schwarz lackierten, auf deren Heck der dezente Schriftzug Monterey stand, gehörten zum Service für Businessgäste mit Exklusivstatus.
Das dritte Air C war das der Bürgermeisterin. Ein Coldstream AV8 in Silber und Grün mit getönten Scheiben und Flügeltüren.
»Warten Sie bitte hier«, sagte der zweite Leibwächter, der Tom Dayly hieß. Er zog einen portablen Datadice aus der Tasche und aktivierte das Security-Protokoll des Coldstream.
Die Bordsensoren checkten die Maschine auf Sprengsätze, Tracker, eingespeiste Schadsoftware und allgemeine Funktionalität der Systeme. »Alles sauber. Wir können einsteigen.«
Das Innere des Coldstream war geräumig und edel. Die Lichtstärke betrug vierzig Prozent, die Ledersitze waren auf angenehme zwanzig Grad vorgewärmt worden. Eine männliche Cis-Einheit begrüßte die Bürgermeisterin. Hatten Sie einen angenehmen Abend?, fragte die Kunststimme.
»Danke, Roy. Ja. Es ist gut gelaufen.«
Haben Sie einen Wunsch? Musik oder einen Drink vielleicht?
»Einen Drink. Wodka, zwei Würfel Eis. Bonny? Sie auch?«
»Sie wissen doch, ich trinke nicht, Mam.«
Zwei Eiswürfel klirrten ins Glas, der Wodka floss kristallklar darüber. »Entschuldigen Sie, das hatte ich vergessen.«
Tom hatte hinter dem Steuer Platz genommen und ließ nun die getönte Zwischenscheibe herunter. »Nach Hause, Madam, oder wollen Sie irgendwo anders hin?«
Goldberg hielt sich das kalte Glas an die Stirn. »Nach Hause, Tom. Ich bin müde.«
Tom fuhr die Zwischenscheibe wieder hoch und startete die Maschine. Mehr als ein Schnurren war nicht zu hören, mehr als ein leichtes Vibrieren nicht zu spüren.
Sie hoben ab und flogen los.
Goldberg und Bonny saßen sich schweigend gegenüber. Sie sahen aus dem Fenster auf die erwachende Stadt. Unter ihnen schimmerten die bunten Lichter der Straßen und die dezent erleuchteten Schaufenster der Luxusgeschäfte, die ihre Kunden nicht mit grellen Hologrammen locken mussten.
Vereinzelte Autos fuhren auf den breiten Straßen. In den Wohnungen gingen Lichter an und beleuchteten die Schemen ihrer Bewohner hinter zugezogenen Vorhängen.
An den Downtown Landing Ports standen die Werbezeppeline nebeneinander aufgereiht wie Zigarren in einer Holzkiste. Gewaltige Taue hielten sie am Boden.
»Sie muten sich zu viel zu, Mam«, durchbrach Bonny das Schweigen.
Goldberg lächelte matt. »Ich hatte auch gedacht, ich müsste das alles nicht alleine durchstehen.«
»Sie meinen Ihren Mann?«
»Haben Sie sich schon mal in einem Menschen geirrt?«, fragte Goldberg, ohne Bonny dabei anzusehen.
»Ja, Mam. Ich glaube, wer sich noch nie in jemandem getäuscht hat, lügt.«
»Ja, das ist wohl so. Ich hätte mich scheiden lassen sollen, als es noch möglich war.« Nachdenklich fuhr sie mit dem Zeigfinger über den Rand des Glases. »Dem Ganzen ein Ende machen.«
»Das können Sie immer noch, Mam.«
»Nein, ich fürchte, den Zeitpunkt habe ich verpasst. Ich will für das Präsidentenamt kandidieren, da käme mich eine Scheidung teuer zu stehen. Steven hat recht. Es wird so weitergehen wie bisher. Er wird in der Öffentlichkeit den Ehemann spielen, und ich werde dazu lächeln und seine Eskapaden decken.«
»Verzeihen Sie, wenn ich so offen zu Ihnen spreche, aber er demütigt Sie. Wenn Sie keine Scheidung wollen, gäbe es andere Optionen.«
Goldberg hatte die Schuhe ausgezogen und die Beine angewinkelt. Gedankenverloren massierte sie sich die Zehenspitzen. »Ihn umbringen lassen. Ist es das, was Sie meinen?«
Bonny erwiderte nur reglos ihren Blick.
»Reizvoller Gedanke.« Dann lächelte sie und zeigte damit, wie absurd ihr die Idee vorkam. »Nein, das würde ich doch nicht übers Herz bringen.« Sie schüttete den Wodka in sich hinein und stellte das Glas beiseite. »Wer war es bei Ihnen, Bonny. Wer hat Ihnen wehgetan?«
»Das war Jane.«
»Jane Capriso?«
Bonny nickte.
»Miss Capriso war es doch, die Sie mir empfohlen hat.«
»Sie wollte wohl irgendwas gutmachen. Aber das wäre nicht nötig gewesen. Sie schuldet mir gar nichts. Ist lange her, dass wir was miteinander hatten. Hat nicht geklappt. Ist vergessen.«
»Und trotzdem ist Ihnen gleich ihr Name eingefallen.«
Bonny sah ertappt aus. Sie hielt den Mund und starrte auf den Boden.
Tom meldete sich aus dem Cockpit. »Die Security Scanner zeigen was an. Wir werden verfolgt. Ich schalte es dir rein, Bonny.« In dem Freiraum zwischen den Sitzen erschien ein dreidimensionales Abbild der Umgebung. Ein Fadenkreuz hatte sich auf ein Objekt gerichtet, das ihnen unzweifelhaft folgte.
Da es noch nicht identifiziert war, markierten die Scanner es als schlichten Würfel, der sich schnell näherte.
»Was sagst du?«, hörte sie Tom fragen.
»Kriegst du es genauer rein?«
»Leider nicht. Ich schätze, das Ding hat eine Phantom-Lackierung. Besser geht’s nicht.«
»Dann ist es nichts Harmloses. Los, flieg schneller!«
Die Turbinen heulten auf. Tom beschleunigte und jagte den Coldstream um eines der nahen Hochhäuser.
Bonny zog ihre Pistole, während sie sich mit der anderen Hand anschnallte. »Mam. Anschnallen.« Da war ein angespannter Zug um ihre Mundwinkel, der Goldberg dazu brachte, widerspruchslos zu tun, was ihr gesagt wurde.
Bonny öffnete das Seitenfenster und streckte den Kopf raus. Ihre künstlichen Augen schalteten auf Kontrast und Zoom. Das lange rote Haar trug sie zu einem engen Zopf geflochten, der sie bei der Arbeit nicht störte und der ihr jetzt nicht die Sicht nahm. »Da ist es.« Sie hielt die Augen starr auf den Verfolger gerichtet, die Iris fokussierte sich. War die Ansicht zunächst noch rot, wurde sie grün, nachdem das Objekt in dem Datenchip in ihrem Kopf gefunden und identifiziert worden war. »Assassinendrohne.«
»Verfickte Scheiße«, war Toms Antwort, der gleich noch etwas schneller flog.
Die Drohne war so groß wie eine Reisetasche, in der sie auch bevorzugt transportiert wurde, was ihr den Spitznamen Bagage Killer eingebracht hatte.
Sie war schnell, sehr schnell. Sie hatte keine Schwierigkeiten, an dem Air C dranzubleiben und weiter aufzuholen.
Bonny schaltete die Augen auf Zielsystem um und verlinkte sich mit der Waffe in der Hand. »Panzerbrechend«, sagte sie, und die Pistole wechselte automatisch auf das kleinere Extramagazin. Pb geladen, erklang eine computergenerierte Stimme.
Die Drohne tanzte durch das Fadenkreuz von links nach rechts.
»Da kommen noch zwei!«, hörte sie Tom aufgeregt rufen.
Bonny ließ sich nicht beirren, behielt die erste Drohne im Blick und ließ Hand und Auge zu einer Einheit verschmelzen. Fünfzig Meter, vierzig Meter.
»Festhalten!« Im gleichen Moment kippte Tom das Air C zur Seite, machte eine Rolle und ging in den Sturzflug.
Annäherungsalarm, schrillte es aus den Lautsprechern. Das Wodkaglas war an die Decke geknallt und zerbrochen.
Bonny hatte ihren Schuss verrissen. Aus dem Augenwinkel sah sie die beiden anderen Drohnen, die knapp am Air C vorbeijagten.
Die Pistole lud eine weitere Patrone in den Mechanismus.
Jetzt nahm Bonnys Optik drei Ziele wahr, die hinter ihnen her waren.
Sie wartete, bis Tom das Air C wieder in eine waagerechte Position gebracht hatte, zielte erneut und drückte ab.
Diesmal traf das Projektil. Es durchschlug die Kameraoptik und zerfetzte das Innenleben. Die Drohne trudelte ab und stürzte in die trüben Fluten des East River.
Der Coldstream jagte unter der Brooklyn Bridge hindurch.
Bonny gab zwei weitere Schüsse ab, denen die Drohnen aber mit flinken Zickzackmanövern ausweichen konnten.
Goldberg klammerte sich an ihrem Sitz fest. Das zersplitterte Glas hatte eine blutige Schramme auf ihrer Wange hinterlassen. Sie war blass vor Entsetzen, aber niemand, der panisch wurde.
Tom flog eine scharfe Kurve, nachdem sie die Brooklyn Bridge passiert hatten, und kehrte mit maximalem Schub in die Innenstadt zurück. Zwischen den Southbridge Towern hindurch versuchte er die Drohnen abzuhängen. Erfolglos, sie blieben dran. Aus einer fuhr der Lauf einer Maschinenpistole heraus, die sofort feuerte. Bonny ließ sich ins Innere des Wagens zurückfallen und machte sich auf dem Sitz ganz klein, als die Salve am gepanzerten Chassis abprallte. Zwei Kugeln fanden ihren Weg durch das geöffnete Fenster und zerschlugen die Trennscheibe zwischen Cockpit und Font.
»Verflucht noch mal!«, schimpfte Tom, der vor Schreck das Steuer verrissen hatte und die Maschine damit ins Trudeln brachte.
Für Bonny war es unmöglich zu zielen und für die Drohne unmöglich zu treffen.
Dann endlich hatte Tom den Coldstream wieder unter Kontrolle gebracht.
Bonny kam aus der Deckung und gab zwei schnelle Schüsse auf die MG-Drohne ab. Der erste verfehlte, der zweite nicht. Die Drohne fiel wie ein Stein vom Himmel und krachte irgendwo zwischen Lafayette und Worth Street auf ein Dach.
Eine noch übrig, die heranjagte und dicht hinter ihnen war. Dünne Krallenbeinchen fuhren an der Unterseite aus dem mattschwarzen Gehäuse.
Der Wind zerrte an Bonny. »Wie viele Schuss noch?«, fragte sie, und der Computer in ihrer Pistole antwortete: Zwei.
Bonny wusste, die mussten sitzen, mit der normalen Munition würde sie die Panzerung nicht durchdringen können.
Die Optik in ihren Augen zählte die Distanz zum Ziel. 50, 40, 30.
»Tom. Ruhig halten. Keine hektischen Manöver.«
»Aber dann krachen wir …«
»Das war keine Bitte!«, herrschte sie ihn an.
In dem Moment, in dem sie abdrückte, riss er die Maschine doch nach oben.
»Scheiße! Tom! Ich hab gesagt …«
»Es ging nicht anders!«, fuhr er dazwischen.
Unter ihnen raste der Schnellzug der West Side Monorail vorbei.
Die Drohne war nun knapp hinter ihnen. Die dürren Beine zuckten wie die einer Kakerlake, die auf dem Rücken lag. Das rote Kameraauge schien Bonny anzustarren, während sie zurückstarrte, zielte und abdrückte.
Die Kugel traf über dem Kameraauge ins Gehäuse. Funken spritzten aus dem unscheinbaren Loch. Die Drohne schlingerte in der Luft, schaffte es aber noch bis zum Heck der Coldstream und explodierte in einem grellen Feuerball, der das Air C umhüllte und es wie eine gewaltige Faust nach vorn schleuderte.
Bonny wurde durch die Wucht in den Sitz zurückgeworfen.
Trotz des schrillen Pfeifens in den Ohren konnte sie Tom fluchen hören. Er kämpfte mit der trudelnden Maschine, die Richtung Hudson abstürzte. Im Cockpit blitzten elektrische Entladungen. Rote Warnlampen blinkten hektisch.
Plötzlich hörte es auf. Der Flug stabilisierte sich. Tom hatte den Coldstream wieder unter Kontrolle gebracht, ehe sie auf dem Hudson aufgeschlagen wären. »Okay, okay, okay. Ich hab’s im Griff.« Seine Stimme vibrierte vor Adrenalin.
Bonny fuhr das Seitenfenster hoch und tastete mit der Hand nach Bürgermeisterin Goldberg.
Sie rührte sich nicht.
»Mam?« Bonny schüttelte sie. »Mam!«
Goldberg schrak auf und blinzelte verwirrt.
»Geht’s Ihnen gut, Mam?«
Sie rieb sich den Hinterkopf. »Ich glaube schon.« An den Fingern klebte Blut. »Ich habe mir wohl den Kopf angeschlagen.«
»Ja. Und einen kleinen Schnitt im Gesicht. Ich kümmere mich darum.«
»Das war knapp. Fast hätten die uns erwischt. Was unternehmen wir jetzt?«, fragte Tom.
»Kehren Sie um, und sammeln Sie die Überreste der Drohne ein.«
»Und dann, Madam?«
»Gar nichts. Wir fliegen nach Hause, und Sie werden den Coldstream reparieren lassen.«
»Wir tun so, als wäre das alles gerade nicht geschehen?« Bonny warf ihr einen zweifelnden Blick zu. »Ist das Ihr Ernst, Mam?«
»Mein voller Ernst. Das Bündnis mit meinen Unterstützern ist fragil. Was denken Sie, wird passieren, wenn bekannt würde, dass am gleichen Abend, an dem ich meine Präsidentschaftskandidatur bekannt gebe, ein Anschlag auf mich verübt wird?«
»Die Leute würden es mit der Angst zu tun bekommen und vielleicht abspringen.«
»Sie haben es genau erfasst, Bonny.«
Bonny hatte inzwischen das Eisgel auf die Wunde gesprüht, das den Blutfluss stoppte. »Wer immer das war. Er wird es wieder versuchen. Das ist Ihnen klar, oder?«
»Ja, das ist mir klar. Und ich habe nicht vor, die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu warten, dass es passiert.« Goldberg machte ein entschlossenes Gesicht. »Ich habe eine Aufgabe für Sie. Finden Sie den Attentäter, und bringen Sie in Erfahrung, wer ihn angeheuert hat. Aber diskret, versteht sich.«
Die sonst so selbstsichere Bonny Greeco druckste herum. »Das kann ich nicht. Ich bin kein Cop mehr. Wieso geben Sie Tom nicht den Job?«
»Tom ist gut, aber Sie sind besser.«
»Das habe ich gehört.«
»Nichts für ungut«, sagte Goldberg und wandte sich wieder Bonny zu. »Sie haben Kontakte, die sicher hilfreich sind. Nutzen Sie sie.«
»Kontakte?« Bonny ging ein Licht auf. »Oh nein, Mam. Nicht Jane.«
»Ich vertraue Sergeant Capriso. Und wie Sie selbst eben sagten, es ist lange her. Außerdem wurde das Departement for Special Operations großzügig von mir unterstützt. Captain Kirkland schuldet mir also mindestens einen Gefallen.« Goldberg nahm Bonnys Hand und drückte sie. »Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Vergessen Sie, was zwischen Ihnen und Miss Capriso war.«
Vergessen? Das konnte sie nicht. Bonny lehnte sich seufzend zurück und legte nachdenklich eine Hand an ihre Schläfe, obwohl sie wusste, dass sie nachgeben würde. »Okay, ich mach’s.« Ihr Zögern hatte nicht lange gedauert.
Sie war gerade erst knapp dem Tod entronnen, und doch war da in ihren Gedanken nur Platz für Jane. Ihr letztes Gespräch kam ihr in den Sinn, die Art, wie sie sich getrennt hatten, und wie scheiße sie sich danach gefühlt hatte.
Sie war immer noch wütend auf Jane, ganz egal wie sehr sie auch versuchte, sich das Gegenteil einzureden.
Miami
Einen Tag später …
Miami war zur Lagunenstadt geworden. Es war ein schleichender, aber absehbarer Prozess gewesen, der den Meeresspiegel hatte ansteigen lassen. Die Everglades waren Vergangenheit.
Cape Canaveral war verschwunden. Und trotzdem hatte Miami überlebt und sich den neuen Gegebenheiten angepasst und das Beste daraus gemacht.
Während Europas Venedig in den Fluten des Mittelmeeres wie ein modernes Atlantis versunken war, blühte Miami auf. Venice of the South nannten es die Werbestrategen neuerdings.
Durch künstliche Riffe, die sich der Wildheit des Atlantiks entgegenstellten, und kilometerlange Betonbarrieren, die wie übergroße Sandkästen mit schneeweißem Sand gefüllt worden waren, hatten die Planer ein Paradies für Urlauber erschaffen. Autos waren gänzlich aus dem Stadtbild verschwunden, und Boote hatten ihren Platz eingenommen.
Am Strand des Three Palms Hotels tummelten sich die Badegäste. Kinder spielten im flachen Wasser, das angenehme Badewannentemperatur hatte. An der Bar gab es Cocktails mit Schirmchen.
Eine Bikinischönheit mit makellosem Gesicht und schwarzem Haar lehnte an der Bar und wartete auf die beiden Wild Waves, die der Barkeeper für sie mixte.
Der Wind spielte mit ihrer langen Mähne, die Sonne fing sich in dem Bauchkettchen, das sie trug. Sie genoss die warme Brise, die ihr angenehm die nackte Haut streichelte. Eine Hand legte sich von hinten um ihre Hüften, und warme Lippen küssten ihre Schultern.
»Hey, Darling«, hauchte sie und wandte sich ihrem Mann zu. Er war größer als sie, kräftig, aber nicht sehr muskulös. Er trug ein offenes Hawaiihemd mit blauen und roten Papageien, dazu zitronengelbe Shorts.
Seine Lippen berührten ihre Schulter ein weiteres Mal, bevor er den romantischen Moment zerstörte, als er die Hände von ihr ließ und sich neben sie an die Bar stellte.
Sie sah ihm an, dass etwas passiert war. »Was ist los?«
»Edge hat sich gemeldet. Unser alter Freund hat ihn kontaktiert. Er hat was Neues für uns«, flüsterte er und wies auf seine teure Comwatch.
Ihr Lächeln und die zufriedene Stimmung verschwanden. »Was ist drin?«
»Alles in allem achtzigtausend. Abzüglich der zwanzig Prozent für Edge.«
»Und wo?«
»New York.«
»Wann?«
»Unverzüglich.«
Sie rümpfte die Nase. »Aber was ist mit unserem Urlaub?«
»Den holen wir nach. Die Sache sollten wir uns wirklich nicht entgehen lassen. Außerdem schulden wir ihm das.«
Sie wandte sich ihm zu, legte die Arme um seinen Hals und stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihm gerade in die Augen sehen zu können. »Und was ist mit Cocktails, schwimmen gehen und Sex haben?« Sie zwinkerte ihm zu und gab ihm einen leidenschaftlichen Zungenkuss.
Als sie sich von ihm löste, lächelte er, was seltsam steif wirkte. »Du kannst wirklich sehr überzeugend sein, Bee. Aber … sag Ja. Okay?«
Gläser klirrten auf dem Tresen, als der Barkeeper ihnen ihre Cocktails servierte.
»Also schön.« Sie seufzte. »Sag Edge, wir sind einverstanden. Wir kommen nach New York, aber erst … wenn wir unseren Cocktail getrunken haben.«
Sie lächelten sich an, probierten ihre Drinks und küssten sich.
Manhattan
Regen und nasse Schneeflocken rannen an den Scheiben der alten Honda-Zero-Limousine hinab, die vor einem ausgebrannten Geschäft für gebrauchte Cyberware geparkt stand. Es war spät, kurz nach drei Uhr am Morgen. Die wenigen Straßenlaternen, die noch funktionierten, waren gedimmt worden. Das Licht war schwach und erreichte kaum die menschenleere Straße.
Vor dem ausgebrannten Laden stapelten sich Trümmer und Mülltüten, in denen Ratten nach Fressbarem suchten. Es raschelte, knackte und huschte.
Die beiden Männer im Wagen achteten kaum darauf. Sie warteten schon seit einer Stunde, deren Minuten sich ewig zogen.
Beide waren blass und ausgezehrt. Einer hatte unruhige Hände, die eine Melodie trommelten, die nur er hören konnte. Der andere hatte ein nervöses Augenzucken.
Im Wagen roch es nach Schweiß und kaltem Zigarettenrauch, dem ein Hauch von Blaubeere anhaftete.
»Wann geht’s denn endlich los?«, fragte der Beifahrer. Er schmierte mit dem Zeigefinger über die Scheibe und folgte damit dem Lauf eines Regentropfens.
»Fuck!« Sein Kumpel verdrehte die Augen. »Wir warten auf das Zeichen, kapierst du das jetzt endlich? Reiß dich zusammen!«
Eine Antwort, die der andere nicht hören wollte. Seine Beine begannen zu zucken. »Scheiß Warterei. Ich halt’s nicht mehr aus. Ich brauch jetzt was.« Noch während er sprach, krempelte er sich den linken Ärmel hoch. Tiefe Schnitte hatten die Haut vernarbt. Manche waren entzündet, andere frisch verschorft.
»Muss’n das jetzt sein?«, fragte der Fahrer.
»Ja, muss sein.«
»Hey, wenn du das heute versaust, war’s das mit unserer Partnerschaft.«
Der andere grinste blöd. »Ich versau’s nicht. Ich schwör’s dir.« Er kramte eine schmale Glasampulle aus der Brusttasche und brach sie an der Sollbruststelle in zwei Stücke. Der obere Teil hatte eine äußerst scharfe Kante, mit der er sich in den linken Unterarm schnitt. Es begann sofort zu bluten, während er den Inhalt der Ampulle in die Wunde träufelte.
Er stöhnte, wohlig und zufrieden.
Sein Kumpel hielt den Blick starr auf den Eingang des Jimmy Dee-Nightclubs gerichtet, der hundert Meter die Straße hinauf lag.
Die haushohen Neonröhren mit dem Jimmy Dee-Schriftzug waren ausgeschaltet, ebenso die Hologramme nackter Mädchen, die üblicherweise auf dem Bürgersteig tanzten.
Davor stand ein goldfarbenes Air C geparkt. Ein Reaper-Typhon. Luxusvariante. An dem Ding war alles teuer, und es passte so gar nicht in diese Gegend.
»Hey, ist dir eigentlich klar, was is’, wenn wir das hier sauber über die Bühne bringen?« Der Fahrer lachte. »Dann fliegen wir auch so was. Fuck, dann haben wir’s endlich geschafft. Geld, Weiber, die besten Drinks und gutes Zeug, nicht mehr diesen Dreck da.« Mit einer abfälligen Geste wies er auf die Ampulle, die seinem Kumpel zwischen den Fingern klemmte »Ha! Kannst du dir das vorstellen? Ich als Manager eines Nachtclubs und du als mein Partner. Fucking Shit, das wird great.«
»Wir werden Könige sein«, stimmte der andere zu. Die Lider flatterten nicht mehr. Er fühlte sich stark und gut und unfassbar cool. Mit der künstlichen Hand berührte er die Maschinenpistole, die in seinem Schoß lag. Die Servos in den Fingern surrten leise, als er fast zärtlich über das kalte Metall strich.
Über dem Eingang zum Jimmy Dee sprang eine der Neonröhren an. Endlich. Das vereinbarte Zeichen.
»Fuck, es geht los. Zieh die Maske auf. Los, mach schon, du Mudhead.« Die beiden schnappten sich die Masken, die sie zwischen die Sitze geklemmt hatten, und streiften sie sich über. Sie waren aus Hartplastik, schwarz und glatt. Ein enges Gitter verbarg Mund und Nase.
Dann startete der Fahrer den Motor, der blubbernd ansprang, ließ die Seitenfenster runter und fuhr langsam los. Er lenkte mit der rechten Hand und entsicherte mit der linken die Maschinenpistole, die in seinem Schoß lag. Die schwarze Beschichtung war abgegriffen, an den Kanten schimmerte gräuliches Metall.
Fünfzig Meter bis zum Jimmy Dee. Das Licht im Wagen blieb aus, die Scheinwerfer auch. Die Neonröhre über dem Eingang war ebenfalls wieder verloschen.
»Was’n jetzt mit meinen Augen los? Ich seh doppelt«, sagte der Beifahrer.
»Mach jetzt keinen Scheiß, reiß dich zusammen«, blaffte der Fahrer, der das Lenkrad so fest umklammerte, dass das Plastik knackte. »Hast du die Scheißknarre entsichert?«
»Klar, denkst du, ich bin bescheuert, oder was?«
Keine Antwort.
Dreißig Meter.
Die Doppeltüren zum Jimmy Dee öffneten sich, und vier Personen traten ins Freie. Zwei Männer, zwei Frauen.
Die Frauen waren gut gekleidete Schönheiten, einer der Kerle war ein Bodyguard. Groß, breit, perfekt sitzender Anzug, grimmiger Blick.
Der zweite Mann war Jimmy Dee persönlich. Schlank, Pferdeschwanz, schönheitsoperiertes Gesicht mit funkelnden Kunstaugen. In den goldglänzenden Händen qualmte eine Zigarette.
Wie von Geisterhand öffnete sich die breite Seitentür des Reaper-Typhon. Die Frauen verabschiedeten sich.
Der maskierte Fahrer trat jetzt aufs Gas. Zwanzig Meter, zehn Meter, gleichzeitig lehnte sich sein Beifahrer aus dem Fenster und eröffnete das Feuer. Er zielte nicht, hielt einfach den Finger am Abzug. Der Rückstoß war minimal. Die Überraschung gelang.
Jimmy Dee wurde in die Brust getroffen, warf die Hände in die Luft, taumelte gegen die Wand und stürzte. Der Bodyguard kam gerade noch dazu, seine Waffe zu ziehen, als er von einer Garbe niedergestreckt wurde.
Nun trat der Fahrer auf die Bremse, auf Höhe des Jimmy Dee kam der Wagen mit quietschenden Reifen zum Halt.
Er stieß die Tür auf, riss die Waffe hoch und begann ebenfalls zu schießen.
Eine der Frauen versuchte sich in den Wagen zu flüchten, die andere schrie panisch und wollte in den Club zurück. Sie verlor einen ihrer Schuhe und stolperte. Zwei Kugeln trafen sie in den Rücken. Sie fiel auf die Knie. Ihre Hand verkrallte sich um den verchromten Türgriff, da durchschlug ein weiteres Projektil ihren Hals. Sie spuckte Blut, gab der Tür einen Stoß und blieb dann reglos im Durchgang liegen.
Die zweite Frau war in Brust und Bauch getroffen worden.
Sie war vor dem Nobel-Air-C zusammengebrochen. Verzweifelt versuchte sie sich aufzurichten und sich den letzten Meter in das rettende Innere des Air Cs zu flüchten. Da fiel ein Schatten auf sie.
Sie hob den Kopf und starrte mit ihren schönen blauen Augen in den glühenden Lauf der Waffe, die der Schatten auf ihren Kopf richtete. Der Moment schien einzufrieren, bevor er den Finger krümmte und abdrückte.
***
In dem kleinen Diner in der 10th Straße war nichts los. Die Uhr über dem Tresen tickerte langsam auf halb vier zu.
Es roch nach zu heiß gewordenem Kaffee und langsam erkaltendem Fett, in dem ein einsamer Double-Ant Donut schwamm.
An einer Wand hing ein großes TV-Panel, über das die übliche Nachtwerbung flimmerte. Viel nackte Haut, die der Fantasie keinen Raum ließ, unterbrochen von Werbung für das neue Sturmgewehr Dekker M8 und den brandaktuellen Trailern zu den 3-D-Holo-Shows auf dem Broadway.
Detective Mike Quillan sah gar nicht hin. Er hatte die Beine auf der Bank ausgestreckt und lehnte müde mit dem Kopf an der Fensterscheibe. Drei Stunden noch, dann konnte er endlich in sein Bett.
Jane Capriso, die alle nur Liberty nannten, saß ihm gegenüber und rührte mit dem Bambusstäbchen in ihrem Becher, bis der Milchersatz schaumig über den Rand quoll. Neben dem Becher lagen ein Pappteller mit ein paar Krümeln ihres Cockroach Donuts mit Zuckerperlen und eine zerknüllte Serviette.
Quillan sah Liberty an. Er kannte sie jetzt fast ein Jahr, in der Zeit hatte sie so oft die Haarfarbe gewechselt wie andere ihre Klamotten. Aber an das grelle Pink mit den hellblauen Strähnchen hatte er sich immer noch nicht gewöhnen können.
Quillan schwang die Beine von der Bank und winkte der Bedienung, die sich konzentriert die Nägel lackierte. »Susan, könnte ich noch einen Kaffee bekommen?«, rief er ihr zu.
Die Frau machte eine säuerliche Miene, schlurfte dann aber um den Tresen herum und füllte seine Tasse nach. »Kann ich dir auch noch was bringen, Libby Schatz?«, fragte sie.
Liberty winkte ab. »Danke, Susan. Mir reicht der Kaffee.«
»Harte Nacht gehabt?«, hakte Susan nach.
»Nein, eigentlich nicht. War ruhig. Aber sechs Tage hintereinander die Nachtschichten. Da bleibt was hängen.«
Susan schmunzelte. »Du siehst immer noch toll aus. Was man von dir nicht gerade sagen kann, Mike.« Sie zwinkerte Liberty verschwörerisch zu, bevor sie lächelnd zu ihren Lackierarbeiten zurückkehrte.
Quillan warf ihr einen düsteren Blick hinterher, nahm seinen Becher, nippte daran und sah aus dem Fenster. Den Regen nahm er schon gar nicht mehr wahr, so oft kam der runter, aber die Schneeflocken dazwischen waren selten. Er sah ihnen beim Fallen zu. Kaltwetterfront aus dem Norden, hatte er im Wetterbericht gehört. Schnee im Mai. So ungewöhnlich war das inzwischen nicht mehr. Auf der Straße spiegelte sich der rot-gelbe Schriftzug des Diners. John & Joakes, Original American Diner. 24 hours.
Seit er beim D.S.O. war, kam er jetzt schon regelmäßig hierher und hatte immer noch nicht rausgefunden, wer John oder Joakes waren.
»Hey, sieh mal.« Liberty stieß ihn an und wies auf das TV-Panel an der Wand. »Susan. Machst du mal lauter?«
Susan schaltete den Ton an. Quillan drehte sich um.
Ein Nachrichtensprecher schaute mit versteinerter Miene in die Kamera. Neben ihm eingeblendet schwebte das Hologrammporträt eines alten Mannes mit schütterem grauem Haar und fleckiger Haut. Darunter der Name Henry Berlitz und ein Datum: 14. Mai 2059.
Der Nachrichtensprecher sah bedeutungsschwer in die Kamera. »Wie die Pressestelle der Black Guard Security Association gerade bekannt gab, ist ihr Gründer Henry Berlitz heute friedlich in seinem Domizil auf Staten Island eingeschlafen. Er wurde neunundachtzig Jahre alt.
Mit Henry Berlitz verlieren die Vereinigten Staaten einen großen Mann, der sein Leben der Sicherheit Amerikas und seiner Bürger gewidmet hatte.«
Quillan hätte sich beinahe verschluckt. Zu frisch waren noch die Erinnerungen an seinen Kampf mit den Black-Guard-Soldaten und Miss Arys, diesem Engel des Todes, der Emilia auf dem Gewissen hatte. Und ihn hatte sie auch fast umgebracht.
Der Nachrichtensprecher fuhr fort: »Präsident Stoddard ließ in einer ersten Stellungnahme vermelden, dass das Land mit Henry Berlitz einen wahren Patrioten verloren habe, der aber durch seine Arbeit und seinen Willen zur Veränderung weiterleben würde. Er bedauere Henry Berlitz’ Tod zutiefst, der nicht nur ein treuer Freund, sondern auch ein moralischer Pfeiler im Kampf gegen Terrorismus und Verbrechen gewesen sei.«
Quillan schnaubte verächtlich. »Und die Leute glauben das auch noch. Susan, schalt das bitte aus, sonst muss ich kotzen.«
Susan tat ihm den Gefallen.
»Dieses Arschloch«, knurrte Quillan.
»Wer?«, fragte Liberty. »Stoddard oder Berlitz.«
»Gibt es da einen Unterschied?«
Sie zuckte die Schultern. »Wohl nicht. Aber was solls? Er ist tot. Einer weniger. In ein paar Wochen haben ihn die Leute vergessen.«
»Das ändert gar nichts. Sein Nachfolger bindet sich bestimmt schon die Krawatte um, und dann geht die ganze Scheiße wieder von vorne los.«
»Ich hab jetzt keine Lust über Politik zu reden. Reden wir lieber darüber, was wir machen, wenn die Schicht vorbei ist.« Sie zwinkerte ihm vielsagend zu.
Er wusste, was sie hören wollte. Dass er Lust darauf hatte, mit ihr in die Kiste zu springen. Und eine ganze Weile hatte er gedacht, dass er das auch wollte und dass es okay sei.
Inzwischen war er sich da nicht mehr so sicher. Sie hatten nichts Festes. Liberty traf sich auch mit anderen: Männern, Frauen, egal. Für sie war es nur Spaß und Ablenkung vom Job. Quillan war enttäuscht. Er hatte gedacht, zwischen ihnen sei mehr nach dem, was sie zusammen durchgemacht hatten. Aber den Zahn hatte sie ihm schnell gezogen. Keine Beziehung, das mache die Sache nur kompliziert, hatte sie ihm mal gesagt. War noch gar nicht so lange her. Das hatte was kaputt gemacht. Bei ihm, nicht bei ihr. Sie war immer noch dieselbe.
»Also was ist? Ich hab ein neues Tattoo. Wenn du nachher mit zu mir kommst, darfst du es suchen.«
»Tut mir leid, Lib. Heute nicht. Ich will einfach mal durchschlafen.« Die Entschuldigung klang lahm.
Die Abfuhr ließ Liberty stutzen. »Oh … okay. Dann ein anderes Mal.« Sie stand auf. »Lass uns weitermachen.« Sie hatte ihren Schaumkaffee nicht einmal angerührt, als sie das Diner verließ und zu dem Chevy Air C ging, das auf der Straße geparkt stand.
Quillan wollte ihr nachgehen.
»Hey, Mike. Hast du nicht was vergessen?«, rief Susan ihm nach. »Macht vier E-Dollar.«
Er bezahlte, gab fünf.
»Bleib sauber«, sagte sie.
»Du auch.« Dann ging er hinaus und stieg zu Liberty in den Air C. Er schnallte sich an. Er hatte ihren Flugstil fürchten und damit umzugehen gelernt.
Mit einem Knopfdruck startete sie die Turbinen. Die Cockpitbeleuchtung sprang an. Der Höhenmesser zeigte null, die Turbinenanzeige fünfzig Prozent Leistung, schnell steigend.
Liberty erhöhte den Schub. Wasser verwirbelte auf der Straße. Die Scheibenwischer sprangen an.
Sie hoben ab, und Liberty schraubte das Air C in den nächtlichen Himmel.
Aus den Lautsprechern drangen verzerrte Funksignale.
Der Regen klatschte auf Dach und Windschutzscheibe.
Quillans Blick fiel auf das vergilbte und abgegriffene Foto, das Liberty zwischen die Belüftungsschlitze geklemmt hatte.
Darauf waren sie und ihr Bruder Warren zu sehen. Lachend und Arm in Arm. Da waren sie noch Kinder gewesen. Trotzdem hatte er Liberty in dem jungen Gesicht gleich erkannt.
Am Rückspiegel baumelten ein paar antiquierte Handschellen, für die man noch einen Schlüssel brauchte.
Sie flogen ohne Ziel zwischen den Hochhäusern entlang und vorbei an gigantischen Werbetafeln, die ihre grellen Botschaften in die Nacht spien.
Liberty steuerte das Air C über den East River, auf dem sich die Lichter der Stadt spiegelten. Liberty liebte die Nacht, das wusste er. Wir schweben auf einem Strom aus Licht, hatte sie das mal genannt und ganz verträumt ausgesehen.
Jetzt schwieg sie.
»Ist alles okay?«, fragte er schließlich, weil er ihre Stille nicht mehr aushielt.
»Ja, alles klar.« Liberty starrte geradeaus.
»Wenn du sauer bist … dann …«
»Warum soll ich sauer sein?«, unterbrach sie ihn. »Wegen eben?«
»Ja.«
»Mach jetzt nicht so ein Drama draus. Wenn du nicht ficken willst, ist das okay für mich.«
»Du findest schon jemand anderen«, sagte er bissig und etwas zu schnell.
Sie funkelte ihn an. »Willst du heute mit mir streiten, oder was?«
»Echo 4, hier spricht Echo 6«, klang es aus dem Lautsprecher und kam Quillans Antwort damit zuvor.
»Lib, kannst du mich hören?« Es war Cole Scott. Gleichzeitig erschienen Koordinatenangaben im Glas der Windschutzscheibe. Uptown East 67th Straße. Area D.
»Wir haben hier einen 3 x 4«, sagte Cole. »Zwei Bewaffnete. Die Wichser haben unseren Air C runtergeholt. Ist ziemlich ungemütlich. Könnten ein bisschen Unterstützung brauchen.« Im Hintergrund war das Rattern automatischer Waffen zu hören, begleitet vom dumpfen Knall aus Coles Blopper Guard Revolver und Bugbears grollender Stimme, die ihre Gegner lautstark zur Hölle wünschte.
»Sind unterwegs. Haltet den Kopf unten.« Liberty fuhr mit der Hand über die Anzeige des Turbinendisplays und erhöhte den Schub auf Maximum.
Die Maschine heulte auf. Quillan schnappte nach der Halterung an der Tür und krallte sich daran fest.
Wenn Liberty wütend war, flog sie noch halsbrecherischer.
Er biss die Zähne zusammen.
Ihr Air C jagte durch die Nacht. Quillan nutzte die freie Hand, um seine Mantis aus dem Schulterholster zu ziehen und die Munitionsanzeige zu überprüfen. Cole hatte ihm das eingebläut und dabei einen Spruch benutzt, den er seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekam: Wenn dir eine Patrone den Arsch rettet, retten dir die anderen das Leben.
Quillan hielt sich daran. »Versuchen wir sie festzunehmen?«, fragte er.
»Wenn sie sich festnehmen lassen, ja. Wenn nicht …« Liberty ließ den Rest des Satzes unausgesprochen. Er wusste, was das bedeutete.
Regen und Schnee wurden dichter. Der Scheibenwischer lief auf Anschlag.
Schon von Weitem konnten sie die Blaulichter sehen, die die Straße und Fassaden beleuchteten. Dazwischen Mündungsfeuer. Liberty drosselte die Geschwindigkeit, bis sie sanft in der Luft standen. Dreihundert Meter bis zum Ziel. Sie nutzte die Aufbauten der Häuser als Deckung.
Quillan warf den Scanner an und checkte die Umgebung. Wie immer half ein Schlag auf die Verkleidung, um die Störungen im Display zu beheben.
»Vier Streifenwagen. Und da sind auch Cole und Bugbear. Die Schüsse kommen aus der dritten Etage von dem Gebäude gegenüber.«
»Okay, wir landen auf dem Dach und gehen durch das Treppenhaus.«
»Warte noch!« Quillan hatte auf Wärmebild umgeschaltet, das zwei rot-gelbe Gestalten zeigte, die bei den Fenstern zur Straße hinaus standen. Die Gewehre in den Händen waren deutlich zu sehen. Es gab aber noch vier weitere Wärmesignaturen in einem der angrenzenden Räume, die sich in einer Ecke zusammendrängten. »In der Wohnung sind noch vier.«
»Bewaffnet?«
»Nein. Sieht nicht so aus. Könnten Geiseln sein.«
»Ach Scheiße«, sagte Liberty und nickte dann, als würde sie sich selbst bestätigen wollen. Sie aktivierte das Com-System des Air C. »Cole? Kannst du mich hören?«
»Ja, laut und deutlich.«
»Wir landen auf dem Dach und fallen den Kerlen in den Rücken.«
»Gut. Beeilt euch. Bugbear ist drauf und dran, denen eine Granate durchs Fenster zu schießen.«
»Auf keinen Fall!«, rief Quillan. »Wir vermuten, dass die Geiseln haben.«
Cole schnaufte hörbar.
Liberty gab Gas, flog eine Kehre, die sie außer Sicht brachte, und näherte sich dem Gebäude von der Rückseite. Übergroße Ventilatoren drehten sich auf dem Dach. Aus Belüftungsrohren quoll Dampf, der unter dem Luftstrom der Turbinen verwirbelte, als Liberty das Air C aufsetzte.
Sie schnappte sich ihre schusssichere Weste vom vollgemüllten Rücksitz und schlüpfte hinein.
Quillan war bereits ausgestiegen. Er hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, die Weste gar nicht erst auszuziehen, wenn er sie zum Dienst einmal angelegt hatte.
Die Luft war schneidend kalt. Schwere, nasse Schneeflocken blieben auf seinen Schultern liegen.
Er zog seine Waffe und eilte mit Liberty an seiner Seite zu einem Aufbau zwischen den Ventilatoren. Dort lag die Tür, die sie ins Treppenhaus bringen würde. Daneben verrottete ein Taubenschlag, dessen Dach eingebrochen war und der nur noch von Drahtgittern aufrecht gehalten wurde.
Liberty prüfte die Tür, verschlossen. Sie wies auf einen Punkt neben dem Schloss. Quillan war immer noch der Neue, also blieb das zweifelhafte Vergnügen, Türen einrennen und aufbrechen zu müssen an ihm hängen. Er nahm einen Schritt Schwung, zielte auf die Stelle, auf die Liberty gedeutet hatte, und trat die Tür ein.
Das Treppenhaus, das dahinter anschloss, bestand noch aus Holz. Das Geländer bildete ein Muster aus Ranken, Blättern und Blumen. Jede Stufe war ausgetreten und knarrte. Die Wand links von der Treppe war nass. Grün-schwarzer Schimmel hatte sich auf dem Putz ausgebreitet.
Aus Rissen in der Decke tropfte Wasser, das sich auf der obersten Etage in einer Pfütze sammelte. Die Luft roch modrig und schwer. Licht kam von Wandlampen im Art-déco-Stil, deren Messing im Laufe der Jahrzehnte stumpf geworden war.
Liberty ging als Erste. Gedämpft durch die Wände waren die Schüsse zu hören. Ein dumpfes Ploppen und Rattern wie weit entferntes Feuerwerk.
Auf der vierten Etage streckte einer seine neugierige Nase auf den Flur hinaus. Als er Liberty und Quillan mit den gezogenen Waffen sah, erschrak der Mann, schlug die Tür zu und legte zahlreiche Riegel vor.
Kaum hatten die beiden die dritte Etage erreicht, klangen die Schüsse nicht mehr wie Feuerwerk. Im Gegenteil, sie waren so laut, dass Quillan glaubte, sie würden gleich neben ihm abgefeuert. Zwischen den Schüssen waren undeutlich Stimmen zu hören, ein Kind weinte, ein Baby plärrte. Ein kurzer Blick zu Liberty. Sie nickte, hatte es also auch gehört.
Geduckt und schussbereit liefen sie zu dem Appartement.
Liberty ging links, Quillan rechts von der Tür in Stellung.
Sie sahen, dass sie aufgebrochen worden war und nicht mehr schloss. Liberty versuchte sie zu öffnen, aber das klappte nicht. Etwas klemmte. Quillan wies nach unten. Man hatte die Tür mit einer breiten Messerklinge verkeilt.
Liberty entfernte sich ein Stück von der Tür und aktivierte ihre Comwatch. »Cole. Wir sind da. Macht ein bisschen Krach. Lenkt sie ab. Aber nicht schießen, wir gehen jetzt rein.«