
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Märchen sind wie Träume. Wer meint, er könne eins deuten, sollte zunächst sagen, wer es geträumt hat. Märchen sind gleichzeitig Unterhaltung und Genuss, Spiegel und weiser Ratgeber. Sie sind Teil der Welt, eines der Wunder des Lebens. Märchen weisen tief in die Vergangenheit der Menschheit zurück. Man sagt auch, Märchen seien für die Literatur das, was die Primzahlen in der Mathematik sind, rätselhaft. Mit den Kunstmärchen in diesem Büchlein wird die Märchenwelt der Brüder Grimm fortgeschrieben. Ihnen dürften jedenfalls alle etwas abgewinnen, egal ob jung oder alt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichem Wege. (Goethe)
Inhaltsverzeichnis
Schneelindchen und Jogoj
Das Märchen von IMMERSCHÖN
Dormirana und ihre Tiere
Die weiße Kachel
Das Schlangenkind
Türme im Morgenland
Der Ritter und Prinzessin HonigsüSS
Schönlinde und Treugott
Die drei Kristallkugeln
Rotkäppchen und der Wolf
Die Vögel der Fürstin
Das Märchen von Tausendschön
Wie der Diener Graf ward
Friedmut
Dornenröslein
Samtmützchen Und der Wolf
Die Mär vom ewiglichen Strom
Froschkönigin und Froschkönig
Kein Licht
Kieselsteine
Herr Wolf und und die sieben Geißlein
Der Übergang
König Pertinaxus’ Bestimmung
Grablegung einer Katze
Lichter in der Ferne
Astra
Der Ritt auf Lava
Flug zum Marspol
Der Schwanenteich
Hans und Grete
Die Adoption
Vorwort
Dieses Büchlein ist ein Gemeinschaftswerk, daher geht mein besonderer Dank an die begnadeten Lektorinnen Elke Staamann und Gabrielle Zähler-Mielke, die Gott sei Dank der Sache bis zum Start den gewissen Schub verliehen haben. Für den computermäßigen Support und Software bedanke ich mich sehr bei Hartmut Köster.
Ganz grundsätzliche, wegweisende Inspirationen für Kunstmärchen und Kurzgeschichten verdanke ich dem 2016 von uns gegangenen Dichter Frank Kminkowski, der mir Gelegenheit gab, seine Bücher zu illustrieren.
Die Texte stammen aus den Jahren 2015 bis 2020. Am Kapitel „Märchenvariationen“ lässt sich einsehen, wie wandelbar Märchen sind und wie sich Märchen interpretieren lassen. Manchen Leser, der gern zur Feder greift, wird es zu eigenen Versuchen ermuntern.
Märchen sind wie Träume. Wer meint, er könne eins deuten, sollte zunächst sagen, wer es geträumt hat. Märchen sind gleichzeitig Unterhaltung und Genuss, beliebter Gesprächspartner und weiser Ratgeber. Sie sind Teil der Welt, eines der Wunder des Lebens.
Man sagt auch, Märchen seien in der Literatur das, was die Primzahlen in der Mathematik sind – rätselhaft. Diesen dürften jedenfalls alle etwas abgewinnen.
Birkenwerder, September 2022
SCHNEELINDCHEN UND JOGOJ
Es war einmal vor langen, langen Zeiten in einem fremden Land in einem Schloss aus grauem und schwarzem Granit. Darin lebte dereinst Prinzessin Schneelindchen mit ihrem Vater sowie der Stiefmutter.
Die Anverwandte schritt mit ihrem Gemahl zum Speisesaal. Unter einem Vorwande eilte sie noch einmal ins Schlafgemach zurück. Da trat sie vor den Spiegel und sprach:
„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer bäckt den schönsten Kuchen aus Sand?“
Des Spiegels Antwort lautete:
„Ihr, Frau Königin, backt den schmackhaftesten Sandkuchen im ganzen Land.
Mit Verlaub, Prinzessin Schneelindchen hinter den sieben Zwergen, bei den sieben Bergen bäckt Pflaumenkuchen mit geschlagener Sahne. Er schmecket noch tausendmal schmackhaftiger als eure Mumpe. Halten zu Gnaden.“
Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Sie nahm zornmutig eine Hand voll Zuckersand. Den warf sie dem Spiegel mit den Worten: „Da hast du!“ an den Kopf. Dann schrie sie vor Wut den Spiegel an: „Du lügst“, griff eine Vase und schleuderte diese in den Glasspiegel, dass er in tausend Stücke sprang.
Sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie im Kuchenbacken von jemand sollte übertroffen werden.
Nach der Mahlzeit verließ die Herrscherin als erste den Speisesaal. Sie befahl Jogoj, den kleinen Hofnarren zu sich. Jogoj bedeutet ‚zwischen den Dämmerungen’; er ward zwischen einer Sonnenfinsternis und der Abenddämmerung geboren. Die Königin zog ihn dicht an sich und blickte ihn scharf an.
„Gehe zu Schneelindchen und den Zwergen, Hofnarr“, hub sie an.
„Besorge mir das Rezept für den Pflaumenkuchen! Sag ihnen, sie werden dafür mit Gold und Edelsteinen aus der Schatzkammer belohnt, soviel sie in ihrem Ränzlein davontragen können“, befahl sie auf ihren Diamantring zeigend.
Den kleinen Hofnarren wollte die Königin deshalb schicken, damit dieser auf Augenhöhe mit den Wichten verhandeln könne.
Weiter sprach seine Gebieterin: „Sei kein Narr, lasse dich von den garstigen Kobolden nicht übertölpeln. Kommst du mir ohne das Rezept zurück, mache ich dich kleiner. Darauf kannst du Gift nehmen.“
Nicht nur ihre Augen waren blau, gleichermaßen ihre Zunge. Die konnte Jogoj jetzt klar erkennen. Sogar ihre schwarzen Haare, die mit zwei Goldnadeln zusammengesteckt waren, schimmerten bläulich.
Ihre Voreltern gehörten zu Erzhexen und Zauberern; von denen hatte die Herrscherin etwelche ‚Die sieben Zwerge’, denn des waren ihrer sieben.
Um jemanden zu verkleinern, vertauscht die Herrscherin einfach ihre linke mit der rechten Haarnadel, indes sie demjenigen in die Augen blickt.
* * *
Jogoj fügte sich und wanderte zu Schneelindchen bei den Zwergen über den sieben Bergen; ihm blieb nichts weiter übrig, wollte er nicht noch weiter schrumpfen – nur halb so groß wie die Königin war er.
Sein Weg führte ihn durch staubtrockene Wüstenei mit Dünen, die der Wind als unaufhörliche Sandflut vor sich her trieb. Wie Sicheln türmten sich die Dünenkämme vor ihm. Auf den Sandbergen thronten geflügelte Schimären, von Sandkörnern in Dunst gehüllt. Seinen Dolch hätte er getrost daheim lassen können, allesamt friedliche Geschöpfe. In deren glänzendem Gefieder spiegelte sich die Sonne. Anfangs meinte er nicht anders, als sei es das Gaukelspiel einer Fata Morgana, das sich beim Näherkommen in Luft auflöst.
Die Dünen wandelten sich ständig. Sandwinde wirbelten die lockeren Sandmassen auf und jagten sie die Hänge empor, sodass die Dünenkämme förmlich rauchten. So befanden sich die Sandberge auf ständiger Wanderung. Tief sanken Jogojs Füße in den Boden. Dann wurde es steinig.
Sand hatte gleichsam wie ein Bildhauer bizarre Formen aus dem Felsgestein geschliffen. Da waren ein Gebilde, das wie ein Schneckenhaus viele Klafter aus dem Fels ragte, eins, das einem sich aufbäumenden Riesen glich und gleich daneben eine steil empor ragende Zunge aus Granit – halb so hoch wie der Felsenriese sowie etwas wie ein Ohr, das zum Riesen hätte gehören können.
Nachdem Jogoi eine tüchtige Strecke gegangen war, gelangte er in einen wilden Wald, in dem der Schwarzstorch und der Tannenhäher brüten, Steinpilze gedeihen und giftiges Kraut wächst. Wacker schritt er begleitet vom Gesang der Vögel vorwärts.
Indem es Abend werden wollte, beleuchteten ihm in der Finsternis blaue Flammen den Weg, die hin und wieder aus den Mäulern von Drachen schossen. Weil seine Beine ihn nicht mehr tragen wollten und die Müdigkeit ihn überkam, legte er sich ins Moos zum Schlafen. Ihm träumte, die Königin im gelben Gewand würde vor ihm stehen und ihm beständig in die Augen schauen. Ihre blaue Zunge schnellt hervor und berühret seine Lippen. Goldene Nadeln stecken darin. Indem er sich abwendet, erscheint ein Lichtlein.
Schreie von Dohlen und Raben weckten ihn beim Morgengrauen. Seine Schritte lenkte er Richtung Sonne.
Duft von frischem Backwerk strömte ihm von Weitem entgegen. Die Zwerge hatten ihr Zuhause in einer Kristallhöhle, in der Kristalle sowie Edelsteine im Schein zahlloser Lichtlein nur so funkelten. Darin war alles klein, zierlich und rein.
Beim Eintreten aßen die Königstochter und die sieben Wichte gerade Backwerk mit Pflaumen darauf und geschlagener Sahne.
So weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz war Schneelindchen angetan mit einem weißen Kleide aus Seide.
War das ein Freuen! Schneelindchen mochte Jogoj von Kindertagen an. Schon beim Hören ihrer sanften Stimme ward ihm gleich wohler ums Herz.
„Jogoj! Was führet dich zu uns?“ erkundigte sich Schneelindchen. Beide drückten sich.
Die liebsame Prinzessin hockte sich dafür hin.
„Ach Schneelindchen, die Königin will, dass ich ihr das Rezept für deinen Pflaumenkuchen herzu schaffe. Falls ich ohne das Rezept wiederkehre, will sie mich noch mehr verkleinern. Gold und edle Steine würde sie dafür geben.“
„Kein Grund sich zu grämen, Jogoj“, tröstete ihn Schneelindchen. Sogleich reichte sie ihm ein großes Stück von ihrem Kuchen. „Wir finden gewisslich einen Ausweg.“
Nachdem ein jeder sich satt gegessen hatte, wandte sich das Mädchen an die Zwerge:
„Verflucht! Ich kann der doch nicht einfach das Kuchenrezept überlassen. Ich habe es von meiner Mutter; sie wiederum hat es von meiner seligen Großmutter geerbt.“
Mit der Hand nach oben weisend versetzte der Älteste, der Hauptzwerg:
„Ei was! Gold und Edelsteine! Ihre Steine kann sie behalten. Soviel Edelsteine, wie hier an der Decke und den Wänden wachsen, hat diese …, diese Hexe ihr ganzes Leben noch nicht gesehen. Außerdem glaube ich ihr keines ihrer Worte.“
Nach langem Hin und Her sowie allerlei Denkübungen fassten sie folgenden Entschluss:
Jogoj solle der Königin ein kleines Gebäck bringen, überdies ein Rezept, bei dem Hefe gegen Pulver vom Drachenhorn vertauscht ist.
„Nun, für den Belag nehmen wir statt der Pflaumen Tollkirschen“, schlug der Hauptzwerg vor. „Die haben dieselbe Farbe wie Pflaumen“.
Weiterhin führte er aus: „Sollte die alte Hexe diesen Kuchen essen, wird ihr der Appetit auf Pflaumenkuchen für immer vergehen, die Lust am Verkleinern gleich mit.“
Indessen die Zwerge noch über das Für und Wider debattierten, schickte Schneelindchen sich bereits an, Tollkirschen zu ernten. Sie eilte zu einer Stelle, wo das Kraut mit den giftigen Kirschen wuchs und pflückte eine Hand voll von einer Staude.
Mit jener giftigen Ernte buk das Mädchen einen Kuchen. Diesen gab es Jogoj mit auf den Heimweg, ferner das falsche Rezept und eine Wegzehrung.
Jogoj sagte Lebewohl und kehrte frohgemut zurück. Unterwegs traf er im Wald zufällig auf des Königs Jäger; ihre Jagdhörner hatte er aus der Ferne gehört. Da erkundigte der erhabene König sich bei ihm nach seiner Tochter. Auf Befehl des Herrschers setzte ihn einer der Jäger auf das Reittier und ritt mit ihm fürbass ins Schloss. Schon von Weitem erkannte Jogoj das Königsschloss mit seinen schwarz-grauen Mauern. Posaunen kündeten von seiner Ankunft.
* * *
Die Königin misstraute der Sache; eine Kostprobe hatte sie ja gar nicht bestellt. Sie schenkte des Hofnarren Bericht vom Besuch bei den Zwergen keinen Glauben und fuhr ihn im großen Zorn gar hart an.
Unter ihren bösen Blicken musste der Narr den falschen Pflaumenkuchen selber aufessen. Kein einziger Krümel durfte übrig bleiben.
Jogoj wich den Blicken der Herrscherin aus.
Ihm schmeckte das Gebäck sogar.
Doch er ward nach dem Verzehr tobsüchtig, dazu lief seine Zunge blau an.
Rasend vor Schmerz warf er der meschanten Königin Sand in die Augen, die im Begriff war, ihre Haarnadeln zu vertauschen. Soeben versuchte sie ihm die Augen auszustechen, indes Jogoj seinen Dolch zog, den er unter dem Wams versteckt hielt. Er erstach die Königin, da sie ihn gezwungen hatte, den Kuchen mit den giftigen Früchten aufzuessen.
Tags darauf fand man ihn tot im Sande liegen. Den kleinen Jogoj hatte vorher schlimmes Zitterweh befallen, dass er sich wie ein Derwisch im Kreise drehte und die Farbe aus seinem Gesicht wich, bevor er umfiel. Noch am gleichen Tag war Jogoj am Gift der Tollkirschen gestorben.
Schneelindchen kam nur noch ein einziges Mal ins Schloss, fortan ward es nimmermehr da gesehen; Schneelindchen blieb bei seinen Freunden, den Zwergen.
* * *
Längst ist das Königtum untergegangen. Seit Jahrhunderten liegt es versunken unter Wüstensand. Nachts liefern sich Fledermäuse und Skorpione erbitterte Kämpfe. Des Palastes Granitsteine zerspringen bei Frost mit lautem Knall. Was übrig bleibt, sind Trümmer.
DAS MÄRCHEN VON IMMERSCHÖN
Es trug sich zu, dass einem Kaufmanne, der in der Welt weitum reiste und seiner Gemahlin weiland ein Töchterlein geboren ward. Sie gaben ihm den Namen Immerschön.
Wenige Wochen nach der Geburt des Kindes ward die Mutter krank. Da holte der Vater eine Frau ins Haus, die sich als Amme für das Kind anbot. Sie war hübsch von Angesicht, aber hoffärtig und schwarz von Herzen, so schwarz wie ihr Haar.
Vormals stand sie in dem Rufe, mit Zauberern im Bunde zu sein. Ihre Tochter hatte sie wenige Wochen vor Immerschön zur Welt gebracht.
Als Immerschöns fieberkranke Mutter großen Durst verspürte, bat sie flehentlich um ein Glas Most. Statt des Mostes reichte ihr die Amme einen giftigen, giftigen Trunk. Wenige Tage später tat Immerschöns Mutter die Augen zu und verschied. Ihrem Kinde hinterließ sie einen goldenen Armreif. In ihm waren die Worte eingraviert: „Sei allzeit tüchtig und zu jedem gut.“
Weil der Vater wollte, dass die Amme hinfort des Mädchens Mutter sei, hielt er Hochzeit mit ihr übers Jahr.
* * *
Immerschön wuchs heran und blieb brav und fügsam. Es war eine Freude, es zu erschauen.
War der Hausherr auf Reisen, brachen allemal schlimme Zeiten für das arme Kind an.
„Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sitzen“, sprach sie, „Wer speisen will, muss es verdienen: Hinaus mit dem Gesinde!“
Sie zog ihm eine graue Schürze an und warf ihm Holzpantinen vor. Die Rassel, die ihr Vater von seiner Reise mitgebracht hatte, warf Immerschöns Stiefmutter in den Ofen.
Sowie Immerschön groß genug war, musste es fürderhin vor Tag aufstehen, vom Morgen bis Abend schwere Arbeit tun, Feuerholz aus dem Buchenwald holen, Asche hinaus tragen, spinnen und fegen. Wollte ihre Stiefschwester ihr bei der Küchenarbeit helfen, zog das Weib sie weg.
Abends, von der Arbeit zermürbt, kam es in kein Bettchen wie das rechte Kind der Stiefmutter, sondern musste sich neben den Herd in die Asche auf den Fußboden legen.
Doch ward das Mädchen so liebreizend, dass kein Maler es schöner hätte malen können, mit Augen blau wie die See und Haut so weiß wie Schnee – seine Stiefschwester dagegen war unansehnlich. Immerschöns güldenes Haar hing in Zöpfen auf dem Rücken. Beim Holzholen in der Waldung nahm sie manchmal ein paar Körnlein, die sie auf dem Boden fand, für die Vögel mit oder fütterte die Rehe mit Kastanien. Auch für den Bären steckte sie sich Reste aus der Küche ein. Immerschön war zu allen Tieren gut. Käfern, Spinnen und anderem winzigen Getier tat sie nie etwas zu leide.
In Immerschöns fünfzehntem Lebensjahr begab es sich, dass der Vater wieder einmal für Wochen in die weite Welt hinaus in Geschäften ziehen sollte.
* * *
Da erteilte ihr die böse Stiefmutter drei Aufgaben. Von einem Zauberer hatte sie einstmals erfahren, dass sie allezeit schön bliebe, wofern sie ein Mädchen von vierzehn Jahren vor eine unlösbare Aufgabe stelle. Drei Versuche hätte sie. Dazu müsse der Zauberspruch
„Perpetuus, perpeturus,
Will die Zeit auch noch verrinnen, Schönheit, du seiest nie von hinnen!“
Aufgesagt werden.
Was der Zauberer für sich behielt: Falls diejenige die drei Aufgaben lösen sollte, wird ihre eigene Pracht im Nu vergehen und jene statt ihrer zu ewiger Schönheit gelangen.
Sollte Immerschön keine der Aufgaben lösen, würde die Stiefmutter ewig jung bleiben.
Beim ersten Mal trug die Frau dem Mädchen auf, Spinnweben zu sammeln, daraus Fäden zu spinnen und sie auf Spulen zu wickeln.
Darauf sprach sie unter mancherlei Gebärde:
„Perpetuus, perpeturus,
Will die Zeit auch noch verrinnen,
Schönheit, du seiest nie von hinnen!“
Das Weib lachte grässlich, als es davon ging.
Spinnen konnte Immerschön wohl, doch wie sollte sie so etwas vollbringen?
Immerschön überlegte, wie sie es wohl anstellen möchte. Indes kam alles Spinnengetier der Umgegend geschwind herbei und half dem Mädchen. Schnurr, schnurr, schnurr; so ging es die ganze Nacht. Sieben Fäden gezogen, geschwind waren alle Spulen voll. Am Morgen lagen sieben Spulen mit Spinnweben beim Spinnrad. Da ward die Stiefmutter zornig und gelb wie ein Pirol. Jetzt blieben ihr noch zwei Versuche. Sie beauftragte Immerschön mit einer neuen Arbeit, von der sie glaubte, das Mädchen werde außer Stande sein sie zu schaffen.
Jedweden gesponnenen Faden sollte es zu Stoff weben. Wieder sagte das Weib den Zauberspruch auf:
„Perpetuus, perpeturus,
Will die Zeit auch noch verrinnen,
Schönheit, du seiest nie von hinnen!“
Weil aus Spinnweben noch keines Menschen Hand Stoff gewebt, ward das Mädchen verzweifelt. Die Schwalben aus dem Wald flogen wie Pfeile herzu, verwandelten die Kammer in eine Webstube und webten geschwind sämtliche Fäden zu Stoff.
Ihre Stiefmutter, indes sie auf dem Webstuhl den fertigen Stoff gewahr wurde, ward abermals gallsüchtig, fluchte entsetzlich und biss sich auf die Lippe.
Eine letzte unlösbare Aufgabe musste sie für das Mädchen finden; sie trachtete weiterhin danach, zur ersehnten ewigen Schönheit zu gelangen.
Sie überlegte lange, tagelang.
Bei Regenwetter schließlich hieß das böse Weib Immerschön an die Stelle zu gehen, wo der Regenbogen die Erde berührt. Allwo sollte sie den Stoff färben. Zum letzten Mal rief sie mit bebender Stimme:
„Perpetuus, perpeturus,
Will die Zeit auch noch verrinnen,
Schönheit, du seiest nie von hinnen!“
Immerschön gehorsamte. Während der kalte Regen fiel und die Sonne hinter den Wolken hervorguckte, eilte sie mit dem Stoff da hin, wo sie glaubte, der Regenbogen berühre die Erde. Je länger sie lief, umso mehr entfernte er sich von ihr. Weiter ging sie, immer weiter.
Endlich kam Immerschön in eine wilde Waldung, in der die Zweige der Baumkronen kaum je einen Sonnenstrahl auf den modrigen Waldboden fallen lassen. Darin war es kalt. Bäume und Sträucher hatten sich in Nebel gehüllt. Dem Mädchen ward es ach so bang, die Beine taten ihm weh. Nebel schluckte sämtliche Geräusche.
Allda begegnete es den wilden Tieren und hörte den Sängerwettstreit der Singvögel zu. Gleich ward ihm leichter ums Herz, als diese sich zu ihm gesellten.
Die Rauchschwalben schwirrten herbei und sprachen: „Tschiep, Tschiep, wir fliegen dir voran.“
Sprach der Hirsch mit tiefer Stimme: „Setz dich auf meinen Rücken und ruh dich aus.“
Und der Braunbär brummte: „Fürchte dich nicht. Ich bin der Herrscher dieses Waldes und gehe voraus.“
Zu guter letzt sagten die Spinnen:
„Pass auf, wir machen einen Faden, der reicht durch den ganzen Wald hindurch. Er geleitet dich auf dem Nach-Hause-Weg.“
Meister Petz bahnte den Weg durch das dichte Gebüsch. Hinter ihnen überwucherten und verschlossen sofort Schlinggewächse den Pfad.
Nachdem Immerschön das Waldland verlassen hatte, regnete es nicht mehr; vergebens suchten ihre Augen den Regenbogen.
„Regenbogen, wo bist du? Ach, wüst ich nur wo der Regenbogen ist“, sprach Immerschön.
Eine gute Fee erschien. „Lass dir nicht bang sein“, tröstete sie die Fee. „Kehre getrost heim. Deinen Stoff überlasse mir. Wenn du bei deiner Eltern Hütte eingetroffen bist, liegt auf dem Tisch, was dir aufgetragen ward.“
Entlang des Fadens, der einem durch die Luft zitternden Mondstrahl glich, gelangte Immerschön nach Hause. Zwei Schwalben setzten sich auf ihre Schultern, die da sitzen blieben. All das Gestrüpp tat sich von selbst auseinander und ließ sie hindurch; hinter ihr tat es sich wieder zusammen.
Beim Eintreten in ihre Stube lag das gefärbte Gespinst schon da. Es leuchtete in allen Regenbogenfarben und glänzte wie Seide.
Wie die garstige Stiefmutter den buntgefärbten Stoff aus Spinnenweben gewahr ward, ergraute auf der Stelle ihr Haar, die Haut ward runzlig, und auf der Nase wuchs eine violette Warze, aus der Borsten spießten.
Sie trat vor den Spiegel wo sie ihre Verwandlung besah und zusammenfuhr. Dann stampfte das Weib mit den Füßen auf, dass der Boden nachgab und die Erde es verschlang.
* * *
Gleichzeitig erfüllte sich der Zauber für Immerschön; denn sie behielt zeitlebens ihre Jugendblüte. Aus dem bunten Stoff nähte sie sich ein Kleid, wie sie es sich von je her gewünscht hatte, schöner, als das ihrer Schwester. Später lernte Immerschön einen Prinzen kennen und sie heirateten einander unter großem Pompe und Frohsinn. Nach des Vaters Tod holte sie ihre Stiefschwester zu sich aufs Schloss. Sie lebten glücklich und sind es bestimmt noch heute. Ihren Armreif hat Immerschön nimmermehr abgestreift.
Und für den, der diesem Märchen lauschte, soll ein goldenes Äpfelchen vom Himmel fallen.
DORMIRANA UND IHRE TIERE
Es war einmal eine junge, wunderschöne Frau, Dormirana geheißen. Die Villa, in der sie lebte, lag in einem Föhrenwald, von dem die Rede ging, dass es darin nicht geheuer sei.
Eines Tages sprach sie zu sich: „Eines der Tiere im Hain muss ein verzauberter Prinz sein“. Mit diesen Worten schritt sie eilends hinaus und holte aus dem Wald Tiere zu sich. Sogar eine Schlange und einen Rehbock mit goldenen Hörnern fing sie ein.
Wäre eines von ihnen der verzauberte Prinz, würde er mit ihr zu seinem Schlosse reiten und sie bestimmt zum Weibe nehmen, nachdem es sich zurückverwandelt hätte, dachte sie.
Als sie meinte, genug beisammen zu haben, wollte sie von jedem wissen, ob es der verzauberte Prinz sei.
Zuerst befragte Dormirana den Rehbock: „Du mit deinen goldenen Hörnern, du warst bestimmt ein Prinz?
„Ich, ein … Die Hörner habe ich geerbt. Meine Vorfahren kämpften auch alle mit goldenen Hörnern.“
Dem Rehbock schenkte Dormirana Glauben und ließ ihn frei.
Gleich darauf kam das schwarze Eichhörnchen, das keinen Schatten warf, an die Reihe: „Sag an Eichkater, bist du ein verzauberter Königssohn?“, fragte sie und streichelte seinen Kopf.
„Ei was, nie und nimmer“, sagte das Eichhörnchen und neigte das Köpfchen zur Seite, „ich bin und bleibe das Eichhörnchen.“ Sodann kam die Wildkatze mit Augen wie Bernstein dran: „Miau, was denkst du von mir. So wie jetzt werde ich immerdar bleiben“, versetzte dieselbe und leckte ihre schwarze Schwanzspitze.
Dormirana befragte als nächstes das Langohr, das trug ein silbriges Fell und drei Ohren waren ihm gewachsen. Langohr konnte nach hinten ausschlagen wie ein Pferd: „Ob ich ein verzauberter Prinz bin?“ empörte der sich, „davon weiß ich nichts, schon allerweile war Hase der meinige Name.“
Dann den Igel mit Stacheln aus Elfenbein: „Igel, sprich! Bist du ein verzauberter Prinz?“
Der: „Potztausend! Prinz, nein. Mir war es noch nie vergönnt, so etwas Edles zu sein.“
Sodann stellte sie sich neben ihre goldenen Volieren, in der sie Waldvögel gefangen hielt. Darin waren neben einer Taube zwei Elstern mit schillernden Federn. Die Elstern legten goldene Eier; wer sie berührte, ward eine Elster.
„Die Elstern müssen mir Glück bringen“, sprach sie, „wer von euch Gefiederten ist der verzauberte Prinz?“
„Krick, krick, keiner von uns beiden“, gegenredeten sie im Chor, „Prinzen schmücken sich mit Edelsteinen. Wir schmücken höchstens unser Nest damit, falls wir so glänzende Steine finden. Dies beweist alles.“
Ungeduldig erkundigte die schöne Frau sich nun am siebten Käfig bei der blaugrauen Taube, die auf der Stelle fliegen konnte: „Täubchen, rede! Bist du der verzauberte Prinz?“
„Gurr, gurr“, versetzte die Taube trotzig, wetzte ihren Schnabel und schlug mit den Flügeln, „das fehlte mir noch, alle Tage im Faulbett liegen oder auf der Schaukel rumsitzen. Außerdem war mein Kleid schon immer aus Federn.“
Sollte denn keines der Tiere aus dem verwunschenen Walde verzaubert sein?
* * *
Da geschah es, dass ein Königssohn auf seinem Pferd in den Zauberwald geriet, wo er zu Dormiranas Villa gelangte.
Dormirana sah von des Turmzimmers Fenster, wie er seinen Schimmel an eine der Buchen band und durch das Tor, das lediglich aus efeuumrankten Wacholder und Eiben bestand, trat.
Er schritt über eine Wiese, die sich in sanften Wellen hob und senkte. Wie auf Wolken schritt der junge Kronprinz darüber hin, sodass er ins Staunen kam: zu beiden Seiten Bäume mit goldenen Früchten der verschiedensten Arten und goldenen Blättern.
Stille, ringsum Stille, alles schlief im Garten: die Nymphen an einer Quelle aus zu Eis gefrorenem Wasser; Bienen, Libellen und Schmetterlinge nicht minder – sie alle in Schlaf gesunken. Die Vögel im Astwerk, die Dolen auf dem Dachfirst, sie alle hatten ihre Köpfchen unter ihre Flügel gesteckt. Sogar die Zikaden schwiegen.
Von den Grashalmen leckten die Strahlen der hoch stehenden Sonne weder den Tau noch spielte Wind im goldenen Laub.
Dies alles wollte dem Jüngling gar wunderlich bedünken. Auf sämtlichen Wegen war ihm so etwas noch nie vor die Augen gekommen. Ein Apfel, der eben vom Baume fallen wollte, ließ sich Zeit, viel Zeit: Bis der goldene Apfel im Grase lang, war die Sonne schon wieder ein Stück weiter gewandert.
Falls überhaupt Tautropfen zu Boden schwebten, brauchten diese ebenso lange.
Im Garten wuchs keine einzige erblühte Blume, nur Knospen, als sei hier die Zeit stehengeblieben, als herrsche gar kein Lenz ...
Wann würden solche Blumen wohl ihre Blüten öffnen und warum war bisher keine erblüht, frug er sich.
Der Weg, den er nun beschritt, war von Hecken umsäumt. Auf immer neue Weggabelungen stieß er. Mal bog er rechts ab, mal links und dann wieder ging er geradezu. Auf der Suche nach dem Ausgang verlief er sich im Labyrinth der Hecken. Endlich stieß der Jüngling inmitten des Irrgartens auf eine Villa.
In der Luft lag ein süßlicher, betäubender Hauch, indessen er auf das Anwesen zuging.
Das Gemäuer umstanden Marmorbilder von Elfen, Säulen aus Sonnenstrahlen und Blumen mit Knospen aus Perlen.
Über glänzende Treppenstufen, so weich wie die Daunenbetten von Prinzessinnen, schritt er zum Portal empor.
Untertanen geleiteten ihn zu ihrer Herrin. Diese war in ein reich von Goldfäden durchwirktes, violettes Kostüm gewandet, der Kragen und die Ärmel von blauem Sammet. Sie begrüßte ihren Besucher im mit Lindenholz getäfelten Empfangssaal, dessen Decke erstaunliche Bernsteinmosaike mit Mischwesen – halb Fuchs, halb Mensch darstellend – enthielt.
Auf des Kabinetts Boden war ein Mosaik aus Marmor, Alabaster, Obsidian und sogar Achat ausgelegt. Es zeigte einen Blumengarten aus Pfingstrosen, Lilien und exotischem Getier. Zudem hatte der Künstler einen Bären, einen Wolf, sowie einen Waldstorch eingefügt.
Des Prinzen Blick schweifte zum Zeitanzeiger, dessen Verzierung aus einem Medusenhaupt, Sonne und Mond bestand. Er befand sich gegenüber dem Fenster auf einem Ständer aus Bronze.
„Was ist mit dem Vogel in der Uhr?“, erkundigte er sich bei der schönen Frau.
„Nun, das Vögelchen will jetzt hervortreten, wo beide Zeiger auf die Zwölf zeigen“, versetzte sie. „Er bewegt sich unendlich langsam. Bis es vollends heraus ist, wird in eurem Reiche eine Stunde verstrichen sein.“
Seine Augen glitten über all die Kuriositäten in weiteren Wunderkammern, durch welche ihn Dormirana führte.
Arabesken, Hirschgeweihe, Muscheln, so groß wie ein Weinfass und Stoßzähne aus Elfenbein: All dies erregte seine Aufmerksamkeit.
Donnerkeile in Mannesgröße, die Hauer von Ebern und rabenschwarze Schneckenhäuser neben weiteren absonderlichen Dingen enthüllten seine Blicke in Schaukästen an den Wänden eines ovalen Salons, dessen Boden mit Parkett aus rötlichem Kirschbaumholz ausgelegt war.
Beide sahen aus dem Spitzbogenfenster. Dormiranas feines Haar glänzte golden im Lichte der Sonne; es war wie zerlassener Honig. Draußen regte sich nichts. Sie tauchte den linken Zeigefinger in rote Tinte und malte einen Salamander auf die Fensterscheibe. Kaum war ihre Zeichnung vollendet, bewegte sich des Salamanders Schwanz, und er kroch auf die Fensterbank hinab, von da auf den Fußboden, um schließlich unter eine Vitrine zu schlüpfen.
Bis auf ihr Schlafgemach hatte Dormirana dem Jüngling alle Räume gezeigt.
Da Dormirana dem Königssohn gar wohl gefiel, wollte er von ihr wissen, ob sie mit ihm Hochzeit halten wolle. Sie wandte sich. Immer noch glaubte sie, eines ihrer Tiere müsse ein verzauberter Prinz sein.
Betrübt kehrte der Jüngling in sein Schloss zurück.
* * *
Weil bei der Befragung der Waldtiere keines sich als der verwunschene Prinz zu erkennen gab, ließ Dormirana bis auf die Giftschlange alle Geschöpfe frei. Am Käfig der schwarzen Schlange mit dem grünen Zick-Zack-Muster, den zwei Schwänzen und der Perle zwischen den Augen war die Frau noch nicht gewesen.
Es währte nur drei Tage, da erschien der Prinz zum zweiten Male in Dormiranas Reich. Er wollte sie ach so gern wiedersehen und begehrte sie zum Weibe.
Erneut frug er züchtiglich, ob sie in die Heirat einwillige. Sie lehnte wiederum ab, zumal sie ja die Natter erst noch fragen wollte.
Dormirana trat vor den achten Käfig, den der Schlange. Zuvor hatte sie mit ihrem Gast an der Quelle gesessen und ihn hernach verabschiedet.
„Schlange, dann musst du der verzauberte Prinz sein!?“, sagte sie zur Schlange, deren gespaltene Zunge hervorschnellte.
„Ei gewiss, öffne den Käfig geschwind; ich bin eines Königs Kind“, lispelte die Schlange, „lässt du mich aus dem Käfig geh’n, will ich als Prinz vor dir ersteh’n.“
Vorsichtig öffnete die Schöne das Käfiggitter. Doch, oh Graus! Statt sich zu verwandeln, spuckte die Natter ihr Gift ins Gesicht, schlängelte zischend davon und verschwand in einem Loche.
* * *
Dem Jüngling im Schlosse träumte, eine schwarze Schlange würde sich ihm nähern. Statt Augen hatte die Schlange goldene Zifferblätter mit nur einer brennenden Fackel als Zeiger. Ganz allgemach erhob sie sich, indes sie sich auf ihn zu bewegte. Ebenso gemachsam öffnete die Schlange ihr Maul. Zurückweichen wollte der Jüngling, doch stand er wie angewurzelt. Irgendetwas hielt ihn zurück oder er war einfach starr.
Nachdem die Schlange nur noch eine Armlänge von ihm entfernt war, sah er sich im Auge der Schlange. Sie hatte ihr Maul so weit geöffnet, dass er die Zunge und den spitzen Giftzahn, der wie ein Donnerkeil aussah, erkennen konnte.
Ihm kam das Ganze unendlich lange vor. Erst als die Schlange ihr Maul vollends aufriss, erwachte er vor Schreck.
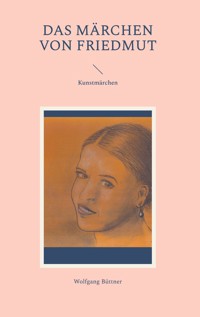

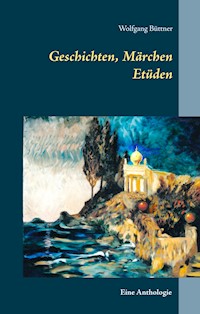














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











