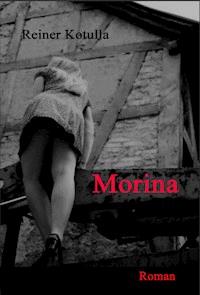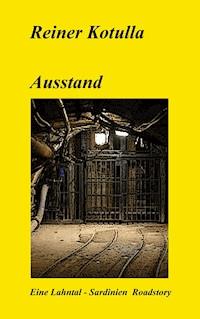Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Protagonist des Romans ist Alexander Fabuschewski, ein Schriftsteller. Er hat eine Schreibidee, will aber gleichzeitig mit Freunden die Lahn erkunden. Zusammen bauen sie aus ehemaligen Ölfässern, Balken und Brettern ein Floß. Auf Deck errichten sie ein Zelt mit zwei Schlafkabinen. Die Haupthandlung ist eine über mehrere Tage sich erstreckende Floßfahrt auf der Lahn, an der neben dem Schriftsteller Alexander und seiner jugendlichen Partnerin noch ein befreundetes Paar teilnimmt. Es wird über eine Flussleiche berichtet, die auch immer wieder Bezugspunkt der auf dem Floß geführten Gespräche wird. Bei ihren Ausflügen an Land begegnen die vier immer wieder geheimnisvollen Menschen und ihren Rätseln. Das enge Zusammenleben führt zu Beziehungskonflikten. Am Ende schreiben Charlene und Alexander gemeinsam eine erotische Story, die sie in die Praxis umsetzen. Die Geschichte der Titelheldin Marijana bildet den tragischen Höhepunkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reiner Kotulla
Marijana
Geschichte einer Floßfahrt auf der Lahn
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1. Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
2. Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
3. Teil
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Epilog
Impressum
1. Teil
Eins
Auf seine Frage „Kann man davon leben?“ hatte der Maler und Bildhauer Wolfgang Schäfer geantwortet: „Ja, wenn du eine renommierte Galerie gefunden hast, in Frankfurt/Main, München, Köln oder Berlin, die deine Exponate ausstellt, mag das gehen.“
Genauso verhält es sich mit der Schreiberei, hatte Alexander Fabuschewski gesagt. Er selbst hat Glück gehabt, hatte bei einem Romanwettbewerb den ersten Preis erhalten. Inzwischen stand sein zweiter Roman vor der Veröffentlichung. Wie gesagt, ein renommierter Verlag. Eigentlich, so dachte er, könnte er sich in diesem Jahr einen längeren Urlaub leisten. Er würde mit Simone darüber reden, nahm er sich vor.
Seit Jahresbeginn wohnten sie zusammen in der Wohnung in der Weißadlergasse, in der sein Vater, Peter Fabuschewski, vorher gelebt hatte. Der war nach Braunfels umgezogen, zu Marina Nowak, deren Vater im Jahr zuvor gestorben war. Heiraten, so hatten sie beide sich übereinstimmend geäußert, wollten sie nicht mehr.
Simone Müller und er, Alexander Fabuschewski, hatten Ähnliches vereinbart. Zusammenleben ja, heiraten nein. Als sie beide darüber gesprochen hatten, amüsierten sie sich über die Wortwahl „vereinbart“.
Simone hatte er bei seinen Recherchen zu dem Roman „Morina“ kennengelernt. Die war damals Schülerin an der Realschule Am Stoppelberg in Wetzlar gewesen. Seit dem Abschluss dort besuchte sie das Hessenkolleg, wollte im Sommer das Abitur machen. Jetzt war sie zweiundzwanzig Jahre alt, fünfundzwanzig Jahre jünger als er. Was ihr Zusammenleben betraf, hatte Alexander Fabuschewski keine Illusionen. Zusammen alt würden sie wohl nicht werden. Er machte sich über ihre Beziehung Gedanken, hatte auch Zeit dazu. Das Café Lebenshilfe war zu seinem Schreibcafé geworden. Das Bistro Am Dom hatte den Besitzer gewechselt und damit auch sein Ambiente verändert.
Den größten Teil seines ersten Romans hatte er dort geschrieben, dazu oft an einem Platz gesessen, von dem aus er sowohl in die Schwarzadlergasse als auch auf den Domplatz blicken konnte. Diese Aussicht, die Einrichtung des Lokals und dessen Gäste hatten ihn beim Schreiben inspiriert. Jetzt fehlten ihm dort alle drei Bedingungen, und so war er an den Eisenmarkt umgezogen. Hier saß er heute in einer Art Erker, hatte den Eisenmarkt und einen Teil der Krämerstraße im Blickfeld.
Wetzlarer Stadtführer behaupten, dass, säße man zehn Stunden am Eisenmarkt, man alle Einwohner Wetzlars getroffen hätte. Schräg gegenüber des Cafés befand sich die Neue Bücherstube. Dort war sein erster Roman kurz nach dessen Erscheinen ausgestellt worden. Nichts ahnend war Alexander eines Vormittags dort vorbeigelaufen. Da sah er sein Buch. Ein ganzer Stapel lag dort auf einem Tischchen. Darüber hatte der Eigentümer des Buchladens eine Vergrößerung der Titelseite angebracht. Alexander war stehen geblieben, genoss das Gefühl, „mein erstes Werk im Buchhandel“. Er war hineingegangen, hatte sich vorgestellt und mit dem Besitzer vereinbart, dass der den Verkauf seines Romans anlässlich der ersten Lesung übernehmen würde. Die fand dann auch drei Wochen später im Café Vinyl, das sich in der Nähe des Schillerplatzes befindet, mit mäßigem Erfolg statt. Etwa fünfzehn Leute waren der Einladung gefolgt.
Heute war einer dieser grauen Februartage, nasskalt wie im November, aber im Unterschied zum Herbst mit positiver Aussicht auf den Frühling.
Zweimal im Jahr litt Alexander unter einer Erkältung, Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, und wie viele Männer in dieser Situation war er dann leidend. Dann wurde ihm auch der Altersunterschied zu Simone bewusst. Eine Frau in seinem Alter, so stellte er sich das vor, würde ihn in diesem Zustand bemuttern. Nicht so Simone, die wollte unterhalten, mochte abends unter Menschen sein.
Aber, so tröstete sich Alexander, was waren schon drei Wochen Leiden im Jahr gegen fünfzig andere. Und doch, das glaubte er zu wissen, eines Tages würde sie gehen. Nur gut, dachte er, dass man nicht weiß, wann „eines Tages“ sein wird. Alexander Fabuschewski war Optimist, bildete er sich ein. Echte Depressionen waren ihm fremd. Deshalb dachte er nun nach vorn, an den Sommer und einen längeren Urlaub.
Simone würde ab dem 9. Juli Ferien haben, so oder so.
Gerade wollte er den Kaffee bezahlen, als er auf dem Eisenmarkt, von der Krämerstraße her kommend, Volker Grün entdeckte, der nun wie unschlüssig stehen geblieben war. Alexander wartete einen Augenblick, bis er glaubte, dass Volker in seine Richtung schaute. Da hob er die Hand und machte ihn durch sein Winken auf sich aufmerksam. Als hätte der darauf gewartet, winkte er zurück und steuerte auf das Café zu.
Volker Grün war ihm ein Freund geworden, seit sie sich im Zusammenhang mit Alexanders Recherchen zu „Michelle“ kennengelernt hatten. Bei Volker hatte er eines Abends Simone wiedergetroffen. Seitdem waren sie zusammen, er und Simone. Die dramatischen Ereignisse im Zusammenhang mit der Festnahme von Klaus Wagner hatte aus der Bekanntschaft eine Freundschaft werden lassen. In den letzten Wochen hatten sie sich ein wenig aus den Augen verloren. Mehrmals hatte Alexander versucht, Volker telefonisch zu erreichen, aber immer ohne Erfolg. Sogleich sollte er den Grund für Volkers Abwesenheit erfahren.
„Hallo Alexander“, rief Volker, als er das Café betreten hatte. Alexander war aufgestanden, um seinen Freund begrüßen zu können. Er spürte die Erwiderung, freute sich aufrichtig über das Wiedersehen. Das sagte er Volker auch, sobald sie sich gesetzt hatten.
„Schön, dich zu sehen Volker, ein paar Mal habe ich schon versucht, dich anzurufen.“
„Kann ich mir denken, Alexander, ich war in der letzten Zeit oft unterwegs.“
Volker machte einen recht aufgekratzten Eindruck. Irgendetwas musste sich ereignet haben, vermutete Alexander, wollte aber nicht so direkt nach den Ursachen dafür nachfragen. Brauchte er auch nicht. „Du erinnerst dich an Charlene Reimann?“
„Na klar, Volker, die Frau mit den schönen Augen.“
„Ja, ja, ich weiß, das habe ich damals so gesagt.“
Charlene Reimann hatte Alexander seinerzeit wichtige Informationen über eine Wetzlarer Burschenschaft beschafft. Sie hatte nicht nur schöne Augen, erinnerte sich Alexander, sie war attraktiv und ihm damals sehr sympathisch gewesen. Auch er hätte sie gerne näher kennengelernt, hätte sie gerne für das Titelbild seines Romans fotografiert. Charlene aber hatte seine Bitte abgelehnt, wegen ihres damaligen Freundes, wie sie sagte.
Einmal war er zusammen mit Volker im Gaudi gewesen, wo Charlene arbeitete, um sich ihr Studium finanzieren zu können. Schon da hatte er bemerkt, dass sich Charlene stets an Volker gewandt hatte, wenn sie beiden etwas erklärte, nachdem Alexander gesagt hatte, dass Volker ein Freund und über den Stand seiner Recherche informiert sei. „Und nun hast du sie näher kennengelernt?“
„Ja, wir waren, wie gesagt, viel zusammen in der letzten Zeit. Demnächst wird sie zu mir ziehen, denn meine Wohnung ist größer als die ihre.“
„Da freue ich mich für dich.“
„Nun aber zu dir, Alexander, wie geht es dir, und was macht Simone?“
Alexander erzählte, und bald hatten sie die zweite Tasse Kaffee getrunken. Zum Schluss verabredeten sie sich zu einem gemeinsamen Abendessen, zu Hause bei Simone und Alexander. „Ich werde kochen“, sagte Alexander, bevor sie sich verabschiedeten.
Zwei
Alexanders Wohnung befand sich in der ersten Etage eines Hauses in der Weißadlergasse. Er stieg die Treppe hoch. Vom Flur aus gelangte man rechter Hand zuerst in die Küche, die zweite Tür führte ins Wohnzimmer. Von der Küche und dem Wohnzimmer aus blickte man hinunter auf die Weißadlergasse. Vom Flur aus linker Hand kam man ins Schlafzimmer und in das Arbeitszimmer. Von hier aus schaute man in einen Hof und auf andere Häuser in Richtung Dom, den man aber nicht sehen konnte.
Er ging zuerst in die Küche, holte sich aus der Vorratskammer eine Flasche Bier, lief zurück ins Wohnzimmer, öffnete beide Fenster und setzte sich in einen Sessel, der gegenüber des einen Fensters stand. Simone war noch nicht zu Hause. Er wollte nachdenken, hatte noch keine Idee für einen neuen Roman. Und wie das so ist mit den Ideen, man hat sie oft dann nicht, wenn man sie braucht. Doch dann, unvermutet, als das Ergebnis sich kreuzender Gedankengänge, erscheinen sie, wie aus dem Nichts. Jedoch nur dann, wenn man denkt. Alexander überlegte, was er kochen könnte. Und plötzlich, wie gesagt, aus dem Nichts, taucht sie auf, die Erinnerung an schöne Tage in Straßburg. Eine Reportage über das Europaparlament hatte er schreiben sollen, und Sylvia war als Fotografin mitgefahren. Woher sie die Fotos dann letztendlich hatte, war Alexander ein Rätsel geblieben. Er jedenfalls hatte den Artikel erst geschrieben, als sie schon wieder zu Hause gewesen waren. Die nötigen Informationen stammten aus dem Internet.
In Straßburg hatten sie das Hotel nicht verlassen und das gemeinsame Zimmer beziehungsweise das Bett nur zum Essen. An einem Abend hatte sie aus der Speisekarte Elsässer Flammkuchen gewählt. Der hatte ihnen so gut geschmeckt, dass er nach dem Rezept gefragt hatte. Der Zettel musste noch in seinen alten Unterlagen zu finden sein. Bald fand er den Ordner und in ihm den Zettel. Zuerst der Einkauf. Er benötigte Dörrfleisch, saure Sahne und Schmand, Zwiebeln, Salz, Knoblauch und Brotteig.
Den Brotteig bekam er erst in der dritten Bäckerei am Schillerplatz. Er hätte natürlich den Teig auch selbst herstellen können, doch in gewisser Weise neigte Alexander Fabuschewski zur Bequemlichkeit, und weil er beides schon einmal ausprobiert hatte, war er der Ansicht, dass der Brotteig aus einer Bäckerei vom Geschmack her besser geeignet war, als der selbst hergestellte.
Wieder zu Hause angekommen, begann er sofort mit den Vorbereitungen. Das Backblech bestrich er mit Olivenöl, heizte den Ofen auf zweihundert Grad vor, rollte den Teig auf Mehl aus, legte ihn auf das Blech und passte ihn dessen Form an. Das Dörrfleisch schnitt er in möglichst dünne Scheiben und die Zwiebeln in Ringe. Die saure Sahne mit Schmand und Käseresten, mit Knoblauch, Salz und Schnittlauch vermischt, verteilte er gleichmäßig auf den Teig im Backblech, belegte die Fläche mit den Zwiebelringen und dem Dörrfleisch. Jetzt drosselte er die Temperatur im Backofen auf hundertsiebzig Grad und schob das Blech hinein. Er rechnete mit einer knappen Stunde an Backzeit.
Bereits nach den ersten Bissen lobten alle seine Kochkunst. „Manchmal frage ich mich, warum ich eigentlich schreibe.“
Volker schaute ihn verwundert an. „Schreibst du nicht, um Geld zu verdienen?“
„Das auch, Volker, aber fragt sich denn nicht jeder irgendwann, warum er diese oder jene Arbeit macht?“
„Natürlich, da hast du recht. Auch ich überlege manchmal, schon während meines Unterrichts, ob die, die da vor mir sitzen, überhaupt etwas lernen wollen. Und oft glaube ich, diese Frage mit einem glatten Nein beantworten zu können. Da frage ich mich natürlich, warum ich das überhaupt tue.“
„Genau, Volker, so habe ich das gemeint.“
Simone und Charlene hatten bisher nur zugehört. Jetzt mischte sich Simone ein. „Also, ich stelle mir die Frage in dieser Weise nicht. Ich lerne, um ein bestimmtes Ziel erreichen zu können.“
„Genauso geht es mir auch, Simone“, bestätigte Charlene.
Es entstand eine Pause. Alexander dachte über das nach, was die beiden Frauen gesagt hatten. „Ihr seid in einer anderen Situation, weil ihr euer Berufsziel noch nicht erreicht habt.“
„Doch, Alexander, nur stelle ich mir die Frage anders. Ich frage mich manchmal, warum ich dieses oder jenes überhaupt lernen muss.“
„Sicher, Charlene, das frage ich mich auch manchmal, aber zu deiner Frage, Alexander, hast du darauf schon eine Antwort gefunden?“
„Nein, ihr seid aber Leserinnen. Mich interessiert schon, warum ihr lest.“
„Das kommt darauf an, was ich lese“, wandte Charlene ein.
„Ich verstehe, Sachbücher, um zu lernen, aber warum liest du einen Roman?“
„Einfach nur so, um mich zu unterhalten.“
„Nur darum?“
„Ja, manchmal nur darum.“
„Und die anderen Male?“
„Wenn ich jetzt sage, auch um etwas zu lernen, dann klingt das vielleicht doch etwas blöd, aber ich meine da eine andere Art zu lernen. Im Moment fällt mir aber kein Beispiel dazu ein.“ Wieder entstand eine Pause.
„Ich will es versuchen. Wir sind beim Essen. Vielleicht ein Beispiel dazu.“ Alexander hatte Messer und Gabel auf seinen Teller gelegt, aus dem Weinglas getrunken, den Stuhl ein wenig nach hinten geschoben und seine Beine übereinandergeschlagen. „Vor Kurzem saß ich im Einkaufszentrum Forum in einem der Cafés. An einem Tisch, mir gegenüber, saßen vier Männer, alle so um die dreißig. Sie aßen, und ihre Essweise unterschied sich nur darin, dass sich ihre Köpfe beim Aufnehmen der Speise in unterschiedlicher Höhe zum Teller befanden. Alle vier benutzten nur die Gabel, die sie in der rechten Hand hielten, etwa so, wie man einen Hammer hält. Ihren linken Unterarm hatten sie komplett auf den Tisch gelegt, wie um ihren Teller vor fremdem Zugriff zu schützen. Nur einer der Männer löste beim zum Mundführen der Gabel seinen rechten Ellenbogen von der Tischplatte. Ihr versteht, was ich meine?“
„Sie saßen also etwa so“, sagte Volker und versuchte die von Alexander beschriebene Sitzhaltung nachzuahmen.
„Genau so, Volker.“
„Jetzt komm schon zur Sache, Alex.“ Simone schien ungeduldig zu werden.
„Da bin ich doch die ganze Zeit. Wenn ich das so beschreibe, was will ich erreichen, wenn ich diese Art zu essen einer Person meiner Handlung zuordne?“
„Ich denke, sie soll dem Leser unsympathisch erscheinen.“
„Und wenn der Leser auf dieselbe Weise isst?“
Jetzt ergriff Charlene das Wort. „Na ja, die Art zu essen wird ja nicht das einzige Charaktermerkmal sein, mit dem du beim Leser eine Antipathie gegen die Person erzeugen willst.“
„Jetzt verstehe ich, was du meinst, Alexander. Du machst die Person, indem du ihre Tischsitten beschreibst, in den Augen der Leser zum Kotzbrocken. Der Leser oder die Leserin, die in gleicher Weise die Gabel zum Mund führt, soll sich deinen Hinweis zu Herzen nehmen und sofort bei der Volkshochschule einen Kurs buchen: ‚Wie gebrauche ich beim Essen Messer und Gabel richtig‘. Sie hat also beim Lesen deines Romans etwas gelernt.“
Alexander kannte Simone, was ihre Art, die Ironie zu gebrauchen, betraf, recht gut. Also ging er darauf ein.
„Genau, Simone, so meine ich das. Und was deinen Freund Goethe betrifft“, Alexander spielte auf eine Arbeit an, die Simone im Fach Deutsch an ihrer Schule gefertigt hatte, „ist ja bekannt, dass der eine politisch operative Funktion der Literatur ablehnte. Diese sollte nicht, wie er sich ausdrückte, zu einem unmittelbaren, irdischen Zwecke, sondern zu einem höheren, geistigen, allgemeinen Zweck dienen.“
Charlene und Volker blickten eher skeptisch drein. Dann sagte Volker, indem er darauf einging: „Sie hörten ein Gespräch zum Thema ‚die Literatur als Lebenshilfe‘.“
„Im Ernst, Volker, ich denke schon, dass man auch aus einem unterhaltsamen Text etwas lernen kann.“
„Vielleicht, Alexander.“ Eine Zeit lang schwiegen alle, und es hatte den Anschein, dass sich keiner mehr zu dem Thema äußern wollte. Gemeinsam hatten sie abgeräumt, das Geschirr in die Spülmaschine gestellt. Jetzt saßen sie im Wohnzimmer. Alexander hatte eine Flasche geöffnet. Simone berichtete von einem Film, den sie im Fernsehen gesehen und der sie beeindruckt hatte. Ein alter Mann, schon recht gebrechlich, erfährt, dass sein Bruder, den er schon Jahre nicht mehr gesehen hat, einen Schlaganfall erlitten hätte. Im Streit seien sie seinerzeit auseinandergegangen.
„Ohne dass viel gesprochen wird, merkt der Zuschauer bald, dass der Mann eine Reise zu seinem Bruder plant. Zuerst sieht man ihn auf seinem Rasentraktor sitzend Gras mähen. Dann schraubt er an einem Einachser Anhänger herum, konstruiert eine Dachverkleidung. Der Zuschauer erkennt, dass der Mann vorhat, mithilfe des Rasentraktors und angekuppeltem Anhänger, seinen Bruder zu besuchen. Durch ein Gespräch zwischen dem Alten und einem Freund wird deutlich, dass es sich um eine lange Reise über mehr als eintausend Kilometer handelt. Alle Warnungen in den Wind schlagend, macht der Alte sich schließlich auf den Weg. Allen Widrigkeiten und Hemmnissen zum Trotz erreicht er schließlich das Haus seines Bruders. Der tritt in dem Moment, als er ankommt, vor die Haustür. Die beiden schauen sich nur an, und in ihrer Mimik erkennt man die Versöhnung.“
„Was waren das für Widrigkeiten und Hemmnisse“, fragt Alexander nach.
„Ein Unfall, ein Schaden am Traktor, aber immer lernt der alte Mann Leute kennen, die ihn aufnehmen und ihm weiterhelfen. Ein modernes Märchen eben.“
Noch Tage später ging Alexander die Geschichte nicht aus dem Kopf, zumal sie ihn an ein eigenes Vorhaben erinnerte. Eines Abends, sie lagen schon im Bett, erzählte er Simone davon. „Ich sah vor einem Haus in Solms einen Traktor stehen. An dessen Frontseite hing ein Schild, dass das Fahrzeug eintausend Euro kosten sollte. Am Kühlergrill der Hinweis auf die Höchstgeschwindigkeit: zwanzig Kilometer pro Stunde. Da kam mir die Idee, dass man an diesen Traktor einen zum Wohnwagen ausgebauten Bauwagen hängen und damit über Land reisen könnte.“
„Und bei der Idee ist es geblieben?“
„Ja, schon, trotzdem wäre das doch eine Möglichkeit, einfach mit unbekanntem Ziel loszufahren, abends irgendwo anzuhalten, zu übernachten, um am nächsten Morgen weiterzufahren. Stell dir vor, zwanzig Stundenkilometer, schnell genug, um weiterzukommen und langsam genug, um schauen zu können.“
„So einfach geht das aber nicht. Der alte Mann im Film hatte deshalb einen Unfall, weil er auf einer abschüssigen Strecke mitsamt seinem Rasentraktor vom Auffahrgewicht des Anhängers in den Straßengraben gedrängt worden ist. Das bedeutet, der Bauwagen müsste, ähnlich wie ein Wohnwagen, mit einer Auflaufbremse, so heißt das, glaube ich, ausgerüstet sein.“
„Meine Güte, Simone, du kennst dich ja aus.“
„Das hat der Werkstattleiter in dem Film dem Alten so erklärt.“
„Na ja, dann war das eben nur so eine Idee. Ich habe mir das einfach nur so vorgestellt, wie ich den Bauwagen ausbauen würde. Mit einem Ofen, den man mit Holz beheizen kann, einem breiten Bett, einer Küchenzeile und einer gemütlichen Sitzgruppe.“
„Und ich, während der Fahrt auf der harten Beibank des Traktors, mit Dirndlkleid und Kopftuch als Bäuerin verkleidet.“
„Na klar, und hin und wieder verrutscht der Rock, und ob der Geschwindigkeit kann ich mir einen längeren Blick nach rechts erlauben und erkenne, dass du wieder einmal vergessen hast, einen Slip anzuziehen.“
„Schön, dann halten wir einfach rechts der Straße an und ziehen uns in das Innere unserer Behausung zurück. Später stellen wir dann fest, dass du vergessen hast, eine Toilette einzubauen.“
„Das macht doch nichts, denn der Wald hat Büsche. Und außerdem könnten wir doch abends einen Campingplatz ansteuern.“
„Apropos Toilette“, sagte Simone, „ich muss mal“, sprang aus dem Bett und lief mehr, als dass sie ging, in Richtung Bad. Im Bett liegend, war ihr das Hemd wohl hochgerutscht, denn nun fiel es ganz langsam wieder zurück über ihren nackten Hintern. Wenn sie zurückkommt, dachte Alexander, werden wir wohl nicht weiter über Traktor und Bauwagen reden.
Und auch sobald sollte er nicht mehr daran denken, denn am nächsten Morgen, kaum dass er begonnen hatte, die Regionalzeitung zu lesen, inspirierten ihn zwei Artikel zu einer neuen Schreibidee. Wie immer wie aus heiterem Himmel. Und sofort stellte er zwischen beiden Texten eine Verbindung her, die ihm den Kern einer Geschichte andeuteten.
Simone war schon in der Schule, und so begab er sich sogleich in sein Arbeitszimmer, schnitt beide Artikel aus der Zeitung aus und heftete sie in einiger Entfernung zueinander an die Clusterwand, die er von seinem Vater übernommen hatte. Auch der arbeitete gerne nach dieser Methode, die im Gegensatz zur herkömmlichen Stoffsammlung eine Visualisierung möglicher Textbestandteile erlaubte. Beide Zeitungsartikel verband er durch Pfeile und notierte auf die Pfeillinien ein paar Stichpunkte. Seinen Computerarbeitsplatz hatte er sich so eingerichtet, dass er beim Schreiben die Clusterwand im Blick hatte.
„Da haben wir beide zum gleichen Zeitpunkt eine Idee gehabt“, sagte Volker Grün, als sie sich tags darauf bei Volker zu einem Kaffee getroffen hatten. Zuerst hatte Alexander erzählt, vom Traktor, dem Bauwagen und seiner Schreibidee. Die gefiel Volker besonders gut.
„Und ich sage dir, Alexander, da hat Simones Filmerzählung doch einiges bewirkt.“ Nun stellte er seine Idee vor, und Alexander war sofort von ihr eingenommen.
„Darüber müssen wir reden, Volker, und vielleicht sind Simone und Charlene ebenso davon angetan, wie wir beide.“
Sie verabredeten sich für den Abend bei Volker und Charlene in deren Wohnung in der Obertorstraße. Volker wollte beim Wirt am Dom Pizza bestellen, und Alexander versprach, Wein mitzubringen.
„Ich weiß, dass du lieber Bier magst, Alexander, aber das habe ich zu Hause.“
Er ließ Simone über den Grund im unklaren, als er ihr sagte, dass Volker sie für den Abend eingeladen hätte.
„Also, das ist so“, begann Volker, als sie gegessen hatten, „ihr erinnert euch doch an den Film, von dem Simone neulich erzählt hat?“
„Und ob“, sagte Simone, die wohl kaum erinnert werden musste.
„Alexander berichtete mir vor Kurzem von einer ähnlichen Idee, nur dass es hier um einen Traktor mit angehängtem Bauwagen ging.“
„Davon hat er mir erzählt, Simone, doch ich habe da einen viel besseren Vorschlag.“
„Nun spanne uns doch nicht so lange auf die Folter“, sagte Charlene, die bisher geschwiegen hatte.
„Genau, Volker“, äußerte sich nun auch Simone etwas ungeduldig.
„Also, das ist so ...“
„Ja, das hast du ja schon gesagt.“
„Ihr kennt doch die Lahn?“
„Volker, es reicht jetzt, natürlich kennen wir die Lahn.“
„Um es kurz zu machen, was haltet ihr von einer gemeinsamen Floßfahrt die Lahn abwärts bis nach Lahnstein?“
Drei
„Eh, ja“, Charlene war die Erste, die sich gefasst hatte, „was meinst du mit einer Floßfahrt?“
„Wie der Name schon sagt, ein Floß, das sind aneinandergebundene Baumstämme, das mithilfe eines Ruders flussabwärts gelenkt wird.“
„Alexander, ich weiß, was ein Floß ist, nehme aber an, dass du dieses traditionelle Wasserfahrzeug nicht meinst.“
Alexander bemerkte den aufkommenden Ärger in Charlenes Stimme und lenkte ein. „Entschuldige, Charlene, so war das nicht gemeint, und du hast natürlich recht damit, dass ich ein solches Gefährt nicht gemeint habe.“
Simone und Volker hatten sich entspannt zurückgelehnt, beobachteten wieder einmal belustigt die kleine Auseinandersetzung zwischen Alexander und Charlene. Gewollt oder ungewollt, sie wussten es nicht, gerieten Alexander und Charlene des Öfteren aneinander. Nicht ernsthaft, wie es sich beide hinterher einander versicherten. „Dann sag doch einfach, was du meinst, Alexander.“ Und da war es auch schon, das Lächeln, mit dem Charlene Alexander immer wieder zu besänftigen wusste.
„Genau weiß ich das selbst noch nicht, ich denke an eine Plattform, auf leere Ölfässer montiert.“
„Und damit willst du von hier aus bis zur Lahnmündung schippern?“
Alexander glaubte, in Volkers Frage bereits einen Ton von Interesse zu erkennen. Das Kind im Manne, eine Eigenschaft, die er an seinem Geschlecht hoch einschätzte. So wie sich Frauen oft bis ins hohe Alter ein gewisses Maß von positiver Albernheit, wie er es nannte, bewahren können, geben Männer gerne einem Spieltrieb abenteuerlicher Art nach. „Kannst du das mit der positiven Albernheit bitte etwas näher erläutern?“
Kaum dass er das gesagt hatte, reagierte nun auch Simone angriffslustig. Alexander konterte. „Jedes Ding hat zwei Seiten. Nehmen wir einmal die Faulheit ...
‚Faulheit jetzo will ich dir
Auch ein kleines Loblied bringen. –
O – wie – sau – er – wird es mir, –
Dich – nach Würden – zu besingen!
Doch, ich will mein Bestes tun,
Nach der Arbeit ist gut ruhn.
Höchstes Gut, wer Dich nur hat,
Dessen ungestörtes Leben –
Ach! – ich – gähn – ich – werde matt –
Nun – so – magst du – mir’s vergeben,
dass ich Dich nicht singen kann;
Du verhinderst mich ja dran.‘“
„Alexander, du brauchst mir jetzt nicht Lessings ‚Lob der Faulheit‘ zu erklären.“
„Das wollte ich auch nicht, Simone, aber ich wusste gar nicht, dass ihr heute noch Gedichte auswendig lernen müsst. Es geht ja um Albernheit. Ich erinnere mich da an meine Schulzeit. Da kam es oft zu regelrechten Lachorgien, wenn zwei Mädchen sich gut verstanden, bedurfte es eines nichtigen Anlasses, und sie begannen zu lachen. Und gerade dann, wenn das Lachen unerwünscht war, zum Beispiel während des Unterrichts, konnten sie damit nicht aufhören. Nur unter dem Zwang, sich nicht anzuschauen, kamen sie zur Ruhe. Aber kaum, dass sich ihre Blicke trafen, begann ihr Gelache von Neuem. Ich denke heute, dass das ein Ausdruck von Lebensfreude und Unbekümmertheit war. Mit der Zeit, zur Frau geworden, diszipliniert, wird die Albernheit zur Ausnahme. Und doch, zum Glück, würde ich sagen, passiert es Freundinnen manchmal bis ins hohe Alter. Und was die Spiellust der Männer betrifft“, und dabei schaute er zu Volker hinüber, „wünschte ich mir noch für lange Zeit entsprechende Ideen.“
„Mischt sich da nicht aber die Lust am Spiel mit der am Abenteuer?“
„Ich denke schon.“
Es entstand eine Pause, und Alexander hoffte, dass die anderen über seinen Vorschlag nachdachten. Er selbst entwickelte bereits gedanklich erste Planansätze. Die Plattform, auf die Fässer montiert, sollte so groß sein, dass ein Zelt und eine fest auf ihr installierte Sitzgruppe Platz fänden. Das Lenkruder sollte von ihr aus bedienbar sein. Auch ein kleiner Außenbordmotor war denkbar. Alexander bemerkte, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren. Aus seinen Gedanken gerissen, schaute er sie der Reihe nach an. Keine Ablehnung nahm er in ihren Augen wahr. „So wie ihr mich anschaut, fasse ich das als eine Aufforderung auf, meine Idee näher zu erläutern?“
„Ich denke schon.“
Volker war der Erste, der sich äußerte. „In Ordnung, Alexander, lass hören.“ Das war Simone.
„Ich will mich auch nicht verweigern“, schloss sich Charlene den anderen an.
Und als ob er schon lange über das Projekt nachgedacht hätte, unterbreitete er ihnen nun seine ersten Vorstellungen.
„Eine Reling darf natürlich nicht fehlen“, ergänzte Simone, als er geendet hatte. Kein Widerspruch von den anderen.
„Dann fasse ich das als eine Art Zustimmung auf?“
„Bei mir kannst du davon ausgehen.“
„Bei mir auch.“
„Ich bin dabei.“
Das hatte er nicht erwartet. Um so mehr freute ihn ihr spontan geäußertes Einverständnis. „Na dann fangen wir doch am besten gleich mit dem Zeitplan an.“
Als sich Simone und Alexander später von den beiden anderen verabschiedeten, hatten sie bereits eine erste Aufgabenverteilung vorgenommen. Auf dem Weg zur Weißadlergasse und noch im Bett sprachen sie von nichts anderem.
Vier
In der Bachweide, an der Lahn gelegen, gab es einen Ruderverein, mit Bootshaus und Freigelände. Da fuhr Alexander Fabuschewski am Montagvormittag hin. Seltsamerweise musste er an Charlene denken, und er erinnerte sich daran, dass er, als er ihr in Marburg zum ersten Mal begegnete, sie gerne näher kennengelernt hätte. Inzwischen waren sie Freunde geworden, nicht zuletzt deshalb, weil sie ähnliche politische Ansichten vertraten. Auch als Frau hatte sie ihn fasziniert, und anfangs hatte er sich mehr als eine Freundschaft erhofft. Oft schon hatten sie über vergangene und gegenwärtige Kriege gesprochen und waren sich darin einig, dass denen immer entsprechende Lügen vorausgegangen waren. Beide befürchteten einen neuen Krieg, den die USA und ihre verbündeten Staaten gegen den Iran zu führen gedachten. Was noch fehlte, war eben eine entsprechende Kriegslüge, die die Menschen und vor allen Dingen die Soldaten glauben machen würde, dass eine militärische Lösung der Probleme unumgänglich sei.
Alexander war so in seinen Gedanken versunken, dass er beinahe die Straße verpasst hätte, die zur Bachweide führte. Bald hatte er das eingezäunte Gebiet erreicht. Er stellte sein Auto in der Nähe des Tores ab, stieg aus und hielt nach einer Person Ausschau, der er sein Anliegen vortragen konnte. Doch niemand war zu sehen. Er umrundete das Gelände einmal, hatte aber auch dabei niemanden entdecken können. Unschlüssig stand er nun wieder am Tor, als er sich an die Telefonnummer erinnerte, die er auf der Internetseite des Ruderklubs gefunden hatte. Schon nach dem zweiten Klingeln meldete sich eine Männerstimme mit Namen, für heutige Telefongewohnheiten eher ungewöhnlich.
Alexander brachte kurz sein Anliegen vor. Zu seiner Freude erklärte der Mann, ein Herr Mühlberg, dass er schon so gut wie auf dem Weg zum Ruderklub sei, und bat Alexander, dort auf ihn zu warten, da sich vor Ort doch alles besser besprechen ließe. In etwa zwanzig Minuten sei mit seinem Eintreffen zu rechnen.
„Eine gute Idee“, sagte Mühlberg, als Alexander seine Ausführungen beendet hatte. „Und woher wollen Sie die Materialien bekommen?“
„Es gibt da bei Löhnberg einen Schrottplatz, dort sah ich vor einiger Zeit, als ich nach einer gusseisernen Pfanne Ausschau gehalten habe, gut erhaltene Blechfässer, die wir als Schwimmer nutzen könnten.“
„Da scheinen Sie ja schon gezielte Vorstellungen zu haben.“
Alexander hätte eigentlich nichts dagegen gehabt, noch weiter über ihr Vorhaben zu plaudern, wollte aber jetzt vorrangig mit Mühlberg über eine mögliche Nutzung des Ruderklubgeländes reden. Der schien seine Gedanken erraten zu haben.
„Ich muss natürlich noch mit unserem Vorstand sprechen, kann mir aber kaum vorstellen, dass der Ihr Anliegen ablehnen wird, zumal wir in der glücklichen Lage sind, ausreichend Platz zu haben.“
Sie saßen vor dem Bootshaus auf einer Terrasse. Dort hatte man wohl in Erwartung schönerer Tage einige Tische und Stühle aufgestellt.
„Alkoholfreies Bier, bitte“, hatte Alexander auf die Frage Mühlbergs geantwortet.
„Na dann wollen wir mal schauen, welchen Platz ich unserem Vorsitzenden vorschlagen werde.“ Mühlberg bat Alexander, ihm zu folgen. Bald hatten sie eine Stelle am Fluss erreicht, wo in den Boden eingelassene Holzbalken eine Art Rutsche ergaben.
„Hier haben wir früher die großen Boote zu Wasser gelassen. Ich denke, dass etwa vier Meter in der Breite für Ihre Zwecke ausreichend sind. Unsere neue Slipanlage befindet sich direkt unterhalb des Bootshauses. Diese hier nutzen wir nicht mehr.“
„Ein idealer Platz für unser Vorhaben, Herr Mühlberg. Hoffentlich gibt es da seitens Ihres Vorstandes keine Einwände.“
„Ich glaube kaum, Herr Fabuschewski. Lassen Sie mir Ihre Telefonnummer da, dann melde ich mich bei Ihnen, sobald ich Näheres in Erfahrung gebracht habe.“
Da müssen wir eben abwarten, dachte Alexander und gab Mühlberg die Hand, wollte sich schon verabschieden, da näherte sich ihnen ein Mann mit einem Hund an der Leine, den er mehr oder weniger hinter sich herzog. „Sie müssen mir helfen“, rief der Mann schon aus der Entfernung. Als er Mühlberg und Alexander erreicht hatte, wandte er sich in Richtung des Lahnufers und deutete mit der Hand auf eine Stelle flussabwärts.
„Da liegt ein Toter“, rief der Mann und fasste sich dabei mit der rechten Hand auf die linke Brustseite.
„Nun beruhigen Sie sich erst einmal“, sagte Mühlberg, griff den Mann wie stützend an den Arm und führte ihn in das Innere des Bootshauses. Dort ließ er ihn Platz nehmen. Der Hund, ein Schäferhund, war widerstandslos gefolgt und nahm nun ebenfalls zu Füßen seines Herren Platz.
„Er hängt an einem Ast“, begann der Mann, „muss sich dort verfangen haben.“
Mühlberg hatte bereits den Telefonhörer in der Hand und wählte eine Nummer. Zehn Minuten später, der Mann hatte ständig diesen einen Satz wiederholt: „Ein Toter in der Lahn, er hängt an einem Ast“, trafen Polizei und Feuerwehr gleichzeitig ein. Ein Polizist kam zu ihnen, und Mühlberg erstattete Bericht, militärisch kurz und knapp. Dabei wies er auf den Spaziergänger, den der Polizist dann bat, ihm zu folgen. Und wieder der eine Satz: „Ein Toter in der Lahn, er hängt an einem Ast.“
Alexander sah zwei Feuerwehrleute, die in Taucheranzügen dem Lahnufer zustrebten. Kurz darauf folgten Männer mit einer Trage, die abwartend am Ufer stehen blieben. Alexander wurde in dem allgemeinen Trubel nicht beachtet. Er setzte sich auf eine Bank, von der aus er die Bergungsarbeiten beobachten konnte. Bald sah er die Männer mit der Trage zu einem der Feuerwehrfahrzeuge streben. Dann, so plötzlich die Aktion begonnen hatte, war sie auch wieder beendet.
Alexander wartete, bis das letzte Fahrzeug das Bootsgelände verlassen hatte, dann ging er noch einmal zum Bootshaus, wo er Mühlberg traf, der in der Eingangstür stand. „Sie haben sicherlich Genaueres herausbekommen?“
„Das können Sie glauben, ich war nicht umsonst Oberfeldwebel bei den Feldjägern.“
Obwohl Mühlberg Alexanders Interesse registriert hatte, wollte er sich wohl extra bitten lassen. Alexander tat ihm den Gefallen. „Sie haben nicht feststellen können, wer der Tote ist. Der Mann wird jetzt in der Gerichtsmedizin untersucht, obduziert nennt man das wohl. Nach der ersten Untersuchung gab es keine Anzeichen von Gewalt. Die Leiche soll allerdings schon mehrere Wochen in der Lahn gelegen haben, denn sie war schon mit einer zentimeterdicken Erdschicht bedeckt. Der Mann mit dem Hund hatte wohl nur den Kopf gesehen. Das war’s, Herr Fabuschewski. Jetzt haben Sie Ihren Freunden was zu erzählen. Mich müssen Sie aber jetzt entschuldigen, muss natürlich einen Bericht schreiben.“
Alexander hatte verstanden, verabschiedete sich und wollte schon gehen, als ihm einfiel, dass er Mühlberg noch seine Telefonnummer geben musste. Er nahm sein Notizbuch aus der Tasche, schrieb Adresse und Telefonnummer auf eine Seite, riss sie heraus und gab sie Mühlberg. Der nahm sie in die Hand, schaute zuerst etwas verständnislos, erinnerte sich dann aber. „Ach so, ja richtig. Ich melde mich bei Ihnen. Bis dann also, Herr Fabuschewski.“
Fünf
Nun waren die technischen Voraussetzungen zu klären. Auch diese Aufgabe hatte Alexander übernommen. So verschob er am nächsten Morgen seinen schon zur Tradition gewordenen Spaziergang durch die Colchesteranlage. Oft war es dabei nicht bei einem gemütlichen Gang geblieben. Er hatte sich einen Laufrhythmus angewöhnt, einhundert Schritte laufen, einhundert Schritte gehen. Von Mal zu Mal hatte er dabei das Tempo erhöht.
Aber wie gedacht, wollte er heute nach Löhnberg fahren. Vor einiger Zeit schon hatte er von einem Bekannten, einem Bildhauer, erfahren, dass es dort einen, wie der sich ausdrückte, gut sortierten Schrottplatz gäbe. Schon einmal war er dort gewesen und konnte sich von der Richtigkeit der Aussage überzeugen. Und wieder, wie am Vortag in der Bachweide, hatte er Glück. Kurz hinter dem Eingang des Schrottplatzes, neben einer Fahrzeugwaage, stand ein Mann, den Alexander Fabuschewski auf gut Glück hin ansprach.
Der Mann, Herr Osfath, wie der sich ihm später vorstellte, war der Besitzer der Anlage. Ein freundlicher Mensch, zu dem Alexander sofort Vertrauen schöpfte. Deshalb berichtete er sofort von ihrem Vorhaben, mit einem Floß von Wetzlar aus lahnabwärts bis zur Mündung des Flusses in den Rhein fahren zu wollen.
„Ich vermute“, sagte Osfath, als Alexander geendet hatte, „Sie wären nicht hier, wollten Sie ein Floß aus Holzbalken bauen?“
„Richtig, wir dachten an eine Art Katamaran, bestehend aus leeren Ölfässern, Profilblechen und Holzplanken.“
„Das habe ich auch gleich vermutet, als Sie begannen, davon zu berichten. Wie viele solcher Fässer werden Sie benötigen?“
Alexander gefiel Osfaths Art, ohne viel drum herum zu reden, zur Sache zu kommen. „Ich denke, das hängt auch von der Größe der Fässer ab, vielleicht sechs, drei für jede Seite.“
„Da wollen wir mal sehen“, sagte Osfath und ging voraus. Alexander folgte ihm zum hinteren Teil des Platzes. Schon von Weitem sah er sie stehen. Doch leider, als sie näher herankamen, zählte er nur vier Stück, jede etwa einen Meter hoch. Als hätte Osfath seine Enttäuschung bemerkt, erklärte der, dass ihm diese Art Fässer ständig angeboten würden. Er schlug Alexander vor, dass dieser eine Materialliste erstellen solle. Dann könne er entsprechende Teile beiseitelegen lassen, sobald sie einträfen. Die vier Fässer seien schon mal gebongt.
Nun hatte Alexander zweimal hintereinander Erfolg gehabt. Er hatte einen Platz an der Lahn gefunden, wo sie das Floß bauen und zu Wasser lassen konnten und einen ihnen wohlgesonnenen Schrotthändler, der ihnen bei der Materialbeschaffung behilflich sein wollte. Er freute sich schon auf den Abend, auf das Treffen mit Charlene und Volker. Fast schon vergessen waren die Ereignisse um den Leichenfund an der Lahn.
Eine Woche später erhielten sie Nachricht von Osfath. Sechs Ölfässer hätte er nun da und alle in derselben Größe. Inzwischen war auch vom Ruderklub eine positive Nachricht eingegangen. Mühlberg übermittelte das Einverständnis des Rudervereinsvorstandes, der ihnen erlaubte, auf dem mit Mühlberg vereinbarten Platz das Floß zu bauen. Zugleich wurde ihnen genehmigt, dort zu zelten, sollten sie mehrere Tage hintereinander arbeiten wollen. Keine Rede von Gebühren.
Volker Grün besaß einen Pkw mit Anhängerkupplung und hatte jemanden ausfindig gemacht, der ihnen zu Transportzwecken seinen Anhänger überlassen wollte. Am Freitagnachmittag machten sich Volker und Alexander auf den Weg, um erstmals Material von Löhnberg in die Bachweide zu transportieren. Volker hatte sich darüber informiert, wie die Ölfässer und die Plattform miteinander zu verbinden seien. In einem Betonwerk in der Nähe von Ehringshausen hatte er sich einweisen lassen. Man verwendet dort ein Hochleistungs-Stahlumreifungsbänder-System, um Betonelemente auf Paletten transportfähig zu machen. Die Stahlbänder hatte er dort gekauft, das Spann- und Verschlusswerkzeug hatte man ihm gegen eine Gebühr geliehen. Sie hatten vor, zunächst die Ölfässer mit Profilblechträgern zu verbinden, jeweils drei Fässer auf eine Länge von sechs Metern auf jeder Seite. Dazu mussten die Profilblechträger auf die Gesamtlänge zusammengeschraubt werden. Das Material hatten sie im Anhänger verstaut, die Zeltausrüstung im Kofferraum.
Von Samstag auf Sonntag wollten sie eine gemeinsame Probenacht an der Lahn verbringen. Man hatte ihnen erlaubt, einen von außen erreichbaren Dusch- und Toilettenraum im Klubgebäude zu benutzen. Der Schlüssel dazu befände sich unter der Fußmatte vor dem Eingang, hatte Mühlberg gesagt.