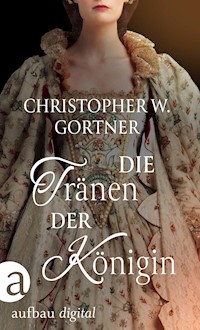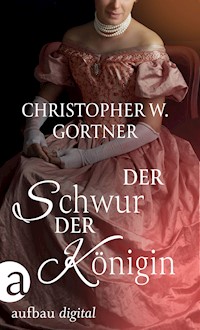10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe
- Sprache: Deutsch
Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
Wie im Rausch erkundet die junge Marlene die wilden Nächte Berlins. Sie liebt, wen immer sie begehrt, und wird mit „Der blaue Engel“ zum Star. Bald feiert man sie in Hollywood als glamouröse Diva. Ihr Streben nach Selbstbestimmung lässt Marlene jedoch immer wieder anecken, und auch in der Liebe bleibt sie auf der Suche – bis sie dem Schauspieler Jean Gabin begegnet. Doch dann zieht Marlene mit den amerikanischen Truppen an die Front – und die Rückkehr in das zerstörte Deutschland wird zu ihrem persönlichen Drama ...
Eine große Geschichte über Leidenschaft und Kunst, eine Welt im Wandel – und die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über C. W. Gortner
C. W. Gortner wuchs in Südspanien auf. In Kalifornien lehrte er an der Universität Geschichte mit einem Fokus auf starke Frauen inder Historie. In Marlene Dietrich erkannt er eine so "stürmische wie unkonventionelle und mutige Frau", dass er einfach über sie schreiben musste. Er lebt in San Francisco.
Mehr Informationen zum Autor unter www.cwgortner.com
Christine Strüh übertrug u.a. Kristin Hannah, Gillian Flynn und Cecelia Ahern ins Deutsche. Sie lebt in Berlin.
Informationen zum Buch
Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt
Wie im Rausch erkundet die junge Marlene die wilden Nächte Berlins. Sie liebt, wen immer sie begehrt, und wird mit „Der blaue Engel“ zum Star. Bald feiert man sie in Hollywood als glamouröse Diva. Ihr Streben nach Selbstbestimmung lässt Marlene jedoch immer wieder anecken, und auch in der Liebe bleibt sie auf der Suche – bis sie dem Schauspieler Jean Gabin begegnet. Doch dann zieht Marlene mit den amerikanischen Truppen an die Front – und die Rückkehr in das zerstörte Deutschland wird zu ihrem persönlichen Drama.
Eine große Geschichte über Leidenschaft und Kunst, eine Welt im Wandel – und die Liebe
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
C. W. Gortner
Marlene und die Suche nach Liebe
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Christine Strüh
Für meinen Vater
»Im Herzen bin ich ein Gentleman.«
Marlene Dietrich
Inhaltsübersicht
Über C. W. Gortner
Informationen zum Buch
Newsletter
Erste Szene: Das Schulmädchen 1914–1918
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Zweite Szene: Geigenunterricht 1919–1921
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Dritte Szene: Probeaufnahme 1922–1929
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Vierte Szene: Der blaue Engel 1930
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Fünfte Szene: Göttin der Begierde 1931–1935
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Sechste Szene: Die höchstbezahlte Schauspielerin 1935–1940
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Siebte Szene: Der goldene Panther 1942–1946
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Nachwort
Dank
Quellen
Impressum
Erste Szene
Das Schulmädchen
1914–1918
»Mit meiner Geburt hatte ich nichts zu tun.«
Kapitel 1
Als ich mich das erste Mal verliebte, war ich zwölf Jahre alt.
Es passierte in der Auguste-Viktoria-Schule in Schöneberg, damals noch eine eigene Stadt im Südwesten Berlins. In einem klotzigen, von schmiedeeisernen Toren bewachten Gebäude, hinter dessen extravaganter Fassade sich ein Labyrinth eisig kalter Klassenzimmer verbarg, lernte ich Tag für Tag Grammatik, Rechnen und Geschichte, darauf folgten Haushaltsführung und kräftigende Leibesübungen im Freien und zu guter Letzt noch ein ausgesprochen oberflächlicher Französischunterricht. Ich hegte eine tiefe Abneigung gegen die Schule, was jedoch nicht daran lag, dass es mir schwerfiel, die fachlichen Anforderungen zu erfüllen. Verschiedene Gouvernanten hatten sich in meiner Kindheit um meine Erziehung gekümmert, wobei meine ein Jahr ältere Schwester Elisabeth – in der Familie stets Liesel genannt – immer die meiste Aufmerksamkeit bekam, weil sie so kränklich war. Bei uns zu Hause hatten täglich Englisch und Französisch, Benehmen, Tanz und Musik auf dem Programm gestanden, und unsere Mutter verlangte in jeder dieser Disziplinen unanfechtbare Perfektion. So mochte ich zwar besser auf die Härten institutionellen Lernens vorbereitet sein als die meisten meiner Klassenkameradinnen, dennoch war mir die Schule verhasst. Ich passte einfach nicht zu den anderen Mädchen mit ihren marmeladenklebrigen Fingern und wollte mich nicht in ihre Gemeinschaft einfügen. Sie hingegen kannten sich fast alle seit frühester Kindheit und verliehen mir wegen meiner vermeintlichen Schüchternheit den Spitznamen Maus, nichtahnend, dass »schüchtern« wohl das letzte Wort gewesen wäre, mit dem meine Mutter mich beschrieben hätte.
Als unser Vater an einem Herzstillstand starb, war ich sechs Jahre alt, doch unsere Trauer um ihn wurde rasch überlagert von der dringenden Notwendigkeit, unser Leben neu zu organisieren. Nach außen musste der Schein gewahrt werden, immerhin stammte die Witwe Josephine Dietrich aus der berühmten Uhrmacherdynastie Felsing, die seit über einem Jahrhundert den Titel »Hoflieferant« führen durfte, doch meine Mutter weigerte sich strikt, Unterstützung von ihrer Familie anzunehmen, und die Rente meines Vaters – er war Polizeileutnant auf der Schöneberger Insel gewesen – reichte bei weitem nicht. So verschwanden schon bald nach seiner Beerdigung die Gouvernanten, weil sie als entbehrlicher Luxus erachtet wurden, und Mutter nahm eine Stelle als Hauswirtschafterin an. Wegen Liesels diffuser gesundheitlicher Beschwerden entwarf Mutter einen Lehrplan für sie, dem sie zu Hause nachgehen sollte. Mich dagegen zwang sie in die steif gestärkte graue Schuluniform, flocht meine rotblonden Haare zu Zöpfen, krönte das Ganze mit einer riesigen Taftschleife auf dem Kopf und führte mich in meinen zehenzwackenden Lacklederschuhen ab in die Schule, wo unbescholtene ältere Fräulein meinen Charakter bilden sollten.
»Benimm dich ordentlich«, ermahnte Mutter mich. »Denk an deine Manieren, und tu, was man dir sagt. Hab ich mich klar ausgedrückt? Durch deine Erziehung bist du vielleicht vielen anderen voraus, aber damit prahlt man nicht.«
Sie hätte sich keine Sorgen machen müssen. Zu Hause wurde ich oft getadelt, weil ich versuchte, Liesel auszustechen, aber als ich den Schulhof betrat und mich von den Mädchencliquen umringt sah, die mich mit argwöhnischen Blicken musterten, begriff ich sofort, dass es besser für mich wäre, mit meinem Wissen hinter dem Berg zu halten. So ahnte niemand, dass ich über mehr als grundlegende schulische Kenntnisse verfügte. Dies galt natürlich auch für die französische Sprache, die zwar zur Bildung jedes wohlerzogenen Mädchens gehörte, mit der jedoch kein wohlerzogenes deutsches Mädchen allzu vertraut werden sollte, da sie mit ihrem verführerischen Klang immer auch einen Hauch des Verbotenen in sich trug. Um die Aufmerksamkeit von mir abzulenken, setzte ich mich an ein Pult ganz hinten im Klassenzimmer und hielt mich von den anderen weitgehend fern – eine Maus eben, die sich in aller Öffentlichkeit versteckte.
Bis zu jenem Tag, an dem unsere neue Französischlehrerin eintraf.
Sie wirkte gehetzt, als hätte sie sich sehr beeilen müssen, nicht zu spät zu kommen. Aus ihrem Knoten hatten sich kastanienbraune Strähnen gelöst, ihre Wangen waren gerötet. Tatsächlich hatte es bereits geläutet, die Mädchen flüsterten aufgeregt über die Gänge hinweg miteinander.
Plötzlich tauchte nun also die lang erwartete Nachfolgerin von Madame Servine auf, die nach einem unglücklichen Sturz früher als geplant in den Ruhestand gegangen war. Die Julihitze war extrem, und unserer neuen Lehrerin stand der Schweiß auf der Stirn, als sie ihre Bücher mit einem lauten Knall auf das Pult fallen ließ. Die ganze Klasse setzte sich erschrocken auf.
Madame Servine hatte keine Trödelei geduldet, und ihr Lineal war als Strafe für vermeintlichen Ungehorsam schmerzhaft auf Knie oder Finger so mancher Schülerin niedergesaust. Und womöglich würde sich diese junge Frau als ebenso furchterregend herausstellen. Von meinem üblichen Platz weit hinten spähte ich über die Schultern der vor mir sitzenden Mädchen und beobachtete, wie sie sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn wischte.
»Mon Dieu«, stöhnte sie dabei. »Il fait si chaud. Ich hätte nicht gedacht, dass es in Deutschland so heiß werden kann.«
Niemand sagte ein Wort. Mit einer achtlosen Handbewegung ließ die neue Französischlehrerin ihr feuchtes Taschentuch in der Bluse verschwinden. »Bonjour mesdemoiselles. Ich bin Mademoiselle Bréguand, eure neue Französischlehrerin.«
Eigentlich war es unnötig, dass sie sich vorstellte. Wir wussten genau, wer sie war, warteten wir doch schon seit Wochen auf sie, während wir von der Vertretungslehrerin Frau Becker mit endlosen Aufgaben gequält wurden. Im Akzent unserer neuen Lehrerin war deutlich die Melodie von Paris zu erkennen, und während es in meinem Bauch vor Freude kribbelte, spürte ich, wie die Mädchen um mich herum schauderten. Madame Servine war wegen ihrer Lorgnette, ihrer bedrohlich klackenden dritten Zähne und ihrer hochgeschlossenen, aus der Zeit der Jahrhundertwende stammenden Kleider stets mit dem Spitznamen Ancien Régime bedacht worden. Doch die junge Frau – in ihrer an Hals und Handgelenken spitzenverzierten Bluse, ihrem modischen knöchellangen Rock, der ihre schlanke Figur betonte und unter dem elegante Stiefelchen hervorlugten – verhieß etwas ganz anderes.
Ich reckte mich erwartungsvoll.
»Allez«, verkündete sie. »Ouvrez vos livres, s’il vous plaît.«
Regungslos saßen die anderen Mädchen da, nur ich griff zu meinem Französischbuch. »Eure Bücher, bitte. Schlagt eure Bücher auf«, erklärte Mademoiselle auf Deutsch und seufzte.
Ich verkniff mir ein Grinsen.
»Wir wollen heute ein paar Verben konjugieren, ja?«, fuhr sie fort und ließ den Blick über die Klasse schweifen. Niemand antwortete ihr. Seit Madame gestürzt war, hatte keines der Mädchen sich die Mühe gemacht, einen Blick in unser Französischbuch zu werfen. Französisch war ihnen gleichgültig, und aus den Gesprächen, die ich gelegentlich mitbekam, wusste ich, dass meine Mitschülerinnen ohnehin nur ein einziges Lebensziel kannten: so schnell wie möglich zu heiraten und den Klauen ihrer Eltern zu entrinnen. Kinder, Küche, Kirche – das schien der alleinige Ehrgeiz, der deutschen Mädchen eingeimpft wurde wie zuvor ihren Müttern und Großmüttern. Welchen Sinn könnte es für diese jungen Frauen haben, Französisch zu lernen?
Mademoiselle Bréguand beobachtete das hektische Blättern, schien jedoch nicht willens, es zu kommentieren. Pflichtvergessenheit bei den Hausaufgaben war ein beliebtes Vergehen, doch jede von uns fürchtete, dabei erwischt zu werden. Von Madame Servine erzählte man sich, dass sie einmal eine Schülerin gezwungen hatte, bis zum Einbruch der Dunkelheit nachzusitzen – bis sie entweder ihre Aufgaben erledigt hatte oder vor Erschöpfung zusammengebrochen war.
Dann sah ich plötzlich, wie sich auf Mademoiselles Gesicht ein schelmisches Lächeln abzeichnete. Ich konnte es nicht fassen – an diesem Ort, wo die Lehrerinnen nie etwas anderes zeigten als Strenge, war diese Gemütsregung so überraschend, dass der Gefühlswirbel in meinem Inneren sich unversehens in etwas verwandelte, was mich an Schlagsahne auf meiner Zunge denken ließ.
»Beginnen wir mit ›sein‹ – être. Je suis, je serai, j’étais. Tu es, tu seras, tu étais. Il est, il sera, il était. Nous sommes, nous serons, nous étions …« Während sie rezitierte, schritt sie langsam durch die schmalen Gänge zwischen unseren Pulten und lauschte, den Kopf zur Seite geneigt, den erbärmlichen Bemühungen ihrer Schülerinnen. Es war eine miserable Darbietung, ein Beweis von Bummelantentum und absoluter Geringschätzung der französischen Sprache. Aber Mademoiselle korrigierte niemanden, sondern wiederholte nur immer wieder die Konjugationen, die die Mädchen ihr mehr oder minder erfolgreich nachsprachen.
Schließlich stand sie vor mir. Blieb stehen. Hob die Hand, und alle verstummten. Mit ihrem bernsteinbraun-grünen Blick fixierte sie mich und forderte mich zu wiederholen auf: »Répète, s’il te plaît.«
Weil ich um jeden Preis vermeiden wollte, herausgestellt zu werden, nahm ich mir vor, genauso schrecklich zu klingen wie die anderen. Aber meine Zunge gehorchte mir nicht, und ich hörte mich zögernd konjugieren: »Vous êtes. Vous serez. Vous étiez.«
Das unterdrückte Kichern eines Mädchens in meiner Nähe traf mich wie eine Ohrfeige.
Aber dafür kehrte das warme Lächeln auf Mademoiselles Lippen zurück, und nun galt es mir allein – zu meinem Entsetzen und meiner Freude zugleich. »Und weiter?«
Im Flüsterton fuhr ich mit den komplexeren grammatischen Formen fort: »Vous soyez. Vous seriez. Vous fûtes. Vous fussiez.«
»Und jetzt benutze das Verb in einem Satz, bitte.«
Einen Moment kaute ich auf der Unterlippe und überlegte, dann platzte ich heraus: »Je voudrais être quelqu’un qui vous aimez bien.« Ich möchte jemand sein, den Sie mögen. Kaum waren die Worte aus meinem Mund, da bereute ich sie auch schon. Was war in mich gefahren, etwas so – Direktes, geradezu Dreistes zu sagen?
Obwohl ich mich nicht umzuschauen wagte, spürte ich, dass meine Mitschülerinnen mich anstarrten. Vielleicht hatten sie nicht verstanden, was ich genau gesagt hatte, aber mein Ton genügte vermutlich.
Ich hatte mich enttarnt.
»Oui«, antwortete Mademoiselle leise. »Parfait.«
Dann ging sie weiter, begann von neuem Verbformen zu skandieren und gab den Mädchen zu verstehen, es ihr nachzutun. Ich saß da wie erstarrt. Aber dann stupste mich auf einmal ein Finger in die Rippen, und als ich mich umdrehte, zwinkerte mir ein dunkelhaariges, dünnes Mädchen mit einem Elfengesicht zu. »Parfait«, flüsterte sie. »Perfekt.«
Mit einer solchen Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, die anderen würden bis zur Schlussglocke warten und mich, sobald wir das Schultor passiert hatten, auf dem Heimweg überfallen und wahrscheinlich verprügeln, weil ich sie hintergangen und mich obendrein auch noch bei unserer neuen Lehrerin lieb Kind gemacht hatte. Aber was ich auf dem Gesicht dieses Mädchens erkannte, war weder Missgunst noch Ärger. Es war … Bewunderung.
Nachdem Mademoiselle uns unsere Hausaufgaben gegeben hatte und alle den Klassenraum verließen, versuchte auch ich, mich an ihrem Pult vorüberzuschleichen. Ich hatte es fast geschafft, als sie sagte: »Mademoiselle, einen Augenblick bitte.«
Ich hielt inne und blickte mich vorsichtig um. Die anderen drängten sich an mir vorbei, und eine spottete: »Marie, das graue Mäuschen, kriegt ihren ersten Goldstern.«
Dann stand ich allein vor der Lehrerin, die mich nachdenklich musterte. Durch das staubige Fenster fiel die Spätnachmittagssonne und ließ ihren unordentlichen Knoten kupferrot schimmern. Ihre Haut war rosig, mit einem leichten Flaum auf den Wangen. Meine Knie wurden weich. Ich verstand nicht, warum ich gesagt hatte, was ich gesagt hatte, aber ich hatte das beunruhigende Gefühl, dass sie es umso besser wusste.
»Marie?«, fragte sie. »Ist das dein Name?«
»Ja. Marie Magdalene.« Nur mit Mühe gehorchte mir meine Stimme. »Marie Magdalene Dietrich. Aber ich möchte lieber … in meiner Familie nennen mich alle nur Marlene. Oder kurz Lena.«
»Ein hübscher Name. Du sprichst sehr gut Französisch, Marlene. Hast du das hier gelernt?« Bevor ich antworten konnte, lachte sie. »Nein, natürlich nicht. Die anderen … c’est terrible, elles savent si peu, es ist eine Schande, wie wenig sie wissen. Du solltest nicht in dieser Klasse sein, du kannst viel mehr.«
»Bitte, Mademoiselle.« Ich drückte meine Schultasche an die Brust. »Wenn die Direktorin das herausfindet, dann wird sie …«
»Was?« Sie neigte den Kopf. »Was wird sie dann tun? Wissen ist kein Verbrechen. Du verschwendest hier deine Zeit. Würdest du diese Stunde nicht lieber für etwas nutzen, bei dem du wirklich etwas lernen kannst?«
»Nein.« Ich war den Tränen nahe. »Ich … ich lerne gern Französisch.«
»Dann müssen wir sehen, was wir für dich tun können. Bei mir ist dein Geheimnis sicher, aber für die anderen kann ich nicht die Hand ins Feuer legen. Sie sind vielleicht ignorant, aber sicher nicht taub.«
»Merci, Mademoiselle. Ich werde fleißig sein. Sie sollen mit mir zufrieden sein.« Das war meine Standarderklärung, begleitet von einem ungeschickten Knicks, wie Mutter es mir beigebracht hatte, wenn wir sonntags nach der Kirche andere achtbare Witwen besuchten, die uns heiße Schokolade und Kuchen vorsetzten. Dann wandte ich mich ab und machte mich hastig auf den Weg zur Tür, um Mademoiselles amüsiertem Blick und meiner eigenen Impulsivität zu entfliehen.
Im Gehen hörte ich noch, wie sie sagte: »Marlene, ich bin schon jetzt mit dir zufrieden. Sogar sehr.«
Kapitel 2
Auf dem Heimweg hüpfte ich und schwang vor Freude meine Schultasche. In meinem Kopf erklang Mademoiselles Stimme wie ein Echo der raschelnden Linden, die die Straßen säumten. Nichts anderes drang in mein Bewusstsein, während ich die Straßenbahnschienen überquerte und den Straßenverkäufern auswich, die lautstark ihre Waren anpriesen.
Marlene, ich bin schon jetzt mit dir zufrieden. Sogar sehr.
Auch als ich die rissige Marmortreppe zu unserer Wohnung in der Tauentzienstraße 13 hinaufstürmte, summte ich noch leise vor mich hin. Ich ließ meine Schultasche auf den Flurtisch fallen und marschierte in den makellosen Salon, wo meine Schwester Liesel über ihren Büchern kauerte. Sie blickte auf und sah so müde aus, als säße sie dort schon seit Wochen.
»Ist der General schon hier?«, fragte ich und griff nach dem letzten Stück Kuchen, das neben ihr auf einem Teller lag.
Die missbilligende Falte zwischen Liesels Augenbrauen vertiefte sich. »Du sollst unsere Mutter nicht so nennen, das ist respektlos. Du weißt doch, dass sie donnerstags immer länger bei den Loschs arbeitet, sie kommt erst um sieben. Und nimm dir einen Teller, Lena, du hinterlässt überall Krümel. Das Hausmädchen ist gerade gegangen.«
Ich bückte mich, klaubte schnell ein paar Krümel von dem abgenutzten Teppich und leckte mir die Finger ab.
»Nimm lieber den Besen.«
Obwohl es sinnlos war, holte ich den Besen aus der Küche – Mutter würde sowieso noch einmal fegen, wenn wir schon im Bett waren, und obendrein die Parkettböden bohnern. Obwohl sie den ganzen Tag bei anderen Leuten putzte, wurde sie es nie müde. Innerhalb von vier Monaten hatte sie ebenso viele Hausmädchen wegen Schlampigkeit entlassen. Es war so absehbar, dass Liesel und ich uns nicht einmal mehr die Mühe machten, uns den Namen des aktuellen Mädchens zu merken.
Noch immer vor mich hin summend, ging ich ins Wohnzimmer, in dem das kleine Hammerklavier und meine Geige warteten; beide Instrumente hätten dringend professionell gestimmt werden müssen. Die Geige hatte mir meine Großmutter zum achten Geburtstag geschenkt, nachdem mein Musiklehrer Mutter glaubhaft versichert hatte, ich hätte Talent. Inzwischen war der Geigenlehrer ebenso verschwunden wie die Gouvernanten, dennoch übte ich weiter. Ich liebte Musik, und sie war eine der wenigen Interessen, die ich mit meiner Mutter teilte. Als Kind hatte sie viele Jahre lang Klavierunterricht gehabt, und wir spielten nach dem Abendessen oft zusammen. Jetzt fand ich auf dem Klavierdeckel die Sonate von Bach, die sie mir zum Üben hingelegt hatte.
Als ich die Geige an die Schulter setzte, sagte Liesel: »Du hast heute so gute Laune. Ist in der Schule irgendwas Besonderes passiert?«
»Nein.« Behutsam, um die abgenutzten Saiten zu schonen, justierte ich die Wirbel. Zu meinem Geburtstag würde Mutter mir sicher neue Saiten kaufen, aber bis Dezember waren es noch ein paar Monate, und bis dahin musste ich das Beste aus den alten herausholen. Als ich dann mit dem Bogen über die Saiten strich und zunächst nur ein misstönendes Quäken hervorbrachte, hakte Liesel nach: »Nichts? Sonst strahlst du nie so, wenn du heimkommst. Und du fängst auch nie gleich an zu üben. Irgendetwas muss doch gewesen sein.«
Ich setzte von neuem an, ließ mich jedoch nebenbei zu einer Antwort herab. »Ich habe eine neue Französischlehrerin. Sie heißt Mademoiselle Bréguand.«
Eine Weile sah Liesel mir stumm zu. Ich musste nur wenig in die Noten schauen, da ich das Stück inzwischen auswendig konnte. Mutter würde stolz auf mich sein.
»Du bist so gutgelaunt, weil ihr eine neue Lehrerin habt?« Meine Schwester gab keine Ruhe. »Das glaube ich dir nicht. Ich weiß doch, wie sehr du die Schule verabscheust. Deiner Meinung nach sind die Lehrerinnen samt und sonders alte Schachteln und die Mädchen allesamt dumme Gänse. Sag die Wahrheit – hast du einen Jungen kennengelernt?«
Mein Bogen rutschte ab, und ich starrte Liesel ungläubig an. »Wo sollte ich denn bitte einen Jungen kennenlernen?«, schnaubte ich. »In meiner Schule gibt es bloß Mädchen.«
»Aber auf dem Nachhauseweg, auf der Straße, da triffst du doch jeden Tag Jungen, oder etwa nicht?« Sie klang ernst. Und auch ein wenig ärgerlich.
»Die einzigen Jungen, die ich unterwegs sehe, sind irgendwelche Straßenlümmel, die streunende Hunde treten. Die lerne ich ganz bestimmt nicht kennen, denen gehe ich aus dem Weg.«
Am liebsten hätte ich noch hinzugefügt, dass Liesel öfter nach draußen gehen sollte, wenn sie sich so für junge Männer interessierte. Doch ich verbiss es mir, weil es ja nicht Liesels Schuld war, dass sie eine schwache Lunge oder verschleimte Bronchien oder was auch immer hatte. Mutter machte immer so viel Aufhebens um die Verfassung meiner Schwester, dass es ihr meiner Ansicht nach überhaupt nicht guttat; aber sie galt nun einmal als »anfällig« und hatte sich diese Diagnose uneingeschränkt zu eigen gemacht.
»Ich frage nur, weil ich mir Sorgen mache«, verteidigte sie sich. »Du wirst dieses Jahr dreizehn, also bist du beinah eine Frau, und Jungen – na ja, Jungen haben die Neigung …«
Ihre Stimme verebbte, unbehagliche Stille trat ein. Während ich meine Geige neu stimmte, erwog ich, was meine Schwester gesagt hatte. Und noch mehr, was sie nicht gesagt hatte.
Liesels Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht waren ebenso begrenzt wie meine: Seit dem Tod unseres Vaters war unser Onkel Willi in Berlin das einzige männliche Wesen, das wir regelmäßig zu Gesicht bekamen. Aber das sagte ich nicht, weil Liesel und ich uns nicht wirklich nahe waren, jedenfalls nicht so, wie es Schwestern sein sollten. Unser Umgang war nicht feindselig – wir teilten uns ein Schlafzimmer und stritten uns selten –, aber wir waren so verschieden, dass sogar Mutter gelegentlich Bemerkungen darüber machte. Schon körperlich waren die Unterschiede offensichtlich: Liesel war dünn und blass und besaß den hellen Teint meines Vaters. Ich dagegen hatte Mutters kräftigen Körperbau geerbt, ihre blauen Augen, die Stupsnase und die durchscheinende Haut, die puterrot wurde, wenn ich zu lange in der Sonne blieb. Und je älter ich wurde, desto besser verstand ich, dass mein zurückhaltendes Auftreten in der Öffentlichkeit nur daher kam, weil Mutter mir eingebläut hatte, Mädchen müssten sich so benehmen. Ganz anders war es bei Liesel, die von Natur aus reserviert war und nie dazu ermahnt zu werden brauchte. Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen machte meiner Schwester Angst, deshalb verließ sie das Haus nur zu den sonntäglichen Besuchen, den Gängen zum Markt und den Ausflügen nach Berlin, die wir einmal im Monat unternahmen.
»Willst du damit andeuten, dass Jungen mich unterwegs anzusprechen versuchen könnten?«, fragte ich mit einem wohlüberlegt ahnungslosen Augenaufschlag. Liesel erstarrte förmlich auf ihrem Stuhl, womit sie mir mehr als deutlich verriet, dass sie genau das meinte.
»Tun sie das etwa?«, hauchte sie.
»Nein. Jedenfalls hab ich bisher nichts davon bemerkt.« Ich hielt inne. »Warum? Sollte ich … sollte ich es bemerken?«
»Aber nein, niemals.« Liesel war entsetzt. »Wenn sie dich ansprechen oder anstößige Bemerkungen machen, musst du es ignorieren und sofort mit Mutter darüber sprechen.«
»Das werde ich.« Ich strich mit dem Bogen sanft über die Saiten. »Versprochen.«
Ich hatte nicht gelogen. Bisher hatte kein Junge mich je beachtet. Aber heute war tatsächlich jemand auf mich aufmerksam geworden. Und ich ahnte, dass es besser war, nicht zuzugeben, was für ein Gefühl das in mir hervorgerufen hatte.
Bei mir ist dein Geheimnis sicher.
Ich hatte noch nie ein Geheimnis gehabt. Und ich beabsichtigte, es um jeden Preis zu bewahren.
Pünktlich fünf Minuten nach sieben traf Mutter ein. Wir hatten Liesels Lehrbücher schon weggeräumt und den Tisch mit unserem angeschlagenen Keramikgeschirr gedeckt; das Meissener Porzellan war für besondere Anlässe reserviert. Ich erhitzte den Topf mit der weißen Bohnensuppe, die ich tags zuvor zubereitet hatte. Mutter weigerte sich standhaft, das Hausmädchen kochen zu lassen, und hatte mir die Verantwortung für das tägliche Abendessen übertragen. Ich kochte gern und auch besser als Liesel, bei der die Sauce anbrannte oder das Fleisch nicht durch war. Genau wie bei der Musik gefiel es mir, einer genauen Vorgabe zu folgen – einem strukturierten Rezept, angefangen beim genauen Portionieren und Mischen der Zutaten bis hin zum Erreichen des gewünschten Ergebnisses. Mutter hatte mir das Kochen selbst beigebracht, aber wie bei allem anderen vertraute sie auch hier letztlich nur ihren eigenen Fähigkeiten und kam noch mit Hut und Handschuhen in die Küche, um den Inhalt des Kochtopfs zu kontrollieren.
»Mehr Salz«, verkündete sie. »Und stell die Hitze runter, sonst wird es eine Pampe.« Dann wandte sie sich ab und verschwand in ihrem Schlafzimmer. Wenige Minuten später kam sie in Hauskleid und Schürze wieder zum Vorschein, die blonden Haare im Nacken aufgesteckt. Ich hatte meine Mutter noch nie mit offenen Haaren gesehen, nicht einmal im Bad. Anscheinend zeigte eine Witwe keine ungezähmten Locken.
»Wie war die Schule heute?«, erkundigte sie sich, als ich die Suppe zum Tisch trug.
»Gut«, antwortete ich. Manchmal überlegte ich, ob Mutter es wohl merken würde, wenn ich ihr erzählte, die Schule sei bis auf die Grundmauern abgebrannt. Vermutlich nicht. Sie fragte mich jeden Tag, aber nur aus Höflichkeit, und meine Antwort war letztlich überflüssig.
Wir aßen schweigend, müßige Gespräche waren bei Tisch nicht erwünscht. Als ich meinen Teller mit meinem Brot auswischte (ich hatte einen gesunden Appetit), meinte sie tadelnd: »Lena, wie oft habe ich es dir schon gesagt?« Natürlich hätte ich ihre übliche Litanei auswendig zitieren können: »Ein wohlerzogenes Mädchen tunkt ihr Brot nicht in die Sauce wie ein Bauer. Wenn du noch etwas essen möchtest, dann bitte darum.«
Aber das tat ich nie. Hätte ich es getan, hätte Mutter mir nur erklärt, dass wohlerzogene Mädchen keine zweite Portion bräuchten. Ein unkontrollierter Appetit offenbare einen Mangel an Kultiviertheit.
Wir wuschen die Teller ab und räumten sie in den Schrank. Als Vater noch lebte, wäre dies der Zeitpunkt gewesen, an dem Liesel und ich uns zurückgezogen hätten, damit unsere Eltern im Wohnzimmer für sich sein konnten, wo Mutter auf dem Klavier spielte und ihren abendlichen Weinbrand trank. Aber Vater war tot, und da wir jetzt im angemessenen Alter waren, machte meine Schwester es sich nach dem Abwaschen auf dem Sofa bequem, und Mutter beaufsichtigte meine Interpretation der Bachsonate.
Wie immer war ich nervös. Zwar spielte Mutter die Violine nicht selbst, doch ihr Ohr war unfehlbar, und ich wollte beweisen, dass ich so viel übte, wie sie es verlangte. Körperlich wurden wir von Mutter nicht gezüchtigt, nur ein einziges Mal hatte sie mich geohrfeigt. Damals war ich zehn Jahre alt gewesen und hatte mich geweigert, mit einem Jungen zu tanzen, dessen Atem nach Zwiebeln stank. Nie würde ich vergessen, wie sie vor den Augen aller anderen Kinder und Eltern über die Tanzfläche auf mich zumarschierte, um mir mit einem strengen: »Wir zeigen unsere Gefühle niemals in der Öffentlichkeit. Das ist unhöflich«, den demütigenden Schlag zu verpassen. Doch obwohl sie uns die sprichwörtliche Zuchtrute ersparte, konnte ihre Zunge ebenso verletzend sein, und für Faulheit hatte sie noch weniger Verständnis als für Unreinlichkeit oder Unhöflichkeit. »Tu etwas!«, lautete ihr Motto. Wir hatten gelernt, dass Müßiggang die schlimmste Sünde sei, die wir um jeden Preis vermeiden mussten.
Ich beendete die Sonate fehlerlos. Mutter lehnte sich auf dem Klavierbänkchen zurück. »Das war hervorragend, Lena«, sagte sie, so voller Zuneigung, wie sie nur mit mir sprach, wenn ich ihre Erwartungen übertroffen hatte.
Ich war erleichtert. Von Mutter bekam man so selten ein Lob, dass ich mich fühlte, als hätte ich eine Heldentat vollbracht.
»Man merkt, dass du geübt hast«, fuhr sie fort. »Weiter so. Wir sollten demnächst einen Vorspieltermin an der Musikhochschule in Weimar für dich vereinbaren, damit du dich für ein Stipendium bewerben kannst.«
»Ja, Mutter«, antwortete ich. Das angesehene Konservatorium in Weimar war ihr Wunschtraum, nicht meiner; sie glaubte, mein Talent könnte mir den Weg in eine Karriere als Konzertsolistin ebnen – was ich davon hielt, interessierte nicht.
»Und du, meine Liebe?« Sie sah zu Liesel, die am Ende meiner Darbietung Beifall geklatscht hatte. »Möchtest du etwas auf dem Klavier für uns spielen?«
Verärgert nahm ich zur Kenntnis, dass meine Schwester im Gegensatz zu mir nach ihrer Meinung gefragt wurde, denn als sie einwandte: »Tut mir leid, aber ich habe Kopfschmerzen«, seufzte Mutter nur und schloss den Tastendeckel.
»Dann solltest du zu Bett gehen. Es ist schon spät, und wir müssen morgen früh aufstehen.«
Noch früher als sonst? Ich stöhnte innerlich. Das bedeutete, dass Mutter irgendwelche Aufträge für mich zu erledigen hatte, ehe ich zur Schule und sie zur Arbeit ging. Während ich meine Geige in ihrem Kasten verstaute, fragte ich mich, wozu wir überhaupt ein Hausmädchen hatten. Zog man die Menge unserer täglichen Pflichten und obendrein noch Mutters abendliches Putzritual in Betracht, war es doch reine Geldverschwendung, eine Haushaltshilfe zu bezahlen.
Dann sagte Mutter: »Ehe wir uns zur Ruhe begeben, habe ich euch noch etwas Wichtiges mitzuteilen.«
Überrascht sah ich auf. Gespannt warteten wir, während sie auf ihre rauen Hände hinunterblickte, die mit noch so viel Creme nicht zu glätten waren – der sichtbare Beweis, dass Wilhelmine Josephine Felsing, die Witwe Dietrich, nicht mehr standesgemäß lebte. Trotz ihrer geschwollenen Fingerknöchel trug sie noch immer ihren goldenen Ehering, und auch jetzt fingerte sie daran herum. Irgendetwas an ihrer Geste machte mich nervös.
»Ich werde wieder heiraten.«
Liesel erstarrte. Ich fragte ungläubig: »Du heiratest? Wen denn?«
Mutter runzelte die Stirn. Ich machte mich schon darauf gefasst, ermahnt zu werden, keine vorlauten Fragen zu stellen, aber sie erwiderte nur: »Herrn von Losch. Wie ihr wisst, ist er Witwer und kinderlos. Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, seinen Antrag anzunehmen.«
»Herrn von Losch?« Jetzt war ich endgültig fassungslos. »Du willst den Mann heiraten, bei dem du als Putzfrau arbeitest?«
»Ich arbeite nicht als Putzfrau.« Obwohl Mutter die Stimme nicht hob, wurde ihr Ton scharf. »Ich kümmere mich um sein Haus. Ich bin bei Herrn von Losch die Haushälterin, seine Dienstmädchen putzen, und ich beaufsichtige sie. Sind deine Fragen damit beantwortet, Lena?«
Keinesfalls, mir schwirrten noch mindestens hundert Fragen im Kopf herum, aber ich sagte nur: »Ja, Mutter«, und trat schnell einen Schritt zurück, weil ich befürchtete, dass mir meine zweite Ohrfeige bevorstand.
»Die Hochzeit wird nächstes Jahr stattfinden.« Mutter stand auf und strich ihre Schürze glatt. »Ich habe mir Zeit erbeten, um mich vorzubereiten, und er hat sie mir eingeräumt. Selbstverständlich möchte ich zunächst eure Großmutter und Onkel Willi informieren, sie müssen ja ihre Zustimmung geben und mich zum Altar führen. Ich habe sie für morgen eingeladen, und bevor sie eintreffen, haben wir viel zu tun, wenn es hier einigermaßen ordentlich aussehen soll. Deshalb müssen wir früh aufstehen.«
Wenn sie nicht vorhatte, das gesamte Mobiliar neu zu arrangieren, wusste ich nicht, was es zu tun gab. Samstags gingen wir auf dem Markt einkaufen und schrubbten danach ohnehin die gesamte Wohnung, einschließlich jeden Winkels, den das Hausmädchen möglicherweise vernachlässigt hatte. Und ganz gleich, wie viel wir putzten, konnte trotzdem jeder sehen, dass wir – im Gegensatz zu Oma und Onkel Willi – in einer Mietwohnung lebten, die zwar nicht schäbig, aber auch alles andere als luxuriös war. Doch ich wagte nichts mehr zu sagen, zu erschütternd war Mutters Neuigkeit.
Liesel und ich würden einen Stiefvater bekommen, einen Mann, den wir überhaupt nicht kannten, und dennoch würde man von uns erwarten, dass wir ihm mit Respekt begegneten und ihm gehorchten.
»Wir haben noch nicht entschieden, wo wir wohnen wollen«, fuhr Mutter unterdessen fort, »aber ich gehe davon aus, dass wir nach der Hochzeit in sein Haus in Dessau ziehen werden. Nächste Woche werde ich hinfahren und sehen, ob es geeignet ist. In der Zwischenzeit dürft ihr niemandem ein Wort sagen. Ich möchte nicht, dass die Nachbarn unpassende Bemerkungen machen oder womöglich dem Vermieter Bescheid sagen, dass wir beabsichtigen zu kündigen. Ist das klar?«
»Ja, Mutter«, antworteten Liesel und ich wie aus einem Munde.
»Gut.« Unsere Mutter versuchte zu lächeln, aber sie hatte so wenig Übung darin, dass es eher einer Grimasse glich. »Geht euch das Gesicht waschen, und sprecht euer Abendgebet.«
Liesel sagte kein Wort, während wir in dem engen Badezimmer abwechselnd das Waschbecken benutzten, uns auszogen und dann in unsere schmalen, durch einen Nachttisch voneinander getrennten Betten schlüpften. Ich hätte den Arm ausstrecken und meine Schwester berühren können, aber ich lag nur reglos da und starrte an die Decke. Als ich dann Mutter in der Diele mit Lappen und Bohnerwachs hantieren hörte, flüsterte ich. »Warum tut sie das? In ihrem Alter?«
Meine Schwester seufzte. »Sie ist erst achtunddreißig. Herr von Losch ist Leutnant bei den Grenadieren, genau wie Papa. Er ist ganz sicher ein ehrenwerter Mann.«
»Achtunddreißig kommt mir so alt vor«, gab ich zurück. »Und woher sollen wir wissen, dass er ehrenwert ist? Was weiß Mutter über ihn, außer wie viel Stärke sie für seine Hemden benutzt? Außerdem ist Dessau so weit weg.«
»Lena.« Liesel wandte sich mir zu, ihre Augen schimmerten im Halbdunkel. »Sei nicht so hart mit ihr. Sie will nur das Beste für uns.«
Aus irgendeinem Grund bezweifelte ich das. Einen Fremden zu heiraten und unser Leben auf den Kopf zu stellen schien mir für niemanden das Beste zu sein – außer vielleicht für sie und Herrn von Losch.
»Eine alleinstehende Frau ist etwas Schreckliches«, fuhr Liesel fort. »Du verstehst das nicht, aber Witwe zu sein mit zwei halbwüchsigen Töchtern – das verlangt einer Frau viel ab.« Damit wandte sie sich ab und zog ihre Decke bis zum Kinn. Innerhalb weniger Minuten schnarchte sie.
Liesel würde keinen Einspruch erheben – was Mutter auch sagte oder tat, Liesel war einverstanden. Ob sie hier oder anderswo säße, war ihr vollkommen einerlei.
Doch bei mir war es anders. Ich hatte ein Geheimnis.
Die Fäuste um meine Decke gekrampft, konnte ich lange nicht einschlafen.
Kapitel 3
Missgelaunt schleppte ich mich durchs Wochenende. Mutter bemerkte es wohl oder übel, vor allem als Liesel mir auch noch zuflüsterte: »Jetzt schau doch nicht so finster drein!«, aber ich wurde nicht bestraft. Nachdem wir die ganze Wohnung einschließlich der Böden und Fenster auf Hochglanz gebracht hatten, erfuhren wir, dass Onkel Willi doch nicht kommen würde. Stattdessen verkündete Mutter zu meiner großen Freude, dass wir ihn in Berlin besuchen würden.
Ich liebte die Berliner Prachtstraße Unter den Linden mit ihren luxuriösen Warenhäusern, wo sich auch Onkel Willis Uhren- und Schmuckgeschäft »Conrad Felsing« befand. Er freute sich sehr, uns zu sehen, und führte uns zuerst in eine Confiserie, um uns mit Vanilletörtchen und Marzipan zu verwöhnen, von dort ging es zu heißer Schokolade ins Café Bauer in der Friedrichstraße. Ich war schon immer eine Naschkatze gewesen, und trotz Mutters Unnachgiebigkeit bei Tisch war sie diesem Laster gegenüber nachsichtig – wenn ein Mädchen ordentlich Fleisch auf den Knochen hatte, galt das für sie als Beweis, dass es aus einer guten, wohlhabenden Familie kam. Aber diesmal futterte ich die Leckereien nicht nur selbst, sondern wickelte heimlich auch ein paar Marzipanpralinen in mein Taschentuch und ließ das Päckchen – unter den entsetzten Blicken meiner Schwester – in meiner Tasche verschwinden, als Onkel Willi die Rechnung bezahlte.
Ihre bevorstehende Heirat erwähnte Mutter mit keinem Wort, jedenfalls nicht in unserer Gegenwart. Allerdings ging ich fest davon aus, dass sie Onkel Willi längst informiert hatte. Sie hielt nichts davon, ihre Entscheidungen mit uns zu besprechen, und natürlich stand es uns auch nicht zu, diese in Frage zu stellen.
Die anstehenden Veränderungen ließen in mir eine neue Aufsässigkeit aufbrodeln, so dass ich in der Schule nun offen um Mademoiselles Aufmerksamkeit buhlte. Als Erste präsentierte ich meine fehlerfreien Hausaufgaben, als Erste meldete ich mich auf jede Frage, die sie stellte, ohne auf die bösen Blicke meiner Mitschülerinnen zu achten, wenn sie mich für meinen Fleiß lobte.
»Nehmt euch ein Beispiel an Marie«, empfahl sie der Klasse und schenkte mir ihr Lächeln. »Sie hat gezeigt, dass man mit der richtigen Einstellung und dem nötigen Fleiß Französisch lernen kann.«
Da inzwischen fast alle den Verdacht hegten, ich hätte schon von Anfang an einen Vorsprung gehabt, machte ich mich natürlich nicht beliebter, aber auch das war mir gleichgültig. Es ging mir nur um Mademoiselles Wohlwollen, um ihre Zuwendung. Das Marzipan, das ich heimlich mitgenommen hatte, wickelte ich in kleine Stückchen Spitzenstoff, schmückte das Päckchen mit einer Mohnblume und legte jeden Tag eines davon beim Hinausgehen auf Mademoiselles Pult. Wenn sie dann sagte: »Wie aufmerksam von dir!«, murmelte ich bescheiden, mit gesenktem Blick: »De rien, Mademoiselle.« Natürlich waren die Marzipanpralinen vom Aufenthalt in meiner Tasche aus der Form geraten, aber das machte nichts – es zählte allein die Geste meiner Wertschätzung.
In der nächsten Woche lud Mademoiselle mich ein, nach der Schule einen kleinen Spaziergang mit ihr zu machen. Es war der Tag, an dem Mutter später nach Hause kommen würde, weil sie nach Dessau gefahren war, um von Loschs Haus in Augenschein zu nehmen. Obgleich ich versprochen hatte, sofort heimzugehen und Liesel bei der Hausarbeit und der Zubereitung des Abendessens zu helfen – wie nicht anders zu erwarten, war das Hausmädchen mal wieder entlassen worden –, nahm ich die Einladung an und wartete nach dem Unterricht vor dem Schultor auf Mademoiselle. Sie erschien, die Mappe wie immer prall gefüllt mit Büchern, auf dem Kopf einen Strohhut.
»Wollen wir?«, fragte sie, und ehe ich michs versah, schlenderte ich neben ihr den Boulevard hinunter, wo in Korsagen geschnürte Damen mit Sonnenschirmen, begleitet von Herren mit Bowlern, denen die goldenen Uhrketten aus den Westentaschen baumelten, ihre kleinen Hündchen spazieren führten und müde Gouvernanten ihre unwilligen Schützlinge hinter sich herschleppten. Es war gut möglich, dass mich jemand erkannte. Schöneberg war noch immer eine kaiserliche Garnisonsstadt, jeder kannte hier jeden. Ich senkte den Kopf, zog die Mütze tief ins Gesicht und hoffte, dass meine Schuluniform als Tarnung ausreichte. Zu meiner großen Erleichterung schenkte uns niemand viel Beachtung – die Herren zogen den Hut, die Damen murmelten guten Tag.
»Lass uns ins Café gehen«, schlug Mademoiselle vor, und als sie eines mit Marmortischchen im Freien entdeckte, steuerte sie darauf zu. Als ich ihr gegenübersaß, fiel mir auf, wie hübsch sie bei Tageslicht war: braune Augen mit grünen Sprenkeln, die Lippen so rosarot wie das Band an ihrem Strohhut. Ein paar ihrem Knoten entwischte Haarsträhnen klebten an ihrer Wange, und um der Versuchung zu widerstehen, sie davon zu befreien, musste ich die Hände auf dem Schoß verschränken.
Sie bestellte. Der Kellner runzelte die Stirn. »Kaffee für das Fräulein?«
»Wie dumm von mir«, lachte Mademoiselle. »Marlene, möchtest du lieber eine heiße Schokolade? Oder vielleicht eine Limonade?«
»Nein, danke«, antwortete ich und richtete mich auf. »Ich nehme gern einen Kaffee.«
Ich hatte noch nie Kaffee getrunken. Mutter trank stets Tee, wie es sich für eine anständige Dame gehörte. Ungeachtet seiner Beliebtheit war Kaffee ihrer Meinung nach nicht mehr als eine fremdländische Unsitte, die einen bitteren Nachgeschmack im Mund hinterließ.
Während wir auf unsere Bestellung warteten, nahm Mademoiselle mit einem Seufzer den Hut ab und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare, wodurch sich noch mehr Strähnen aus dem Knoten lösten und ihr ums Gesicht flirrten. Dann sah sie mich an und kam ohne Vorwarnung zur Sache: »Also, sag mir, was dich so quält.«
Ich erschrak. »Was mich quält? Nichts, Mademoiselle.« Außer dass ich Angst hatte, jemand, der Mutter kannte, könnte uns entdecken.
»Nein, nein.« Sie drohte mir mit dem Finger. »Ich habe genügend Erfahrung mit jungen Mädchen, um zu merken, wenn eine Schülerin etwas vor mir verbirgt.«
»Erfahrung?«
»Ja.« Sie nickte, als der Kellner zwei Tassen mit dem dunklen Gebräu vor uns auf den Tisch stellte, goss sich aus einem kleinen Krug Sahne in ihre und streckte mir dann den Krug entgegen. »So schmeckt er milder. Nimm ruhig auch ein bisschen Zucker.« Ich bediente mich, und sie fuhr fort: »Ehe ich die Stelle an deiner Schule bekommen habe, war ich Gouvernante in einem großen Haus. Ich hatte drei Kinder zu betreuen, deshalb sehe ich es sofort, wenn ein junger Mensch nicht wagt, über das zu sprechen, was ihm durch den Kopf geht.«
Für einen lähmenden Moment dachte ich, sie wäre mir auf die Schliche gekommen und ich hätte mich mit meinen Marzipangeschenken und meiner Gier nach Aufmerksamkeit verraten. Doch dann erkannte ich, dass sie weder verärgert noch beunruhigt wirkte, sondern ihren Blick so offen und direkt auf mich richtete wie eh und je. »Ich verspreche dir, dass ich alles für mich behalte, was du mir erzählst«, fügte sie hinzu.
»Wie … wie bei einem Geheimnis?«, fragte ich. Dann nippte ich an dem Kaffee, der schmeckte wie süßer geschmolzener Samt.
»Ja. Un secret entre nous. Alles, was du mir anvertraust, wird unter uns bleiben.«
Mein Französisch war zwar gut, nicht aber gut genug, um meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben, die so neu und aufregend waren. Noch nie hatte jemand mich gefragt, wie ich mich fühlte, geschweige denn, welche Gedanken mir durch den Kopf gingen. Als wäre Mutter an meiner Seite, hörte ich ein scharfes Wispern in meinem Ohr: Wir zeigen unsere Gefühle niemals in der Öffentlichkeit.
Ich wandte meinen Blick von ihr ab. »Es ist wirklich nichts«, murmelte ich.
Ihre Hand legte sich auf meine. Ihre Finger waren warm, ich spürte die Wärme bis in die Zehen. »Bitte. Ich will dir helfen. Wenn ich kann.«
War ich so leicht zu durchschauen? Oder lag es daran, dass bis zu diesem Moment niemand sich dazu herabgelassen hatte, mich als einen Menschen mit Gefühlen wahrzunehmen?
»Es … es ist meine Mutter. Sie will wieder heiraten.«
»Das ist alles? Ich hatte den Eindruck, es geht noch um etwas anderes.«
»Worum denn?« Ich hatte furchtbare Angst, was sie noch alles erraten haben mochte, und machte mich auf das Schlimmste gefasst: dass sie mir sagte, meine Zuneigung sei zwar schmeichelhaft, aber zwischen einer Schülerin und ihrer Lehrerin unpassend.
Stattdessen antwortete sie: »Ich dachte, es gäbe vielleicht einen Jungen, den du magst. Oder womöglich ein Frauenproblem?«
Ich verstand, was sie meinte, schüttelte jedoch den Kopf. Vor drei Monaten hatte ich meine erste Regelblutung gehabt.
»Dann geht es nur darum, dass deine Mutter wieder heiratet? Warum ist das so schrecklich? Magst du ihren Zukünftigen nicht?«
»Ich kenne ihn gar nicht. Mein Vater ist gestorben, als ich sechs war. Bis jetzt waren wir immer nur zu dritt, Mutter, meine Schwester und ich …« Ehe ich michs versah, erzählte ich ihr alles, von dem drohenden Umzug nach Dessau, von meinem Geigentalent und von Mutters Traum, mich auf die Musikhochschule zu schicken. Erst als ich kurz davor war, Mademoiselle zu beichten, dass auch sie mir Probleme bereitete, weil ich keine Worte für meine Gefühle fand, aber um jeden Preis in ihrer Nähe bleiben wollte, bremste ich mich.
Sie nippte an ihrem Kaffee. »Ich verstehe, dass man vor Veränderungen Angst hat«, sagte sie schließlich. »Aber ich habe den Eindruck, dass du dir keine Sorgen zu machen brauchst. Deine Mutter scheint eine anständige Frau zu sein, und jetzt hat sie einen Mann gefunden, der für sie sorgen will. Und du möchtest doch, dass sie glücklich ist, nicht wahr? Dessau ist nicht sehr weit weg, bestimmt gibt es dort gute Schulen und auch Mädchen, mit denen du dich anfreunden kannst.« Sie hielt inne. »Hier hast du keine Freundschaften geschlossen, dabei versucht das dunkelhaarige Mädchen neben dir – ich glaube, sie heißt Hilde – ständig, dich auf sich aufmerksam zu machen. Aber du verhältst dich, als wäre sie unsichtbar.«
Wirklich? Mir war das nicht aufgefallen. Andererseits achtete ich in der Schule derzeit auch auf nichts anderes als auf Mademoiselle.
»Ein Mädchen wie du, so hübsch und intelligent«, fuhr sie fort. »Wenn du wolltest, könntest du hundert Freundinnen haben. Aber du probierst es nicht einmal, oder?«
Jetzt hatte das Gespräch eine unangenehme Wendung genommen – ich wollte nicht über meinen Mangel an Freundinnen reden, sondern …
Mademoiselle deutete auf meine Tasse. »Du solltest den Kaffee trinken, ehe er kalt wird.«
Während ich den inzwischen lauwarmen Kaffee hinunterstürzte, betrachtete sie mich mit dieser irritierenden Kombination aus Offenheit und Einfühlungsvermögen, die mir das Gefühl gab, dass sie meine tiefsten Gedanken lesen konnte.
»Weißt du, was ein cinématographe ist?«, fragte sie auf einmal.
»Ein – was?« Ich hatte keine Ahnung, was sie meinte.
»Na, wie sagt man gleich – bewegte Bilder. Film.«
Davon hatte ich schon gehört, war jedoch noch nie in einem Filmtheater gewesen, denn Mutter lehnte so etwas strikt ab.
»Du hast noch nie einen Film gesehen«, interpretierte sie mein Schweigen. »Wundervoll! Ganz hier in der Nähe gibt es ein Lichtspielhaus – es ist zwar nicht so eindrucksvoll wie die Filmpaläste in Berlin, aber dafür auch nicht so teuer. Möchtest du hingehen? Ich liebe das Kino, das ist die Zukunft. Heute wird In Nacht und Eis gezeigt. Sagt dir der Untergang der Titanic etwas?«
Ich nickte. »Die Titanic ist auf einen Eisberg aufgelaufen und gesunken.« Ich erinnerte mich noch gut an das Unglück, zwei Jahre war es her, und sämtliche Zeitungsjungen hatten die Schlagzeilen tagelang durch die Straßen gebrüllt.
»Genau, eine Katastrophe, die viele Menschenleben gefordert hat. Angeblich ist der Film eine Sensation, produziert von Continental-Kunstfilm Berlin. Dort werden ganze Studios gebaut, nur um Filme zu machen.« Sie winkte dem Kellner nach der Rechnung. »Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch zur Vorstellung.«
Ich wusste, dass ich das Angebot hätte ablehnen, mich bei ihr für den Kaffee und den guten Rat bedanken und dann auf dem schnellsten Weg nach Hause gehen sollen. Liesel würde sich schon Sorgen machen. Womöglich würde sie Mutter erzählen, dass ich viel zu spät nach Hause gekommen war und …
Doch Mademoiselle legte ein paar Münzen auf den Teller mit der Rechnung, stand auf und streckte mir die Hand entgegen. »Beeil dich, Marlene, sonst verpassen wir die Stadtbahn!«
Wie konnte ich da widerstehen? Ich nahm ihre Hand und ließ mich von Mademoiselle Bréguand vom rechten Weg abbringen.
Ich weinte.
Ich konnte nicht anders, Schmerz und Staunen rissen mich mit, als die körnigen Bilder auf dem verzogenen Tuch, das man als Leinwand aufgehängt hatte, zum Leben erwachten: der im weiten Meer verlorene Schiffstitan; die verzweifelten Männer auf dem Deck; das Schiffsorchester, das bis zum letzten Moment spielte; die in den Rettungsbooten kauernden Frauen, die die Katastrophe hilflos mit ansehen mussten. So überwältigt war ich, dass ich an einer Stelle sogar Mademoiselles Knie ergriff – ich vergaß völlig, dass wir uns in der Öffentlichkeit befanden, zwar in einer abgedunkelten Halle, in der es nach Bier und abgestandenem Zigarettenrauch stank, aber umgeben von anderen Menschen, die mit ihren unterdrückten Entsetzensschreien und geflüsterten Kommentaren die Wirkung der Bilder noch verstärkten.
Danach war ich wie betäubt.
»War das nicht grandios?« Mademoiselle strahlte übers ganze Gesicht. »Irgendwann möchte ich dort auch sein.«
»Auf der Titanic?«, stieß ich hervor und versuchte, das Gefühl abzuschütteln, auf offener See gestrandet zu sein und zusehen zu müssen, wie die Menschen, die ich liebte, im kalten schwarzen Wasser den sicheren Tod fanden.
»Nein, Dummerchen. Dort oben! Auf der Leinwand. Ich möchte Schauspielerin werden, deshalb habe ich Paris verlassen und bin hierhergekommen. Ich arbeite als Lehrerin, bis ich genug gespart habe, um mir in Berlin ein Zimmer mieten zu können. Heutzutage ist es schrecklich teuer, in Berlin zu wohnen – es ist die modernste Stadt der Welt, und ich muss auch noch den Schauspielunterricht bezahlen.« Während wir auf die Hochbahn warteten, nahm sie wieder meine Hand. »Jetzt haben wir beide etwas für uns zu behalten, denn was ich dir gerade verraten habe, ist mein Geheimnis.«
Am liebsten hätte ich sie gefragt, ob sie in Frankreich jemanden, den sie liebte und vermisste, zurückgelassen hatte, um ihrem Traum nachzugehen. Aber ich brachte die Frage nicht über die Lippen, und nur allzu früh erreichten wir den Boulevard, wo das neue elektrische Licht die Menschen in den Biergärten und Cafés mit seinem schwefligen Schimmer übergoss.
Wir eilten auf die menschenleere Schule zu.
Am Tor machte Mademoiselle halt. »Ich wohne in dieser Richtung«, sagte sie und deutete auf eine Seitenstraße, die sich zwischen baufälligen älteren Gebäuden hindurchschlängelte. »Aber ich kann dich gern nach Hause begleiten und deiner Familie erklären, warum du erst so spät zurückkommst.« Sie lächelte verschmitzt. »Wir müssen sagen, dass du deine Aufgaben nicht rechtzeitig fertig hattest. Andererseits missfällt das vielleicht deiner Mutter.«
Missfallen seitens meiner Mutter war das mindeste, was mich erwartete.
»Das ist nicht nötig, Mutter arbeitet heute länger. Möglicherweise ist sie noch gar nicht zu Hause.« Obwohl es mir vorkam, als wäre eine Ewigkeit vergangen, hatte der Film kaum mehr als eine halbe Stunde gedauert. Natürlich würde Liesel mich ausschimpfen, aber Mutter kam frühestens um neun zurück.
»Richtig, sie ist ja in Dessau. Na gut. Bist du ganz sicher?«
»Ja.« Ich setzte zu einem Knicks an, aber sie ließ es gar nicht erst so weit kommen, sondern nahm mich einfach in die Arme. Ich nahm den Geruch ihres Körpers wahr, einen Hauch Lavendelwasser, Kaffee, den Gestank der Halle, der noch an ihren Kleidern haftete. Für einen Moment presste ich mich an sie. »Merci, Mademoiselle.«
»Mais non, ma fille, nicht doch.« Sie umfasste mein Gesicht und küsste mich auf beide Wangen. »Wenn wir allein sind, musst du mich in Zukunft Marguerite nennen. Frauen mit Geheimnissen sollten doch Freundinnen sein, n’est‑ce pas?«
Damit wandte sie sich ab und ging davon. Kurz bevor sie im Schatten der Häuser verschwand, drehte sie sich noch einmal um und hob die Hand. »À bientôt, mon amie Marlene!« Bis bald, meine Freundin.
Ich wollte sie nicht gehen lassen und würde wahrscheinlich nie wieder baden, um auf ewig ihren Duft auf meiner Haut zu behalten. Auf dem Weg nach Hause hob ich alle paar Schritte die Hände ans Gesicht, um daran zu riechen, und merkte nichts von der plötzlichen Kühle, die in der Luft lag.
Die Juliwärme hatte uns verlassen.
Ich sollte Marguerite Bréguand nie wiedersehen.
Kapitel 4
»Sie ist einfach weg«, sagte Hilde. Wir saßen draußen auf dem Schulhof, nachdem Frau Becker uns mitgeteilt hatte, dass kein Französischunterricht stattfinden würde – weder heute noch in absehbarer Zukunft. »Keine Ahnung, warum.«
Bestürzt hatte ich mich endlich überwunden und Hilde angesprochen, das dünne, dunkelhaarige Mädchen, das mir erklärt hatte, dass parfait »perfekt« bedeutete, und sich angeblich nach meiner Aufmerksamkeit sehnte. Aber zu meiner großen Enttäuschung schien auch sie den Grund von Mademoiselle Bréguands Verschwinden nicht zu kennen.
So saßen wir nebeneinander, während sich die anderen Mädchen – hocherfreut über den freien Nachmittag – mit Seilhüpfen die Zeit vertrieben. Nach einer Weile angelte ich das letzte Stückchen Marzipan aus meiner Tasche und gab es Hilde. »Hier.«
»Oh.« Sie nahm das Päckchen entgegen, als hätte ich ihr eine Perle überreicht. »Danke, Marie.«
»Marlene«, verbesserte ich, während ich mit den Augen die Umgebung sinnlos nach Mademoiselle absuchte. »Ich heiße Marlene.«
»Ach wirklich? Ich dachte, du heißt Marie. Marlene ist ein eigenartiger Name. Aber irgendwie auch schön.« Achselzuckend kaute sie auf dem Marzipan herum.
»Und du hast wirklich nichts gehört?«, fragte ich noch einmal. »Wie kann es denn sein, dass sie einfach fort ist? Sie war Madame Servines Nachfolgerin, es hat so lange gedauert, bis sie kam, und sie war gerade erst ein paar Wochen bei uns.«
Nachdenklich sah Hilde mich an. »Vielleicht hat es was mit dem Krieg zu tun.«
»Mit welchem Krieg denn?« Ich starrte sie an. »Es gibt keinen Krieg.«
»Noch nicht.« Ihr Gesicht nahm einen eifrigen Ausdruck an, als wüsste sie etwas, dessen sich ihre neue Freundin noch nicht bewusst war. »Aber es gibt Gerüchte, dass der Kaiser den Krieg erklärt hat …« Sie runzelte die Stirn. »Ich weiß auch nichts Genaues, aber mein Vater ist bei der Infanterie, und er hat meiner Mutter letzte Woche geschrieben, dass sein Regiment mobilmacht, weil der Krieg unmittelbar bevorsteht.«
»Also ich habe davon nichts gehört«, verkündete ich sicherer, als ich mich fühlte. Wie hätte ich so etwas denn hören können? Wenn der Feind nicht gerade bei uns an die Tür klopfte und Bescheid sagte, würde Mutter sich um keinen Krieg scheren, selbst wenn er direkt vor unserer Haustür ausgebrochen wäre.
Mir graute bei dem Gedanken, dass jemand mich mit Marguerite gesehen und sie bei der Schulleiterin gemeldet hatte. Eine Schülerin nach Schulschluss dazubehalten, um Defizite zu korrigieren, war akzeptabel, aber sie zu einem Kaffee und dann auch noch einem Ausflug in ein Lichtspielhaus einzuladen – das wäre Grund genug für eine Entlassung gewesen. Hatte ich Mademoiselles geheimnisvolles Verschwinden unwissentlich verschuldet?
Falls ja, konnte ich nicht länger hier herumsitzen. »Komm, wir müssen etwas tun«, sagte ich, sprang auf die Füße und griff nach meiner Schultasche.
Hilde glotzte mich an, Marzipankrümel am Kinn. »Wo willst du hin?«
»Raus.« Ich machte mich auf den Weg über den Hof, als Hilde mich am Riemen meiner Mappe packte. »Das darfst du nicht, Marlene. Es hat noch nicht geläutet. Das Tor ist abgeschlossen.«
»Diese dummen Kühe von Lehrerinnen«, schimpfte ich. »Sind wir hier in einer Schule oder einem Gefängnis?«
»Beides«, antwortete Hilde, und ich musste grinsen. Trotz ihres unscheinbaren Äußeren hatte Hilde anscheinend Humor. »Aber das hintere Tor ist nie abgeschlossen. Der Brandinspektor hat gesagt, es muss offen bleiben, falls es mal einen Notfall gibt. Und da alle hier draußen sind …«, fuhr sie fort und grinste ebenfalls.
So schlichen wir gemeinsam durch das fast menschenleere Gebäude zum hinteren Tor, das auf einen schlammigen Weg über verlassenes Weideland führte. Vor kurzem waren solche Brachen noch typisch für Schöneberg gewesen, aber nun entstanden überall dort, wo früher Kartoffeln und Salat angebaut worden waren, neumodische Mietskasernen – billige Häuserblocks für die rasant anwachsende Bevölkerung Berlins, das aus allen Nähten zu platzen drohte. Ich erinnerte mich an das, was Mademoiselle mir über ihre Zukunftspläne erzählt hatte. Ob unser Erlebnis gestern Abend sie dazu veranlasst hatte, alle Vorsicht in den Wind zu schlagen und in die Stadt zu verschwinden, in der sie ihre Träume wahr werden lassen wollte?
Der Pfad endete an der Seitenstraße, in der Mademoiselles Zimmer lag, wie sie mir gestern erzählt hatte. Auf dem unebenen Kopfsteinpflaster räkelten sich streunende Hunde, magere Kinder spielten mit Murmeln, und mir sank der Mut. Ich hatte nicht gesehen, in welches Haus Mademoiselle gegangen war, und wusste demzufolge auch nicht, in welchem dieser heruntergekommenen Gemäuer sie sich eingemietet hatte.
»Und?«, fragte Hilde. Ich bewunderte ihre Courage, ich konnte nicht anders. Ohne eine Sekunde zu zögern, war sie mit mir losgezogen, obwohl sie doch – genau wie ich – eine harte Strafe riskierte.
Ich seufzte. »Sie ist hier langgegangen, aber …« Ich brach ab, als von fern laute Stimmen und der Lärm marschierender Füße zu uns drangen. Bestürzt sah ich Hilde an. »Es hat begonnen«, rief sie.
Schon rannte sie die schmale Straße entlang, hinunter zur Chaussee, und ich war gezwungen, ihr zu folgen. In der Hoffnung, dass die Unruhe vielleicht die Bewohner der Häuser hervorlocken würde, warf ich noch einen letzten Blick über die Schulter, aber die faulen Hunde spitzten nur die Ohren, sonst regte sich nichts. Schlaff hing die Wäsche vor den schmutzigen Fenstern, aus denen niemand herausschaute.
Atemlos blieb ich neben Hilde stehen. Vor uns drängten sich die Passanten auf den Gehwegen, während mitten auf der Straße eine Horde junger Männer die Straße entlangstampfte und die Fahne mit dem schwarzen Kaiseradler schwenkte. Die meisten waren Jugendliche mit rauen Händen und bis zu den Ellbogen aufgerollten Hemdsärmeln, Arbeiter aus den nahegelegenen Fabriken – gemeiner Pöbel, hätte Mutter gesagt –, und alle sangen: »Heilige Flamme, glüh, glüh und erlösche nie fürs Vaterland. Wir alle stehen dann mutig für einen Mann, kämpfen und bluten gern für Thron und Reich!«
»Das ist ›Heil dir im Siegerkranz‹«, schrie Hilde mir ins Ohr. »Siehst du? Wir sind im Krieg.«
Ich konnte es nicht glauben. Während die Demonstranten immer zahlreicher wurden, sah ich, wie die Damen mit ihren Sonnenschirmen und den kleinen Hunden, die Herren mit ihren Bowlern und auch die Gouvernanten mit den staunenden Kindern applaudierten und grüßend die Faust hoben, als wäre der Zirkus in die Stadt gekommen.
»Sind denn alle verrückt geworden?«, fragte ich, aber niemand hörte mir zu. Das Singen und Schreien war ohrenbetäubend, hallte über die Chaussee und stieg hinauf zum wolkenverhangenen Himmel, so laut, dass wir die Schulglocke fast überhört hätten.
Hilde schnappte nach Luft. »Sie lassen uns früher raus. Beeil dich!«
Sie zog mich durch die Menge, bahnte sich schubsend und drängelnd einen Weg, bis wir das offen stehende Schultor erreichten. Darunter hatten sich die Schülerinnen versammelt und beobachteten, von den Lehrerinnen mühsam im Zaum gehalten, die Parade mit großen Augen und vor Aufregung bebenden Zopfschleifen.
Frau Becker entdeckte uns. »Hilde! Marie!«, bellte sie. »Rein mit euch, aber schnell!«
Wir zwängten uns durch die Reihen unserer Mitschülerinnen und wurden von den Lehrerinnen sofort am Kragen gepackt. »Wie könnt ihr es wagen wegzulaufen?«, herrschte Frau Becker uns an. »Was in aller Welt habt ihr euch dabei gedacht?«
Hilde warf mir einen vielsagenden Blick zu. Anscheinend gingen die Lehrerinnen davon aus, dass wir durch das offene Tor auf die Straße geschlüpft waren. »Wir wollten nur sehen, was los ist«, antwortete ich rasch. »Wir sind nicht weit gegangen.«
»Ihr seid entschieden zu weit gegangen«, gab Frau Becker zurück. »Ich werde die Direktorin verständigen. Eine bodenlose Frechheit, dass ihr euch einfach davonstehlt, wenn die ganze Welt in Schutt und Asche zu fallen droht!«
»In Schutt und Asche?«, wiederholte ich erschrocken, denn auf einmal wurde dieser angebliche Krieg furchterregend real.
»Ja. Seine Kaiserliche Majestät hat geschworen, die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand von Österreich zu rächen. Deutschland muss seine Ehre verteidigen. Aber das tut nichts zur Sache – Krieg oder nicht, einen solchen Ungehorsam kann man einem Mädchen keinesfalls durchgehen lassen.«
Sie führte uns ab und brachte uns direkt ins Büro der Direktorin, wo wir eine harsche Standpauke über uns ergehen lassen mussten. Und während sich in der darauffolgenden Woche direkt vor unseren Toren die gesamte Nation kopfüber ins Desaster stürzte, schwitzten Hilde und ich über den Strafarbeiten, die man uns aufgebrummt hatte, und durften in den Pausen nicht einmal mehr auf den Schulhof.
Kapitel 5
»Muss ich?« Meine Finger waren eiskalt, und wenn ich auf den Korb mit der aus alten Pullovern aufgeribbelten Wolle hinunterschaute, die ich zu Handschuhen, Schals und Mützen verarbeiten sollte, spürte ich die Verzweiflung nicht nur in meinem immerzu hungrigen Magen.
»Möchtest du, dass unsere tapferen Männer sich die Finger abfrieren, nur weil du müde bist?«, war Mutters empörte Gegenfrage. »Was wir hier tun, ist nur ein kleines Opfer für ihres. Also hör auf, dich zu beschweren, und stricke den Schal fertig. Die Hilfskrankenschwestern brauchen die Sachen rechtzeitig, um sie mit an die Front nehmen zu können.«
Ich widerstand der Versuchung, Liesel anzuschauen und die Augen zu verdrehen. Auch sie saß im riesigen Wohnzimmer der Von-Losch-Residenz in Dessau, in die wir nach der Kriegserklärung des Kaisers umgezogen waren, und nähte.
Zu meiner großen Erleichterung hatten wir wenig mit dem Leutnant zu tun gehabt, bevor er eingezogen wurde, aber bei den wenigen Begegnungen hatte ich ihn als steifen, humorlosen Mann wahrgenommen, der Mutter ausnahmslos als »Frau« anredete und uns nur kurz begutachtete, als wären wir zusätzliche Koffer, die sie mitgebracht hatte. In diesen ersten Wochen waren wir ihm aus dem Weg gegangen, hatten uns strikt nach seinen Essenszeiten gerichtet, denn er legte großen Wert darauf, dass alle um den Tisch herumsaßen, kein Wort sprachen und aufmerksam seinen Ausführungen lauschten, wie wichtig es war, unsere preußische Ehre zu verteidigen. Mutter ihrerseits fügte sich ihm, als wäre sie immer noch seine Hausangestellte und nicht die Frau, die er zu ehelichen beabsichtigte. Zu meiner Überraschung hatten sie, als er einberufen wurde, immer noch nicht geheiratet. Warum Mutter trotzdem darauf bestanden hatte, dass wir hierherzogen, wagte ich nicht zu fragen. Wie konnte Josephine Felsing mit einem Mann zusammenleben, ehe das Aufgebot bestellt war? Ohne den Segen der Kirche? Wahrscheinlich lebte sie gar nicht wirklich mit ihm zusammen. Oder doch?
Aber nun war er fort, um für das Kaiserreich zu kämpfen, und Mutter versah weiter die Arbeit seiner Haushälterin, mit dem einzigen Unterschied, dass sie jetzt das Haus in Dessau beaufsichtigte. Ich fragte, inwieweit finanzielle Erwägungen eine Rolle spielten – selbst wenn Mutter das nie im Leben zugegeben hätte –, denn ohne ihre Arbeit hätten wir unsere Wohnung nicht bezahlen können. Folglich waren wir gezwungen, an dem Ort zu leben, den Herr von Losch bestimmte. Mir gefiel das ganz und gar nicht; ich fand Mutters freudlose Unterwürfigkeit verstörend. Allmählich begann ich zu verstehen, was Liesel über eine alleinlebende Frau gesagt hatte: Obwohl Mutter auf ihre Herkunft so stolz war und darauf bestand, dass wir die mit ihrem gesellschaftlichen Status verbundenen Anstandsregeln peinlich genau einhielten, waren wir letztlich doch alles andere als privilegiert, sondern ganz und gar abhängig von den Launen ihres Arbeitgebers.
Und in Wahrheit hatte Mutter in Dessau nicht viel zu verwalten. Neben einer zänkischen katholischen Köchin gab es noch ein nervöses Dienstmädchen, das in ständiger Angst vor Mutters Kontrollen lebte, und einen lahmen Kutscher, der, soweit ich es beurteilen konnte, rein gar nichts zu tun hatte, da die Ställe leer standen. Für den Krieg waren sämtliche Pferde erst beschlagnahmt worden, und wurden jetzt, wie man munkelte, für den Suppentopf geschlachtet.