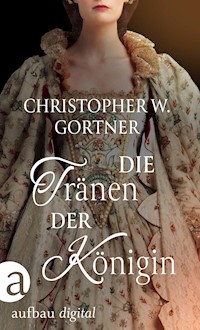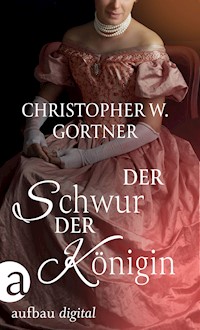9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Opulent, packend, unvergesslich: das faszinierende Porträt der Caterina de Medici.
Mit gerade einmal acht Jahren wird Caterina de Medici im Zuge der republikanischen Unruhen zur Geisel genommen und gefangen gehalten. Als junges Mädchen wird sie Heinrich dem II. versprochen und nach Frankreich, in eine ihr feindlich gesinnte, fremde Umgebung, geschickt. Am französischen Hof ist sie dann jahrelang den Demütigungen der Liebhaberin ihres Mannes ausgesetzt. Doch Caterina lässt sich nicht einschüchtern, und konzentriert all ihre Energie auf ein Ziel: den Thron für ihre Söhne zu sichern. Auch wenn dies bedeutet, ihre eigenen Ideale und die Leidenschaft ihres Herzens zu opfern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Opulent, packend, unvergesslich: das faszinierende Porträt der Caterina de Medici
Mit gerade mal acht Jahren wird Caterina de Medici im Zuge der republikanischen Unruhen zur Geisel genommen und gefangen gehalten, als junges Mädchen wird sie Heinrich dem II. versprochen und nach Frankreich, in eine ihr feindlich gesinnte, fremde Umgebung, geschickt. Am französischen Hof ist sie dann jahrelang den Demütigungen der Liebhaberin ihres Mannes ausgesetzt. Doch Caterina lässt sich nicht einschüchtern, und sie konzentriert all ihre Energien auf ein Ziel: den Thron für ihre Söhne zu sichern. Auch wenn dies bedeutet, ihre eigenen Ideale und die Leidenschaft ihres Herzens zu opfern …
Über C. W. Gortner
C. W. Gortner wuchs in Südspanien auf. In Kalifornien lehrte er an der Universität Geschichte mit einem Fokus auf starke Frauen inder Historie. In Marlene Dietrich erkannt er eine so »stürmische wie unkonventionelle und mutige Frau«, dass er einfach über sie schreiben musste. Er lebt in San Francisco.
Mehr Informationen zum Autor unter www.cwgortner.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
C. W. Gortner
Die florentinische Prinzessin
Übersetzt von Sabine Lohmann und Peter Pfaffinger aus dem amerikanischen Englisch
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Blois, 1589
Teil I: 1527 – 1532 Das zarte Blatt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Teil II: 1532 – 1547 Nackt wie ein Neugeborenes
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil III: 1547 – 1559 Licht und Ruhe
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Teil IV: 1559 – 1560 Die Tiger
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Teil V: 1560 – 1570 Der Sturm
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Teil VI: 1571 – 1574 Blutnacht
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Teil VII: 1574 – 1588 Der Geliebte
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Blois, 1589
Nachwort des Autors
Bibliografie
Impressum
Für Erik, der mich immer daran erinnert, dass das Leben mehr zu bieten hat; und für Jennifer, die mich zum Lachen bringt.
Blois, 1589
Ich halte nichts von Sentimentalität.
Schon in meiner Jugend neigte ich kaum zu Melancholie oder Wehmut. Ich blickte selten zurück, hielt selten inne, um der verrinnenden Zeit nachzulauschen. Manch einer würde wohl sagen, ich kenne weder Reue noch Bedauern. Will man meinen Feinden glauben, so blicken meine Augen starr in die Zukunft, auf den nächsten auszufechtenden Krieg, den nächsten in Königswürden zu erhebenden Sohn, den nächsten zu besiegenden Feind.
Wie wenig sie mich doch kennen. Wie wenig irgendjemand mich kennt. Vielleicht war es mein Schicksal, allein im Mythos meines eigenen Lebens zu verharren, um schließlich Zeugnis abzulegen angesichts der Legende, die sich um mich her entfaltete wie eine giftige Blüte. Man nannte mich Mörderin, Opportunistin, Retterin und Opfer. Und im Laufe der Jahre wurde so viel mehr aus mir, als man es je von mir erwartet hatte, auch wenn die Einsamkeit immer da war wie ein treuer Hund an meiner Seite.
In Wahrheit ist keiner von uns unschuldig.
Wir alle haben Sünden zu beichten.
Flasche! Aus deiner dunklen Tiefe Tausend Geheimnisse ich riefe, Warte ich geduldig bloß; Mögest künden mir mein Lo
RABELAIS, Gargantua und Pantagruel, Kap. 5, XLIV
Teil I 1527 – 1532 Das zarte Blatt
1
Ich war zehn Jahre alt, als mir bewusst wurde, dass ich eine Hexe sein könnte. Ich saß, wie üblich stickend, bei meiner Tante Clarissa, während das Sonnenlicht langsam über den Boden der Galerie wanderte. Draußen vor dem Fenster hörte ich das Plätschern des Brunnens im Hof, die Rufe der Straßenhändler in der Via Larga, das Klappern der Hufe auf dem Kopfsteinpflaster, und ich dachte zum hundertsten Male, ich würde es keine Minute mehr hier drinnen aushalten.
»Caterina Romelo de Medici, kann es sein, dass du schon fertig bist?«
Ich blickte auf. Die Schwester meines verstorbenen Vaters, Clarissa de Medici e Strozzi, sah mich von ihrem Sessel aus an. Ich wischte mir mit dem Ärmel über die Stirn. »Es ist so heiß hier drinnen«, sagte ich. »Darf ich nach draußen gehen?«
Sie hob eine Braue. Noch ehe sie sprach, hätte ich ihre Worte bereits aufsagen können, sooft hatte sie sie mir schon eingebläut: »Du bist die Herzogin von Urbino, die Tochter von Lorenzo de Medici und seiner Frau Madeleine de la Tour, die von edlem französischem Blut war. Wie oft soll ich es dir noch sagen, du musst deine Regungen zügeln lernen, um dich auf deine große Zukunft vorzubereiten.«
Die Zukunft war mir egal. Wichtig war mir nur, dass draußen Sommer und ich hier im Palazzo meiner Familie eingesperrt war und den ganzen Tag lernen und sticken musste, als könnte ich in der Sonne schmelzen.
Ich schleuderte meinen Stickrahmen zu Boden. »Ich langweile mich! Ich will wieder nach Hause.«
»Florenz ist dein Zuhause; es ist deine Geburtsstadt«, entgegnete sie. »Ich habe dich aus Rom mitgenommen, weil du fieberkrank warst. Du kannst dich glücklich schätzen, dass du überhaupt hier sitzen und mir Widerworte geben kannst.«
»Ich bin ja nicht mehr krank«, begehrte ich auf. Ich konnte es nicht leiden, wenn sie meine angegriffene Gesundheit als Vorwand benutzte. »In Rom hat Papa Clemens mir wenigstens eigene Dienstboten gewährt und ein Pony zum Reiten.«
Sie blickte mich ernst an, ohne einen Anflug von Zorn, den die Erwähnung meines päpstlichen Oheims sonst in ihr auslöste. »Mag sein, aber nun bist du hier, in meiner Obhut, und da wirst du dich meinen Regeln beugen. Es ist noch früh am Nachmittag. Ich lasse es nicht zu, dass du in diese Hitze hinausgehst.«
»Ich werde eine Haube aufsetzen und mich im Schatten halten. Bitte, Tante Clarissa. Ihr könnt ja mitkommen.«
Ich sah, wie sie versuchte, ein unwillkürliches Lächeln zu unterdrücken, als sie aufstand. »Wenn deine Arbeit zufriedenstellend ausfällt, können wir vor dem Nachtmahl eine kleine Runde auf der Loggia drehen.« Sie trat auf mich zu, eine hagere Frau in einem schlichten grauen Kleid, mit ovalem Gesicht und großen schwarzen Augen – den Medici-Augen, die auch ich geerbt hatte, ebenso wie die lockigen kastanienbraunen Haare und die langgliedrigen Hände.
Sie hob meine Stickerei auf und schürzte tadelnd die Lippen, als sie mich kichern hörte. »Du findest es wohl witzig, der Heiligen Mutter Gottes ein grünes Gesicht zu geben? Also wirklich, Caterina; so eine Blasphemie.« Sie warf mir den Stickrahmen auf den Schoß. »Bring das sofort in Ordnung. Die Stickerei ist eine Kunst, die du ebenso beherrschen musst wie deine anderen Fächer. Ich will nicht, dass man von dir sagt, Caterina de Medici näht wie eine Bäuerin.«
Ich hielt es für besser, mir das Lachen zu verkneifen, und begann, die Anstoß erregenden grünen Fäden herauszuzupfen, während meine Tante zu ihrem Sessel zurückkehrte. Sie blickte sinnend in die Ferne, und ich fragte mich, welche Prüfungen sie wohl noch für mich parat hatte. Ich liebte sie, doch sie sprach immer nur davon, wie hinfällig das Prestige unserer Familie geworden sei seit dem Tode meines Urgroßvaters Lorenzo il Magnifico; wie Florenz einst eine Hochburg der Künste und der Bildung gewesen sei, unter der Schirmherrschaft unserer Familie, und wie wir jetzt nur mehr illustre Gäste in der Stadt seien, die wir aufzubauen geholfen hatten. Mir obliege es, sagte sie, den Ruhm unserer Familie wiederherzustellen, da ich der letzte legitime Spross vom Stamme des Magnifico sei.
Ich fragte mich, wie ich eine so hehre Aufgabe wohl erfüllen sollte. Ich war Waise seit kurz nach meiner Geburt; ich hatte weder Schwestern noch Brüder und war abhängig vom Wohlwollen meines päpstlichen Oheims. Als ich dies einmal erwähnte, schimpfte meine Tante: »Clemens der Siebte wurde als Bastard geboren. Er hat sich den Heiligen Stuhl durch Schmiergelder erschlichen, zu unserer großen Schande. Er ist kein echter Medici. Er hat keine Ehre.«
Wenn er bei seinem Prestige den Ruhm unserer Familie nicht wiederherstellen konnte, wie konnte sie es dann von mir erwarten? Doch sie schien überzeugt, dass es mein Schicksal sei; jeden Monat musste ich unbequeme herzogliche Gewänder anlegen und für ein neues Porträt posieren, was dann in vielen Miniaturen kopiert und den ausländischen Prinzen zugesandt wurde, die mich zu heiraten gedachten. Ich war noch zu jung für die Ehe, aber Tante Clarissa ließ keinen Zweifel daran, dass sie schon die Kathedrale und die Anzahl meiner Brautjungfern ausgewählt hatte …
Plötzlich krampfte sich mir der Magen zusammen. Ein stechender Schmerz durchfuhr mich, und meine Umgebung verschwamm, als wären wir unter Wasser getaucht. Übelkeit machte mir den Mund sauer. Blindlings taumelte ich hoch und hörte meinen Stuhl umfallen. Eine schreckliche Dunkelheit senkte sich über mich. Ich spürte, wie mein Mund sich zu einem lautlosen Schrei öffnete, während die Dunkelheit sich wie ein riesiger Tintenfleck ausbreitete und alles um mich her verschluckte. Ich war nicht mehr in der Galerie und stritt mit meiner Tante, sondern ich befand mich an einem ungewissen Ort, machtlos gegen eine Kraft, die aus meinem Inneren aufzusteigen schien …
Ich stehe unsicher zwischen Fremden. Sie weinen und wehklagen. Ich sehe Tränen über ihre Gesichter laufen, auch wenn ich ihre Klagen nicht hören kann. Vor mir steht ein schwarz verhängtes Bett. Ich weiß augenblicklich, dass etwas Grauenvolles darauf liegt, etwas, das ich nicht sehen sollte. Ich versuche, zurückzubleiben, doch meine Füße tragen mich mit albtraumhafter Unvermeidlichkeit darauf zu, und wie gebannt strecke ich eine fleckige, aufgedunsene Hand aus, die ich nicht als die meine erkenne, teile den Vorhang und gewahre…
»Dio mio, no!«, entrang sich mir ein Schrei. Ich fühlte den Arm meiner Tante um mich, das ängstliche Streicheln ihrer Hand auf meinem Scheitel. Ich hatte schreckliches Bauchweh und lag hingestreckt auf dem Boden, Stickrahmen und verworrene Garne um mich her verstreut.
»Caterina, Kindchen«, sagte meine Tante. »Bitte, nicht wieder das Fieber …«
Als das seltsame Gefühl, meinen Körper verlassen zu haben, langsam abflaute, richtete ich mich mühsam auf. »Ich glaube nicht, dass es das Fieber ist«, sagte ich. »Ich habe etwas gesehen: einen Mann, tot auf einem Totenbett. Er war so echt, Zia … es war entsetzlich.«
Sie starrte mich an. Dann wisperte sie: »Una visione«, als sei es etwas, das sie lange befürchtet hatte. Sie schenkte mir ein bebendes Lächeln und half mir auf die Beine. »Komm, das ist genug für heute. Lass uns jetzt spazierengehen, si? Morgen werden wir den Maestro besuchen. Er wird wissen, was am besten zu tun ist.«
2
Meine Kammerjungfer weckte mich vor Tagesanbruch. Nach einem Frühstück aus Käse und Brot, das ich hastig verschlang, kleidete sie mich in ein schlichtes Gewand, band meine Locken zurück und legte mir ein Kapuzencape um die Schultern. Dann geleitete sie mich eilends in den Hof, wo Tante Clarissa und der hünenhafte Diener, der sie auf all ihren Gängen begleitete, mich erwarteten.
Ich war froh, endlich einmal in die Stadt gehen zu dürfen, obgleich ich annahm, dass wir den Weg in einer geschlossenen Sänfte zurücklegen würden. Stattdessen schlug meine Tante ihre Kapuze hoch, nahm mich an die Hand und führte mich zum Tor hinaus auf die Via Larga, der Diener dicht auf unseren Fersen.
»Warum gehen wir zu Fuß?«, fragte ich sie, auch wenn ich dachte, dass es viel mehr Spaß machte, die Stadt auf diese Weise zu erleben, statt nur durch die zugezogenen Vorhänge der Sänfte zu lugen.
»Wir gehen zu Fuß, weil ich nicht will, dass man weiß, wer wir sind«, erklärte meine Tante. »Wir sind die Medici, und die Leute sind schwatzhaft. Ich will nicht, dass alle in Florenz sich das Maul darüber zerreißen, dass Madama Strozzi ihre Nichte zu einem Hellseher gebracht hat.« Ihre Hand schloss sich fester um die meine. »Verstehst du? Ruggieri mag sehr gefragt sein wegen seiner Talente, doch er ist nun mal ein konvertierter Jude.«
Ich nickte unsicher. Ich wusste, dass meine Tante oft nach dem Maestro schickte, um Kräuterelixiere zu brauen; er hatte auch geholfen, mich von meinem Fieber zu kurieren, aber ich hatte ihn noch nie leibhaftig gesehen. Durfte er uns vielleicht nicht besuchen, weil er Jude war?
Wir spazierten die Via Larga hinab. Seit meiner Ankunft in Florenz, vor drei Jahren, hatte ich den Palazzo genau viermal verlassen, und immer nur zu feierlichen Besuchen des duomo, bewacht von Dienerschaft, die mir die Sicht nahm, als würde jede Berührung mit dem gemeinen Volk meine Gesundheit gefährden. Nun, da meine Tante mich zum ersten Mal in die Stadt ausführte, fühlte ich mich wie aus der Gefangenschaft entlassen.
Die aufgehende Sonne tauchte die Stadt in Safrangelb und Rosa. In den Wohnvierteln nahe des Palazzo hingen noch die Dünste nächtlicher Gelage. In den krummen Gassen mussten wir uns zwischen Pfützen aus Unrat durchschlängeln. Zu gern wäre ich hier und da stehen geblieben, um die in Nischen prangenden Statuen zu bewundern, die kupfernen Herolde des Baptisteriums und die prächtige Fassade des duomo, doch meine Tante zog mich ungeduldig mit sich fort; sie mied den geschäftigen Marktplatz, nahm lieber den Weg durch die rückwärtigen Gassen, wo die alten Häuser sich wie absterbende Bäume neigten und das Tageslicht aussperrten.
Ich sah den Diener nach dem Messer an seiner Seite greifen. Es war so dunkel hier, und es stank nach Fäulnis. Ich schmiegte mich dichter an meine Tante, als ich magere, zerlumpte Kinder und ausgemergelte Hunde vorbeihuschen sah. Ein paar verwitterte alte Weiber in zerschlissenen Tüchern hockten auf ihren Türstufen und musterten uns mit scheelen Blicken. Nach vielen verwirrenden Abzweigungen gelangten wir schließlich zu einem windschiefen Holzhaus, das aussah, als könnte es jeden Moment einstürzen. Hier blieb meine Tante stehen; ihr Diener pochte an die klapprige Tür.
Sie schwang auf, und ein schmaler Junge stand da, mit zerzaustem Haar und schläfrigen braunen Augen. Als er uns sah, verneigte er sich tief. »Duchessina, ich bin Carlo Ruggieri. Mein Vater erwartet Euch.«
Meine Tante drückte mir eine kleine Stoffbörse in die Hand. Ich blickte überrascht zu ihr auf. »Geh«, sagte sie. »Du musst den Maestro allein aufsuchen. Bezahle ihn, wenn er fertig ist.« Ich zögerte, und sie schubste mich an. »Säume nicht, Kind. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«
Ich nahm an, dieser Carlo müsse wohl der älteste Sohn des Maestro sein; hinter seinem Rücken lugte noch ein kleinerer Junge hervor. Ich lächelte ihn vorsichtig an, und der Kleine wagte sich vor, streckte eine schmuddelige Patschhand nach meinem Rock aus.
»Das ist mein Bruder Cosimo«, sagte Carlo. »Er ist vier Jahre alt und mag Naschwerk.«
»Ich mag auch Naschwerk«, sagte ich zu Cosimo. »Aber ich habe heute keines dabei.« Er schien den Klang meiner Stimme zu schätzen und klammerte sich an meine Hand, während Carlo mich in das dämmrige Innere des Hauses geleitete, das von einem seltsam durchdringenden Geruch erfüllt war. Ich erspähte einen vergilbten Totenschädel auf einem Stapel stockfleckiger Pergamente, bevor Carlo mich eine knarrende Treppe hinaufführte. Die Gerüche wurden stärker: Ich roch Kampher, Kräuter und etwas Bittersüßes, das mich an den Herbst gemahnte, wenn die Schweine geschlachtet wurden.
»Papa!«, hörte ich Carlo rufen, »Papa! Die Medici ist da!« Er schob eine schmale Tür auf und wandte sich zu uns um. »Er will Euch allein sehen. Du musst sie jetzt loslassen, Cosimo.«
Cosimo schürzte die Lippen und ließ meine Hand los. Ich straffte die Schultern und trat in die Kammer des Maestro. Das Erste, was ich sah, war das Licht. Es strömte in schrägen Strahlenbündeln durch ein offenes Dachfenster hoch oben zwischen den Deckenbalken und erhellte einen Raum, der nicht größer war als mein Schlafgemach im Palazzo. Regale voller Bücher und Gläser mit dunklen Dingen in irgendeiner Flüssigkeit bedeckten die Wände. In einer Ecke stapelten sich Sitzkissen rings um einen Messingtisch. Ein breiter Marmorblock auf Böcken nahm die Mitte des Raumes ein. Ich war überrascht, einen Leichnam darauf zu sehen, halb von einem Leintuch bedeckt.
Bloße Füße ragten unter dem Tuch vor. Eine Stimme, die von nirgendwoher zu kommen schien, sagte: »Ah, Duchessina, da seid Ihr ja!«, und dann kam der Maestro in Sicht, schlurfend, hohlwangig, silberbärtig, eine fleckige Schürze über dem schwarzen Gewand. Er winkte mich heran. »Möchtet Ihr mal sehen?«
Ich trat näher. Ich musste mich auf die Zehenspitzen stellen, um über den Rand des Blocks zu schauen. Der Leichnam war der einer Frau mit geschorenem Kopf, die von der Kehle bis zur Leiste aufgeschlitzt war. Es gab weder Blut noch üblen Geruch, bis auf den der Kräuter. Ich hatte erwartet, angeekelt zu sein, abgestoßen. Stattdessen war ich fasziniert von den blauen Lungen und dem geschrumpften Herzen, das in einem Käfig aus gebrochenen Rippen ruhte.
»Was macht Ihr da?«, fragte ich leise, als ob sie mich hören könnte.
Er seufzte. »Ich suche nach ihrer Seele.«
»Und? Könnt Ihr eine Seele sehen?«
Sein Lächeln vertiefte die Runzeln in seinem Gesicht. »Muss man immer etwas sehen, um daran zu glauben?« Er nahm mich bei der Hand und führte mich zu den Kissen in der Ecke. »Setzt Euch. Sagt mir, warum Ihr gekommen seid.«
Ich war mir nicht sicher, was ich sagen sollte, aber seine sanfte Art weckte in mir den Wunsch, ihm die Wahrheit zu erzählen. »Ich … ich habe gestern etwas gesehen. Es machte mir Angst.«
»War es ein Traum?«
»Nein, ich war wach.« Ich hielt inne, dachte nach. »Aber es war wie ein Traum.«
»Sagt mir, was Ihr gesehen habt.«
Ich beschrieb es ihm. Und wieder empfand ich diese schreckliche Hilflosigkeit und hörte meine Stimme zittern. Als ich geendet hatte, faltete der Maestro die Hände. »Lag da jemand, den Ihr kanntet, auf dem Bett?« Er lächelte, als ich den Kopf schüttelte. »Ich verstehe. Darum habt Ihr Euch gefürchtet. Ihr dachtet, Ihr würdet einen Angehörigen sehen, und stattdessen saht Ihr einen Fremden. Einen jungen Mann, nicht wahr, der gewaltsam zu Tode kam?«
Es lief mir kalt über den Rücken. »Woher wisst Ihr das?«
»Ich sehe es Euch an. Ach, mein Kind, Ihr müsst Euch nicht ängstigen, nur begreifen, dass nur wenige Menschen Verständnis dafür aufbringen würden, was Ihr mir eben erzählt habt.« Er beugte sich zu mir vor. »Was Ihr gestern erlebt habt, nennt man eine Vorahnung. Sie betrifft die Zukunft, kann aber auch ein Echo aus der Vergangenheit sein. Im Altertum hielt man die Hellsicht für ein Geschenk der Götter und verehrte den, der diese Gabe besaß. Aber in unseren dunklen Zeiten hält man sie meist für ein Hexenzeichen.«
Ich starrte ihn entsetzt an. »Meine Tante sagte, es sei eine Vision. Bin ich deswegen hier? Bin ich verflucht?«
Er lachte auf. »Ich habe schon manches Rätsel gelöst, aber den Beweis, dass ein Fluch wirkt, müsste ich erst noch erbringen. « Er kitzelte mich mit seinem knotigen Finger unter dem Kinn. »Glaubt Ihr denn, dass Ihr böse seid?«
»Nein. Ich höre täglich die Messe und verehre unsere Heiligen. Aber manchmal habe ich böse Gedanken.«
»Wie wir alle. Ich versichere Euch, es gibt keinen Fluch. Ich habe Euch Euer Horoskop gestellt, als Ihr zur Welt kamt, und habe dort nichts Böses gefunden.«
Mein Horoskop? Das hatte meine Tante nie erwähnt.
»Warum hatte ich denn diese … Vision?«, fragte ich.
»Nur Gott weiß darauf die Antwort, aber ich warne Euch, es könnte sein, dass es nicht Eure letzte war. Bei manchen treten solche Visionen häufig auf, bei anderen nur in Zeiten der Gefahr. Und bei Euch liegt die Gabe in der Familie. Es heißt, Euer Urgroßvater il Magnifico habe manchmal in die Zukunft sehen können.«
Das gefiel mir gar nicht. »Und wenn ich es nicht will? Wird es dann aufhören?«
Seine struppigen Brauen hoben sich. »Die Hellsicht kann nicht abgelehnt werden. Viele würden ihre Seele für das hingeben, was Ihr so leichtfertig von Euch weist.«
»Habt Ihr denn die Gabe?«, fragte ich, geschmeichelt von der Vorstellung, dass ich etwas so überaus Begehrtes besaß.
Er seufzte, hob die Augen und blickte sich im Raum um. »Wenn ich sie hätte, würde ich dann all das hier brauchen? Nein, Duchessina. Ich verfüge nur über das Geschick, die Bahnen der Sterne zu erkunden und sie für die Menschen zu deuten. Aber das Firmament ist nicht immer freimütig. › Quod de futuris non est determinata omnino veritas.‹ Die Zukunft betreffend gibt es keine sicher zu bestimmende Wahrheit.«
Ich überlegte lange, ehe ich sagte: »Ihr könnt meine Gabe haben, wenn Ihr wollt.«
Er schmunzelte, tätschelte mir die Hand. »Mein Kind, selbst wenn Ihr sie mir geben könntet, würde ich sie niemals beherrschen lernen in der kurzen Zeit, die mir bleibt.« Er hielt inne. »Aber Ihr könnt es lernen.«
Er senkte die Stimme. »Ich habe lange gelebt und viel gelitten. Bei Eurer Geburt sah ich voraus, dass Ihr noch länger leben würdet. Also werdet auch Ihr leiden. Aber Ihr werdet nie erdulden müssen, was ich zu erdulden hatte, den Schmerz, das ganze Leben lang etwas zu suchen, das man nicht zu fassen kriegt. Euer Schicksal wird sich erfüllen. Es ist vielleicht nicht das Schicksal, das Ihr Euch wünscht, Caterina de Medici, doch erfüllen wird es sich.«
Er streckte die Hand aus und streichelte mir über die Wange. Ich schlang die Arme um seine knochige Gestalt. Für einen Augenblick erschien er mir so klein wie ich. Dann entzog er sich mir. »Ihr beehrt mich mit Eurer Zuneigung, Duchessina. Dafür möchte ich Euch dies hier schenken.«
Er fasste in seine Tasche, öffnete meine Hand und legte eine Phiole hinein, die an einer dünnen Silberkette hing und mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit gefüllt war.
»Darin befindet sich ein starkes Elixier. Ihr dürft es nur verwenden, wenn Ihr keine andere Wahl mehr habt. Wird es auf die falsche Weise, zur falschen Zeit verwendet, kann es tödlich für Euch sein – und für andere.«
»Was ist es denn?« Ich konnte mir nicht vorstellen, dass etwas so Kleines eine so starke Wirkung haben sollte.
»Manche würden es Erlösung nennen, andere Gift.«
Ich staunte. »Wozu sollte ich Gift brauchen?«
»Hoffen wir, nie. Dennoch ist es mein Geschenk an Euch.« Er verstummte, legte den Kopf schief, als ob er horchte. »Nun versteckt die Phiole und hütet sie gut. Eure Tante wird ungeduldig. Ihr müsst gehen.«
Man hatte mir beigebracht, dass es unhöflich sei, ein Geschenk abzulehnen, also legte ich mir die Kette um den Hals und ließ die Phiole in meinen Ausschnitt gleiten. »Ich hoffe, wir können Euch bald einmal wieder besuchen, Maestro«, sagte ich. Dann fiel mir die Geldbörse ein, und ich zog sie aus der Manteltasche. »Die ist für Euch.«
Er nahm sie entgegen, als sei sie ganz nebensächlich. »Geht mit Gott, Duchessina.«
Ich war schon an der Tür, als er plötzlich sagte: »Noch etwas. « Ich wandte mich zu ihm um. »Sagt Madama Strozzi, sie soll Euch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sagt ihr, Rom wird fallen.«
Ich nickte beklommen und trat hinaus auf den Treppenabsatz, wo Carlo wartete. Als ich einen letzten Blick zurück in die Studierstube warf, hatte das Licht sich verändert. Der Maestro saß jetzt im Dunkeln, und doch wusste ich, dass er lächelte.
Carlo brachte mich zurück nach unten; ich dankte ihm und verabschiedete mich. Cosimo brach in Tränen aus. »Verlass uns nicht!« Carlo musste ihn festhalten, als er versuchte, sich an mich zu klammern.
Ich lächelte Cosimo zu. »Ich muss jetzt heimgehen, aber ich verspreche dir, dass ich bald wiederkomme.«
»Das geht nicht«, schluchzte er, und die Tränen liefen ihm die schmutzigen Wangen hinab. »Alle werden tot sein.«
»Tot?« Ich sah Carlo an. »Was meint er?«
Carlo rollte die Augen. »Er sagt immer so seltsame Dinge. Hör auf damit, Cosimo. Du machst ihr Angst.«
Cosimo blickte mit verzweifelter Miene zu mir auf. Ich spürte eine plötzliche Leere, als ich mich vorbeugte, um ihn auf die Wange zu küssen. »Bis bald«, sagte ich und zwang mich dazu zu lächeln. »Sei brav und gehorche deinem Bruder.«
Meine Tante wartete noch an der gleichen Stelle, wo ich sie verlassen hatte. Als der Diener seinen Wachposten an der Hauswand verließ, fragte sie: »Hat er dir Antwort auf deine Fragen gegeben?«
»Ich glaube schon.« Ich erinnerte mich an die Warnung des Maestro, dass wenige Verständnis dafür aufbringen würden, und fügte hinzu: »Er sagt, ich lerne zu viel und hatte einen Ohnmachtsanfall. «
Ich weiß nicht, wo die Worte herkamen, doch es waren offenbar die richtigen, denn die Miene meiner Tante erhellte sich mit unverkennbarer Erleichterung. »Bene«, sagte sie. Sie nahm mich an die Hand. »Hat er sonst nichts gesagt?«
Ich wiederholte seine letzten rätselhaften Worte. »Wisst Ihr, was er damit meint?«
Sie zuckte die Schultern. »Die meiste Zeit frage ich mich, ob er selbst weiß, was er meint.« Schweigend kehrten wir zurück zum Palazzo.
Im Gehen tastete ich mit der freien Hand über mein Mieder, wo ich die Phiole dicht am Herzen fühlte.
3
»Caterina, mein Kind, wacht auf!«
Ich öffnete die Augen und sah meine Kammerjungfer über mich gebeugt, in der Hand eine Kerze, deren flackernde Flamme riesige Schatten an die Wände warf. »Madama Strozzi bittet Euch in die Halle«, sagte sie. »Ihr müsst Euch rasch ankleiden. «
Ich nickte, schlüpfte aus dem Bett und ließ sie mir mein Nachthemd ausziehen und mich in ein Kleid schnüren. Während sie mir hastig die Haare flocht, fragte ich mich, was meine Tante wohl von mir wollte. Im Palazzo war eine zunehmende Spannung zu spüren, seit ich meiner Tante erzählt hatte, dass der Maestro den Fall Roms voraussagte. Auch ich hatte mich verändert. Seit der Entdeckung meiner geheimnisvollen Gabe stellte ich heimlich alles infrage. Obwohl es mir damals noch nicht bewusst war, hatte ich aufgehört, ein leichtgläubiges Kind zu sein. Ich versuchte, meine Gabe heraufzubeschwören, in der Hoffnung, die Zukunft zu sehen, doch ich hatte keine Visionen, keine Vorahnungen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, wie sehr mein Leben sich bald verändern würde.
Meine Zofe eilte durchs Zimmer und stopfte meine silbernen Haarbürsten, meine Schultertücher und Schuhe in eine Stofftasche. »Gehen wir auf Reisen?«, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf. »Madama hat mir nur befohlen, Eure Sachen zu packen. Mehr weiß ich nicht. Ihr Diener erwartet Euch draußen.«
»Dann sieh zu, dass du meine Schatulle einpackst.« Ich zeigte auf mein Elfenbeinkästchen mit Silberbeschlägen, das Einzige, was ich von meiner Mutter hatte. Sie hatte es als Teil ihrer Aussteuer aus Frankreich mitgebracht, und das rote Samtfutter duftete noch immer schwach nach Lavendel. Ich hatte Ruggieris Phiole im Geheimfach des Kästchens verwahrt.
Der Palazzo war dunkel, still. Ich konnte das Tappen meiner weichen Sohlen auf dem Marmorboden hören, gefolgt vom Stiefelschlurfen des Dieners, der mich in die Halle geleitete. Ich fand meine Tante wartend inmitten etlicher aufs Geratewohl angehäufter Koffer und Kästen. Die hohen Wände waren bar aller Teppiche und Gemälde, das vergoldete Mobiliar in den Ecken gestapelt.
Meine Tante umfing mich und drückte mich so fest, dass mir das Mieder in die Rippen schnitt. »Du musst jetzt tapfer sein«, raunte sie. »Tapferer denn je. Die Zeit ist gekommen, der Welt zu zeigen, dass du eine echte Medici bist.«
Ich stand wie versteinert da. Was war geschehen? Warum sagte sie so etwas zu mir?
»Du kannst es nicht verstehen«, fuhr sie mit bebender, tränenerstickter Stimme fort. »Aber ich habe keine andere Wahl. Sie haben es befohlen. Die Signoria von Florenz hat uns verbannt. «
Ich wusste, dass die Signoria die von der Bürgerschaft gewählte Regierung von Florenz war. Im Unterschied zu anderen Stadtstaaten war Florenz eine Republik und überaus stolz darauf. Die Signoria war uns immer wohlgesinnt gewesen. Oft genug hatten sie im Palazzo diniert, eine Gruppe älterer Herren, die zu viel aßen und tranken und mir augenzwinkernd Komplimente machten.
Meine Tante steigerte sich in einen leidenschaftlichen Tonfall, als hätte sie vergessen, dass ich vor ihr stand. »Eine Schande ist das! Aus der eigenen Stadt hinausgejagt wie Diebe in der Nacht! Ich habe es ja immer gesagt, dieser Clemens wird unser Untergang sein. Er hat sich das alles selbst eingebrockt. Es ist mir egal, was mit ihm passiert – aber du, mein Kind, meine Caterina, du sollst nicht für seine Verbrechen büßen müssen.«
»Verbrechen?«, fragte ich. »Was hat Papa Clemens denn getan?«
»Nein! Nenn ihn niemals mehr so! Jedermann hasst ihn, weil er alles tun würde, um seine eigene Haut zu retten. Verstehst du? Er ist von seinem Heiligen Stuhl geflohen, als Karl der Fünfte Rom eingenommen hat. Keiner darf auf den Gedanken kommen, dass du noch an dem Feigling hängst, der es wagt, sich Papst zu nennen.«
Ich starrte sie an. War sie verrückt geworden? Karl V., aus der Dynastie der Habsburger, war Kaiser von Spanien und Österreich, der Deutschen und der Niederlande. Er war ein glühender Verteidiger des rechten Glaubens, obwohl ich meinen Onkel einst sagen hörte, er sei ungemein geldgierig, rücksichtslos auf Eroberungen aus und liege stets im Streit mit den schlauen Franzosen oder den häretischen Engländern. Doch immerhin trug er die Krone des Heiligen Römischen Reiches, von päpstlicher Gunst gesegnet, und ich konnte nicht glauben, dass er sich erdreisten würde, Rom zu überfallen.
»Dieser Clemens«, fuhr meine Tante mit brechender Stimme fort, »hätte den Forderungen des Kaisers Folge leisten und das Geld zur Erhaltung der kaiserlichen Truppen aufbringen sollen. Aber stattdessen musste er sich ja auf seinen idiotischen Stolz berufen und die Franzosen unterstützen, obwohl die Soldaten schon an seine Tore klopften.« Sie schüttelte die Fäuste. »Und nun steht die Heilige Stadt in Flammen, und Florenz rebelliert gegen uns. Er hat uns alle ins Verderben gestürzt!«
Sie wandte sich wieder mir zu. Das plötzliche Schweigen, in das sie verfiel, war schlimmer als alles, was ich bisher gehört hatte. »Du hast mich gewarnt«, wisperte sie. »Du hast mir erzählt, dass der Maestro dies vorhergesagt hat. ›Rom wird fallen‹, sagte er. Aber wie Clemens war ich zu starrsinnig, um auf ihn zu hören.«
Am liebsten wäre ich die Treppe hinaufgeflüchtet und hätte mich in mein Zimmer verkrochen, doch der Blick meiner Tante lähmte mich. »Die Signoria hat versprochen, dir nichts anzutun. Aber du musst ihnen gehorchen, Caterina. Du musst alles tun, was sie sagen.«
Eine schwarze Woge der Angst schlug über mir zusammen. Ich hörte ihn nicht kommen, bis der hünenhafte Diener mir die Hand auf die Schulter legte. Das konnte doch nicht sein! Meine Tante war Zeugin meiner Geburt sowie des Todes meiner Eltern gewesen. Sie hatte mich dem Oheim in Rom überlassen, weil sie keine andere Wahl hatte, aber dann hatte sie mich nach Florenz zurückgeholt, um mich selbst zu erziehen. Auch wenn ihr eisernes Regiment mich oft verdross – an ihrer Liebe hatte ich nie gezweifelt. Das konnte sie doch nicht tun. Sie konnte mich doch nicht verlassen!
Ich brach in jämmerliches Geheul aus. Der Diener presste mir die Hand auf den Mund; ich roch seine grobe Haut, als er mich hochhob. Wild vor Wut, versuchte ich, ihn zu beißen, wand mich und strampelte, während er mich mit stählernem Arm umklammerte. »Bitte, mein Kind«, schluchzte meine Tante, »es ist doch nur zu deinem Besten. Wir müssen dich in Sicherheit bringen!«
Die Verzweiflung in ihrer Stimme brachte mich dazu, mit vermehrter Kraft Widerstand zu leisten; ich trat den Diener fest in die Seite, als er mich über seine Schulter warf und entschlossenen Schrittes in den Hof hinausging. Ich schlug mir die Fäuste an seinem harten Rücken wund, während wir den Hof durchquerten, vorbei an dem herrlichen Brunnen und dem zierlichen Bronze-David mit dem albernen Hut. Weiter, immer weiter ging es bis zum Tor des Palazzo.
Draußen auf der Straße vernahm ich ein Heulen, als ob Dämonen über die Pflastersteine jagten. Ein Mann in einem Kapuzenumhang trat aus dem Schatten am Tor und sagte: »Gib sie mir.« Ich bäumte mich auf und schrie, als ich übergeben wurde. Der Fremde roch nach Ruß und Moschus; als er mich auf ein braunes Ross hob, sah ich in seine schwarzen Augen. Er war jung, hübsch. »Ich bin Aldobrindi«, wisperte er, »Sekretär der Signoria. Seid still, Duchessina, um unser beider Leib und Leben willen.«
Die Torflügel schwangen auf, und ich stellte mir vor, wie die Dämonen warteten, Mistgabeln im Anschlag. Er schwang sich hinter mir aufs Pferd und warf mir etwas Schweres, Dunkles über den Kopf: ein Cape, um mich zu verbergen.
Nun ging es hinaus auf die Straße. Obgleich ich die Menschen in der Via Larga nicht sehen konnte, hörte ich ihr ohrenbetäubendes Psalmodieren: »Tod den Medici! Tod den Tyrannen! «
Eine Peitsche knallte; das Pferd tänzelte nervös. »Aus dem Weg«, knurrte Aldobrindi, »aus dem Weg, Gesindel! Ich komme von der Signoria!« Plötzlich herrschte unheimliche Stille. Ich drückte mich noch mehr an ihn, versuchte, mich so klein wie möglich zu machen, voller Angst, vom Sattel gezerrt und in Stücke gerissen zu werden.
Dann bewegten wir uns wieder vorwärts, das Pferd schien wie auf Zehenspitzen zu gehen, durch die Stadt, die voller Rauch und Geschrei war. Durch einen Spalt im Umhang sah ich den öligen Schein von Fackeln vorüberwischen, die von rennenden Gestalten hochgereckt wurden; und überall Gebrüll, Gekreisch. Ich versuchte, ruhig zu bleiben. Doch je weiter wir ritten, desto mehr fürchtete ich mich. Ich hatte keine Ahnung, wohin er mich brachte und was mit mir geschehen würde, wenn wir dort ankamen.
Als wir schließlich vor einem hohen Tor in einer mächtigen Backsteinmauer hielten, taumelte ich vor Erschöpfung. Der Fremde hob mich vom Pferd. Ich spürte meine Beine kaum noch, während Aldobrindi mich in einen düsteren Kreuzgang führte. Eine einzelne Fackel warf ein schaurig flackerndes Licht über die steinernen Säulen und den verwitterten Brunnen in der Mitte des Gevierts.
Eine schwarz verhüllte Gestalt näherte sich. »Willkommen im Kloster von Santa Lucia.«
Ich fuhr zusammen, blickte angstvoll zu Aldobrindi auf. Dies war das Haus der Savonarola-Schwestern, Anhängerinnen des verrückten Propheten, der gegen die Medici gepredigt hatte und von meinem Urgroßvater auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war. Das Kloster von Santa Lucia war das ärmste von ganz Florenz; dass es überhaupt noch stand, zeugte von dem unverbrüchlichen Hass der Nonnen auf meine Familie, da sie niemals von unserer Großzügigkeit profitieren würden. Meine Tante konnte nicht gewusst haben, dass ich an diesen Ort gebracht wurde; sie hätte sich bis zum letzten Atemzug dagegen gewehrt.
»Ihr könnt mich nicht hierlassen«, sagte ich tonlos. Doch er verbeugte sich nur und zog sich zurück, während die Nonne mich am Arm packte.
»Das ist das Ende«, zischte sie. »Dein Oheim, der Papst, verkriecht sich in seiner Zitadelle in Orvieto, und der Kaiser lässt seine Wölfe auf Rom los. Das ist es, was der Stolz Eurer Familie uns eingebracht hat: den Zorn Gottes. Aber diesmal gibt es kein Entrinnen. Hier wirst du für die Sünden der Medici Abbitte leisten.«
Ich blickte in ihr namenloses Gesicht, das wie erstarrt vor Hass war, die farblosen Augen ohne Mitleid, und ich wusste, sie sah mich gar nicht. Tränen brannten mir in den Augen, als sie mich an der gespenstischen Reihe der Nonnen vorbeizerrte, die reglos unter dem Portikus standen, einen muffigen Korridor entlang in eine fensterlose Zelle, wo eine andere Nonne wartete.
Die Tür schlug hinter mir zu. Die erste Nonne entkleidete mich und ließ mich nackt und zitternd dastehen. Dann zog sie etwas aus ihrer Tasche; ich duckte mich unwillkürlich, als ich eine Schere in ihrer Hand aufblitzen sah. »Wenn du dich widersetzt, wird es dir noch schlimmer ergehen«, sagte sie.
Ich brach in Tränen aus, als sie meinen Zopf packte und abschnitt. Noch mit dem rosa Band umwickelt, fiel mein schönes Haar mir zu Füßen. Ein Schrei drängte sich in meine Kehle, aber ich unterdrückte ihn, schlotternd, als stünde ich im Schnee; ich wollte meine Schmach nicht eingestehen, während die Nonne mir das Haar bis zu den Wurzeln kappte.
Als sie fertig war, warf sie mir eine grobe wollene Kutte über und drückte mir einen struppigen Besen in die Hand. »Aufkehren«, befahl sie und sah zu, wie ich die glänzenden Locken zusammenfegte. Ihr Blick war wie ein Feld im Winter, bar allen Lebens.
Ohne ein weiteres Wort sperrte sie die Tür ab und ließ mich allein im Dunkeln, inmitten von Schimmelgeruch und Rattengeraschel. Ich weinte mich in den Schlaf.
Wochenlang wurde ich Tag für Tag gezwungen, in ihrer eisigen Kapelle auf Stein zu knien, bis mir die Knie bluteten. Jede Nuance ihrer strengen Klosterregel musste ich aufs Peinlichste beachten; ich durfte nicht sprechen und bekam jeden Tag nur eine wässrige Suppe, gefolgt von endlosen Gebeten, die von einer hohl klingenden Glocke diktiert wurden. Nie war ich allein, außer bei Nacht; dann hockte ich in meiner Zelle und hörte fernen Kanonendonner. Ich wusste nicht, was außerhalb dieser Mauern geschah, doch Jammern und Klagen tönten von der Straße herauf, und Asche fiel vom raucherfüllten Himmel und bedeckte den kümmerlichen Küchengarten.
Eines Nachts presste eine Schwester die Lippen an meine Tür und wisperte voller Schadenfreude: »Die Pest ist da, von den Franzosen eingeschleppt. Dein Oheim hat verseuchte Ausländer angeheuert, um Florenz in die Knie zu zwingen, aber das wird ihm nicht gelingen. Wir sterben eher, als dass wir die Medici noch mal unsere Stadt regieren lassen.«
Die Nonnen verdoppelten die Anzahl ihrer Gebete, umsonst. Vier der älteren Schwestern erkrankten und starben, an ihrem Erbrochenen erstickend, von Beulen übersät. Ich verlor jeden Anschein von Würde und flehte sie an, mich gehen zu lassen, auf die Straße, wenn nötig, wie ein herrenloser Hund. Doch sie blickten mich nur an, als sei ich ein Tier, das für die Schlachtbank bestimmt war.
Ich stellte mir meinen Tod vor, machte mich eine halbe Ewigkeit lang darauf gefasst. Wie auch immer er käme, ich müsste tapfer sein, sagte ich mir. Nie dürfte ich meine Angst zeigen, denn ich war eine Medici.
Und dann, nach neun langen Monaten der Belagerung, als die großartigen Befestigungen der Stadt in Schutt und Asche lagen und die Leute an Hunger starben, hatte die Signoria keine Wahl mehr und musste sich ergeben.
Die Armee, die mein Oheim finanzierte, marschierte ein.
Die Nonnen brachen in Panik aus. Sie quartierten mich in eine größere Zelle um, brachten mir Käse und Pökelfleisch aus dem Keller, wo sie ihre Vorräte versteckt hatten. Sie sagten, sie hätten nur den Befehl der Signoria befolgt, nie hätten sie mir wehtun wollen. Ich sah sie teilnahmslos an. Mein Kopf wimmelte vor Läusen, mein Zahnfleisch blutete, mein Körper war zaundürr. Ich war so erschöpft davon, auf den Tod zu warten, dass ich nicht einmal mehr die Kraft hatte, sie zu hassen.
Nach ein paar Tagen erschien Aldobrindi. Ich hatte genug gegessen, um ihn ohne Schwächeanfall zu empfangen, in demselben Kleid, das ich trug, als er mich aus meinem Palazzo geholt hatte. Seine schockierte Miene verriet ihn. Ich musste wohl wie ein Gerippe in rosa Damast ausgesehen haben, und er fiel auf die Knie und bat mich um Vergebung. Seine wehleidigen Entschuldigungen drifteten an mir vorbei. Als er oft genug beteuert hatte, dass ich freigelassen und nach Rom gesandt würde, fragte ich leise: »Wo ist meine Tante?«
Eine unheilvolle Pause trat ein, ehe er entgegnete: »Madama Strozzi musste die Stadt verlassen, doch selbst aus dem Exil hörte sie nie auf, für Euch zu kämpfen, bis das Fieber sie dahinraffte.« Er griff in sein Wams. »Dies hat sie für Euch hinterlassen.«
Ich blickte den Brief nicht an. Ich schloss ihn in den Händen ein und spürte durch das Papier die unsichtbare Gegenwart der Frau, die solch ein wichtiger Teil meiner Welt gewesen war, dass es nicht möglich war, mir ihr Verschwinden vorzustellen. Ich weinte nicht. Mein Kummer war zu tief.
Noch am gleichen Tag verließ ich Santa Lucia und wurde nach Rom gebracht. Ich wusste nicht, was mich erwartete.
Alles, was ich wusste, war, dass ich elf Jahre alt war, dass meine Tante tot war und mein Leben nicht mir gehörte.
4
Die Stadt, die ich verließ, war ein Trümmerfeld; die Stadt, in die ich zurückkehrte, war nicht wiederzuerkennen. Ich war von meiner Eskorte gewarnt worden, dass Rom schwer unter der kaiserlichen Belagerung gelitten hatte, doch als wir über die Hügel ins Tibertal ritten, traute ich meinen Augen nicht. Ich hatte nur noch vage Erinnerungen an die kurze Zeit, die ich in den sumpfigen Dünsten und herrlichen Palazzi der Ewigen Stadt verbracht hatte; nun aber wünschte ich, ich könnte mich an gar nichts mehr erinnern.
Rauchende Gemäuer ragten vor der verwüsteten Landschaft auf. Als wir in die Stadt einritten, sah ich Männer mit leeren Blicken und verstörte Frauen mit gesenkten Köpfen in ausgebrannten Ruinen sitzen, umgeben von zerschlagenem Hausrat und zertrampelten Besitztümern. Ich sah ein Grüppchen zerlumpter Kinder, die still dastanden, ratlos, als wüssten sie nicht, wo sie hingehörten. Das Herz krampfte sich mir zusammen, als ich begriff, dass sie Waisen waren wie ich, aber keinen Ort mehr hatten, wo sie hingehen konnten. Außer den Mauleseln, die zum Schutträumen benutzt wurden, sah ich kein einziges Tier, nicht einmal die sonst so allgegenwärtigen Katzen. Ich wandte den Blick ab von den aufgedunsenen Leichen, die wie Feuerholz in den Straßen aufgeschichtet waren, von den Lachen geronnenen Bluts, die den Widerschein des verdüsterten Himmels schluckten, und sah starr vor mich hin, als ich in den Lateran geführt wurde, wo ich untergebracht werden sollte.
Räumlichkeiten waren eingerichtet worden, die auf den zertrampelten Park hinausgingen, und ein Hauswesen von Edelfrauen, die mich erwarteten; unter ihnen Lucrezia Cavalcanti, ein blondes Mädchen mit leuchtend blauen Augen und gertenschlanker Figur, die mir erklärte, dass mein päpstlicher Oheim noch nicht aus Orvieto zurück sei, jedoch die Anweisung hinterlassen habe, mir jeglichen Luxus zu gewähren.
Sie lächelte. »Nicht, dass wir viel zu bieten hätten. Die Gemächer Seiner Heiligkeit sind geplündert worden, alles von Wert gestohlen. Aber wir können uns glücklich schätzen, dass wir genug zu essen haben. Wir werden unser Möglichstes für Euch tun, Duchessina, doch ich fürchte, mit Seidenlaken können wir zurzeit nicht dienen.«
Sie war fünfzehn Jahre alt und behandelte mich wie eine Erwachsene, die nicht vor den Tatsachen dieser Welt geschützt werden musste. Das war mir recht. Ich wollte nicht mehr verwöhnt oder belogen werden.
In meiner Schlafkammer setzte ich mich auf das Bett und sah zu, wie die Sonne hinter den pinienbestandenen Hügeln Roms versank. Dann zog ich den Brief meiner Tante hervor. Es waren nur wenige Zeilen, in der zittrigen Handschrift einer Sterbenden hingekritzelt.
Mein Kind, ich fürchte, ich werde Dich in diesem Leben nicht wiedersehen. Doch ich werde nie aufhören, Dich zu lieben, und ich weiß, dass Gott in Seiner Gnade über Dich wachen wird. Denke immer daran, dass Du eine Medici bist, zu Großem bestimmt. Du bist meine Hoffnung, Caterina. Vergiss das nie.
Ich drückte den Brief an die Brust, rollte mich auf dem Bett zusammen und schlief elf Stunden lang. Als ich erwachte, fand ich Lucrezia auf einem Schemel an meiner Seite. »Ihr habt viel gelitten«, bemerkte sie sachlich. »Aber jetzt müsst Ihr wie ein Tier sein, das nur für den Tag lebt.«
»Wie könnte ich?«, fragte ich betrübt. »Anders als das Tier weiß ich, was der morgige Tag bringen kann.«
»Dann müsst Ihr es lernen. Ob es uns gefällt oder nicht, der heutige Tag ist alles, was wir haben.« Sie streckte die Hand aus und nahm mir den Brief ab. »Lasst mich den verwahren«, sagte sie, dann rief sie die anderen Frauen herein, die mich mit emsiger Fürsorge umgaben. Nur wenige Schritte von hier war Rom blutgetränkt, doch innerhalb dieser vier Wände fühlte ich mich zum ersten Mal seit langer Zeit in Sicherheit.
Und so hatte ich mich erholt, als Papa Clemens ankam.
Die Kerzen eines verbogenen Kandelabers verbreiteten mildes Licht, als ich mich dem päpstlichen Thron näherte und in die Knie sank. Papa Clemens bedeutete mir mit einer Geste, mich zu erheben. Während ich mich aufrichtete und ihn ansah, versuchte ich mich zu erinnern, wie er früher ausgesehen hatte. Er war aus Rom geflohen, war gezwungen gewesen, von Weitem zuzusehen, wie die kaiserlichen Truppen seine Heilige Stadt entweihten, doch für mich sah er aus, als sei er aus der Sommerfrische zurückgekehrt, die kantigen Wangen von gesunder Farbe, die fleischigen Lippen von einem silbrigen Bart umrahmt. Er trug elfenbeinweiße Gewänder, deren üppige Falten von makelloser Reinheit waren; als ich auf seine Füße blickte, sah ich goldbestickte Pantoffeln. Allein in seinen Augen entdeckte ich die Nachwirkungen des Exils: von blaugrüner Farbe, blickten sie mich scharf, abschätzend und misstrauisch an. Mir wurde bewusst, dass ich ihn gar nicht kannte. Er musste wohl das Gleiche empfunden haben. Er musterte mich wie eine Fremde, und seine Umarmung war matt, als läge ihm nichts an mir.
»Das werden sie mir büßen«, knurrte er. »Sie alle – die Nonnen von Santa Lucia, die Florentiner Rebellen, dieser Verräter Karl der Fünfte. Sie werden für ihre Untaten bezahlen!«
Ich wusste, dass er nicht mit mir sprach; und als ich mich wieder verneigte und rückwärtsgehend entfernte, sah ich die Kardinäle seiner Kurie in den Ecken beisammenstehen und mich wie Raubvögel beäugen.
Mich schauderte. Was auch immer sie im Schilde führten, es war sicherlich nichts Gutes.
Papa Clemens ließ mich monatelang nicht zu sich rufen; ich blieb in der Obhut meiner Kammerfrauen. Es dauerte mehrere Wochen, bis ich nachts durchschlafen konnte, ohne aus Albträumen von der schrecklichen Zeit in Santa Lucia hochzuschrecken. Es war mir eine Genugtuung zu erfahren, dass die Schwestern von Savonarola mit einem saftigen Bußgeld und dem Befehl zur Ordensauflösung gestraft worden waren; weniger erfreut war ich darüber, dass Papa Clemens sich weigerte, den Florentinern ihre republikanischen Rechte zurückzugeben, und ihnen einen seiner Statthalter als Regenten aufgezwungen hatte. Lucrezia nahm mir gegenüber kein Blatt vor den Mund. »Er wird Florenz unter seiner Zwangsherrschaft knechten und dafür sorgen, dass Kaiser Karl eine ebenso bittere Pille schlucken muss.«
Ich wusste, dass sie recht hatte. Aber ich war noch jung und zufrieden damit, in Ruhe gelassen zu werden, im Park spazieren zu gehen, zu lesen und neue Kleider angepasst zu bekommen, zu essen und zu schlafen, so viel ich wollte.
Lucrezia hielt mich auf dem Laufenden über die Vorgänge am päpstlichen Hof, der wieder zum Leben erwachte, noch ehe der Ruß, der Schmutz, die Spuren der Entweihung von seinen Mauern entfernt worden waren. Kurz vor meinem dreizehnten Geburtstag erzählte sie mir, der französische König François I. habe einen neuen Gesandten nach Rom geschickt, und Papa Clemens habe verfügt, ich solle ihn unterhalten.
Ich erschrak. »Aber was soll ich denn tun? Ihm Wein kredenzen? «
Sie lachte. »Natürlich nicht! Ihr werdet ihn mit einem französischen Tanz ergötzen; Seine Heiligkeit hat schon einen Tanzlehrer für Euch bestellt. Wir dürfen nicht vergessen, Euch auf Eure Zukunft vorzubereiten, und Eure weiblichen Fertigkeiten sind sträflich vernachlässigt worden. Die Zeit ist gekommen, eine Dame des Hofes aus Euch zu machen.«
»Ich dachte, ich sollte sein wie ein Tier«, schmollte ich. Ob es mir passte oder nicht, ich hatte keine Wahl, und so wurde ich während der folgenden Wochen gnadenlos von einem geschniegelten, stark parfümierten Mann gedrillt, der mich ankläffte und mit seinem weißen Taktstock anstieß, und behauptete, eine Schindmähre besäße mehr Anmut in der Hinterhand als ich in meinem ganzen Körper. Ich hasste das Tanzen. Die zahllosen albernen Knickse, das Händegeflatter und die neckischen Blicke verdrossen mich über alle Maßen.
Dennoch lernte ich es gut genug, um dem Franzosen etwas vorzutanzen. Während mein Oheim sich, erhitzt vom Wein, auf seinem Thron lümmelte, betrachtete der Botschafter mich mit einem schwer zu deutenden Lächeln, musterte mich von Kopf bis Fuß, als ob ich auf einer Auktion feilgeboten würde.
Ein paar Tage später blutete ich zum ersten Mal. Während ich mich vor Bauchkrämpfen krümmte, behauptete Lucrezia, es sei ein sicheres Zeichen, dass ich viele gesunde Söhne bekommen würde. Trotz der Unannehmlichkeiten beobachtete ich fasziniert die subtilen Veränderungen meines Körpers, die neue Prallheit meiner Brüste, die sich rundenden Hüften, die zunehmende Rosigkeit meiner Haut – all das schien sich über Nacht ereignet zu haben.
»Werde ich einmal hübsch sein?«, fragte ich Lucrezia, während sie mir das Haar bürstete, das noch lockiger geworden war und das sie gern mit Perlenkappen und eingeflochtenen Bändern schmückte.
Sie beugte sich über meine Schulter und sah mich im Spiegel an. »Ihr seid hübsch«, sagte sie. »Diese großen schwarzen Augen würden jeden Mann bezaubern, und Eure Lippen sind voll genug, die Lust eines Bischofs zu wecken – nicht, dass das bei einem Bischof besonders schwierig wäre«, setzte sie mit einem schalkhaften Augenzwinkern hinzu.
Ich kicherte. Obwohl sie als Vorsteherin meines Haushalts die Aufgabe hatte, mich anzuleiten, war sie wie eine Schwester für mich, und ich war jeden Tag dankbar für ihre Anwesenheit. Mit Lucrezias Hilfe waren die Narben meiner Heimsuchungen verblasst, und ich hatte wieder begonnen, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.
Antwort auf meine Frage erhielt ich bald genug. Eines Nachmittags kam Lucrezia mit der Nachricht, Papa Clemens habe mich rufen lassen. Sie wusste nicht, warum, nur, dass er wünschte, mich unter vier Augen zu sprechen, und so begaben wir uns zusammen zu seinen Gemächern, durch verhängte Korridore, wo die Handwerker die von der Besatzung zerstörten Fresken restaurierten.
Als wir uns den vergoldeten Flügeltüren meines Oheims näherten, rührte sich auf einmal meine Gabe wieder. Es war nicht das hilflose Abtauchen in eine andere Welt, wie ich es in Florenz erlebt hatte, sondern eher ein warnendes Vorgefühl, das mich ängstlich zu Lucrezia aufblicken ließ. Sie lächelte ermunternd. »Denkt daran, was auch immer er sagt, Ihr seid wichtiger für ihn als er für Euch.«
Ich betrat den großen, goldverzierten Raum und sank in die Knie; mein Oheim saß an seinem massiven Schreibtisch und schälte Orangen; ihr süßer Duft erfüllte den Raum und übertönte den Geruch von altem Parfüm und rauchigem Bienenwachs. Er winkte mich heran. Ich trat näher und küsste seine Hand, die mit dem Siegel von Sankt Peter geschmückt war. Er trug seine weißen Gewänder; um seinen Hals hing ein Kruzifix, das mit Smaragden und Rubinen besetzt war.
»Wie ich höre, bist du jetzt eine Frau.« Er seufzte. »Wie die Zeit vergeht.« Seine lederne Schreibunterlage war voller Orangenschalen; er sog an einem Schnitz, winkte mich auf einen Schemel neben sich. »Setz dich. Es ist zu lange her, seit wir Zeit miteinander verbracht haben.«
»Ich war erst letzten Monat hier, zum Besuch des französischen Gesandten«, sagte ich. »Und ich würde lieber stehen, wenn Eure Heiligkeit erlauben. Das Kleid ist neu und unbequem. «
»Ah, an solche Dinge musst du dich aber gewöhnen. Die angemessene Kleidung ist von äußerster Wichtigkeit. Am französischen Hof sind diese Dinge absolut de rigueur.«
Er nahm ein juwelenbesetztes Messer und zerteilte die Frucht. Der Duft, der ihr entströmte, war wie Sonnenlicht und ließ mir das Wasser im Munde zusammenlaufen. »Das solltest du doch wissen. Schließlich war deine Mutter Französin.«
Es lag mir auf der Zunge, ihn daran zu erinnern, dass ich meine Mutter nie gekannt hatte. Stattdessen murmelte ich: »Ja, das war sie, Eure Heiligkeit. Es ist mir eine große Ehre.«
»Ganz recht. Und was würdest du sagen, wenn ich dir eröffnete, dass Frankreich nach dir verlangt?«
Seine Stimme war milde, erinnerte mich an die Zeit, als ich ein kleines Mädchen war und er mein liebevoller Onkel. Doch ich machte mir nichts vor; er hatte mich zu einem bestimmten Zweck herbestellt.
»Nun?«, meinte er brüsk. »Hast du nichts zu sagen?«
»Ich würde sagen«, entgegnete ich, »dass ich mich geehrt fühle.«
Er lachte auf. »So spricht eine Medici!« Es war, als hätte er die Reißzähne gebleckt. Unter meinem Kleid wurden mir die Knie weich. Clemens’ Blick glitt über mich. »Du hast den Wert einer neutralen Antwort erlernt. Das ist ein Vorzug, der deine Ehe umso weniger betrüblich gestalten wird.«
Das Blut gefror mir in den Adern. Ich dachte, ich hätte mich verhört.
»Es wird Zeit, dass du deinen Platz in der Welt einnimmst«, fuhr er fort, während er in seine Orange biss und blasser Saft auf seinen Ärmel spritzte. »Tatsächlich sind die Verhandlungen schon so gut wie abgeschlossen. Als Teil deiner Mitgift werde ich das Herzogtum Mailand bieten, sobald die Hochzeit stattfindet.« Er blickte auf. »Wer weiß? Eines Tages könntest du Königin von Frankreich sein.«
Ein Brausen wie Sturmgeheul erfüllte meine Ohren. Hier war seine Rache, zu guter Letzt. Hier war sein Dolchstoß für Karl V.: eine Allianz mit des Kaisers Rivalen François I. – und ich sollte als Einsatz dafür herhalten. Mich mit Frankreich zu vermählen würde Karls Bestrebungen vereiteln, sich Italien zu unterwerfen, da das lang umkämpfte Herzogtum Mailand, das gegenwärtig in kaiserlicher Hand war, dann an François fallen würde.
»Aber König François ist doch schon verheiratet«, wandte ich ein, »mit der Schwester des Kaisers.«
»Ganz recht. Aber sein zweiter Sohn, Henri d’Orléans, ist noch ledig und könnte eines Tages Thronerbe sein. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass François’ Ältester, der dauphin, recht kränklich sein soll.«
Er begann, eine neue Orange zu schälen; seine langen Spinnenfinger gruben sich in die Schale. »Ich nehme an, dein Schweigen hat kein Missvergnügen zu bedeuten«, setzte er hinzu. »Ich habe weder Kosten noch Aufwand gescheut, um dich hierherzubringen. Das Letzte, was ich brauchen kann, ist eine widerstrebende Braut.«
Was konnte ich noch sagen? Er hatte das Recht, mich zu schicken, wohin er wollte. Nichts, was ich tun konnte, außer mich umzubringen, würde mich je befreien, und die kalte Endgültigkeit dieser Tatsache machte meine Stimme rau.
»Wenn es Euer Wunsch ist«, sagte ich, »dann soll es mir eine Freude sein. Darf ich dafür um eine Gunst bitten? Ich möchte zurück nach Florenz. Es ist meine Heimat, und ich …« Meine Stimme bebte. »Ich möchte Abschied nehmen.«
Sein Blick wurde kalt. »Nun gut«, sagte er. »Wenn dir Rom nicht länger angenehm ist, werde ich dir eine Eskorte zuweisen. « Er streckte eine beringte Hand aus, und als ich sie küsste, hörte ich ihn murmeln: »Die Liebe ist ein trügerisches Gefühl. Du wirst besser ohne sie auskommen. Das haben wir Medici immer getan.«
Ich bewegte mich rückwärts zur Tür, während er eine weitere Orange schälte, die Mundwinkel zu einem selbstgefälligen Schmunzeln verzogen.
In der duftenden Sommerhitze kehrte ich zurück nach Florenz, begleitet von Leibwächtern und meinen Frauen, auch Lucrezia und einer neuen Gespielin, meiner Zwergin Anna-Maria – ein vierzehnjähriges Miniaturmädchen, deren kurze Gliedmaßen nicht von ihrer prächtigen aschblonden Mähne und vorwitzigen Schnute ablenkten. Ich mochte sie vom ersten Augenblick an; Papa Clemens hatte ganz Italien nach ihr abgesucht; er bestand darauf, dass ich in Frankreich meine eigene Hofnärrin haben müsste, doch ich beschloss, sie nicht mit einer Narrenkappe zu erniedrigen. Stattdessen betraute ich sie mit der Aufgabe, meine Wäsche in Ordnung zu halten, eine Vorzugsstellung in meinen Privatgemächern.
Im Palazzo der Familie fand ich wenig verändert. Florenz trug noch die Wunden, die zu heilen es Jahre brauchen würde, aber unser Heim war unversehrt, still wie ein prunkvolles Grab. Ich ließ mich in den Räumen meiner geliebten verstorbenen Tante nieder, wo den Leintüchern noch ihr Duft anhaftete und auf ihrem Schreibtisch mit den Alabaster-Intarsien noch ihre Schreibutensilien lagen, als könnte sie jeden Moment hereinkommen.
Und dort entdeckte ich mein silberbeschlagenes Elfenbeinkästchen, in einer Schublade unter unvollendeten Briefen. Ich drückte es an die Brust und strich über den verbeulten Deckel. Als sie es zwischen ihren Sachen verbarg, hatte meine Tante gewusst, dass ich es irgendwann holen würde.
Ich ließ den Deckel aufschnappen; in dem Samtfutter tastete ich nach dem Geheimfach, wo Ruggieris Phiole an ihrer Kette wie eine Schlange eingerollt lag. Ich hängte sie mir um den Hals, hielt das Kästchen noch lange in Händen und überließ mich meinem Schmerz.
Meine Verlobung wurde im Frühling ausgehandelt. Papa Clemens stellte eine beeindruckende Mitgift zusammen, um meinen Reichtum als Medici-Braut zu demonstrieren; er zögerte nicht, seine Schatzkammer um die kostbarsten Juwelen zu plündern, darunter auch sieben graue Perlen, die einer Byzantinischen Kaiserin gehört haben sollen und nun meine herzogliche Krone schmückten. Außerdem ließ er mein Portrait nach Frankreich senden.
Im Gegenzug schickte François I. mir das Konterfei seines Sohnes. Es kam in einer exquisiten, satingefütterten Schatulle, und als Lucrezia die Miniatur herausholte, gewahrte ich meinen zukünftigen Gatten zum ersten Mal – ein verschlossenes Antlitz mit schweren Lidern, geschürzten Lippen und der langen Nase der Valois. Es weckte nichts in mir, und ich fragte mich, ob er wohl den gleichen Eindruck von mir hatte. Was für eine Ehe konnten zwei Fremde, die nichts miteinander gemein hatten, denn überhaupt führen?
»Er sieht gut aus«, sagte Lucrezia erleichtert, mit einem Blick zu mir, die ich wie versteinert dasaß. »Die drei Jahre in Spanien scheinen ihm gut bekommen zu sein.«
Anna-Maria zog die Stirn kraus. »Warum war er in Spanien? «
»Weil er und sein Bruder, der dauphin, als Geiseln zu Kaiser Karl dem Fünften geschickt wurden, als König François den Krieg um Mailand verloren hatte«, erklärte ich ihr. »Und außerdem musste François Karls Schwester Eleonore heiraten.« Zu meinem Schrecken hatte ich das kindliche Bedürfnis, mit dem Fuß aufzustampfen und das Bild quer durchs Zimmer zu schleudern, meinem hilflosen Zorn mit einem Wutanfall Luft zu machen. Doch ich drängte die Tränen zurück. »Packt das Bild weg«, sagte ich mit einer gleichgültigen Geste. »Lasst mich allein.«
In jener Nacht saß ich schlaflos am Fenster und blickte in die schwüle Florentiner Nacht hinaus. Noch einmal trauerte ich um alles, was ich verloren hatte, bevor ich mich auf meine neue Wegrichtung besann. Mein Leben in Italien war vorüber. Mochte es auch nicht das sein, was ich wollte, so war es doch mein Schicksal. Ich musste mich der Zukunft stellen.
Schließlich war ich eine Medici.
Teil II 1532 – 1547 Nackt wie ein Neugeborenes
5
Nach zwei Wochen auf See gingen wir in der Bucht von Marseille vor Anker. Es war eine fürchterlich stürmische Überfahrt gewesen, auf der ich mir schwor, niemals mehr das Festland zu verlassen. Falls ich geneigt war, über die Unwägbarkeiten des Schicksals nachzugrübeln, das mich in ein fremdes Land zu einem fremden Ehemann geführt hatte, so ließ die übermächtige Erleichterung, etwas anderes als rollende Wellen zu sehen, jede Schwermut verfliegen.
Lucrezia und Anna-Maria holten eines meiner neuen Gewänder aus dem Lederkoffer, glätteten die verknitterten Falten und schnürten mich hinein – ein Brokatpanzer, so steif von Juwelen, dass ich kaum fähig war, an Deck zu wanken, geschweige denn, durch Marseille zu dem Palast zu reiten, wo der französische Hof wartete. Zum ersten Mal setzte ich auch meine Herzogskrone auf, die mit den sieben Perlen. Derart feierlich herausgeputzt, verharrte ich an Bord, bis mein neuer Schatzmeister, René Birago, mir kundtat, dass Hofmarschall Montmorencys Boot gekommen war, um mich an Land zu bringen.
Ich nickte. »Dann muss ich ihn wohl begrüßen gehen.«
Birago lächelte. Er war Florentiner, Mitte zwanzig, und von Papa Clemens dazu ausersehen, meine Finanzen zu überwachen. Trotz eines leichten Hinkens, das angeblich an der Gicht lag, besaß er eine alterslose Anmut, die erkennen ließ, dass er sein ganzes Leben am päpstlichen Hof verbracht hatte; seine schlanke Gestalt wurde von einem scharlachroten Wams im eng anliegenden, italienischen Stil zur Geltung gebracht, und sein glatt von der kantigen Stirn zurückgekämmtes, hellbraunes Haar betonte die Hakennase und die klugen dunklen Augen.
»Madama«, sagte er mit einer Stimme, die für heimliche Einflüsterungen wie geschaffen war, »ich rate Euch hierzubleiben. Zwar ist Montmorency Konnetabel von Frankreich und Stallmeister Seiner Majestät, doch Ihr seid die Herzogin von Urbino und die zukünftige Duchesse d’Orléans. Lasst Frankreich doch zur Abwechslung einmal Italien seine Reverenz erweisen.«
Es war eine gewitzte Bemerkung von einem geistreichen Mann, die dazu angetan war, mir ein Lächeln zu entlocken. Wenigstens hatte ich ein kleines Stück Italien zum Schutz an meiner Seite, dachte ich und hob eine Hand zur Brust; unter meinem Mieder spürte ich noch ein weiteres Stück Italien – Ruggieris Phiole.
Meine Frauen scharten sich um mich, als die Franzosen an Bord der Galeone kamen, prachtvoll mit blitzenden Juwelen an Kappen und Wämsen geschmückt. Ohne den Blick von ihnen abzuwenden, wisperte ich Lucrezia zu: »Wer von ihnen ist der Konnetabel?«
»Der dort neben Birago«, wisperte sie zurück. »Das muss er sein; so barbarisch groß und ganz in Schwarz.«
Sie hatte recht. Montmorency sah aus wie ein Titan, seine Schultern verdunkelten die Sonne, und seine steife Halskrause wirkte seltsam puppenhaft an seinem Stiernacken. Birago hatte mir erzählt, dass er Ende dreißig sei, ein Veteran vieler Gefechte, der in dem Krieg um Mailand wie ein Löwe gekämpft hatte. Ich war auf jemanden gefasst, der den Italienern kaum wohlgesinnt sein konnte, nachdem er sein Schwert mit dem Blut so vieler meiner Landsleute besudelt hatte. Doch als er sich über meine Hand beugte, sah ich, dass trotz der ledrigen Haut und der strengen graublauen Augen seine Miene nicht unfreundlich war.