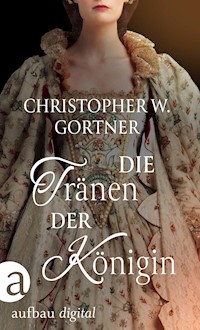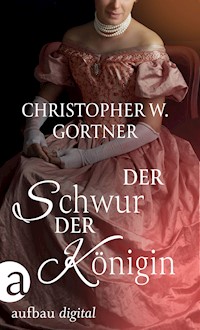
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Prinzessin lernte sie ihre große Liebe kennen. Muss sie sich als Königin zwischen ihrem Herzen und der Krone Spaniens entscheiden?
Spanien, Mitte des 15. Jahrhunderts: Alte Fehden spalten die Königreiche Kastilien und Aragon. Prinzessin Isabella lebt am Hofe ihres Halbbruders Enrique, dem König von Kastilien. Nach einer Tragödie wird sie mit nur siebzehn Jahren zur Erbin des Throns. Nun muss sie über Nacht lernen, als souveräne Herrscherin zu agieren und sich gegen ihre politischen Feinde durchzusetzen. Denn nicht nur der Kampf um die Krone droht ein blutiger zu werden, sondern auch der um ihre große Liebe – den charismatischen Prinzen des verfeindeten Königreiches Aragon ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 745
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Als Prinzessin lernte sie ihre große Liebe kennen. Muss sie sich als Königin zwischen ihrem Herzen und der Krone Spaniens entscheiden?
Spanien, Mitte des 15. Jahrhunderts: Alte Fehden spalten die Königreiche Kastilien und Aragon. Prinzessin Isabella lebt am Hofe ihres Halbbruders Enrique, dem König von Kastilien. Nach einer Tragödie wird sie mit nur siebzehn Jahren zur Erbin des Throns. Nun muss sie über Nacht lernen, als souveräne Herrscherin zu agieren und sich gegen ihre politischen Feinde durchzusetzen. Denn nicht nur der Kampf um die Krone droht ein blutiger zu werden, sondern auch der um ihre große Liebe – den charismatischen Prinzen des verfeindeten Königreiches Aragon.
Über Christopher W. Gortner
Christopher W. Gortner wuchs in Südspanien auf. In Kalifornien lehrte er an der Universität Geschichte mit einem Fokus auf starke Frauen inder Historie. Er lebt und schreibt in Nordkalifornien. Im Aufbau Taschenbuch ist bereits sein Roman »Marlene und die Suche nach Liebe« erschienen.
Mehr Informationen zum Autor unter www.cwgortner.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
https://www.aufbau-verlage.de/newsletter-uebersicht
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christopher W. Gortner
Der Schwur der Königin
Historischer Roman
Übersetzt von Peter Pfaffinger
Für meine Nichte, Isabel Gortner, und meine liebe Freundin, Judith Merkle Riley (1942–2010)
Da ich nun in dieses Land gekommen bin,
habe ich gewiss nicht die Absicht, es zu verlassen,
zu fliehen oder mich vor meiner Aufgabe zu drücken, noch werde ich diese Pracht meinen Feinden überlassen
oder meinen Untertanen solchen Schmerz zumuten.
Isabella I. von Kastilien
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Zweiter Teil
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Dritter Teil
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Vierter Teil
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Nachwort des Autors
Danksagung
Impressum
Prolog
1454
Niemand glaubte, dass ich für Großes bestimmt war.
Geboren in dem kastilischen Ort Madrigal de las Altas Torres als erstes Kind der zweiten Ehe meines Vaters, Juan II., mit Isabella von Portugal, deren Namen ich erhielt, war ich eine gesunde und ungewöhnlich ruhige Infantin. Um meine Ankunft wurde nicht viel Aufhebens gemacht. Sie wurde zwar mit Glockenläuten verkündet, doch es gab nur flüchtige Gratulationen und keine Fanfaren. Mit seiner ersten Frau hatte mein Vater bereits einen Thronfolger gezeugt, meinen Halbbruder Enrique. Und als meine Mutter zwei Jahre nach mir meinen Bruder Alfonso gebar und so die Erbfolge des Hauses Trastámara zusätzlich sicherte, wurde allseits angenommen, dass mir Kloster und Spinnrocken beschieden sein würden, bis man mich zu Kastiliens Vorteil verheiraten konnte.
Doch wie es so oft geschieht, hatte Gott anderes mit mir vor.
Die Stunde, als alles sich änderte, habe ich nie vergessen.
Ich war noch nicht ganz vier Jahre alt. Schon seit Wochen litt mein Vater an einem schrecklichen Fieber und lag die ganze Zeit hinter geschlossenen Türen in seinen Gemächern im Alkazar, dem Palast von Valladolid. Ich kannte ihn kaum, diesen neunundvierzigjährigen König, dem seine Untertanen wegen seiner Art zu herrschen den Spitznamen El Inútil, der Nutzlose, gegeben hatten. Bis zum heutigen Tag kann ich mich an nicht mehr erinnern als an einen hageren Mann mit traurigen Augen und einem wässrigen Lächeln, der mich einmal zu sich in seine Privatgemächer befahl und mir einen nach maurischer Art emaillierten und mit Juwelen besetzten Kamm schenkte. Während ich bei ihm war, stand die ganze Zeit ein kleiner, dunkelhäutiger Fürst hinter dem Thron meines Vaters, die Wurstfinger besitzergreifend auf die Rückenlehne gelegt und die durchdringenden Augen unablässig auf mich gerichtet.
Wenige Monate nach dieser Begegnung hörte ich die Hofdamen meiner Mutter einander zuflüstern, der kleine Fürst sei geköpft worden und sein Tod hätte meinen Vater in untröstliche Trauer gestürzt.
»Lo mató esa loba portuguesa«, sagten die Frauen. »Das war diese portugiesische Wölfin. Sie hat den Konnetabel Luna umbringen lassen, weil er der Liebling des Königs war.« Plötzlich zischte eine von ihnen: »Pst! Das Kind hört zu!« Ihre Köpfe flogen herum, und als sie mich mit weit aufgerissenen Augen auf dem Stuhl im Alkoven nebenan bemerkten, erstarrten sie alle mitten in ihren Bewegungen.
Nur wenige Tage nachdem ich die Hofdamen belauscht hatte, wurde ich eines Nachts aus dem Schlaf gerissen, hastig in einen Umhang gehüllt und durch die Korridore des Alkazar zu den königlichen Gemächern gescheucht. Diesmal führte man mich in eine stickige Kammer, wo Kohlebecken glühten und aus einer Weihrauchwolke der gedämpfte Psalmengesang kniender Mönche an meine Ohren drang. Über mir baumelten an vergoldeten Ketten Kupferlampen, deren öliges Glühen über die versteinerten Mienen der in düsterer Tracht versammelten Granden flackerte.
Die Vorhänge des großen Betts vor mir waren geöffnet worden.
Auf der Schwelle zögerte ich. Instinktiv blickte ich mich nach dem kleinen Fürsten um, obwohl ich längst wusste, dass er tot war. Dann erspähte ich den Lieblingsfalken meines Vaters. An seine silberne Stange gekettet, hockte er im Alkoven. Seine geweiteten Pupillen, von den Flammen beleuchtet, doch unergründlich, richteten sich auf mich.
Wie angewurzelt stand ich da. Mich beschlich eine Vorahnung von etwas Schrecklichem, das ich nicht sehen wollte.
»Geh, mein Kind«, drängte mich meine aya, Doña Clara. »Seine Majestät, dein Vater, verlangt nach dir.«
Ich weigerte mich zu gehorchen. Stattdessen klammerte ich mich an ihre Röcke und verbarg das Gesicht in deren staubigen Falten.
Doch dann näherten sich von hinten schwere Schritte, und eine tiefe Stimme dröhnte: »Ist das nicht unsere kleine Infanta Isabella? Komm, lass dich anschauen, Kind.«
Etwas an dieser Stimme bannte mich, ließ mich aufblicken.
Ein Mann türmte sich vor mir auf, groß und mit tonnenförmiger Brust, bekleidet mit dem dunklen Gewand eines Granden. Sein ziegenbärtiges Gesicht war feist, seine hellbraunen Augen blickten durchdringend. Ansehnlich war er nicht; vielmehr erinnerte er an einen verwöhnten Palastkater, doch sein leicht schiefer, rosiger Mund verzauberte mich, denn er schien allein für mich zu lächeln und eine nur mir geltende Aufmerksamkeit auszudrücken, die mir das Gefühl vermittelte, der einzige Mensch zu sein, den er wirklich sehen wollte.
Er streckte mir eine für einen Mann von seiner Größe verblüffend zierliche Hand entgegen. »Ich bin Erzbischof Carrillo von Toledo«, sagte er. »Kommt mit mir, Hoheit. Es gibt nichts zu fürchten.«
Zögernd ergriff ich seine Hand. Seine Finger waren kräftig und warm. Und als sich seine Hand um meine schloss, fühlte ich mich tatsächlich sicher. Er führte mich vorbei an den Mönchen und dunkel gekleideten Höflingen, in deren unpersönlichen Augen wie bei dem Falken im Alkoven leidenschaftsloses Interesse zu glimmen schien.
Damit ich näher bei meinem Vater stehen konnte, hob der Erzbischof mich auf einen Schemel vor dem Bett. Bei jedem Atemzug des Königs hörte ich ein lautes Rasseln in seiner Brust. Die Haut, die bereits merkwürdig wächsern wirkte, schien ihm förmlich auf den Knochen zu kleben. Seine Augen waren geschlossen, die feingliedrigen Hände über der Brust gefaltet, als wäre er eine Steinplastik auf einem jener aufwendigen Grabmäler, von denen es in unseren Kathedralen nur so wimmelte.
Ich musste wohl einen Laut des Entsetzens von mir gegeban haben, denn Carrillo raunte mir ins Ohr: »Du musst ihn küssen, Isabella. Gib deinem Vater deinen Segen, damit er dieses Tränental in Frieden verlassen kann.«
Obwohl dies das Letzte war, was ich tun wollte, hielt ich die Luft an, beugte mich über meinen Vater und drückte ihm flüchtig die Lippen auf die Wange. Als ich die vom Schüttelfrost eisige Haut berührte, prallte ich erschrocken zurück und hob unwillkürlich die Augen zur anderen Seite des Betts.
Dort bemerkte ich eine Silhouette. Einen schrecklichen Moment lang hielt ich sie für den Geist des toten Konnetabels, der laut meinen Hofdamen rastlos auf Rache sinnend im Palast herumspukte. Doch da flackerte eine Kerze auf, und ihr Schein fiel lange genug auf sein Gesicht, sodass ich meinen älteren Halbbruder, Prinz Enrique, erkennen konnte. Sein Anblick verwirrte mich. Normalerweise hielt er sich doch vom Hof fern, dem er seine geliebte casa real in Segovia bei Weitem vorzog. Wie es hieß, leistete er sich dort eine aus Ungläubigen bestehende Wache und eine Menagerie aus exotischen Raubtieren, die er eigenhändig fütterte. Jetzt war er also im Sterbezimmer unseres Vaters anwesend, gehüllt in einen schwarzen Umhang, das lange, zottelige Haar unter einem scharlachroten Turban verborgen, sodass seine sonderbar flache Nase und die eng beieinanderliegenden Augen hervorstachen und er an einen ungepflegten Löwen erinnerte.
Das wissende Lächeln, mit dem er mich bedachte, jagte mir jäh einen kalten Schauer den Rücken hinunter.
Der Erzbischof nahm mich auf die Arme und trug mich hinaus, als gäbe es in dem Gemach nichts mehr, was für uns noch von Belang wäre. Über seine Schulter hinweg sah ich die Höflinge und Granden sich um das Bett scharen. Der Gesang der Mönche wurde lauter, und Enrique beugte sich beflissen, ja, fast eifrig über den sterbenden König.
In diesem Moment hauchte unser Vater, Juan II., sein Leben aus.
Wir kehrten nicht in meine Gemächer zurück. Fest an die mächtige Brust des Erzbischofs gedrückt, verfolgte ich benommen, wie er meine im Korridor wartende aya gebieterisch zu sich winkte und uns die Wendeltreppe hinunter zum Burghof führte. Der fahle Mond am Nachthimmel vermochte kaum die Wolken- und Nebelschleier zu durchdringen.
Als wir den schützenden Schatten der Festung verließen, spähte der Erzbischof zum hinteren Ausfalltor, ein dunkles viereckiges Portal, das man in die Ringmauer eingelassen hatte.
»Wo sind sie?«, drängte er mit gepresster Stimme.
»Ich … ich weiß es nicht«, stammelte Doña Clara. »Ich habe die Nachricht gesandt, wie Ihr es mich geheißen hattet, und Ihre Hoheit gebeten, hier auf uns zu warten. Hoffentlich ist ihr nichts …«
Er unterbrach sie mit erhobener Hand. »Ich glaube, sie kommen.« Er trat vor. Das flüchtige Klappern leichter Schuhe auf dem Kopfsteinpflaster näherte sich, und ich spürte, wie er sich anspannte. Mit einem scharfen Geräusch stieß er die Luft aus, als plötzlich mehrere Gestalten, angeführt von meiner Mutter, auf uns zutraten. Sie war blass. Die Kapuze ihres Umhang hatte sich um ihre schmalen Schultern gelegt, doch ein paar schweißnasse kastanienbraune Strähnen waren ihrer Haube entkommen. Ihr folgten ihre portugiesischen Hofdamen sowie Don Gonzalo Chacón, der Erzieher meines einjährigen Bruders, den er in seinen kräftigen Armen wiegte. Ich fragte mich, warum wir uns gerade jetzt, mitten in der Nacht, hier draußen versammelt hatten. Mein Bruder war doch so klein, und es war schrecklich kalt.
»Ist er …?«, keuchte meine Mutter.
Carrillo nickte. Ein Schluchzen entrang sich ihrer Kehle, während ihre einschüchternden blaugrünen Augen mich fixierten, die ich immer noch in den Armen des Erzbischofs lag. Sie streckte die Hände nach mir aus. »Isabella, hija mia.«
Carrillo setzte mich ab. Zu meiner eigenen Überraschung wollte ich nicht fort von ihm. Doch dann lief ich los, von meinem übergroßen Umhang wie von einem formlosen Kokon umhüllt. Vor ihr knickste ich, wie man es mich gelehrt und wie ich es stets bei den seltenen Anlässen getan hatte, zu denen man mich vor versammeltem Hof zu meiner schönen Mutter geführt hatte. Sie schlug meine Kapuze zurück, und ihr Blick begegnete dem meinen. Alle sagten, ich hätte die Augen meiner Mutter, nur seien meine von einer dunkleren Tönung.
»Mein Kind«, flüsterte sie, und ich nahm ein verzweifeltes Beben in ihrer Stimme wahr, »meine liebste Tochter, jetzt haben wir nur noch einander.«
»Eure Hoheit müssen sich auf das konzentrieren, was jetzt wichtig ist«, hörte ich Carrillo sagen. »Eure Kinder müssen geschützt werden. Mit dem Ableben Eures Gemahls, des Königs, sind sie …«
»Ich weiß, was meine Kinder sind«, fiel ihm meine Mutter ins Wort. »Was ich wissen will, ist: Wie lange, Carrillo? Wie viel Zeit bleibt uns noch, bis wir all das, was wir kennen und lieben, verlassen und gegen ein vergessenes Asyl am Ende der Welt tauschen müssen?«
»Bestenfalls ein paar Stunden«, antwortete der Erzbischof tonlos. »Noch haben die Glocken nicht geläutet, denn die Vorbereitung einer solchen Verlautbarung erfordert eine gewisse Zeit.« Er zögerte. »Aber sie wird früh genug erfolgen – spätestens am Morgen. Ihr müsst mir vertrauen. Ich verspreche Euch: Ich werde dafür sorgen, dass Euch und den Infanten kein Leid geschieht.«
Meine Mutter blickte ihm in die Augen. Wie um ein Lachen zu ersticken, presste sie eine Hand auf den Mund. »Wie wollt Ihr das bewerkstelligen? Enrique von Trastámara, der Sohn meines Gemahls aus erster Ehe, wird bald König sein. Wenn meine Augen mich in all den Jahren nicht getäuscht haben, wird er für seine Günstlinge nicht minder empfänglich sein, als es Juan stets war. Welche Sicherheit könnt Ihr mir denn schon bieten außer der Gesellschaft eines Teils Eurer Wache und der Zuflucht in einem Kloster? Und warum eigentlich nicht? Zweifellos ist ein Nonnenkonvent die beste Lösung für eine verhasste Königin aus der Fremde mitsamt ihrer Brut.«
»In einem Kloster können Kinder nicht verweilen«, entgegnete Carrillo. »Außerdem sollten sie in einem so zarten Alter nicht von ihrer Mutter getrennt werden. Euer Sohn ist jetzt Enriques gesetzlicher Erbe, bis dessen Frau ihm ein Kind gebiert. Ich versichere Euch: Der Kronrat wird gewährleisten, dass die Rechte der Infanten nicht angefochten werden. Mehr noch, er hat eingewilligt, Euch den Prinzen und seine Schwester auf der Burg Arévalo in Ávila aufziehen zu lassen, die Euch als Teil Eures Witwengedinges übergeben werden wird.«
Schweigen breitete sich aus. Stumm stand ich da und beobachtete meine Mutter, wie sie mit versteinerter Miene »Arévalo« wiederholte, als hätte sie sich verhört.
Unbeirrt fuhr Carrillo fort: »Das Testament Seiner Majestät sieht reichliche Vorsorge für die Infanten vor, wobei jedem bei Vollendung des dreizehnten Lebensjahres eine eigene Stadt als persönliches Eigentum übertragen werden soll. Ich verspreche Euch: Euch wird es an nichts fehlen.«
Die Augen meiner Mutter verengten sich. »Juan hat seine Kinder kaum je gesehen. Er hat sich überhaupt nicht um sie gekümmert. Er hat sich um niemanden gekümmert außer um diesen grässlichen Mann, diesen Konnetabel Luna. Und doch behauptet Ihr, er hätte für sie vorgesorgt. Wie, um alles auf der Welt, könnt Ihr das wissen?«
»Vergesst nicht, ich war sein Beichtvater. Er hörte auf meinen Rat, weil er die Feuer der ewigen Hölle fürchtete.« Die plötzliche Eindringlichkeit in Carrillos Ton ließ mich zu ihm aufblicken. »Aber wenn Ihr mir nicht vertraut, kann ich Euch nicht schützen. Es ist in Kastilien Brauch, dass eine verwitwete Königin sich vom Hof zurückzieht. Und üblicherweise darf sie ihre Kinder nicht behalten, vor allem dann nicht, wenn der neue König keinen eigenen Erben hat. Aus diesem Grund müsst Ihr noch heute Nacht aufbrechen. Nehmt nur die Infanten mit Euch und Eure wichtigste persönliche Habe, die Ihr tragen könnt. Den Rest Eures Eigentums werde ich Euch nachsenden, sobald mir das möglich ist. Wenn Ihr in Arévalo eingetroffen seid und der Letzte Wille des Königs verkündet ist, wird niemand es wagen, Euch anzurühren, nicht einmal Enrique.«
»Das verstehe ich. Aber wir zwei waren nie Freunde, Carrillo. Warum bringt Ihr Euch meinetwegen in Gefahr?«
»Drücken wir es so aus: Ich biete Euch einen Tausch an – Gefallen gegen Gefallen.«
Jetzt konnte meine Mutter ihr bitteres Auflachen nicht länger unterdrücken. »Welchen Gefallen kann ich Euch, dem reichsten Geistlichen von Kastilien, schon erweisen? Ich, eine Witwe ohne eigene Einkünfte, die zwei kleine Kinder und einen Hofstaat versorgen muss.«
»Ihr werdet es beizeiten erfahren. Seid versichert, dass es Euch nicht zum Nachteil gereichen wird.« Damit wandte sich Carrillo ab und erteilte den Bediensteten meiner Mutter Anweisungen. Diese starrten uns mit vor Angst großen Augen an.
Langsam griff ich nach der Hand meiner Mutter. Nie zuvor hatte ich es gewagt, sie ohne vorherige Erlaubnis zu berühren. Für mich war sie eine wunderschöne, doch unnahbare Erscheinung in glitzernden Gewändern und mit perlendem Lachen gewesen, stets umringt von unterwürfigen Bewunderern – eine Mutter, die man aus der Ferne zu lieben hatte. Jetzt hingegen wirkte sie, als wäre sie meilenweit durch eine Steinwüste gestolpert, und ihre Miene verriet solche Qual, dass ich mir wünschte, ich wäre älter, größer und stark genug, um sie vor dem grausamen Schicksal zu schützen, das ihr meinen Vater entrissen hatte.
»Das ist nicht Eure Schuld, Mama«, sagte ich. »Papa ist in den Himmel gegangen. Darum müssen wir jetzt fort von hier.«
Sie nickte. Tränen traten ihr in die Augen, sie starrte in eine unsichtbare Ferne.
»Und wir gehen nach Ávila«, fügte ich hinzu. »Das ist nicht weit, Mama, oder?«
»Nein«, sagte sie sanft, »nicht weit, hija mia, überhaupt nicht weit.«
Doch ich spürte, dass es für sie ein ganzes Leben weit entfernt war.
Erster Teil Die Infantin von Arévalo
1464–1468
Kapitel 1
»Halte die Zügel fest in der Hand, Isabella. Lass ihn deine Angst nicht spüren. Sonst meint er, er hätte Macht über dich, und versucht, dich abzuwerfen.«
Hoch auf dem Rücken des eleganten schwarzen Hengstes, nickte ich eifrig und ergriff die Zügel. Durch die wettergegerbten Spitzen meiner Handschuhe konnte ich das straffe Leder fühlen. Zu spät fiel mir ein, dass ich Beatriz’ Vater, Don Pedro de Bobadilla, die neuen Handschuhe hätte kaufen lassen sollen, die er mir kürzlich zum dreizehnten Geburtstag schenken wollte. Doch mein Stolz – eine Sünde, die zu überwinden ich mir alle Mühe gab, wenn auch meistens vergeblich – hatte es mir verboten, mit der Annahme seiner Gabe unsere Not zuzugeben. Dabei lebte er mit uns unter einem Dach und hatte sicher mit eigenen Augen gesehen, wie verarmt wir waren. Derselbe Stolz war auch schuld daran, dass ich die Herausforderung meines Bruders wider besseres Wissen annahm. Er hatte gefragt, ob ich nicht endlich auf einem richtigen Pferd reiten wollte.
So saß ich nun, die Hände mit alten Lederhandschuhen geschützt, die sich anfühlten wie dünne Seide, auf diesem prächtigen Hengst. Obwohl er nicht übermäßig groß war, machte er mir dennoch Angst. Das Tier tänzelte und scharrte mit den Hufen, als würde es jeden Moment durchgehen, ohne Rücksicht darauf, ob ich mich abwerfen ließe oder nicht.
Kopfschüttelnd beugte sich Alfonso von seinem Rotschimmel zu mir herüber, um meine Finger aufzubiegen, damit die Zügel locker darum gelegt werden konnten.
»So«, sagte er, »fest, aber nicht so fest, dass du ihm das Maul verletzt. Und denk daran, dass du beim Traben aufrecht sitzt und dich beim Galoppieren vorbeugst. Canela ist keines von den dummen Maultieren, auf denen du und Beatriz sonst immer reitet. Er ist ein reinrassiger Araber und eines Kalifen wert. Er muss wissen, dass sein Reiter das Sagen hat, und zwar immer.«
Ich streckte den Rücken durch und presste mich in den erhaben gearbeiteten Sattel. Ich fühlte mich leicht wie eine Distel. Obwohl ich in einem Alter war, in dem die meisten Mädchen begannen, sich zu entwickeln, war ich immer noch am ganzen Körper flach und mager, sodass mich meine Freundin und Zofe Beatriz, Don Bobadillas Tochter, ständig bedrängte, mehr zu essen. Jetzt beäugte sie mich sichtlich besorgt. Ihr erheblich üppigerer Körper nahm sich auf ihrem scheckigen Wallach so natürlich und anmutig aus, dass man meinen konnte, sie hätte ihr Leben lang auf ihm geritten. Ihre markanten Züge wurden von ihrem unter Haube und Schleier hervorquellenden, dichten schwarzen Haar umrahmt.
An Alfonso gewandt, sagte sie: »Eure Hoheit hat doch sicher darauf geachtet, dass dieses königliche Tier ordentlich zugeritten wurde. Wir wollen schließlich nicht, dass Eurer Schwester etwas Unerwünschtes geschieht.«
»Natürlich ist er zugeritten. Don Chacón und ich haben das persönlich getan. Isabella wird nichts passieren. Nicht wahr, hermana?«
Noch während ich nickte, befiel mich eine geradezu lähmende Angst. Wie konnte irgendwer von mir erwarten, dass ich diesem Tier zeigte, dass ich das Sagen hatte? Und als spürte er meine Gedanken, tänzelte Canela seitwärts. Ich stieß einen Schrei aus und riss an den Zügeln. Schnaubend blieb er stehen und legte die Ohren an. Ihm missfiel eindeutig, was ich da mit seinem Zaumzeug anstellte.
Alfonso zwinkerte mir zu. »Na also. Sie hat ihn im Griff.« Seine Augen wanderten weiter zu Beatriz. »Benötigt Ihr meine Hilfe, hohe Dame?«, fragte er in einem scherzenden Ton, der jahrelange freundschaftliche Wortgefechte mit der einzigen und eigenwilligen Tochter des Haushofmeisters unserer Burg erahnen ließ.
»Ich komme zurecht, danke«, erwiderte Beatriz spitz. »Mehr noch, Ihre Hoheit und ich werden uns wunderbar fühlen, sobald wir ein Gefühl für Eure maurischen Rösser entwickelt haben. Vergesst nur nicht, dass wir nicht zum ersten Mal reiten, auch wenn unsere Gäule bisher, wie Ihr sagt, bloß dumme Maultiere waren.«
Alfonso lachte und vollführte auf seinem Rotschimmel eine für seine knapp zehn Jahre beachtlich geschickte Wendung, die viel Übung erfordert hatte. Seine leuchtend blauen Augen glitzerten in einem runden, hübschen Gesicht, dessen Züge durch das lange, an den Schultern gerade abgeschnittene Haar betont wurden. »Und bevor du es vergisst«, erwiderte er, »ich reite seit meinem fünften Lebensjahr jeden Tag aus. Erfahrung macht den Meister.«
»Wie wahr«, bestätigte Alfonsos Erzieher, Don Chacón, von seinem mächtigen Pferd herab. »Unser Infant Alfonso ist schon jetzt ein vorzüglicher Reiter. Der Pferdesport ist ihm zur zweiten Natur geworden.«
»Das bezweifeln wir auch gar nicht«, warf ich ein, bevor Beatriz etwas darauf sagen konnte. Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Nun, ich glaube, wir sind bereit, Bruder. Aber bitte nicht zu schnell.«
Alfonso drückte seinem Rotschimmel leicht die Fersen in die Flanken und ritt als Erster hinaus aus dem inneren Burghof von Arévalo und unter dem Fallgitter des Haupttors hindurch ins Freie.
Ich blitzte Beatriz missbilligend an.
Hinter all dem steckte natürlich sie. Gelangweilt von unserem immer gleichen Tagesablauf, der aus Unterricht, Gebeten und Handarbeiten bestand, hatte sie heute Morgen verkündet, dass wir uns körperlich ertüchtigen müssten, sonst verkämen wir vorzeitig zu alten Jungfern. Wir seien viel zu lange in den eigenen vier Wänden eingesperrt gewesen, sagte sie zur Begründung, womit sie auch recht hatte, denn der Winter war dieses Jahr besonders streng gewesen. Und als sie unsere Gouvernante, Doña Clara, um deren Erlaubnis gebeten hatte, hatte meine aya zugestimmt, weil Ausreiten bei uns stets nur bedeutet hatte, dass wir eine Stunde vor dem Abendessen die älteren Maultiere bestiegen, um gemächlich um die Ringmauern der Burg und des daran angrenzenden Städtchens zu trotten.
Aber als ich meine Reitkleidung angezogen hatte und mit Beatriz in den Burghof trat, wartete dort Alfonso bereits mit Don Chacón und den zwei rassigen Hengsten – Geschenke unseres Halbbruders, König Enrique. Der Rappe sei für mich, meinte Alfonso. Er heiße Canela – der Zimtfarbene.
Als ich mithilfe eines Schemels aufgestiegen war, hatte ich meine Befürchtungen noch unterdrückt. Doch meine Angst wuchs, als klar wurde, dass ich rittlings sitzen sollte – a la jineta, wie die Mauren, die bei sehr hoch angebrachten Steigbügeln auf dem schmalen Ledersattel kauerten. Für mich war das freilich eine unvertraute Haltung, die mich gehörig verunsicherte.
»Ein komischer Pferdename«, hatte ich genörgelt, um meine Angst zu verbergen. »Zimt ist eher hell, aber dieses Tier ist schwarz wie die Nacht.«
Canela hatte seine Mähne geschüttelt, den ausnehmend schön geformten Kopf verdreht und mich ins Bein gezwickt. Als gutes Vorzeichen für den Nachmittag wertete ich das nicht.
»Beatriz«, zischte ich jetzt meiner neben mir zur Ebene hinausreitenden Zofe zu. »Warum hast du mir nichts gesagt? Du weißt doch, dass ich keine Überraschungen mag.«
»Eben deshalb«, zischte sie zurück. »Hätte ich Euch eingeweiht, wärt Ihr gar nicht mitgekommen. Ihr hättet gesagt, wir sollen lesen oder irgendwelche Novenen herunterleiern. Aber irgendwann müssen wir doch auch ein wenig Spaß haben.«
»Mir leuchtet nicht ein, was daran spaßig sein soll, von einem Pferd abgeworfen zu werden.«
»Ach was! Betrachtet ihn einfach als einen groß geratenen Hund. Na gut, er ist recht stattlich, aber doch eigentlich harmlos.«
»Verrate mir doch bitte, woher du das weißt.«
»Weil Alfonso Euch ihn sonst nie reiten lassen würde«, erwiderte Beatriz und warf trotzig den Kopf zurück, womit sie wieder einmal ihr unerschütterliches Selbstbewusstsein zeigte, das sie zu meiner engsten Gefährtin und Vertrauten hatte werden lassen, obwohl ich – wie bei jeder Konfrontation mit ihrer respektlosen Art – zwischen Belustigung und Unbehagen schwankte.
Zwischen uns lagen drei Jahre und dazu Unterschiede im Temperament, wie sie größer nicht sein konnten. Beatriz verhielt sich stets so, als wäre das Land außerhalb unserer Tore eine unerforschte Welt voller möglicher Abenteuer. Doña Clara führte ihre Unbekümmertheit darauf zurück, dass Beatriz’ Mutter kurz nach ihrer Geburt gestorben war und ihr Vater sie allein und ohne jede weibliche Aufsicht in Arévalo aufgezogen hatte. So dunkel wie ich blond war, so üppig wie ich hager, zeigte sich Beatriz rebellisch, unberechenbar und unverblümter, als es ihr guttat. Sie legte sich sogar mit den Nonnen im Convento de las Angustinas an, wo wir unseren Unterricht erhielten, und trieb die arme Sor María mit ihren endlosen Fragen zur Raserei. Sie war aber auch eine treue und lustige Freundin mit einem sicheren Gespür für das Erheiternde am Treiben anderer. Den Respektspersonen war sie ein permanenter Dorn im Auge, insbesondere Doña Clara, die sich vergeblich damit abmühte, Beatriz beizubringen, dass wohlerzogene Damen nicht einfach ihren Launen nachgaben.
»Wir hätten Doña Clara die Wahrheit sagen sollen.« Ich seufzte, die Augen auf meine Hände gerichtet. Schon wieder hielt ich die Zügel zu fest und zwang mich, den Griff zu lockern. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unser Umherziehen auf Pferden angemessen finden wird.«
Beatriz deutete auf die Landschaft vor uns. »Angemessen! Wer schert sich denn um so was? Seht Euch doch nur um!«
Ich gehorchte, wenn auch widerstrebend.
Die Sonne senkte sich zum Horizont und verströmte ein safrangelbes Glühen über den ausgebleichten Himmel. Zu unserer Linken thronte die Burg Arévalo über einem felsigen Abhang, eine graubraune Zitadelle mit ihren vier von Zinnen gekrönten Türmen, die über dem Marktflecken gleichen Namens emporragten. Rechts wand sich die Hauptstraße durch das Land, die letztlich nach Madrid führte, während sich rings um uns die offene Ebene Kastiliens erstreckte, so weit das Auge reichte – ein endloses Land, gesprenkelt mit Gersten- und Weizenfeldern, Gemüsegärten und vom Wind verkrümmten Pinien. In der reglosen Luft hingen der schwere Duft von Harz und eine Ahnung der Schneeschmelze in den Bergen, die ich seit jeher mit der Ankunft des Frühlings verband.
»Ist das nicht atemberaubend?«, hauchte Beatriz mit glänzenden Augen. Ich nickte, den Blick auf das Land gerichtet, das meine Heimat gewesen war. Ich hatte es natürlich schon oft gesehen, vom höchsten Turm der Festung Arévalo und bei unseren jährlichen Reisen mit Doña Clara zu der in unserer Nachbarschaft gelegenen Stadt Medina del Campo, wo der größte Viehmarkt von Kastilien abgehalten wurde. Doch aus einem unerklärlichen Grund wirkte es heute anders. Es war, als bemerkte man plötzlich bei einem oft betrachteten Gemälde, dass die Zeit es verändert, den Farben einen neuen Glanz verliehen und den Kontrast zwischen Licht und Schatten vertieft hatte.
In meiner praktischen Art redete ich mir zu, das liege daran, dass ich das Land heute von einer höheren Warte aus sah, da ich nun mal auf Canela saß und nicht auf meinem gewohnten Maultier. Gleichwohl brannten mir Tränen in den Augen, und unvermittelt überfiel mich die Erinnerung an einen prunkvollen sala, gefüllt mit Menschen in Samt und Seide. Das Bild verblasste so schnell, wie es gekommen war, ein Phantom aus der Vergangenheit; und als Alfonso, der mit Don Chacón ein Stück vorausgeritten war, mir zuwinkte, vergaß ich, dass ich auf einem mir nicht vertrauten und möglicherweise gefährlichen Pferd saß, und rammte ihm die Fersen in die Rippen.
Canela schlug mit den Hinterbeinen aus, und ich kippte nach vorn auf seinen anmutig gewölbten Hals. Instinktiv klammerte ich mich an seine Mähne, stemmte mich aus dem Sattel hoch und spannte die Oberschenkel an. Darauf reagierte Canela mit einem zufriedenen Schnauben. Er galoppierte, ockerfarbenen Staub aufwirbelnd, an Alfonso vorbei.
»Dios mío!«, hörte ich Alfonso rufen, als ich an ihm vorbeipreschte. Aus dem Augenwinkel sah ich Beatriz hinter mir näher kommen und hörte sie meinem Bruder und dem verdutzten Don Chacón zurufen: »Erfahrung macht den Meister, was?«
Ich lachte hell auf.
Ich fühlte mich großartig. So hatte ich mir das Fliegen vorgestellt: alles hinter mir lassen, den Verdruss über den Unterricht und die Hausaufgaben, die kalten Steinplatten der Burg, die ewigen Körbe voller Sachen zum Stopfen, das ständige Gebrummel über Geldsorgen und den wechselhaften Gesundheitszustand meiner Mutter; frei zu sein und die Bewegungen des Pferdes unter mir zu genießen, und all das mitten in der herrlichen kastilischen Landschaft.
Als ich endlich keuchend auf einer Bergkuppe, mit Blick über die Ebene, zum Stehen kam, hing meine Reithaube nur noch an ihren Bändern über dem Rücken, und mein Haar hatte sich gelöst. Ich ließ mich von Canela herabgleiten und tätschelte ihm den schweißnassen Hals. Er beschnupperte meine Handfläche, ehe er sich daranmachte, an den dürren Dornensträuchern zu knabbern, die zwischen den Felsen wuchsen. Ich setzte mich auf einen Steinhaufen, von wo aus ich verfolgte, wie Beatriz den Grat erklomm. Als sie schließlich, von der Anstrengung erhitzt, ihr Pferd anhielt, sagte ich: »Du hattest recht. Wir hatten die Bewegung tatsächlich nötig.«
»Bewegung?«, japste sie und glitt aus dem Sattel. »Ist Euch bewusst, dass wir Seine Hoheit und Chacón soeben in einer Staubwolke zurückgelassen haben?«
Ich lächelte. »Beatriz de Bobadilla, muss bei dir alles ein Wettkampf sein?«
Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Wenn es darum geht, unseren Wert zu beweisen – ja. Wenn wir das nicht selbst tun, wer dann?«
»Es ist also deine Kraft, die du beweisen willst«, sinnierte ich. »Hm. Erkläre mir das.«
Beatriz ließ sich neben mir zu Boden plumpsen, die Augen auf die sinkende Sonne gerichtet. In dieser Jahreszeit zog sich der Sonnenuntergang in Kastilien immer lange hin, was uns ein spektakuläres Schauspiel mit golden umrandeten Wolken und einem mit Violett und Purpur übergossenen Himmel bescherte. Der aufkommende Abendwind wehte durch Beatriz’ zerzaustes Haar. Ihre ausdrucksvollen Augen, die jeden ihrer Gedanken sofort verrieten, blickten wehmütig. »Ich möchte beweisen, dass wir genauso fähig sind wie jeder Mann und darum dieselben Privilegien genießen sollten.«
Ich runzelte die Stirn. »Wozu sollte das gut sein?«
»Damit wir ein Leben nach unseren eigenen Vorstellungen führen können, so wie Seine Hoheit.«
»Alfonso führt doch kein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen.« Ich rückte meine Haube zurecht und stopfte die Bänder unter das Mieder. »Eigentlich genießt er bedeutend weniger Freiheit, als du glaubst. Heute ist das eine Ausnahme; sonst bekomme ich ihn kaum noch zu sehen, so sehr nehmen ihn seine Schwertkämpfe, das Bogenschießen und die Turniere in Anspruch, ganz zu schweigen von seinen Studien. Er ist ein Prinz. Da hat er viele Pflichten und wenig Zeit.«
Sie zog eine Schnute. »Ja, aber es sind wichtige Pflichten. Mehr, als nur zu lernen, wie man näht, Butter schlägt oder Schafe in den Pferch treibt. Wenn wir wie Männer leben könnten, dann hätten wir die Freiheit, durch die Welt zu ziehen und edle Taten zu vollbringen – so wie ein fahrender Ritter oder die Jungfrau von Orléans.«
Ich verbarg die ungewollte Erregung, die ihre Worte in mir auslösten. Seit jener schrecklichen Nacht vor zehn Jahren, als meine Mutter, Alfonso und ich aus Valladolid geflohen waren, hatte ich mich darin geschult, meine Gefühle zu verbergen, zumal ich mittlerweile viel besser verstand, was damals geschehen war. Wir waren in Arévalo nicht so hermetisch von der Welt abgeschnitten, dass nicht doch gelegentlich über die Meseta hinweg Nachrichten über die königlichen Residenzen in Madrid, Segovia und Valladolid zu uns durchsickerten. Unsere Bediensteten tuschelten über alles Mögliche, und wenn man sich – scheinbar unbeteiligt – in ihrer Nähe aufhielt, schnappte man leicht das eine oder andere auf. So wusste ich, dass mit Enriques Thronbesteigung der Hof für uns ein gefährlicher Ort geworden war, da er von seinen Günstlingen und seiner habgierigen Königin beherrscht wurde. Nie hatte ich die Angst von jener Nacht, als mein Vater starb, vergessen, auch nicht den langen Ritt über Felder und durch dunkle Wälder, bei dem wir die Hauptstraßen gemieden hatten, falls Enrique Soldaten hinter uns herhetzte. Die Erinnerung hatte sich in mein Bewusstsein gebrannt, eine untilgbare Lektion darüber, dass die Wechselfälle des Lebens sich jederzeit ereignen konnten, egal, ob wir darauf vorbereitet waren oder nicht, und wir unser Bestes tun mussten, um uns den Umständen ohne großes Aufhebens anzupassen.
»Die Jungfrau von Orléans wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt«, erwiderte ich schließlich. »Ist dies das große Ziel, das wir deiner Meinung nach anstreben sollten, meine Freundin?«
Beatriz seufzte. »Natürlich nicht. Das ist ein schrecklicher Tod. Aber ich möchte gern glauben, dass wir, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, genauso wie sie Armeen zur Verteidigung unseres Landes in die Schlacht führen können. Im Moment ist es doch so, dass wir verurteilt sind, bevor wir überhaupt gelebt haben!« Sie reckte die Arme in die Höhe. »Es ist ja immer dasselbe, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für trostlosen Monat. Da frage ich mich: Werden wirklich alle Edelfrauen zu einem derartigen Dasein erzogen? Sind wir wirklich so geistlos, dass unsere einzigen Vergnügungen darin bestehen müssen, Gäste zu unterhalten und unseren zukünftigen Ehemännern zu gefallen, zu lernen, wie man beim Essen zwischen den Gängen lächelt, ohne jemals eine eigene Meinung zu äußern? Wenn es so ist, dann können wir doch gleich das Heiraten und Kinderkriegen auslassen und ohne Umwege ins Greisentum und den Zustand der Heiligkeit übergehen.«
Ich musterte sie nachdenklich. Beatriz stellte immer Fragen, auf die es keine leichten Antworten gab. Seit jeher hatte sie gewünscht, das zu ändern, was uns bereits vor unserer Geburt auferlegt worden war. Es befremdete mich, dass ich mir in letzter Zeit ähnliche Fragen gestellt hatte und wie sie unter Rastlosigkeit litt, auch wenn ich das nie offen zugegeben hätte. Mir missfiel die Ungeduld, die mich jetzt ergriff, da ich die Zukunft ins Auge fasste, denn mir war klar, dass sogar ich, eine kastilische Prinzessin, mich eines Tages dorthin verheiraten lassen musste, wohin auch immer ich befohlen wurde, und mich in das Leben zu fügen hatte, das mein Gemahl für mich vorsah.
»Es ist weder öde noch entwürdigend, zu heiraten und für Mann und Kinder zu sorgen«, hielt ich ihr vor. »Das ist nun einmal seit Anbeginn der Zeit das Los der Frau.«
»Ihr sagt nur auf, was Euch eingetrichtert wurde«, entgegnete Beatriz. »›Frauen gebären, und Männer versorgen sie.‹ Aber ich frage Euch: Warum? Warum dürfen nur wir nur einen einzigen Weg beschreiten? Wer hat gesagt, dass eine Frau nicht das Schwert und das Kreuz ergreifen und gegen Granada ziehen kann, um die Mauren zu besiegen? Wer hat gesagt, dass wir nicht in der Lage sind, wie jeder Mann unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und unser Leben selbst in die Hand zu nehmen?«
»Es geht nicht darum, wer das gesagt hat. Es ist einfach so.«
Sie verdrehte die Augen. »Tja, die Jungfrau von Orléans hat nicht geheiratet. Sie hat nicht geschrubbt, genäht oder sich den Kopf über Brautgaben zerbrochen. Sie hat eine Rüstung angelegt und ist für ihren Dauphin in den Krieg gezogen.«
»Für ihren Dauphin, der sie dann an die Engländer verraten hat«, hielt ich ihr entgegen. »Beatriz, die Jungfrau wurde von Gott berufen, um sein Werk zu verrichten. Du kannst ihr Schicksal nicht mit dem unseren vergleichen. Sie war ein heiliges Werkzeug; sie hat sich für ihr Land geopfert.«
Beatriz schnaubte abfällig, doch ich wusste, dass ich in unserem Streit, den wir seit Kindheitstagen miteinander führten, ein unwiderlegbares Argument angebracht hatte. Äußerlich zeigte ich mich gelassen, wie das immer der Fall war, wenn Beatriz mir eine Predigt hielt. Doch als ich mir ausmalte, wie meine lebhafte Freundin in einer rostigen Ritterrüstung steckte und eine Abordnung von Adeligen zum Krieg für la patria aufrief, musste ich plötzlich kichern.
»Jetzt lacht Ihr mich aus!«, beschwerte sie sich.
»Nein, nein.« So gut ich konnte, unterdrückte ich meinen Heiterkeitsausbruch. »Bestimmt nicht. Ich habe mir nur vorgestellt, wie du dich, ohne zu zögern, der Jungfrau angeschlossen hättest, wenn sie gerade des Weges gekommen wäre.«
»Das hätte ich allerdings!« Sie sprang auf. »Ich hätte meine Bücher und Sticksachen zum Fenster hinausgeworfen und wäre auf das nächste freie Pferd gesprungen. Wie herrlich es sein muss zu tun, was einem gefällt, für das Heimatland zu kämpfen und mit dem Himmel als Dach und der Erde als Bett zu leben.«
»Du übertreibst, Beatriz. Kreuzzüge bringen größeres Leid mit sich, als die Geschichte uns überliefert.«
»Vielleicht, aber wenigstens würden wir etwas tun!«
Ich blickte auf ihre Hände, die zu Fäusten geballt waren, als umklammerten sie eine Waffe. »Mit deinen Pranken könntest du ohne Zweifel ein Schwert schwingen«, neckte ich sie.
Sie hob das Kinn. »Ihr seid die Prinzessin, nicht ich. Ihr würdet das Schwert schwingen.«
Als wäre der Tag ohne Warnung der Nacht gewichen, befiel mich auf einmal Kälte. Ich fröstelte. »Ich glaube nicht, dass ich eine Armee führen könnte«, sagte ich leise. »Es muss schrecklich sein zu sehen, wie die eigenen Landsleute von den Feinden niedergemetzelt werden, und zu wissen, dass einen der Tod jeden Moment ereilen kann. Genauso wenig« – mit erhobener Hand unterband ich Beatriz’ Protest – »glaube ich, dass man die Jungfrau von Orléans als Beispiel verherrlichen sollte, dem wir alle nacheifern müssen. Sie hat für ihren Prinzen gekämpft, nur um einen grausamen Tod zu erleiden. Ein solches Schicksal wünsche ich keinem Menschen. Und mir selbst schon gar nicht. Auch wenn das langweilig in deinen Ohren klingen mag, ich möchte lieber heiraten und Kinder gebären, wie es meine Pflicht ist.«
Beatriz starrte mich durchdringend an. »Pflicht ist etwas für Schwächlinge. Sagt mir nicht, dass Ihr nicht auch schon alles infrage gestellt habt! Ihr habt doch die Erzählung über die Kreuzfahrerkönige in unserer Bibliothek verschlungen, als ob sie aus Marzipan wäre.«
Ich lachte gepresst. »Du bist wirklich unverbesserlich.«
In diesem Moment kamen Alfonso und Don Chacón herangeritten. Der Erzieher wirkte zutiefst besorgt. »Eure Hoheit, edle Fürstin von Bobadilla. Ihr hättet nicht so plötzlich davongaloppieren dürfen. Ihr hättet Verletzungen oder Schlimmeres erleiden können. Wer weiß, was hier draußen nach der Dämmerung alles lauert?«
Ich hörte die Angst in seiner Stimme. Auch wenn König Enrique es für angebracht gehalten hatte, uns isoliert vom Hof in Arévalo zurückzulassen, war sein Schatten nie weit von unserem Leben entfernt. Die Gefahr, verschleppt zu werden, war eine Bedrohung, an die ich mich längst gewöhnt hatte, ja, die ich eigentlich ignorierte. Doch Chacón widmete sein Leben unserem Schutz und betrachtete jede Möglichkeit einer Gefährdung als ernste Angelegenheit.
»Verzeiht mir«, lenkte ich ein. »Das war mein Fehler. Ich weiß selbst nicht, was in mich gefahren ist.«
»Was immer es war, ich bin beeindruckt«, schwärmte Alfonso. »Wer hätte gedacht, dass du eine solche Amazone bist, Schwesterherz?«
»Ich, eine Amazone? Bestimmt nicht! Ich habe bloß Canelas Ausdauer auf die Probe gestellt. Er hat sich gut geschlagen, findest du nicht auch? Er ist viel schneller, als seine Größe vermuten lässt.«
Alfonso grinste. »Allerdings. Und ja, er hat sich tatsächlich gut geschlagen.«
»Aber jetzt müssen wir zurück«, mahnte Chacón. »Es ist bald Nacht. Kommt, wir reiten auf der Hauptstraße. Und diesmal wird nicht vorausgaloppiert. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
Wieder auf unseren Pferden, folgten Beatriz und ich meinem Bruder und Chacón ins Zwielicht. Zu meiner Erleichterung hielt sich Beatriz zurück und ritt sittsam neben mir her. Doch während wir uns Arévalo näherten und rote Schlieren den Himmel überzogen, ging mir unwillkürlich unser Gespräch durch den Kopf, und ich fragte mich trotz aller Bemühungen, diesen Gedanken zu verdrängen, wie es wohl sein mochte, sich wie ein Mann zu fühlen.
Kapitel 2
Der Wohntrakt war verlassen, was um diese Stunde noch nie vorgekommen war. In dem Moment, als wir in den großen Saal traten und ich sah, dass der vernarbte lange Tisch in der Mitte noch nicht fürs Abendessen gedeckt war, befiel mich ein ungutes Gefühl. Etwas stimmte hier nicht. Alfonso und Chacón waren noch in den Stallungen, wo sie die Pferde absattelten und striegelten. Während Beatriz mir den Umhang abnahm, spähte ich zum Kamin hinüber. Niemand hatte daran gedacht einzuheizen. Die einzige Lichtquelle waren die flackernden Fackeln an der Wand.
Vorsichtig betastete ich mir die von den Zügeln wund gescheuerten Hände. »Wo nur alle sind?«, fragte ich, um einen forschen Ton bemüht. »Eigentlich hätte ich erwartet, dass Doña Clara mit der Rute in der Tür steht und uns eine Strafpredigt hält.«
»Ich auch.« Beatriz runzelte die Stirn. »Es ist so seltsam still hier.«
Ich fragte mich, ob meine Mutter während unseres Ausritts wieder eine Krise erlitten hatte. Schuldgefühle befielen mich. Ich hätte in der Burg bleiben müssen und mich nicht so überstürzt entfernen dürfen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen.
Meine Gouvernante kam hereingeeilt.
»Jetzt geht’s uns an den Kragen«, zischte Beatriz, doch ich merkte sofort, dass die betroffene Miene meiner aya nicht uns galt. Falls Doña Clara zunächst wegen unserer Eskapade erbost gewesen war, musste danach etwas geschehen sein, das alles andere verdrängt hatte.
»Endlich«, seufzte Doña Clara in einem Ton, dem die gewohnte Schärfe fehlte. »Wo habt Ihr nur gesteckt? Ihre Hoheit, Eure Mutter, hat sich nach Euch erkundigt.«
Meine Mutter hatte sich nach mir erkundigt! Mir sank das Herz. Wie aus weiter Ferne hörte ich Beatriz murmeln: »Wir waren mit Seiner Hoheit zusammen, Doña Clara. Wisst Ihr nicht mehr? Wir haben doch gesagt, dass wir …«
»Ich weiß, mit wem ihr zusammen wart«, fiel ihr meine aya ins Wort. »Ungezogenes Kind! Was ich gefragt habe, ist, wo ihr wart. Ihr wart über drei Stunden verschwunden, falls ihr das noch nicht bemerkt habt.«
»Drei Stunden?« Ich starrte sie an. »Es kam mir nicht länger vor als …« Meine Stimme erstarb, als mich ihr aufgebrachter Blick traf. »Ist etwas passiert? Ist Mama …?
Doña Clara nickte. »Ein Brief ist eingetroffen, als Ihr weg wart. Er hat sie in größte Betrübnis gestürzt.«
Mir schnürte sich der Magen zusammen. Hilfe suchend griff ich nach Beatriz’ Hand, als Doña Clara hinzufügte: »Der Brief war vom Hof. Ich habe ihn mir vom Boten aushändigen lassen und gleich das Siegel erkannt. Der Bote hat gar nicht erst auf eine Antwort gewartet. Er meinte, das sei nicht nötig. Und als meine Herrin den Brief las, hat sie sich dermaßen aufgeregt, dass wir ihr einen Trunk aus Ringelblume und Rhabarber bereiten mussten. Doña Elvira hat dann versucht, sie zum Trinken zu bewegen, aber sie hat sich geweigert, sich bedienen zu lassen. Sie ist wortlos in ihren Gemächern verschwunden und hat die Tür zugeschlagen.«
Beatriz drückte meine Hand. Sie brauchte nicht in Worte zu fassen, was wir beide dachten. Wenn ein Brief vom Hof kam, egal, welchen Wortlauts, konnte das nichts Gutes verheißen.
»Ein Brief – ausgerechnet jetzt!«, ächzte Doña Clara. »Könnt Ihr Euch das vorstellen? Nach zehn Jahren Schweigen! Natürlich ist sie außer sich! Die ganze Zeit haben wir hier gelebt, und nie gab es eine Einladung oder irgendeinen Aufruf – als ob wir verarmte Verwandte wären, die man besser versteckt, weil man sich sonst schämen müsste. Nur Carrillo hat stets das versprochene Geld für unseren Unterhalt geschickt. Aber auch ein Prinz der Kirche kann aus einem zahlungsunwilligen Schatzamt kein Gold herauspressen. Wenn wir nicht unsere eigenen Nutztiere und Felder für den Anbau hätten, wären wir längst verhungert. Und seht Euch nur um: Wir brauchen neue Wandbehänge, Teppiche für die Böden, von Kleidern ganz zu schweigen. Seine Hoheit, der König, weiß das sehr wohl. Er weiß, dass wir zwei Kinder nicht mit Luft und Hoffnung allein aufziehen können.«
Heftige Ausbrüche waren bei ihr nichts Ungewöhnliches, ja, Klagen über unsere Not erfolgten bei ihr so sicher wie das Amen in der Kirche, sodass ich meist gar nicht mehr hinhörte. Doch nun, als hätte sie mir jäh Scheuklappen von den Augen gerissen, sah ich die Mauern des Saals auf einmal so, wie sie tatsächlich waren: von Schimmel beschmutzt und mit bis zur Farblosigkeit ausgeblichenen Teppichen behängt; die abgetretenen Bodendielen und altersschwachen Möbel, wie man sie in einem heruntergekommenen Bauernhaus erwarten würde, aber doch nicht in der Residenz der Königinwitwe von Kastilien und ihrer Kinder, beide mögliche Thronfolger.
Trotzdem war das hier mein Zuhause – das einzige, das ich kannte. Ein Ruck ging durch mich, als ich mich plötzlich der Vision von den in Samt gekleideten Gestalten in einem Saal entsann. Anscheinend hatte ich jenen weit entfernten Königshof, an dem meine Familie und ich einst gelebt hatten, doch nicht ganz vergessen …
Ich wünschte mir sehnlichst, ich könnte in die Kapelle gehen, um eine Weile allein zu sein und in Ruhe nachzudenken. Obwohl sie kalt und karg war, fand ich in der Burgkapelle immer Trost, wenn sich Schwierigkeiten vor mir auftürmten. Das bloße Hinknien und Händefalten verhalf mir zu mehr Gelassenheit und innerer Sammlung, selbst wenn es mir nicht gelang, meine aufgewühlten Gedanken so weit zu bändigen, dass ich beten konnte.
»Ihr müsst zu ihr gehen«, forderte mich Doña Clara auf. Mit einem stummen Seufzer nickte ich, dann durchquerte ich mit Beatriz an meiner Seite den Saal bis zu der Treppe, die ins erste Stockwerk führte. Am Treppenabsatz angelangt, trafen wir Doña Elvira, die oberste Hofdame meiner Mutter, auf einem Hocker sitzend an. Sie erhob sich eilig.
»Ach, Isabella, mein Kind!« Sie presste sich ihre mit braunen Flecken übersäte Hand an den Mund, sichtlich darum bemüht, ihre Tränen zurückzukämpfen. Die arme Doña Elvira war ständig den Tränen nahe. Ich kannte keinen Menschen, der so ausgiebig oder häufig weinte wie sie.
Beschwichtigend berührte ich sie an der knochigen Schulter. Sie war eine meiner Mutter treu ergebene Dienerin, die mit ihr aus Portugal gekommen war und bei allen Widrigkeiten stets an ihrer Seite gestanden hatte. Von ihrer Veranlagung her neigte sie zu Nervosität. Überdies war sie mit den Anfällen meiner Mutter heillos überfordert. Nun, in Wahrheit kam auf der ganzen Burg niemand damit zurecht – außer mir.
»Ihr dürft Euch nicht beunruhigen«, sagte ich sanft.
Elvira wischte sich die Tränen von den faltigen Wangen ab. »Als dieser Brief eingetroffen ist … Heilige Jungfrau, du hättest sie sehen müssen. Sie ist ganz wild geworden und hat geschrien und getobt. Ach, war das schrecklich! Und dann hat sie … hat sie die Tür zugeknallt und sich geweigert, irgendjemanden in ihre Nähe zu lassen – nicht einmal mich! Ich habe sie angebettelt, ihren Trunk einzunehmen, sich ins Bett zu legen und sich zu beruhigen. Sie hat gesagt, dass ihr jetzt außer Gott niemand helfen kann.«
»Ich kümmere mich um sie«, versprach ich. »Geht und bereitet ihr einen frischen Trunk zu. Aber lasst mir etwas Zeit, bevor Ihr ihn bringt.« Ich schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln, dann sah ich ihr nach, wie sie davonschlurfte. Schließlich näherte ich mich der Tür zum Schlafgemach meiner Mutter. Ich wollte nicht dort hinein. Am liebsten wäre ich weggelaufen.
»Ich warte hier«, kündigte Beatriz an. »Für den Fall, dass Ihr mich braucht.«
Um mich zu beruhigen, atmete ich tief durch, dann griff ich nach der Klinke. Der Riegel innen war vor einiger Zeit entfernt worden, nachdem meine Mutter sich während eines dieser Anfälle wieder einmal eingeschlossen hatte. Mehr als zwei Tage lang hatte sie niemanden zu sich hereingelassen. Zu guter Letzt hatte Don Chacón die Tür aufgebrochen.
Schon beim Eintreten konnte ich die Spuren des neuesten Anfalls sehen. Über den Boden verstreut lagen zerbrochene Phiolen, Dokumente, Gegenstände, die sie aus Truhen gezerrt und durch den Raum geschleudert hatte. Ich blinzelte, musste mich erst an die Dunkelheit gewöhnen, ehe ich entschlossen einen Schritt vortrat. Mein Fuß stieß gegen etwas. Scheppernd rollte es davon. Es glänzte matt und hinterließ eine nasse Spur.
Der Kelch mit Doña Elviras Trunk.
»Mama«, sagte ich, »Mama, ich bin’s, Isabella.«
Ein Hauch von Schimmelgeruch – wegen der Nähe des Flusses ein ständiger Begleiter in dieser alten Burg – stieg mir in die Nase. Nach und nach zeichneten sich in der Dunkelheit vertraute Gegenstände ab. Ich erkannte das durchhängende Himmelbett meiner Mutter, die Samtvorhänge, die die auf dem Boden ausgebreiteten Binsen streiften, ihren Webstuhl, den Spinnrocken an dem von den geschlossenen Läden verdunkelten Fenster, das erkaltete Kohlenbecken und hinten im Alkoven ihren gepolsterten Thron, ein einsames Relikt unter seinem Abdecktuch, das als Insignien die Wappen ihrer portugiesischen Heimat und Kastiliens trug.
»Mama?« Meine Stimme bebte. Dann ballte ich die Fäuste. Ich brauchte doch vor nichts Angst zu haben, hielt ich mir vor. Dies hier war nun wirklich nichts Neues für mich! Schon oft hatte ich meine Mutter vom Rand des Abgrunds zurückgeholt. Von allen Mitgliedern ihres Hofs war ich die Einzige, die es vermochte, sie zu beruhigen und zur Vernunft zu bringen, wenn diese Krisen über sie hereinbrachen. Und kein einziges Mal hatte sie mir etwas zuleide getan.
Dann hörte ich vom Bett her ein Rascheln. Angestrengt spähte ich in die Schatten und erkannte schließlich ihre Gestalt. Ein Schauder huschte mir über den Rücken. Noch immer hatte ich die Todesnacht meines Vaters, als ich geglaubt hatte, den Geist des Konnetabels zu sehen, in schrecklicher Erinnerung.
»Mama, ich bin hier. Kommt heraus. Sagt mir, was Euch so erschreckt hat.«
Langsam tastete sie sich nach vorn. Zerzaustes Haar umrahmte ihr bleiches Gesicht, ihre langen weißen Hände kneteten ihre Robe. »Hija mia, er ist hier. Er ist zurückgekommen, um mich zu quälen.«
»O nein, Mama, das ist nur der Wind.« Ich ging weiter zur Anrichte, auf der ich eine Kerze erspäht hatte. Während ich mit dem Feuerstein eine Flamme schlug und sie gegen den Docht hielt, schrie meine Mutter: »Nein, kein Licht! Sonst sieht er mich noch! Er wird …«
Sie verstummte, als ich mich, die brennende Kerze mit beiden Händen haltend, zu ihr umdrehte. Der flackernde Lichtkreis rückte die Schatten an den Wänden höher. »Seht Ihr, Mama? Es ist niemand hier außer Euch und mir.«
Mit den gespenstisch weit aufgerissenen blaugrünen Augen suchte sie das Gemach ab, als befürchtete sie, ihren Quälgeist in den Ecken lauernd vorzufinden. Schon wollte ich einen Schritt zurückweichen, als sie plötzlich erschlaffte. Mit einem Stoßseufzer der Erleichterung steckte ich die Kerze in einen Leuchter und führte meine Mutter dann zu einem Stuhl. Sobald ich mich vor ihr auf einen Hocker gesetzt hatte, nahm ich ihre eisigen Hände in die meinen.
»Ich weiß, dass du mir nicht glaubst«, murmelte sie mit einer Stimme, die immer noch einen Nachhall ihrer panischen Furcht enthielt. »Aber er war hier. Ich habe ihn beim Fenster gesehen. Er hat mich angestarrt, und zwar genauso wie damals, als er noch lebte und mir beweisen wollte, wie viel Macht er über deinen Vater hatte.«
»Mama, der Konnetabel Luna ist tot. Niemand war hier. Niemand wollte Euch etwas antun. Das schwöre ich Euch.«
Sie entzog mir ihre Hand. »Wie kannst du mir so etwas schwören? Du weißt nichts davon; du verstehst nichts davon. Kein Mensch hat einen Begriff davon. Aber er schon. Er weiß, dass eine Blutschuld bezahlt werden muss.«
Es überlief mich eiskalt. »Mama, wovon sprecht Ihr da? Welche Schuld?«
Sie schien mich nicht zu hören. »Ich hatte keine Wahl«, sagte sie. »Er hat mir deinen Vater geraubt. Er war eine Ausgeburt der Hölle, ein Dämon: Er hat deinen Vater von mir weggelockt, ihn verführt. Und doch haben sie behauptet, ich wäre schuld daran. Juan hat mir damals gesagt, er wünschte, er wäre an jenem Tag auch gestorben, dann könnte er bei seinem geliebten Freund sein. Und das ist ja auch geschehen: Er ist gestorben. Er hat gar nicht versucht zu leben – nicht für mich, nicht für seine Kinder. Dieser … dieser unnatürliche Mann war ihm lieber.«
Ich wollte nichts davon hören. Das alles war nicht für meine Ohren bestimmt. Ich war doch nicht ihr Beichtvater. Aber wir waren allein. Und ich musste sie so weit beruhigen, dass sie sich wenigstens wieder bereit zeigte, sich versorgen zu lassen. Und dann gab es auch noch diesen Brief, den Grund, warum sie überhaupt in diesen Zustand verfallen war. Ich musste herausfinden, was darin stand.
»Papa ist an einer Krankheit gestorben«, sagte ich stockend. »Das war keine Absicht. Er war krank. Er hatte Fieber und …«
»Nein!« Sie erhob sich. »Er wollte sterben! Er wählte den Tod, damit er mir entkommen konnte. Geliebte Jungfrau, Mutter Gottes, das ist der Grund, warum ich keine Ruhe finde, warum ich Tag für Tag entsetzliche Qualen aushalten muss. Hätte ich diese Tat nicht begangen, würde Juan vielleicht noch leben. Ich wäre immer noch Königin. Wir würden immer noch den uns gebührenden Rang bekleiden!«
Als wären sie bei uns im Gemach, hörte ich plötzlich die Worte der Hofdamen, die sie vor so langer Zeit geflüstert hatten: Diese portugiesische Wölf in hat es getan … Sie hat Luna umgebracht.
Meine Mutter hatte den besten Freund meines Vaters vernichtet. Das war der Grund, warum sie glaubte, sein Geist würde sie verfolgen; warum sie immer wieder diesen entsetzlichen Krisen zum Opfer fiel. Sie glaubte, dass sie mit ihrer Tat eine Blutschuld über sich gebracht hatte.
Ich zwang mich dazu aufzustehen. »Es ist kalt hier. Lasst mich das Kohlenbecken einschüren.«
»Ja! Warum nicht? Entfach das Feuer. Oder, besser noch: Hol die Fackeln und setz die ganze Burg in Brand. Das wird ein Vorgeschmack dessen sein, was uns in der Hölle erwartet.« Sie begann, im Gemach auf und ab zu schreiten. »Gott im Himmel, was kann ich tun? Wie kann ich dich schützen?« Sie wirbelte herum. Ich erstarrte, machte mich schon auf das Schlimmste gefasst. Doch sie begann nicht zu kreischen, zu toben oder sich selbst zu zerkratzen, wie das schon einmal geschehen war. Stattdessen griff sie in die Tasche ihrer Robe und schleuderte mir ein zerknülltes Stück Pergament entgegen. Ich hob es vom Boden auf und stellte mich in den Lichtschein der Kerze. Mit stockendem Atem las ich den Inhalt. Stille breitete sich aus, nur durchbrochen vom Pfeifen des Windes draußen. Der Brief war von König Enrique. Seine Gemahlin, Königin Juana, hatte einer Tochter das Leben geschenkt. Sie hatten das Kind nach seiner Mutter Joanna getauft.
Mit wieder normaler Stimme sagte meine Mutter: »Enrique hat das Unmögliche vollbracht. Er hat einen Erben.«
Ich sah verwirrt auf. »Aber das ist doch sicher ein Grund zum Feiern.«
Sie lachte. »O ja, eine Feier wird es geben! Sie werden über meine Abdankung jubeln. Alles, wofür ich gekämpft habe, ist verloren; ich habe keine Krone, keinen Hof; dein Bruder Alfonso wird enterbt. Und sie werden kommen. Sie werden Alfonso und dich fortbringen. Sie werden mich allein zurücklassen, damit ich, vergessen von der Welt, langsam verrotte.«
»Mama, das ist nicht wahr. Dieser Brief verkündet doch nur die Geburt des Kindes. Darin steht nichts darüber, dass wir irgendwohin müssen. Ihr seid nur überreizt. Kommt, lasst uns zusammen Trost suchen.«
Ich steckte den Brief ein und wandte mich zu ihrer Gebetsbank. Das Beten war eine Freude, die sie mir in meiner frühen Kindheit nahegebracht hatte, ein Ritual, das wir liebten und in Ehren hielten. Jeden Abend sprachen wir gemeinsam unsere Gebete.
Schon streckte ich die Hand nach der Perlmuttschachtel aus, als sie sagte: »Nein, keine Gebete mehr. Gott hört mir nicht mehr zu.«
Ich erschrak. »Das … das ist Gotteslästerung. Gott hört immer zu.« Doch in diesem Moment klangen meine Worte lahm, sogar in meinen Ohren, ohne jede Überzeugung, und das ängstigte mich. Plötzlich spürte ich, wie mich das Gewicht von Dingen, von denen ich so gut wie keinen Begriff hatte, niederdrückte und eine Kluft zwischen uns schuf. Fast hätte ich laut nach Luft geschnappt, als ein schüchternes Klopfen von der Tür herüberdrang. Es war Elvira. Einen Trinkkelch in der Hand, stand sie auf der Schwelle und bedachte mich mit einem fragenden Blick, als ich ihn ihr abnahm. Dann drehte ich mich zu meiner Mutter um. Sie war zum Bett zurückgewichen und beobachtete mich. »Ah«, sagte sie, »mein Vergessen ist gekommen.«
»Es ist ein Trank, der Euch einschlafen hilft. Mama, Ihr müsst jetzt ruhen.« Ich trat zu ihr und reichte ihr den Kelch. Sie wehrte sich nicht. Gehorsam leerte sie ihn und legte sich auf das zerwühlte Laken. Sie wirkte so alt, mit Augen, die viel zu groß für das hohlwangige Gesicht waren, und Falten, die sich um ihren einst so weichen Mund herum in die Haut gegraben hatten. Dabei war sie erst dreiunddreißig Jahre alt, immer noch eine junge Frau, doch in diesem Moment sah sie aus, als hätte sie schon tausend Jahre in dieser einsamen Festung gehaust.
»Ruht jetzt«, redete ich ihr zu. »Ich bin bei Euch und werde Euch nicht verlassen. Ruht, und alles wird gut.«
Ihre Lider flatterten. Mit leiser Stimme begann ich zu singen. Es war ein Schlaflied, das jedes Kind kannte. »Duerme, pequeña mía; duerme feliz. Los lobos aúllan fuera, pero aquí me tienes a mí. Schlafe, mein Kleines, schlafe sanft. Draußen heulen die Wölfe, aber hier drinnen bin ich bei dir.«
Die Augen fielen ihr zu. Einmal zuckte sie noch, doch der Trank wirkte bereits. Sie murmelte etwas. Ich beugte mich ganz nah über ihren Mund.
»Ich habe es für euch getan«, flüsterte sie. »Für dich und Alfonso. Ich habe Luna umgebracht, um euch zu retten.«
Regungslos saß ich an ihrer Seite, wieder zurückversetzt in jene Nacht vor so langer Zeit, als wir aus Valladolid geflohen waren. Ich hatte nie über die Ereignisse nachgedacht, die zu unserem Exil geführt hatten, doch jetzt bekam ich eine Ahnung von dem schrecklichen Geheimnis, das die Seele meiner Mutter jeden Tag aufs Neue zerriss.
Ich sah ihr beim Schlafen zu. Ich wollte für sie beten. Ganz gewiss hatte sie unrecht. Gott hörte uns immer zu, vor allem in unseren dunkelsten Stunden. Doch statt mich an Ihn zu wenden, grübelte ich darüber nach, ob vielleicht auch für mich irgendwann ein Tag kommen mochte, an dem ich zu einer solchen Tat getrieben wurde, an dem ich dazu gezwungen sein würde, das Undenkbare zu tun, um danach bis in alle Ewigkeit von meinen Dämonen verfolgt zu werden.
Beatriz wartete vor der Tür. Als ich herauskam, stand sie auf; mein Bruder leistete ihr Gesellschaft.
»Ich habe gehört, dass es Mama nicht gut geht«, sagte er. »Ist sie …?«
Ich nickte. »Es war schlimm. Wir müssen sie ablenken, immer in ihrer Nähe sein. Sie braucht uns jetzt.«
»Natürlich. Was immer du sagst«, meinte er. Doch ich wusste, dass er sich lieber von ihr fernhalten und sich mit seinen Waffen und Pferden beschäftigen würde. Alfonso hatte nie verstanden, warum unsere Mutter dieses Verhalten zeigte, warum ihre innigen Umarmungen und ihre Fröhlichkeit von einem Moment auf den anderen in Raserei umschlagen konnten, so wild wie die Stürme, die im Winter über die Ebene heulten. Immer hatte ich seine Angst vor ihr gespürt und mein Möglichstes getan, um ihn vor ihren Anfällen zu schützen. Als er sich nach einem unbeholfenen Kuss auf meine Wange entfernte und die Treppe hinunter ins Freie lief, stellte ich mich Beatriz’ forschendem Blick. Der zerknüllte Brief lag in meiner Tasche wie ein Stein.
Sie werden kommen. Sie werden Alfonso und dich fortbringen.
Obwohl alles in mir sich dagegen sträubte, war mir klar, dass sich diese Prophezeiung bewahrheiten konnte.
Wir mussten Vorbereitungen treffen.
Kapitel 3
Wie um meine Aufregung Lügen zu strafen, vergingen die folgenden Tage ohne besondere Vorfälle. Ich verbarg den Brief des Königs in einer Truhe in meinem Gemach. Natürlich erkundigte sich Beatriz in einem fort danach, bis ich die Fragerei nicht mehr aushielt und sie ihn lesen ließ. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben verschlug es ihr die Sprache. Völlig verdutzt starrte sie mich an. Ich ermunterte sie nicht, ihre Meinung zu äußern – zu sehr war ich mit meinen eigenen düsteren Vorahnungen beschäftigt, dass uns unumkehrbare Veränderungen bevorstanden.
Ich widmete mich voll und ganz meiner Mutter. Krisen oder Anfälle traten nicht mehr auf. Auch wenn sie weiterhin viel zu dünn und bleich blieb und wie ein Vogel in ihren Mahlzeiten herumstocherte, freute sie sich stets, wenn Alfonso und ich sie nachmittags besuchten.
Es rührte mich zu erfahren, dass Alfonso sich Mühe gegeben und ein portugiesisches Lied gelernt hatte, das er mit Begeisterung, wenn auch wackeliger Stimme vortrug. Musisch veranlagt war mein Bruder nicht unbedingt, doch als er meiner Mutter die Verse aus ihrer Heimat vorsang, konnte ich sehen, wie ihr Gesicht weicher wurde und seine verblühte Schönheit zurückgewann. In ihre völlig veraltete Hofrobe gehüllt, die Finger befrachtet mit matt gewordenen Ringen, klopfte sie den Rhythmus auf den Armlehnen ihres Stuhls mit, während die Füße unter dem Saum ihrer Robe lautlos die komplizierten Schrittmuster des Tanzes ausführten. Sie hatte ihn einst meisterhaft beherrscht, als sie, die mächtigste und begehrteste Frau am ganzen Hof, über die Parkette der festlich geschmückten, großen salas geschwebt war.