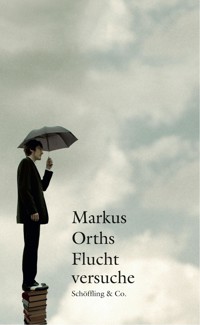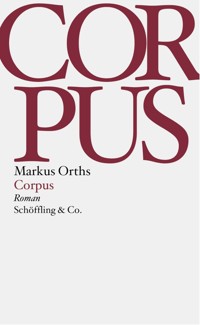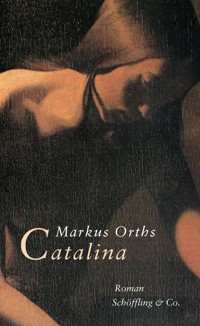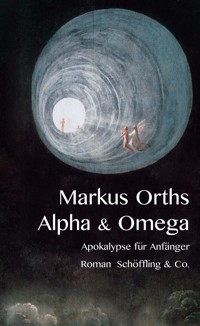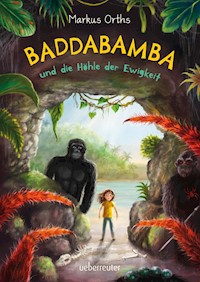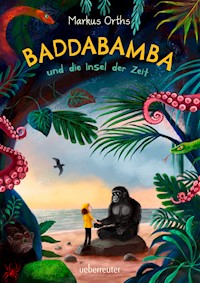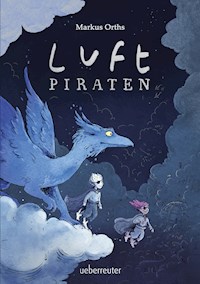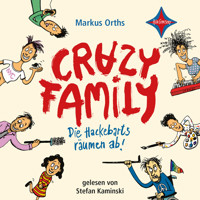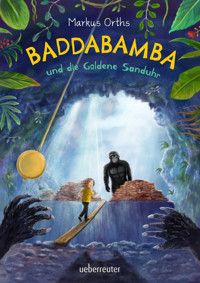Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Markus Orths mitreißender Roman über die Schriftstellerinnen Mary Shelley und Claire Clairmont – eine sprudelnde Geschichte über die Literatur, das Leben und die Liebe Nach einer wahren Begebenheit: Die Stiefschwestern und Schriftstellerinnen Mary Shelley und Claire Clairmont lieben Percy. Und Percy liebt Mary & Claire. An seiner Seite entfliehen die Frauen der Londoner Enge. Sie wollen atmen, reisen, lesen, wollen verrückt sein, lieben und schreiben. Und sie nehmen den schillerndsten Popstar der Literatur Anfang des 19. Jahrhunderts in ihre Gemeinschaft auf: den jungen Lord Byron. Bei heftigen Gewittern treffen sie sich am Genfer See. Opiumberauscht schlägt Byron um Mitternacht ein Spiel vor: Wer von uns schreibt die schaurigste Geschichte? Für Mary & Claire wird nach dieser Nacht nichts mehr so sein wie zuvor. Ein mitreißender Roman, der Geschichte lebendig macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Nach einer wahren Begebenheit: Die Stiefschwestern und Schriftstellerinnen Mary Shelley und Claire Clairmont lieben Percy. Und Percy liebt Mary & Claire. An seiner Seite entfliehen die Frauen der Londoner Enge. Sie wollen atmen, reisen, lesen, wollen verrückt sein, lieben und schreiben. Und sie nehmen den schillerndsten Popstar der Literatur Anfang des 19. Jahrhunderts in ihre Gemeinschaft auf: den jungen Lord Byron. Bei heftigen Gewittern treffen sie sich am Genfer See. Opiumberauscht schlägt Byron um Mitternacht ein Spiel vor: Wer von uns schreibt die schaurigste Geschichte? Für Mary & Claire wird nach dieser Nacht nichts mehr so sein wie zuvor. Ein mitreißender Roman, der Geschichte lebendig macht.
Markus Orths
Mary & Claire
Roman
Hanser
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Markus Orths
Impressum
Inhalt
Saint Pancras & Skinner Street
Ramsgate School & Broughty Ferry
Field Place & Syon House
Newgate Prison & Cliffs of Dover
Hôtel de Vienne & Chalet de Troyes
Church Street & Arabella Road
Bishopsgate & Lynmouth Bay
Folly Castle & Piccadilly Terrace
Blizzard Pass & Lac Léman
Maison Chapuis & Villa Diodati
Bagnacavallo & La Spezia
Antella & Saint Peter’s
Saint Pancras & Skinner Street
Das Grab rührt sich nicht vom Fleck. Der mächtige Stein ähnelt einer Truhe. Still und in sich gekehrt. Noch fehlt das Moos. Es ist ein fröhlicher Friedhof: Wärme liegt auf den Wegen, überall tschilpt es, Büsche und Bäume stehen in Blüte, ein frühes Blatt segelt zu Boden und Pollen tanzen im Licht.
Etwas nähert sich, ein feinleises, wehendes Zetern, das lauter wird, ein Säugling schreit, auf dem Arm eines Mannes, der sich, schwarz gekleidet, durch Äste schiebt, wohl abgekommen vom Weg. Der Mann bleibt stehen, schaut zum Stein, will sprechen, kann es nicht. Seine Tränensäcke sind geschwollen, und in den Augen stecken Splitter einer Fassungslosigkeit. Die ausgehobene Erde ist getrocknet und staubig, auf dem Grabhügel türmen sich Kränze und Blumen in Hülle und Fülle, bereits im Welken begriffen. Das Kind hört nicht auf zu schreien. Ein Arm des Mannes zuckt, will hoch zum Hut, doch weiß er nicht, wie man einen Säugling trägt mit nur einer Hand. Er schwitzt. Das Kind auch. Die Sonne steht hoch über ihnen. »Mary«, sagt der Mann. »Ich wollte dir nur zeigen, wo sie liegt.« Der Säugling schreit und windet sich. Es hat keinen Zweck. Der Mann deutet eine Verbeugung an, murmelt ein paar Worte, entfernt sich, wählt jetzt den Kiesweg, es wird ruhiger, das Geschrei verweht, und frische Stille zieht ein.
Blätter fallen. Bald ist die Erde bedeckt vom Schnee, der eilig schmilzt. Schon stehlen sich erste Stängel ins Freie, werden wieder gerupft. Eine Mütze Moos wächst in die Zeit: So wird dem Grabstein nicht kalt am Kopf.
Stimmen, noch leise. Der Vater erscheint, auf dem Kiesweg diesmal, er trägt einen braunen Anzug, junge Falten im Gesicht. Seine Tochter an der Hand ist inzwischen ein stilles Mädchen, vier oder fünf Jahre alt, die Haare schimmern rötlich unter der Haube, hie und da wachsen Sommersprossen im blassen Gesicht, zart ist das Kind, ernst und nachdenklich, ein beständiges Grübeln auf der Stirn. Jetzt sind sie da. Das Mädchen streichelt kurz das Moos auf dem Grabstein. Das tut sie jedes Mal. Der Vater darf das Moos auf keinen Fall entfernen lassen. Jetzt nimmt er seinen Hut ab und schweigt eine Weile.
»Deine Mutter«, sagt der Vater, »war eine besondere Frau.«
»Das weiß ich, Papa.«
»Als du zum ersten Mal hier warst, Mary, hast du geschrien. Und frag nicht, wie. Überhaupt, du hast ständig geschrien, noch Wochen, Monate nach der Geburt. Lies mal vor, was da steht.«
Mary streckt ihre Hand aus. Mit den Fingerkuppen tastet sie die Inschrift ab. »MARY«, liest sie. »WOLL-STONE-CRAFT. Papa? Hat Mama Wolle gemacht? Oder Steine?«
Der Vater streicht Mary über den Kopf. »So«, sagt er, »habe ich das noch nie betrachtet. Aber vielleicht hast du recht: Mama wollte aus Steinen Wolle machen. Wollte Hartes aufbrechen zu etwas Weichem. Das ist gut, Mary. Mama hätte sich gefreut. Ich sehe sie lächeln. Aber merk dir: Ihren Namen schreibt man mit zwei ›l‹! ›Wool‹ dagegen mit zwei ›o‹. Lies weiter, bitte.«
»GODWIN«, sagt Mary, denkt eine Weile nach und sagt dann: »Gewinnt Gott eigentlich immer? Oder kann der Mensch auch mal gegen ihn gewinnen?«
Der Vater kniet sich zu Mary, legt ihr die Hände an die Schultern, sieht sie an. Eine Weile geschieht nichts. Mary weicht dem Blick nicht aus. Dann fragt sie: »Hast du Mama sehr geliebt?«
»Das habe ich, Mary.«
»Mehr als meine Stiefmutter?«
»Du sollst sie so nicht nennen, Mary«, sagt der Vater und steht wieder auf.
»Wie soll ich sie denn dann nennen?«
»Weißt du doch. Nenn sie ›Mama‹. Sie würde sich freuen.«
Mary zieht die Nase hoch: »Meine Mama liegt hier.«
»Dann sag wenigstens ›Mary Jane‹.«
»Alle heißen Mary. Ich heiße Mary. Mama heißt Mary. Meine Stiefmutter heißt Mary, gut, Mary Jane, aber trotzdem. Alle heißen Mary. Ist das nicht komisch?«
Mit einem spektakulären Auftritt hat Mary Jane Clairmont William Godwins Leben geentert, kurz nach ihrem Einzug ins Polygon, jenem halbkreisförmigen Block neu gebauter hoher Häuser in Somers Town bei London. Mary Jane wusste genau, was sie wollte: einen Mann und eine sichere Bank für ihre Tochter. Und Mary Jane wusste auch: Bei Schriftstellern aller Art herrscht meist die blanke Eitelkeit. Als sie William Godwin zum ersten Mal sah, strahlte Mary Jane, legte die flache Hand an die Stirn und rief ihm zu: »O Gott! Ist das die Möglichkeit! Sie sind doch nicht etwa William Godwin? Der unsterbliche William Godwin! Dessen Bücher ich bewundere wie sonst nichts auf der Welt!«
William Godwin schaute überrumpelt drein. Er wusste nicht: War das jetzt Ernst oder Ironie? Er hoffte auf: Ernst. Denn nach dem Tod seiner Frau Mary Wollstonecraft hatte William Godwin — wenn auch erfolglos — verschiedenen Frauen Heiratsanträge gemacht, einfach weil er glaubte, Kinder bräuchten die zarte Hand einer Mutter. Daher winkte William jetzt der neuen Nachbarin zurück, nickte geschmeichelt, und ein paar Monate später malte William ein großes »X« in sein Tagebuch, zum Zeichen dafür, dass er mit Mary Jane Clairmont erstmalig den Beischlaf vollzogen hatte. Für seine Tagebücher hatte Godwin — nach einem langen Vormittag intensiven Schreibens — nicht mehr viele Wörter im Köcher und beschränkte sich aufs Wesentliche. Beispielsweise hatte William nur »Panc« ins Tagebuch gekritzelt, an dem Tag, da er Mary Wollstonecraft heiratete: in Saint Pancras. Und an ihrem Todestag hatte William eine ganze Seite durchgestrichen, einfach so, mit langen, vertikalen Strichen. Jetzt also ein »X«, der letzte Buchstabe dieses ominösen Körperwortes: Schon zog Mary Jane bei den Godwins ein, kein langer Weg von nebenan. Und Mary Jane Clairmont kam nicht allein. Auch sie brachte eine Tochter mit. Acht Monate jünger als Mary. Das Mädchen hieß: Clara Mary Jane Clairmont. Noch wurde sie »Jane« genannt. Oder: »die Wilde«.
William geht los, doch Mary folgt ihm nicht. Sie bleibt beim Grab ihrer Mutter, Kopf im Nacken, Füße verwurzelt im Dreck, ruft: »Sag ehrlich: Hast du oder hast du nicht?«
»Was meinst du, Mary?«
»Mama mehr geliebt als Mary Jane?«
»In der Liebe gibt es kein Mehr oder Weniger. Entweder man liebt oder man liebt nicht.«
»Nennt man das Ausrede, Papa?«
»Komm jetzt, Mary! Es ist Zeit!«
William meint es genau so: Es ist Zeit, die Zeit ist, sie entsteht in dem Augenblick, in dem man in sie springt, Zeit ist das Kostbarste für ihn, Zeit bestimmt alles andere. William Godwin ist ein sparsamer Mensch, er hätte die Zeit am liebsten in eine Socke gestopft, unters Kissen geschoben und jeden Morgen nachgezählt, ob noch alle Tage da sind, die ihm zustehen seiner Meinung nach. Es gibt eine Regel im Haus der Godwins: Die Zeit des Schreibens ist heilig. Bis zum Mittagessen haben Ideen Vorrang: William muss Gedanken aus dem Kopf pflücken oder meißeln und anschließend zu Papier bringen. Die Kinder haben sich ruhig zu verhalten. Erst nach dem Mittag liest er ihnen vor, und Mary lauscht mit großen Augen und zuckt kein einziges Mal.
Wind wirbelt die Jahre fort, der Stein verwittert, das Wetter kerbt, in der Tiefe welkt eine Frau zum Skelett. Nacht folgt auf Tag, Tag folgt auf Nacht, immer neue Perlen einer immer gleichen Schnur, es ist das Einzige, was man über die Zeit sagen kann: Sie ist unbestechlich.
Jetzt ein Geräusch. Schnelle Schritte. Ein Rennen, noch ist unklar, aus welcher Richtung, ein Keuchen nähert sich, schon ist sie da, querfeldein gerannt: Mary. Sie hält sich die Seiten, neun Jahre jung, rot im Gesicht, außer Puste, fällt auf die Knie, in die Erde, nah beim Stein, wühlt die Hände ins Schwarze, als wolle sie Mutter begrüßen, lässt die Finger auskühlen, holt endlich zwei Handvoll Erde heraus, zerreibt sie, der Dreck bröselt aufs Grab, unter den Nägeln bleibt Schwarzes. Immer wenn sie hier ist, tunkt sie die Hände in die Mutter. Sie tut es, seitdem sie weiß: Das Schwarze unter den Fingernägeln heißt »Trauerränder«.
»Mama«, keucht Mary, ihr Atem holt sie langsam wieder ein. »Da ist was passiert. Gestern. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Samuel war da, der Dichter. Jane & ich, wir haben gewusst: Der wird wieder erzählen! Und wir wollten zuhören, Jane & ich, wir haben uns aus dem Bett gestohlen, sind durchs Haus geschlichen, haben uns versteckt, hinter der Couch in Papas Arbeitszimmer. Samuel! Seine Stimme! Seine Erscheinung! Seine wüsten, langen Haare. Schon fängt er an. Als hätte er nur auf uns gewartet! In seinem Gedicht, da taucht ein Alter Seemann auf, und der Alte Seemann, der hält einen Mann an, einen Hochzeitsgast, einfach so: hält der ihn an. Mit seiner knochigen Hand. Einen von dreien hält der an. Sagt Samuel, nein, er singt es fast. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, Mama: einer von dreien. Aber ich weiß, dass ich auch eine von dreien bin. Weil ich einfach zuhören musste! Weil das Gedicht mich angehalten hat! Kann das ein Dichter, Mama? Einen anderen anhalten? Dass man einfach zuhören muss? Nur durch Worte? Und auf den Worten reiten die Bilder? Pass auf. Die Geschichte geht so. Der Alte Seemann fährt aufs Meer mit seinem Schiff und der Crew. Bald kommt ein Sturm auf, Mama, und mit seinen Flügeln … Ist das nicht schön!? Dass ein Sturm Flügel haben kann!? Mit seinen Flügeln packt der Sturm das Schiff und bläst es nach Süden, und das Schiff jagt dahin über die Wellen. Jetzt wird es plötzlich kalt, Mama, Schnee und Nebel, immer schlimmer wird es, hoch türmt sich das Eis, stell dir das vor, die kalten Berge knirschen vorbei, kommen näher, keilen sie ein, es wird kälter und kälter, it cracked and growled, and roared and howled, hörst du das, Mama, hörst du, wie das Eis in den Wörtern knackt? Wie der Wind darüberfegt und heult? Sie sind gefangen im Eis, eingefroren, das Schiff kann nicht weiter. Da segelt ein Albatros herbei, Mama, ein großer, fast weißer Vogel, und die Seeleute locken ihn mit Rufen und Futter, der Vogel ist das Einzige, was lebt an diesem Ort aus Eis, keiner weiß, woher der Vogel kommt, aber er bleibt bei den Seeleuten und fliegt um das Schiff herum, und das Eis bricht und schmilzt, der Vogel rettet sie, der Albatros wandelt Hartes in Weiches, Mama, Eis zu Wasser, ein Südwind kommt auf, und fort werden sie geweht mit ihrem Schiff, ins Warme hinein, der Vogel fliegt um sie herum, alle sind glücklich, und dann greift der Alte Seemann zur Armbrust und schießt ihn tot, den Albatros.«
Mary hält inne. Sie schluchzt.
»Warum?«, ruft sie. »Warum tut er das? Der Vogel hat sie gerettet. Und er schießt ihn tot!? Ich verstehe das nicht, Mama. Mein Herz läuft an. Jede Zeile des Gedichts tanzt so schön und hüpft wie die Wogen, die Wellen, wie das Schiff auf dem Wasser, und plötzlich: I shot the Albatross. Der Satz trifft mich wie ein Pfeil, Mama. Der Albatros fällt aufs Deck, tot. Aber es geht weiter! Ich bin kaum mitgekommen. Ich habe keine Zeit gehabt für all diese Bilder. Mein Kopf wie unter Wasser. Die anderen Matrosen klagen den Alten Seemann an. Wie konntest du den Vogel töten, der den Wind brachte und das Eis schmelzen ließ!? Und es legt sich grausame Stille übers Meer. Kein Hauch, kein Wind, kein Lüftchen. Day after day, day after day, we stuck, nor breath nor motion; as idle as a painted ship upon a painted ocean. Und dann kriechen schleimige Kreaturen aus dem Meer, mit ekelhaften Beinen, Todesfeuer und Hexenöl und ein Geist, der den Männern gefolgt ist, unterm Schiff, und die Matrosen können nicht mehr sprechen, ihre Münder ausgetrocknet, staubig, alle hassen den Alten Seemann, und sie hängen ihm den toten Albatros um den Hals. Weiter, Mama, immer weiter. Schon sieht der Alte Seemann ein Segel, es nähert sich ein Schiff, und das wird gruselig jetzt, denn auf dem Schiff, da hockt der Tod, du kennst ihn, Mama, und an seiner Seite sitzt eine Frau. Und diese Frau heißt ›Leben-im-Tod‹. Was bedeutet das? Ewiges Leben? Die beiden würfeln jetzt, Tod gegen Leben-im-Tod. Ich weiß nicht, was der Einsatz ist. Ich hab das nicht verstanden. Die Frau Leben-im-Tod gewinnt. Es sterben sofort alle Seeleute, nur der Alte Seemann nicht. Also lebt der Alte Seemann weiter im Tod? Aber wo? Wie kann man im Tod weiterleben? Lebst du auch weiter im Tod, Mama? Wo kann ich dich treffen? Wie kann ich dich sehen? Oder hören? Ich sitze hinterm Sofa, und ich verstehe es nicht, aber ich sehe alles klar und deutlich, ich sehe die schleimigen Kreaturen und die Windstille und das Eis und den Albatros und die Armbrust und den Pfeil und die Männer und das Schiff und den Tod und die Frau Leben-im-Tod, und dann spüre ich sie, Mama, ich spüre, wie diese Frau wirklich neben mir steht, die Frau Leben-im-Tod, die jedes Menschen Blut vereist: mit ihrem Kälteschrei. Die Frau zieht mich am rechten Ohr, und sie zieht Jane am linken Ohr, und wir blicken auf, und ich komme zu mir wie aus einem Traum, und das ist nicht die Frau Leben-im-Tod, die uns an den Ohren zieht, nein, das ist Janes Mutter. Stiefmütter sind schlimm. Sie hat geschimpft. Sie hat zu Papa gesagt: Die zwei gehören ins Bett. Sofort. Ich hab nicht mitbekommen, wie das Gedicht ausging, Mama. Ich hab im Bett gelegen und kein Auge zugetan. Beim ersten Sonnenstrahl bin ich aufgesprungen und zu dir gelaufen. Jetzt geht’s mir besser. The Rime of the Ancient Mariner. So heißt das Gedicht. Es ist, es ist, es ist das Schönste, Mama, das Allerschönste, was ich jemals gehört hab in meinem Leben. Nichts würde ich lieber, als auch so was zu schreiben. Ich hab’s schon mal versucht. Heimlich. Zu schreiben. Aber Mädchen können es nicht. Sagen alle. Ja, ich weiß, du denkst anders. Und ich will wissen, warum das so ist. Ich verspreche dir jetzt etwas, Mama. Wenn ich morgen komme, bringe ich dein Buch mit. Ja? Dann lese ich dir vor. Aus deinem eigenen Buch, Mama. Dein Buch ist ein Schwamm, vollgesogen mit Gedanken. Sie sind so dicht, tief und schwer. Ich will dein Buch gründlich auswringen. Am besten tu ich’s hier. Dann sickern die Gedanken zwischen deine Blumen. Zurück zu dir.«
Moos wächst langsam und barfüßig, krallt sich nicht fest, schwitzt und schmiegt sich an, locker, lose. Mary geht hin und streichelt das Moos. Anfangs ist Mary kleiner als der Grabstein. Für kurze Zeit ist sie auf Augenhöhe. Jetzt ist Mary dem Stein über den Kopf gewachsen, und sie muss ihre Hand senken zum Moos. Es ist Marys zehnter Geburtstag.
»Von heute an gibt es immer zwei Zahlen für mich«, sagt sie laut. »Keine einzelne mehr. Eine einzelne Zahl ist einsam. Zwei können sich an den Händen halten, weißt du?«
Mary sitzt in der Erde.
Auf Mutter stehen zwölf Ziffern.
Geboren am 27. April 1759.
Gestorben am 10. September 1797.
Die letzten sechs Ziffern sind grausam. In ihnen steckt ein Muster: 101 und 797. Etwas, das wiederkehrt. Die 1 kehrt wieder. Die 7 kehrt wieder. Eine Schleife. Etwas Beharrliches. Ein steter Gedankentropfen, der nie aufhören wird, Mary zu höhlen.
Der 10. September 1797 ist Mutters Todestag.
Und Marys Geburtstag ist der 30. August 1797.
Am elften Tag nach Marys Geburt ist Mutter gestorben. Fieber. Kindbettfieber. Oder Wochenbettfieber. Die Worte schneiden Mary hart ins Fleisch. Sie bedeuten nichts anderes als: Mary hat ihre Mutter auf dem Gewissen. Mary ist schuld an Mutters Tod. Mary denkt: Gäbe es mich nicht, lebtest du noch. Gäbe es mich nicht, schriebest du noch. Gäbe es mich nicht, könntest du der Welt neue Werke schenken. Dein Kopf war schneller als andere Köpfe, Mutter. Ich habe dich zum Schweigen gebracht. Wer bin ich? Niemand. Tochter, Monster, Tochtermonster. Ich werde deinen Platz nicht einnehmen können, ich werde nichts Neues schreiben können, nichts von Wert. Aber mir bleibt keine Wahl, ich muss es versuchen.
Eine Stimme ertönt neben Mary. Sie kommt von der rechten Seite, glockenhell, sie schwirrt so schön und singt, ohne zu singen. Die Stimme gehört Jane, genannt: die Wilde: Marys Stiefschwester: die Tochter von Mary Jane Clairmont.
»Mach dir keinen Kopf«, sagt Jane.
Die fröhliche Jane: Sie plappert so gern. Ist längst Marys beste Freundin und beste Feindin zugleich. Eine Stiefschwester sondergleichen. Mal Stief. Mal Schwester. Mit Jane kann Mary lachen und spielen und Zeit verbringen. Mit niemandem lässt sich so gut streiten und rangeln. Jane ist ein leuchtend-lautes Mittelpunktkind, ein gespaltenes Mädchen: Sie konnte mit drei Jahren schon ihren Willen durchsetzen mittels Wutanfällen aller Art, bei denen sie sich schreiend hinwarf und mit ihren Fäusten auf den Boden trommelte. Andererseits quietscht sie gern, ist albern, kiekst und kichert, sucht die Nähe anderer Kinder. Jane ist acht Monate jünger als Mary, hat sich diebisch gefreut über das unverhoffte Geschenk einer älteren, aber nicht zu alten Schwester, die ihr irgendwie immer einen Schritt voraus ist, etwas, das Jane mag und schrecklich findet zugleich, zerrissen zwischen dem Ehrgeiz, Mary einzuholen, vielleicht zu überholen, und einer tiefen, trägen Gemütlichkeit, sich von der Stiefschwester zeigen zu lassen, was man wissen muss im Leben. Alles hüpft an Jane: Wenn sie geht, hüpft sie; ihre schwarzen Locken hüpfen; das Lächeln auf ihren Lippen hüpft; ihre blitzhellen Augen hüpfen. Manchmal wird aus dem Hüpfen ein Rennen: mit den Beinen, mit dem Herzen. Sie ist wild wie ein Pferd. Und kann auch stolzieren. Sie rückt sich gern ins rechte Licht. Das hat sie von ihrer Mutter. Jane weiß nicht immer, was sie will, aber dass sie etwas will, weiß sie genau. Sie beherrscht Pose und Übertreibung, kann umgarnen und mitreißen, Jane ist mit einem Wort einfach: »clairmont«. Ihren Nachnamen hat Mary zum Adjektiv geformt. »Clairmont«, das bedeutet: selbstbegeistert, egozentrisch, theatralisch, willensstark, ellbogenbereit, zugleich träge, zweifelnd, selbstzerrissen, die eigene Fassade als Fassade durchschauend, stets Hilfe suchend, und dem Glück springt sie hinterher wie einem Schmetterling. Ach, sagt Mary manchmal, sei doch nicht immer so schrecklich clairmont.
Jetzt sitzt Jane neben ihr.
»Mach dir keinen Kopf«, sagt Jane noch einmal.
Hand in Hand sitzen sie dort.
»Ich mach mir keinen Kopf«, sagt Mary.
»Siehst immer aus wie siebzehn Tage Regenwetter.«
»Das Grab«, sagt Mary. »Ein Schweigen, gemeißelt in Stein.«
»Wollen wir wetten?«, ruft Jane, die ungern hierherkommt und es nie lange aushält, weder das Schweigen noch Marys Kellerstimmung namens Melancholie. »Wetten, ich bin schneller am Tor?«
»Ich will noch bleiben.«
»Die Erde ist kalt, Schwesterchen.«
»Du kannst ja Kniebeugen machen.«
Jane seufzt. »Wie viele?«, fragt sie.
»Dreißig?«
Und Jane fängt an.
Währenddessen rinnen Mary Tränen über die Wangen, einfach so, sie kann nichts dafür, die Augen laufen aus, es ist nicht der Wind, es ist die Traurigkeit, die in ihr sitzt.
»Ich vermisse unser altes Haus!«, flüstert Mary.
»Was sich nicht ändern lässt, musst du schlucken!« Jane gähnt und keucht zugleich. »Wirst dich schon noch dran gewöhnen!«
»An die Skinner Street!? Nie, Jane! Niemals!«
Der Umzug war ein harter Schlag für Mary. Vom Polygon in die Skinner Street. Vom Himmel in die Hölle. Den glänzenden Neubau eintauschen gegen ein marodes Fünf-Etagen-Haus? Mary verstand das nicht. Aus Geldmangel? Dann lieber mehr arbeiten, oder? Kannst du nicht was anderes schreiben, Papa? Etwas, das sich besser verkauft? Diese Frage hätte Mary lieber nicht gestellt: Papa schimpfte scharf wie nie, rief etwas von intellektuellem Anspruch und Hass auf Schlamperei, er mache keine Zugeständnisse und lebe für die Genauigkeit. Dann knallte er die Tür. Mary hatte wohl einen wunden Punkt getroffen.
Treibende Kraft für den Umzug war Marys Stiefmutter in ihrer Enttäuschung darüber, dass William kaum noch Geld verdiente und die reichen Besucher ausblieben, die armen sich dagegen in seinem Büro drängelten und die ganze Nacht bis zwei Uhr disputierten, so lautstark manchmal, dass Mary Jane und die Kinder aus dem Schlaf fuhren. Mary Jane hatte zwei Jahre vor dem Umzug ihr erstes Kinderbuchgeschäft eröffnet, einfach, weil irgendwer hier ja das Geld verdienen müsse, wie sie gern betonte. Das Geschäft lag in der Hanway Street, ein kleiner, zugiger, unschöner Laden, zugleich ein Kinderbuchverlag. Mary Jane akquirierte Texte, sichtete Manuskripte, übersetzte unermüdlich und vor jeder Veröffentlichung las sie den Kindern die möglichen Kinderbücher vor. Mary aber hasste Kinderbücher. Was wollte sie mit diesen Kinderbüchern, wenn es Coleridge gab? Was war ein mümmelnder Hase gegenüber einem erschossenen Albatros?
Im Erdgeschoss der Skinner Street fand Mary Jane endlich einen Laden, der den gewachsenen Bedürfnissen ihrer Kinderbuchgeschäfte besser entsprach. Daher der Umzug. Für den Buchladen eine Verbesserung, fürs Wohnen eine Verschlechterung. Hatten Mary & Jane vom obersten Fenster im Polygon noch den idyllischen River Fleet sehen können, so schauten sie jetzt von der Skinner Street auf die Galgen von Tyburn. Wobei das nicht unbedingt ein Makel war, denn Galgen sind spannend. Vom fünften Stockwerk aus konnten die Mädchen den Hinrichtungsplatz mit Holzgerüst erkennen, dort, vorm Old Bailey, dem zentralen Strafgerichtshof, kaum hundert Meter entfernt. Bei jeder Hinrichtung warteten sie darauf, dass der Henker den Hebel umlegte, doch Mary schloss immer die Augen, kurz bevor es geschah.
Mary stand jetzt auf, schlug Erde aus dem Kleid und fragte ihre Schwester: »Weißt du, was ein Skinner ist?«
»Klar weiß ich, was ein Skinner ist!«
»Und was?«
»Sag du zuerst!«, rief Jane.
»Skinner heißt: Maultiertreiber.«
»Ich dachte: Hautabzieher?«
»Das auch.«
»Ist das ein Gerber?«
»Skinner heißt auch Betrüger. Oder Schwindler.«
»Wetten, du kennst eine Geschichte, Schwester? Die Geschichte von einem Skinner? Gib’s zu!«
»Woher weißt du das?«, rief Mary.
»Deine Geschichten stehen dir ins Gesicht geschrieben.«
Mary wurde ernst. Konzentriert. In Vorfreude auf das, was nun geschehen würde: erzählen, einfach nur erzählen.
»In meiner Geschichte«, sagte Mary, »ist Skinner ein Name. Frank Skinner. The Skinner of London.«
Jane war überaus empfänglich für Gruselgeschichten aller Art, und sie rief: »Muss das sein, Mary? Hier?«
»Frank Skinner war ein Gerber, er lebte im Mittelalter«, raunte Mary. »Er liebte seinen Beruf, das Gerben, er zog die Haut von Tieren ab, ritsche-ratsche mit dem Messer, und vorher musste er das blutige Gekröse entfernen, das schmierige Gedärm!«
»Igitt!«
»Doch kein Mensch nahm ihn wahr. Alle Menschen kauften Felle bei ihm, aber niemand sah ihn wirklich an. Alle verachteten ihn. Sie ekelten sich. Weil er so einen schmutzigen Beruf hatte.«
»Und dann?«, fragte Jane.
»Dann passiert etwas Plötzliches! Das ist immer spannend in Geschichten. Wenn etwas Plötzliches passiert. Mit dem niemand rechnet. Das muss schnell gehen. Wie beim Ancient Mariner. Frank Skinner denkt sich eine Zahl aus. Sagen wir: sieben!«
»Wieso sieben?«
»Wieso nicht sieben?«
»Könnte das auch vier sein?«
»Ja. Ist aber sieben. Und der siebte Kunde, der an diesem Tag den Laden betrat, er wusste es noch nicht, aber er war forfeit.«
»Was heißt ›fortfeit‹?«
»Es heißt ›des Todes‹.«
»Und warum sagst du nicht ›des Todes‹?«
»Weil ›forfeit‹ besser klingt. Hörst du das nicht? Also: Frank Skinner wetzte sein Messer, und als der siebte Kunde erschien, da sprang er aus dem Schatten und stach ihm sieben Mal ins Herz.«
»Mary!«, rief Jane. »Warum sieben Mal?«
»Das nennt sich Symmetrie.«
»Ich weiß, was jetzt passiert!«, rief Jane und sprang auf. »Ich weiß, dass er ihm die Haut abzieht, Mary! Das ist doch klar! Er heißt Skinner. Und er ist ein Gerber. Ein Hautabzieher. Also zieht er dem toten Mann die Haut ab!«
»Jane! Das ist meine Geschichte!«
»Und was macht er mit der Haut des anderen?«, rief Jane und sprang kurz in die Luft. »Na, klar! Er zieht sich die Haut des anderen über die eigene Haut, oder?«
»Jane!! Hör auf!!«
»Und er wächst in die Haut des anderen hinein, oder? Und er lebt ein Leben an Stelle des anderen, oder?«
Mary rieb sich den Dreck ab und warf die Stöcke weg.
»Hast du dir das selber ausgedacht?«, fragte Jane.
»Ja«, rief Mary wütend. »Und du bist Frank Skinner, Jane! Du würdest gern in meiner Haut stecken! Du bist nur neidisch!«
»Arrogante Zicke!!«
Schon flogen Dreckklumpen in Gesichter, Mary stürzte sich auf Jane, Jane stürzte sich auf Mary, beide balgten eine Weile überm Grab. Mary kämpfte gänzlich stumm, Jane zugleich mit bitteren Worten, sie äffte die vielen strahlenden Besucher im Hause Godwin nach: »Ach Gott, diese Mary! Schau nur! Die Tochter vom göttlichen William Godwin und der einzigartigen Mary Wollstonecraft! Sie muss doch einfach ein Genie werden! Sie ist geradezu präpariert dazu! Geboren im selben August, als der Komet am Himmel flog.«
Janes Fingernagel schlitzte plötzlich die Haut in Marys Nacken, Blut quoll, beide hielten inne, schauten sich an, ein wenig beschämt und erschrocken über sich selbst.
Da trat der Geist zwischen sie, nahm beide Mädchen an einem Arm und zog sie vom Boden hoch. Der Geist hauchte: »Bitte!« Die Mädchen starrten ihn an, Mary fragte sich, wieso der Geist plötzlich hier war, am Grab. Der Geist. So nannten sie Marys Halbschwester Fanny Imlay. Sie war drei Jahre älter als Mary, fiel nie auf, war kaum zu sehen. Am liebsten durchstreifte Fanny Wiesen und Felder, warf Steine in den Fluss, kletterte auf Friedhofsbäume, hielt sich nicht gern drinnen auf, weder im Polygon noch in der Skinner Street, nur draußen fühlte sie so etwas Ähnliches wie Fröhlichkeit, drinnen dagegen kam sie sich vor wie ein überzähliges Möbelstück.
»Wo kommst du denn jetzt her?«, fragte Mary.
»Bist du uns nachgelaufen?«, rief Jane.
»Oder warst du schon vor uns hier?«
»Hat Mary Jane dich geschickt?«
Der Geist schwieg. Mary & Jane fragten nicht weiter nach, denn sie wussten: Der Geist liebte die Stille. Es war nie viel aus Fanny herauszubekommen, stumm war sie wie die Fische, die sie mit ihrem Käscher aus dem River Fleet fing, um kurz das Luftschnappen zu betrachten und sie rasch wieder hineingleiten zu lassen. Nein, Fanny ließ lieber ihre Augen sprechen, zutiefst blaue, beinah dunkelblaue Augen, aus denen etwas Verlorenes schimmerte.
Mary fasste sich an den Nacken.
»Das blutet!«, sagte Fanny, nahm ein Taschentuch, tupfte das Blut sorgsam ab und sagte: »Mary Jane darf das nicht sehen!«
So viel sprach sie selten.
Mary entschuldigte sich bei Jane und Jane bei Mary. Sie reichten einander die Hand, küssten die schmutzigen Wangen, ordneten ihre Kleider, machten sich mit Spucke sauber. Bald sahen sie wieder aus wie halbwegs brave Mädchen.
Fanny und Mary haben etwas gemeinsam. Auf immer. Ihre tote Mutter. Auch Fanny ist Tochter von Mary Wollstonecraft. Wenngleich Fanny einen anderen leiblichen Vater hat: den ganz und gar abwesenden Gilbert Imlay. Aber Mary & Fanny teilen etwas Großes, ihr Leben lang: Beide haben — bei Marys Geburt — ihre Mutter verloren. Nie hat Fanny Mary Vorwürfe gemacht. Doch Fanny ist da, sie existiert. Als Tochter von Mary Wollstonecraft ist ihre Anwesenheit eine stillschweigende Anklage: Mutter ist tot. Fanny ist nicht nur Geist, ist unsichtbarer Schatten. Der blaue Blick. Die verschlossenen Lippen. Sie ist eine seltene Blume, die nicht gern Blüte zeigt, eine liebevolle Mimose, bei Berührung schließt sie sich. Ein guter Mensch, das ist sie. Als Dreijährige hat ausgerechnet Fanny versucht, nach dem Tod der Mutter das stets schreiende Mary-Bündel zu trösten, ausgerechnet Fanny ist es gewesen, die an Marys Wiege saß und summte. Doch auch ihr gelang es nicht. Drei Schwestern unter einem Dach. Mary Wollstonecraft Godwin. Stiefschwester Jane. Und Halbschwester Fanny.
Das Grab friert. Wenn der Winter einzieht, steckt ihm Kälte in den Knochen. Der Stein liegt jetzt — nach dem Umzug in die Skinner Street — oft tagelang dort ohne Marys Rücken, der sich an ihn lehnt, ohne ihre Hände im Dreck. Dennoch wächst Mary ihrer Mutter immer näher. Das liegt an den Büchern.
Mary ist jetzt vierzehn Jahre alt. Auch ein Buch kann ein Grab sein, denkt sie, ungelesen in der Bibliothek, ein senkrechtes Grab für Gedanken. Erst wenn jemand es öffnet, das Buch, auferstehen die Worte. Das Grab für den Leib ist unwiderruflich. Das Grab für den Geist aber nicht.
Mutters Bücher kann sie lesen, wieder und wieder, kann sie sogar laut lesen, hier, am Grab, liest am liebsten aus dem berühmtesten Buch: Eine Verteidigung der Rechte der Frau. Marys Mutter hat in Gedanken geschrieben und nicht in Bildern wie Coleridge. Bilder kann Mary sehen. Das fällt ihr leicht. Gedanken muss sie nachvollziehen. Das ist schwieriger. Mutters Bücher zerfleddern mit der Zeit, werden fleckig und voll erdiger Fingerabdrücke.
Mary will nicht allein bleiben, am Grab, will nicht nur vorlesen und nachdenken und nachempfinden, will, dass ihre Mutter endlich zu ihr spricht und Antwort gibt. Mary kennt inzwischen Leben und Werk ihrer Mutter ganz genau, nicht nur Schriften, Briefe, Tagebücher, sondern auch Vaters Erinnerungsbuch Memoirs of the Author of A Vindication of the Rights of Woman. Heute, an ihrem vierzehnten Geburtstag, denkt Mary: Wenn Mutter mir zuhören kann, so kann sie auch sprechen mit mir. Und Mary zieht zum ersten Mal Mutters Stimme aus dem Grab. Behutsam, als könne sie zerbrechen. Wie an einem seidenen Faden flimmert Mutters Stimme jetzt neben ihr.
»Wie schön, dass du da bist, Mary«, sagt ihre Mutter.
»Für dich immer, Mama«, flüstert Mary und hält den Atem an.
»Du bist vierzehn?«
»Ja, Mama.«
»Als ich vierzehn war, stand ich mit dem Rücken zur Tür.«
»Zu welcher Tür, Mama?«
»Ich stand mit dem Rücken zur Tür meiner eigenen Mutter. Ich breitete die Arme aus an der Tür, ich war ein Schlagbaum.«
»Und dann?«
»Ich wartete, Mary.«
»Worauf hast du gewartet, Mama?«
»Auf den Mann, den ich Vater nennen muss.«
»Auf meinen Großvater, Mama?«
»Ja, Mary, auf deinen Großvater.« Die Stimme ist da. Nicht allzu hell, eher ein blasser Alt. »Dein Großvater, Mary, er stieg die steile Treppe hoch, die behaarten, hässlichen Hände schwarz von der Landarbeit, er stank nach Schweiß, von seinen Stiefeln bröckelten Matsch und Schweinemist, den ich und meine Geschwister am nächsten Morgen würden aufputzen müssen, mein Vater, da kam er, mit Stoppeln im Gesicht, er wankte weiter, Mary, die steile Treppe hinauf, und jemand muss ihn aufhalten, ich muss ihn aufhalten, er wollte das Leben in der Küche nicht mehr aussitzen, ein Leben, das zu dieser Stunde nichts für ihn bereithielt, oben wartete Lustigeres auf ihn: Ablenkung. Schon erreichte der Vater den Austritt der Treppe. Mit dem Blick traf er mich, seine Tochter.«
»Und weiter?«
»Ich stand oben, Mary, die Stirn hoch, trotzig, kampfbereit, mit einer Träne im Auge, stand dort, in meine vierzehn Jahre gekleidet, wie eine Kerze, versuchte nicht zu flackern, Arme ausgebreitet, mit dem Rücken zur Tür stand ich und sagte nur: Nein! Der Blick meines Vaters wurde weder zornig noch drohend. Diese wässrigen Augen, beinah von selber Farbe wie die grauweißen Höhlen, tote und lebende Augen zugleich. Vater zog nur eine Braue hoch, kräuselte die Stirn, hielt gar nicht erst inne in seinem Schritt, beachtete meinen Ruf nicht, ging zur Tür, rupfte mich wie Unkraut aus und stieß und schleuderte mich, und ich rutschte den Flur entlang und knallte mit dem Kopf an die Wand, ich war besiegt, einmal mehr, ein Ritual, ich war nicht groß genug, aber ich konnte nicht anders, Mary, ich musste mich ihm wieder und wieder in den Weg stellen. Er riss die Tür auf, ging ins Zimmer, zur Mutter, und schloss ab. Ich legte die Hand an den Kopf, kein Blut, ich stürzte nach unten, zu den Geschwistern, die nicht aufwachen durften von den Mutterschmerzen oben, doch die Geschwister schliefen, und meine Mutter schrie ihre Schreie ins Kissen. Ich würde am frühen Morgen wieder Mutterwunden versorgen müssen, blaue Flecken und blutende Stellen zwischen den Beinen, ich musste raus, kurz nur, an die Luft, und als ich das Haus verließ, fiel mein Blick auf das Baumeln. Etwas baumelte leise im Windzug, neben dem Haus, von einer Stange am Hühnerstall.«
»Was baumelte da, Mama?«
»Mein Hund. Schau weg, Mary, wenn etwas baumelt. Vater hatte ihn aufgeknüpft, ich lief hin, kam zu spät, ich löste die Schlinge und drückte den Hund an mich, versuchte, ihm wieder Leben einzuhauchen, aber er war längst tot. Und ich blickte hoch zum Fenster, hinter dem ein Mensch auf dem Bett herumgeschlagen wurde und betete, dass es gleich vorbei sein möge, aber es dauert noch an, Mary, noch dauert es an.«
Mary hat ein bisschen viel Grab geatmet. Sie steht auf, lässt Mutter zurück, läuft zu Vater. Zum Glück ist ihr Papa in allem das Gegenteil ihres Großvaters: sanftmütig, gebildet, ruhig. Niemals hätte er eine Hand gegen Mary erhoben. Mary läuft sich mit jedem Schritt die Bilder aus dem Kopf. Doch Bilder verschwinden nur langsam, müssen überlagert werden von neuer Gegenwart.
In der Skinner Street stand die Ladentür offen. Mary hielt an. Warf den Kopf in den Nacken und schaute kurz zum Aesop-Relief über der Tür, bärtig, lockig, mit diesen Augen, die wie irrsinnig nach rechts oben schielten. Mary lief durch den Buchladen ihrer Stiefmutter, stürzte an einer erstaunten Mary Jane vorbei, ehe diese etwas hätte sagen können, durch die Hintertür lief Mary, ins Treppenhaus, die Treppen hoch. Sie wusste: Die heilige Schreibzeit ihres Vaters William war beendet.
Sie betrat das Wohnzimmer. Schon sah sie ihn. Saß der einfach da und gab kein Lebenszeichen von sich. Nichts. Saß der im Sessel und regte sich nicht, Kinn Richtung Brust, die Augen zu, zu, zu. Mary trat näher, hielt einen gekrümmten Zeigefinger unter Vaters Nase, suchte den Vater-Atem, fand ihn zunächst nicht, doch endlich ein Röcheln, ein Hauch streifte ihren Finger, sie packte den Vater und rüttelte ihn so sanft wie möglich.
»Wo bin ich?«, sagte William und riss die Augen auf.
»Du warst wieder weg, Papa.«
»Wie lange?«
»Du musst zum Arzt. Unbedingt!«
»Ich bin nur eingeschlafen.«
»Schon ein paar Mal. Das nennt sich Ohnmacht. Ich habe nachgelesen. Das ist alles andere als harmlos. Du musst zum Arzt, Papa, glaub mir.«
In diesem Augenblick rief ihre Stiefmutter Mary Jane Clairmont von unten: »Mary!! Komm runter! Wir brauchen Hilfe!!«
Mary verdrehte die Augen, legte den Zeigefinger mit dem Vater-Atem auf die Lippen und blinzelte Vater verschwörerisch zu.
»Mary!!??«, schrie Mary Jane noch einmal.
William schloss kurz die Augen und öffnete sie wieder.
Mary verstand, dass er sagen wollte: Sei so gut!
Sie nickte.
»Ich komme gleich!«, rief Mary nach unten und konnte ihre Gereiztheit nicht verbergen. Sie schüttelte sich kurz und umarmte ihren Vater heftig.
»Ich bin froh, dass du da bist«, sagte sie.
»Schon gut, Mary.«
»So eine Ohnmacht kann verschiedene Ursachen haben. Herzstörungen. Kreislauf. Niedriger Blutdruck. Gefährliche Sachen im Kopf. Geschwülste und so. Du musst dich untersuchen lassen. Unbedingt.«
»Mach dir keine Sorgen, ich arbeite so viel, dass ich ab und zu einschlafe, das ist schon alles. Ach so. Und noch was. Na ja. Mary Jane & ich: Wir müssen dir etwas mitteilen.«
Doch in diesem Augenblick stürmte Marys Stiefschwester Jane die Treppen hoch, ins Zimmer hinein, sie rief: »Mary, du musst jetzt wirklich kommen!«
»Ja doch! Gleich!«
»Beeil dich!«
»Was wollt ihr mir sagen?«, fragte Mary ihren Vater.
»Wir reden heute Abend, ja?«
Mary nickte und folgte wortlos der Schwester.
»Mary!«, rief William ihr nach.
»Ja?«
»Schreibst du noch?«
»Tagebücher, Papa.«
»Geschichten?«
»Mir fehlen die Zahnräder.«
»Welche Zahnräder?«
»Wie Zahnräder ineinandergreifen, eins ins nächste, so müsste man schreiben. Ein Wort muss ins andere greifen, und am Schluss läuft alles wie von selbst. Vielleicht lern ich es noch.«
»Mary! Du weißt ja: Schreiben ist …«
»… mein Vermächtnis, jaja. Ich weiß, ich weiß.«
Mary lief hinunter, zu ihrer Stiefmutter Mary Jane, die im Hausflur wartete und blitzend schimpfte: dass sie nicht alles selber machen könne und Mary endlich vernünftig werden solle und man irgendwann mal an die Zukunft denken müsse, und für die Zukunft brauche man Geld, und das Geld liege in diesem Buchladen hier, nicht in Williams Büchern, und Angestellte könne man sich nicht wirklich leisten, also solle Mary endlich die verdammten Pakete auspacken.
Mary schaute sie an, ohne ein Wort.
Stiefmutter Mary Jane war eine Zumutung. Mamas Platz hatte sie sich gekrallt. Vater um den Finger gewickelt. Die geliebte Amme Marguerite gefeuert und alle Bediensteten ausgetauscht. Und jetzt sollte Mary Pakete auspacken? Mary wollte wie üblich eine schnippische Antwort geben, wollte die Tür knallen, abhauen, nur weg von dieser Frau. Da hielt sie mit einem Ruck inne, und sie wusste überhaupt nicht, woher diese Erinnerung jetzt kam, wie ein Riss, deutlich, klar.
Ihren ersten Toten sah Mary mit fünf Jahren. Das war lange her. Wieder klebte der Tod an seinem Gegenspieler Geburt. Stiefmutter Mary Jane war schwanger damals, die kleine Mary sah den Bauch wachsen. Eins lernte sie: Die Zeit verstreicht langsamer, wartet man auf ein Kind. Das Kind wurde im Haus geboren, Mary lauschte von oben, hörte Schmerzensschreie, wusste, die Schreie zählen zur Geburt dazu, auch ihre eigene Mutter wird geschrien haben damals, jede Mutter schreit, es muss ein riesiger Kopf durch eine winzige Öffnung, und wehe, der Kopf bleibt stecken auf dem Weg ans Licht.
Jane bibberte im Bett.
Mary hielt ihre Hand.
Unten, bei Mary Jane, schien alles gut zu gehen. Die Schreie wurden lauter, so, wie es sich gehörte, bis zur letzten Wehe. Das Kind selber schrie, zum Glück, ein kräftiges Kind, es schrie, ein gutes Zeichen, das wusste Mary, schreiende Kinder sind gesund.
Doch rasch kam die Stille, kurz nur, eine Spinnfadenstille. Mary hörte nichts mehr. Dann aber Hektik, Schritte, Rumpeln, Rufe. Da setzten die Schreie wieder ein. Nicht Kindesschreie, sondern Mutterschreie. Die neuen Schreie der Mutter klangen anders: verzweifelt und trostlos zugleich. Mary musste sich die Ohren zuhalten.
Als es ruhiger geworden war, schlichen die Schwestern auf Zehenspitzen nach unten, wollten zur Mutter, zur Stiefmutter. Betraten den Schlafraum, leise. Doch Mary Jane schlief nicht, sie hockte mit dem Kissen im Rücken im Bett. Ihr Gesicht war ausgewischt, sie sah durch die Mädchen hindurch, die Bettdecke gewölbt. Da schlug Mary Jane die Decke auf, Mary sah das tote Kind, eingewickelt in einen Schal, nur das blasse Gesichtchen lugte heraus, die spaltbreite Öffnung eines Lids, darunter schimmerte ein einzelner Augenschlitz, gelblich, leblos, ausgehaucht. Mary Janes Bauch war leer. Die fünfjährige Mary kletterte aufs Bett und umarmte die Stiefmutter. Jane tat es ihr gleich.
Mary überwand sich jetzt, hier, in der Buchhandlung, Aug in Aug mit Mary Jane, sie sprang über ihren Schatten, ließ allen Ärger schmelzen, wurde nicht patzig wie gewohnt, schluckte alles Aufmüpfige herunter, ich gewinne, dachte sie, ich gewinne gegen mich selbst, ich gebe nach, und schon sagte Mary mit leuchtendem Blick: »Mary Jane. Sag mir, was ich tun soll.«
Mary Jane entgegnete: »Du weißt doch, dass ich es nicht mag, wenn du mich ›Mary Jane‹ nennst.«
»Soll ich ›Mama‹ sagen?«
Mary Jane schaute misstrauisch.
»Wo sind die Pakete?«, fragte Mary.
»Da, wo sie immer sind.«
Jane hielt in der Buchhandlung drei Kundinnen in Schach. Jede von ihnen wedelte mit einem brandneuen Exemplar der Schweizer Familie Robinson, einem Bestseller, übersetzt von: Mary Jane Clairmont höchstpersönlich. Die Frauen wollten ein Autogramm. Die Stiefmutter trippelte zu ihnen und sprach in einer höheren Stimme als sonst.
Mary griff zu einem Messer, schlitzte die Pakete auf, die in der Ecke standen, holte die neuen Kinderbücher heraus und reichte sie Jane. Und dann war es wieder da. Mit einem Schlag. Dieses Jucken an Händen und Armen, das sie seit Wochen heimsuchte. Mary bekam einen regelrechten Kratzanfall, hätte sich am liebsten die Haut abgerissen in der Skinner Street, hielt es nicht mehr aus, knöpfte die Bluse auf, warf sie von sich, auf Händen und Armen glühten tiefrote Ekzeme, schlimmer als je zuvor, Wunden auch: vom Kratzen. Die pikierten Kundinnen verließen den Laden.
»Hör endlich auf, dich zu kratzen!«, rief Mary Jane.
Mary konnte nicht aufhören. Es juckte schlimmer, je stärker sie kratzte. Da griff Jane ein, stellte sich hinter Mary, umklammerte sie mit aller Kraft, und Mary schrie, versuchte sich selbst zu beißen, ehe auch Mary Jane zu ihr trat und sie an den Schultern packte. Ihre Stiefmutter sagte: »Genau deshalb schicken wir dich weg!«
Mary hörte auf zu zappeln.
»Ihr schickt mich weg?«, fragte sie, als hätte ihr jemand eine Ohrfeige gegeben.
»Du wirst auf ein Internat gehen. Direkt am Meer. Wegen deiner Haut, Mary. Und weil ich nicht mehr kann. Ich bin am Ende. Deine ewigen Widerworte. Deine Frechheiten.«
»Wohin schickt ihr mich?«
»Nach Ramsgate. Am liebsten schon morgen.«
Mary riss sich los. Sie blickte an sich herab. Stand dort im Korsett. Bückte sich, nahm das Messer, schnitt das Korsett auf, von unten nach oben, warf es von sich, das Unterhemd hinterher, hob die Bluse auf und bedeckte ihren bloßen Oberkörper.
»Und ich?«, rief Jane in ihrem Rücken. »Was ist mit mir?«
»Du bleibst«, sagte Janes Mutter. »Du bleibst hier.«
Jane stürmte wütend an ihr vorbei, polterte die Treppe hoch.
Mary knöpfte die Bluse zu und ging zur Ladentür.
»Deine Brust«, rief Mary Jane. »Man sieht sie durch den Stoff.«
Mary nahm die Klinke in die Hand. Ehe sie durch die Tür trat, drehte sie sich noch einmal um und sagte: »Leb wohl, Mama!«
Dann ging sie los.
Langsam, behutsam ging sie, Schritt für Schritt, zwei Kilometer, zurück zum Grab ihrer Mutter. Man starrte sie an unterwegs, doch es störte sie nicht. Der Juckreiz legte sich, hier, an der frischen Luft. Mary erreichte den Friedhof, folgte dem Weg, setzte sich. Wie immer steckte sie ihre Hände in die Erde, tief hinein, und sie ließ die Hände dort drinnen, dicht bei Mutter, schloss die Augen, erzählte Mutter alles, was geschehen war. Währenddessen wurde sie nicht müde, in der Erde zu wühlen, als suche sie etwas, Knochen vielleicht oder eine Seele. Die Arme krochen tiefer ins Erdreich, bis zu den Ellbogen schon, endlich hielt Mary inne. Sie hatte es gefunden und zog es langsam ans Licht, vorsichtig, sachte, um es nicht zu beschädigen: ein Buch. Sie blies die Erde vom Einband. A Vindication of the Rights of Woman. Ihr eigenes Exemplar. Sie hatte es vor Wochen in die Tiefe geschoben. Jetzt lag es in ihrer Hand, kalt und feucht, aber unbeschädigt, sie öffnete das Buch, ließ es mit dem Daumen flirren, ihre Miene hellte sich auf: Überall zwischen den Seiten steckten schwarze Krümel. »Muttererde«, sagte Mary. »Ich fahre fort, Mama. Zum ersten Mal. Aber ich habe nicht vor, dich hierzulassen. Gemeinsam können wir gegen Gott gewinnen.« Mary steckte das Buch unter ihre Bluse, kalt am nackten Bauch, dann presste sie die Arme an die Seiten und legte sich mit der Brust flach aufs Grab, Spiegelkörper der Mutter, Beine über Gebeinen, Brust über Rippen und zwischen den Nabeln das Buch. Mary holte tief Luft, presste ihr Gesicht in die Erde und murmelte: »Hier bin ich!« Sehen konnte sie nichts.
Ramsgate School & Broughty Ferry
Die Einsamkeit währte ein halbes Jahr. Im Internat gab es keine Menschen, die Mary entflammt hätten. Die Jungen lernten Latein, Mathematik und Geschichte. Die Mädchen dagegen Stricken, Gutaussehen und Artigkeit. Marys Mutter hatte ihr Leben lang genau dagegen gekämpft. Gegen die Versklavung der Seele der Frau. Und gegen die Unwissenheit. Auch Marys Vater verachtete solche Schulen. Warum war Mary dann hier? Natürlich: wegen ihrer Stiefmutter. Mary vermisste den Vater, seine Struktur, seinen Rhythmus, alle Tage verliefen gleich bei ihm: fünf Stunden schreiben, zwei Stunden studieren, eine Stunde Spaziergang, den Kindern vorlesen, dazwischen essen. Alles, was Vater sagte, ergab einen Sinn. In Ramsgate ahmte Mary ihren Vater nach, sie teilte ihren Tag minutiös ein, stand früh auf, las vor und nach der Schule so viele Bücher wie möglich und lernte sogar für sich selbst ein wenig Latein und Mathematik.
Auch ohne Grab hörte Mary nicht auf, sich zur Mutter zu lesen, und kam ihr immer näher, je mehr sie verstand und erfuhr über ihr Leben. Nach beinah sechs Ramsgate-Monaten ging Mary an einem regnerischen Sonntag allein über den Strand. Sie stellte sich in aller Ausführlichkeit den Selbstmordversuch ihrer Mutter vor. Sie folgte Mutter in Gedanken Schritt für Schritt durch den Regen ins Wasser. Das war in der Zeit vor William Godwin gewesen. Marys Mutter hatte damals genug gehabt vom Leben mit Fannys Vater Gilbert. Sie war einfach zur Putney Bridge gelaufen, hatte keine Sekunde gezögert und sich übers Geländer geschwungen, hinab ins Wasser. Diese Entschlossenheit nahm Mary den Atem. Nie würde sie selber den Mut finden zu solch einer Tat. Befreiung musste aber nicht bedeuten, endgültig Schluss zu machen. Befreiung könnte auch heißen: Schluss zu machen mit untragbaren Zuständen. Was läge näher als die Flucht aus diesem lächerlichen Internat? Endlich raus hier! Fort von den störrischen Feriengästen, die des Sonntags über den Strand promenierten oder auf den Sands lagen und das bisschen Sonne vom Himmel stahlen. Mary hatte genug nach diesen sechs Monaten. Warum war sie überhaupt so lange geblieben? Ihr fehlte die Entschlossenheit der Mutter. Bei ihr gab es kein Schnurstracks, nein, sie musste Anlauf nehmen, mühevoll, Kraft sammeln. Sie rannte in ihrem Zimmerchen auf und ab und klopfte gegen Wände, öffnete Fenster, malte sich aus, wie es wäre, einfach so, mir nichts, dir nichts: durchzubrennen.
Und dann, es war ein Mittwoch, erwachte Mary mit einem ihr unerklärlichen Lachanfall, weil plötzlich ihre Pantöffelchen so lächerlich sinnlos nebeneinanderstanden vor dem Bett, und Mary verließ das Internat kichernd, lief ins Städtchen, stieg grinsend in eine Kutsche, das Geld, sagte sie dem Fahrer, werde am Ziel ausgezahlt, und dann tat sie endlich das, was sie eigentlich seit ihrem ersten Tag hier tun wollte: abhauen. Wohin? Nach Hause. Zurück in London, rief sie ihrem Vater zu: »Ich gehe da nie wieder hin!« Mit aller Kraft knallte sie die schwere Tür zu ihrem Zimmer. Die Entscheidung ihrer Eltern darüber, wie die ungeheuerliche Rebellin zu bestrafen sei, wurde vertagt: Für den Abend waren Gäste eingeladen.
In den letzten sechs Monaten hatte Marys Stiefmutter reichlich Geld ausgegeben: für ihre leibliche Tochter. Jane hatte Gesangsunterricht bekommen und rasante Fortschritte gemacht, sowohl im Singen als auch bei den Posen, die das Singen begleiteten: das galante Strecken der Arme von ihrem Körper, einer Ballerina gleich, mit geöffneten Handflächen, das Schließen der Augen, wenn sie eine besonders ergreifende Stelle vortragen musste, das übertriebene Öffnen und Runden des Mundes sowie der kokette Griff unter ihre Brust, wenn von Herz oder Liebe die Rede war. Wann immer Gäste in die Skinner Street kamen, musste Jane nun Kostproben ihrer Kunst zum Besten geben, und ihre Stimme ließ alle verstummen.