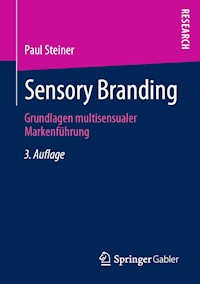Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biografien bei ceBooks.de
- Sprache: Deutsch
Mary Slessor wuchs in einer armen schottischen Arbeiterfamilie auf und erlebte schon früh harte Zeiten. Doch ihr Leben nahm eine entscheidende Wendung, als sie mit 27 Jahren vom Tod David Livingstones erfuhr – inspiriert von seinem Vermächtnis beschloss sie, selbst als Missionarin nach Afrika zu gehen. In Nigeria widmete sie sich unermüdlich den Efik und Okoyong. Sie rettete Hunderte Zwillinge, die aufgrund eines Aberglaubens getötet werden sollten, versorgte Kranke und setzte sich mutig gegen brutale Traditionen wie die Giftprobe zur Schuldfindung ein. Trotz der Gefahr betrat sie Gebiete, in denen zuvor Missionare ermordet wurden, und brachte den Menschen die Botschaft von Jesus Christus. Ihr außergewöhnlicher Mut, ihre pragmatische Art und ihr Humor machten sie weit über die Grenzen ihrer Mission hinaus bekannt. Die Einheimischen ehrten sie als die „weiße Königin von Okoyong“ – doch ihr Vermächtnis reicht weit darüber hinaus. Eine bewegende Biografie über Glauben, Mut und Menschlichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mary Slessor
Die weiße Königin von Okoyong
Paul Steiner
Impressum
© 2018 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Paul Steiner
Cover: Caspar Kaufmann
ISBN: 978-3-95893-180-0
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Shop: www.ceBooks.de
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Dank
Herzlichen Dank, dass Sie dieses eBook aus dem Folgen Verlag erworben haben.
Haben Sie Anregungen oder finden Sie einen Fehler, dann schreiben Sie uns bitte.
Folgen Verlag, [email protected]
Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über:
Neuerscheinungen aus dem Folgen Verlag und anderen christlichen Verlagen
Neuigkeiten zu unseren Autoren
Angebote und mehr
http://www.cebooks.de/newsletter
Inhalt
Titelblatt
Impressum
1. Eine harte Jugend
2. An den Ufern des Kalabar
3. In der afrikanischen Wildnis
4. Die weiße Königin von Okoyong
5. Ein Kinderheim
6. Sieben Jahre später
7. Pionierdienst
8. Wie Debora, die Richterin
9. Noch weiter landeinwärts
10. Lebensabend und Heimgang
Unsere Empfehlungen
1. Eine harte Jugend
Am 2. Dezember 1848 wurde dem Schuhmacher Robert Slessor in der schottischen Stadt Aberdeen ein Töchterlein geboren, das in der heiligen Taufe den Namen Mary erhielt. Es war ein gar bescheidenes Heim, in dem das Mädchen im Kreise seiner sechs Geschwister aufwuchs. Der Vater hatte nur spärlichen Verdienst, und den trug er noch zum größten Teil ins Wirtshaus. Der kleinen Mary war auch kein sonniges Kinderheim beschieden, denn wie ein tiefer Schatten lag infolge des Vaters unglückseliger Leidenschaft das Elend auf dem Familienkreis. Die gute, fromme Mutter musste alle Kräfte einsehen, um den Ihrigen das Dasein zu ermöglichen, und Mary, die schon frühzeitig der Mutter in der Arbeit beistehen und sich der kleinen Geschwister annehmen musste, fand keine Zeit, um mit der Puppe oder mit ihren Kameradinnen zu spielen.
Als sie zehn Jahre alt war, siedelte die Familie nach dem gewerbereichen Dundee über, da man hoffte, der Vater würde hier besseren Verdienst finden und in anderer Umgebung der Versuchung zum Trunk weniger ausgesetzt sein. Doch darin täuschte man sich. Es ging mit dem Mann immer mehr bergab. Die Mutter war genötigt, trotz ihrer sechs Kinder in einer Fabrik Arbeit und Verdienst zu suchen, während die kleine Mary, so gut sie konnte, den Haushalt versah. Von früh bis spät hatte sie sich zu tummeln, und wenn ihr auch oft vor Hunger und Müdigkeit die Augen zufallen wollten, so begrüßte sie doch jedes Mal die am Abend von harter Fabrikarbeit zurückkehrende Mutter mit einem glücklichen Lächeln.
Doch immer düsterer gestaltete sich die Lage der Familie, immer größer ward die Not. Mary, obwohl erst elf Jahre alt, musste mitverdienen helfen und gleich ihrer Mutter in die Fabrik gehen. Doch durfte sie darin nur halbtägige Arbeit tun, da sie während der andern Hälfte des Tages die Schule besuchen musste.
Das Hausmütterchen
Es war eine Baumwollspinnerei, in der sie, wie vormals ihr Landsmann Dr. Livingstone, Fäden knüpfte und webte. Ihre geschickten Finger hatten bald eine Fertigkeit darin erlangt, und freudestrahlend brachte sie der Mutter ihren ersten Wochenlohn. Tränenden Auges nahm ihn diese in Empfang und tat ihn beiseite, denn das sauer verdiente Geld ihres Kindes brannte ihr in den Händen.
Mittlerweile war Mary 14 Jahre alt geworden und konnte jetzt den ganzen Tag hinter dem Webstuhl stehen. Wohl war der Verdienst ein guter, aber die Arbeit streng und ermüdend. Schon um 5 Uhr morgens, wenn der gellende Pfiff der Fabriksirene ertönte, erhob sich das Mädchen von ihrem Lager und hatte von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends hinter der Maschine zu stehen, während um sie her die Räder surrten und die Spindeln sich drehten. Nur zwei Stunden Freizeit waren ihr am Tag für ihre Mahlzeiten vergönnt. Diese nahm sie des Winters neben ihrem Webstuhl, im Sommer im nahen Stadtpark ein. An den freien Samstagnachmittagen saß sie dann mit der Mutter bis in die späte Nacht hinein bei der Näharbeit oder beim Strümpfestricken, während ihre kleineren Geschwister die süßesten Träume träumten. Dabei lauschten sie ängstlich auf die unsicheren Tritte des trunkenen Vaters, der polternd aus dem Wirtshause zurückkehrte und dann in seinem Rausch oft das für ihn zurechtgestellte Abendessen in den brennenden Kamin warf. Weinend verließ Mary oft ihr trauriges Heim und irrte trostlos in den dunklen Straßen umher.
Das häusliche Elend verband Tochter und Mutter aufs innigste, und beide suchten ihren Trost bei ihrem Heiland, dem sie täglich ihre Not ans Herz legten. Fleißig besuchten sie auch die Gottesdienste der unierten Presbyterianerkirche und fanden in Gottes Wort Stärkung und Aufrichtung in ihrer trostlosen Lage. Endlich nahm diese ein Ende.
Eines Tags standen Mutter und Kinder am Toten-lager des unglücklichen Familienvaters. So schmerzlich der Fall war, so war es doch eine Erlösung für die ganze Familie. Mary wurde nun die Hauptstütze derselben. Mit unermüdlichem Fleiß und Eifer suchte sie durch ihre Fabrikarbeit einen wesentlichen Teil ihres Unterhaltes aufzubringen. Die schwere Zeit, die hinter ihr lag, war nicht ohne Einfluss auf sie gewesen. Sie war dadurch innerlich gereifter geworden und hatte gelernt, stille zu Gott zu sein, Liebe zu üben und auf den Herrn zu harren.
Marys Mutter gab nun ihre Arbeit in der Fabrik auf und eröffnete einen kleinen Laden. Ihre Tochter stand ihr auch hier, soweit es ihre Freizeit erlaubte, wacker zur Seite. Es war ihr aber auch darum zu tun, sich möglichst weiter zu bilden, und zwar durch Lesen von guten Büchern. Selbst am Webstuhl pflegte sie das eine und andere Buch zu befestigen und in freien Minuten ein Blatt ums andere zu lesen. Vor allem aber war ihr die Bibel die liebste Lektüre. Mit ihr war sie so vertraut, dass sie in der Bibelklasse, die sie regelmäßig besuchte, keine Antwort schuldig blieb.
Ihr fleißiges Bibelstudium, durch das sie in immer innigere Lebensgemeinschaft mit ihrem Heiland kam, weckte in ihrem Herzen das Verlangen, auch andern Menschenkindern den Weg zu ihm zu weisen. Sie übernahm deshalb eine Klasse in der Sonntagsschule und unterrichtete darin kleine Mädchen. Doch das genügte ihr nicht. Es zog sie zu den verlorenen Kindern ihres Volkes. Im Drang ihres liebevollen Herzens suchte sie die Knaben und Mädchen, die im verrufensten Quartier der Stadt sich Tag und Nacht heimatlos Herumtrieben, um sich zu sammeln und sie des Abends zu unterweisen. Sie tat dies Hand in Hand mit der Stadtmission, die für die vernachlässigte Jugend einen Sammelpunkt schuf und Mary als Lehrerin derselben anstellte. Als das Lokal verlegt wurde, meinte der Leiter der Stadtmission: „Wir sollten eine Putzfrau kommen lassen, damit sie den Versammlungsraum gründlich reinige.“ – „Unsinn!“ erklärte Mary, „das können wir Lehrerinnen ebenso gut selbst besorgen.“ – „Aber Damen können sich doch nicht einer solch schmutzigen Arbeit unterziehen“, meinte der Stadtmissionar. – „Wir sind keine Damen“, erwiderte Mary, „wir sind nur gewöhnliche Arbeiterinnen.“ – Am nächsten Abend stand Mary und noch eine Lehrerin mit aufgestülpten Ärmeln und umgebundener Schürze, neben sich einen Eimer mit Wasser, und reinigten mit handfesten Scheuerbürsten das Versammlungslokal.
Es war keine kleine Aufgabe, die verwahrloste Jugend in Ordnung und Zucht zu halten. Aber Mary hatte ein fröhliches, kindliches Temperament, das mit den wildesten Buben und ausgelassensten Mädchen sich fröhlich tummelte und Nachsicht auch für tolle Streiche hatte.
So konnte sie unter Umständen sagen: „Ein bisschen Unsinn dann und wann ist auch erfrischend für den weisen Mann.“ – Einer ihrer alten Freunde schildert sie in jener Zeit mit den Morten: „Immer lag Sonnenschein und strahlendes Glück auf ihrem Gesicht. Mit ihrer frischen Gesichtsfarbe, ihren kurzen Löckchen und dem fest geschlossenen Mund erschien sie mir immer wie eine derbe Bauerntochter, die mit Butter und Eiern auf den Markt kommt.“
Durch den Verkehr mit der Jugend fand sie auch Zugang zu den Herzen der Eltern, die meist in muffigen, schmutzigen Winkeln wohnten.
Das Haus, indem Mary als Lehrerin wirkte
Sie besuchte die Mütter und Schwestern ihrer Pfleglinge und lernte da das harte Dasein, das Elend und die Verworfenheit der Ausgestoßenen kennen. Während die Stadtmissionare es nur zu Zweit wagten, diese verrufenen Quartiere zu besuchen, begab sich Mary oft ganz allein dahin. Meist saß sie bei einem solchen Besuch am Kaminfeuer mit einem Säugling auf dem Schoß. Bisweilen trank sie mit der Familie Tee aus einer zerbrochenen Tasse. Oft half sie einer vielbeschäftigten Mutter bei ihrer Arbeit und suchte die gedrückten Herzen der Leute aufzuheitern und zu trösten. Überall suchte sie Sonnenschein zu verbreiten und das Dunkel der Verzweiflung zu bannen. Dabei war ihr Einfluss auf andere ganz wunderbar, und manche rühmten ihr nach, dass sie im Umgang mit ihr den Weg zu Gott gefunden hätten.
Es war diese Zeit eine Vorbereitung für ihre spätere Wirksamkeit im heidnischen Westafrika, ohne dass sie ahnte, dass des Herrn Hand sie je dahin führen würde, und doch träumte sie oft vom Dienst Gottes an armen Heidenkindern. Durch den trüben Dunst der schottischen Fabrikstadt tauchten vor ihrem sinnenden Geist tropischer Urwald und armselige Negerhütten unter stolzen Palmen auf; denn von der Heidenmission hatte sie in ihrem Kirchlein oft und viel gehört. Durch die Missionsblätter, die sie mit regem Interesse las, war es besonders das heidnische Kalabargebiet in Westafrika, wo die Missionare der „Vereinigten Presbyterianerkirche Schottlands“ ihren mühevollen und opferreichen Missionsdienst verrichteten, das ihr ganzes Herz gewonnen hatte, und oft fragte sie sich, ob sie sich nicht in den Missionsdienst melden sollte. Aber sie war sich bewusst, dass sie hierfür zu wenig Schulbildung besitze und überdies die Stütze ihrer Mutter sei.
So verbrachte sie vierzehn lange Jahre in den Räumen der Fabrik, während dem sie unablässig bemüht war, sich weiter zu bilden. Da flog eines Tages eine telegraphische Meldung durch das Land, die alle ernstgesinnten Schotten aufs tiefste erschütterte. Es war die Todesbotschaft von Dr. David Livingstone, dem kühnen Schotten, der unermüdlich das bisher unbekannte und unerforschte Afrika durchreiste, Flüsse und Seen entdeckte und das Innere des Landes dem Handel und der Mission erschloss, vor allem aber den schändlichen Sklavenhandel zu unterdrücken suchte. Einsam und allein, nur von einigen treuen Schwarzen begleitet, hatte er in einer elenden Negerhütte im Innern des dunklen Afrikas sein rastloses Missionsleben beschlossen. Seine Todesbotschaft war zugleich der Aufruf an alle Christen: Wer will sich des armen Afrikas und seiner Kinder fernerhin annehmen? Wer will jenen Völkern das Heil Gottes bringen helfen?
Dieser Ruf drang auch an Marys Herz. Sie war zur Tat entschlossen. „Mutter“, sagte sie eines Tages, „ich biete mich als Missionarin an, aber erschrick nicht! Ich trete einen Teil meines Gehalts an dich ab; mit ihm und was meine Schwestern Susanns und Janie verdienen, kannst du ohne Sorge leben.“
Die Mutter gab ihren Segen zu dem Vorhaben der Tochter. Nur verschiedene Freunde schüttelten den Kopf und meinten, ihr fehle der Mut dazu, denn sie fürchte sich ja vor jedem harmlosen Hund. Dem war allerdings so, aber sie vergaßen, dass Liebe alle Furcht austreibt.
Mary Slessor schrieb nun an die Direktion der presbyterianischen Mission und meldete sich in deren Dienst. Bebenden Herzens wartete sie auf den Entscheid. Als dieser eintraf, eilte sie zu ihrer Mutter mit den Worten: „Ich bin angenommen; ich gehe als Lehrerin nach Kalabar.“
2. An den Ufern des Kalabar
Duketown am Kalabarfluss (Westafrika)
Am 5. August 1876 stand Mary Slessor im Hafen von Liverpool an Deck des Dampfers Ethiopia und winkte zwei Freundinnen, die sie von Dundee aus begleitet hatten, Lebewohl zu. Sie befand sich auf dem Weg nach Westafrika. Der Dampfer legte an der Insel Madeira, sowie an den Kanarischen Inseln an, und bald machten sich die warmen Lüfte der nahen Küste Afrikas bemerklich. Es war eine lange Fahrt längs der verschiedenen Küstenstriche, bis der Dampfer nach Monatsfrist in das Mündungsgebiet des Kalabarflusses einlenkte und den Strom hinauffuhr, dessen dichtbewaldete Ufer von Papageien und Affen belebt waren. Auf den Sandbänken stolzierten prächtige Flamingo und sonnten sich Krokodile. Fischerboote der Eingeborenen glitten vorüber und vom Südosten herüber grüßte der gewaltige Kamerunberg. Was gab es doch alles zu sehen – für Mary Slessor eine neue, wunderbare Welt!
Endlich, am 11. September, lag Duketown, der erste bedeutende Handelsplatz am Kalabarfluss, vor ihren Augen, und der Dampfer ließ den Anker fallen. Sie war am Ziel. Die Stadt, die sich am Flussufer erhob, umkränzt von Anhöhen, bestand aus unzähligen Hütten, die in wildem Gewirr regellos durcheinander lagen und einen echt afrikanischen Anblick boten. Hoch über dem Fluss und der Stadt aber stand, wie ein Leuchtturm auf felsiger Klippe, das Anwesen der Mission, wo Daddy (Väterchen) und Mammy Anderson, zwei alte Pioniere der schottischen Kalabarmission, ihr trautes Heim hatten. Bei diesem würdigen Paar sollte sich Mary Slessor zunächst aufhalten, um sich in ihre Missionsarbeit einzuleben.
Sie war da ganz in ihrem Element und fühlte sich überaus glücklich.
O, wie liebte sie die strahlende Sonne, den freundlichen Sonnenuntergang, das glänzende Mondeslicht, den Strom mit seinen schimmernden Fluten, die Blumen mit ihren feurigen Farben, zwischen denen Vögel und Schmetterlinge hin und her flogen, die Palmen mit ihren stolzen Wipfeln und langen Wedeln! All die fremdartige Umgebung, die so ganz anders war, als die in Schottland, begeisterte sie so, dass sie ihren Gefühlen nur in Gedichten Ausdruck geben und die Schönheit ihrer neuen Heimat schildern konnte. Bisher in den Fabrikräumen Dundees eingeschlossen, fühlte sie sich hier so frei und ungebunden, dass sie sich in ihrem kindlichen Frohsinn zu manchem Übermut fortreißen ließ, der das Kopfschütteln der älteren und ernstgesinnten Missionsleute hervorrief. So kletterte sie auf Bäume, lief mit den schwarzen Knaben und Mädchen um die Wette und vergaß darüber nicht selten die Essenszeit, so dass die gestrenge Frau Anderson ihr manchmal zur Strafe nichts auftischte. Doch der gutmütige alte Daddy hatte das lebhafte, warmherzige Mädchen so lieb, dass er ihr in solchem Fall gern einige Bananen und andere Früchte heimlich zusteckte.
Die sonnigen Farben der neuen Umgebung verblassten allmählich und an ihre Stelle traten die dunkeln Schatten des Heidentums. Auf ihren Missionsgängen lernte sie die Heimstätten der Eingeborenen in der Stadt kennen. Es trat ihr hier ein rohes Heidentum entgegen, das sie aufs tiefste erschütterte. Sie konnte es schier nicht glauben, dass Menschenkinder so tief sinken können. Verstehen konnte sie auch nicht, dass die nackt herumlaufenden Kinder sich vor ihr fürchteten und unter lautem Geschrei auf und davon liefen. Sie selbst war freilich auch oft erschreckt, wenn die stämmigen Neger sich mit lebhaften Gebärden um sie her drängten und auf sie einsprachen, doch ihre freundliche Art gewann bald ihre Herzen.
Daheim erzählte sie dann ihrer mütterlichen Freundin, Frau Anderson, was sie in der Negerstadt erlebt und gesehen hatte. „O Mädchen“, antwortete diese, „du hast noch nichts gesehen, und weißt nicht, welch heidnische Gräuel hierzulande vorgehen und welcher Art das Heidentum ist.“ Und dann erzählte sie ihr das eine und andere von den Zuständen des Landes und Volkes. „Rund um uns her, bis weit ins Innere des Landes, leben Tausende und aber Tausende von Schwarzen. Jedes Dorf besitzt seinen Häuptling und einige wenige sogenannte Freigeborene. Alle übrigen Bewohner sind Sklaven, die ganz und gar der Willkür ihrer rohen Herren preisgegeben sind. Die Völkerstämme sind wild und grausam, und verbringen ihre meiste Zeit in Dorf- und Stammesfehden, in Tanz und Saufgelagen. Ja, manche von ihnen sind Menschenfresser. Ihre Religion besteht in abergläubischer Furcht vor Geistern, denen sie oft blutige Opfer darbringen. Außerdem spielt Zauberei und Beschwörung eine große Rolle in ihrem religiösen Leben. Von Liebe und Barmherzigkeit weiß man nichts. Wenn ein Häuptling oder Großer des Landes stirbt, so werden ihren Frauen und Sklaven die Köpfe abgeschlagen, oder sie werden erdrosselt und ihre Leichname mit ihrem Herrn begraben, damit dieser im Totenreich seine Gefährten und Diener um sich habe wie bei Lebzeiten.“
„Das ist ja schrecklich!“ rief Mary aus. „Und wie steht's denn mit den Kindern?“ – „O, von diesen sind die meisten auch Sklaven, und ihre Herren behandeln sie wie das liebe Vieh. Die Kinder bilden sozusagen ihren Reichtum. Sobald die Kleinen soweit sind, dass sie gehen können, müssen sie auf dem Kopf Traglasten schleppen, im Kanu rudern helfen und die Gehöfte fegen. Dabei werden sie oft unmenschlich geschlagen oder mit einem glühenden Eisen gebrannt. Ja, man schneidet ihnen unter Umständen die Ohrläppchen ab. Ihre Ruhestätte finden sie auf dem bloßen Erdboden, auf dem sie oft ohne irgendwelche Decke liegen. Wenn die Mädchen ein gewisses Alter erreicht haben, müssen sie sich in das sogenannte „Abschließungshaus“ begeben, wo sie in strenger Verborgenheit gehalten und mit allem Bedacht gemästet werden, bis sie unförmlich feist sind. Dann werden sie die sklavischen Ehefrauen ihrer Eigentümer. Besonders traurig ist das Los der Zwillinge. Das sind arme Geschöpfe, für die niemand ein Herz Hut. Im Gegenteil. Die Neger fürchten Zwillinge mehr als den Tod und machen ihnen deshalb gleich nach ihrer Geburt den Garaus. Man zwängt sie in einen irdenen Topf und wirft sie in den Busch den Leoparden zum Fraß. Die unglückliche Mutter aber, die ihnen das Leben gegeben hat, wird erbarmungslos in den Wald gejagt, wo sie einsam und allein ihr Dasein fristen muss.“
Topf, in den Zwillinge getan werden.
Mary Slessor schrie bei dieser Schilderung laut auf und war empört über diese Grausamkeit.
Dann rief sie erregt aus: „O, ich werde gegen diese gräuliche Unsitte ankämpfen, und will die armen Zwillinge zu retten suchen!“
„Tue das“, erwiderte Mammy Anderson, „und wollte Gott, wir hätten hundert solcher Mädchen, wie du bist, um überall zu helfen und zu retten.
Mary sprang auf ihre Füße: „Aber vor allem“, sagte sie, „tut es not, dass ich erst die Landessprache tüchtig lerne. Denn so lange ich diese nicht gemeistert habe, kann ich wenig oder nichts tun.“
Sie warf sich mit aller Macht auf die Erlernung der Efiksprache und hatte es darin bald zu einer solchen Fertigkeit gebracht, dass die Eingeborenen sie beglückwünschten und meinten, sie sei mit einem Efikmund gesegnet. Nun konnte sie auch dem Drang ihres Herzens folgen und erfolgreich ihre Arbeit in der Schule und in den Häusern von Duketown tun. Es war freilich nur ein kleines und oft wechselndes Häuflein schwarzer Kinder, die sich in ihrer Schule einstellten, denn es herrschte kein Schulzwang, und die Eingeborenen hatten wenig Verständnis für die Wohltat einer geistigen Ausbildung. Aber Mary Slessor hatte ihre Freude an den schwarzen Buben und Mädchen, die zum Teil in Adamskleidung mit der Schiefertafel und dem Lesebuch auf dem Kopf, mit dem Griffel im Kraushaar daher getrottet kamen. Ihre Bekanntschaft mit den Kindern führte sie auch zu deren Eltern, die sie in ihren Hütten aufsuchte, wo sie mit ihnen ernste Zwiegespräche führte und guten Samen ausstreute.
So vergingen drei volle Jahre in rastloser Arbeit. Die fremde Welt von Kalabar war ihr zum Heim geworden. Aber so sehr auch ringsum die Natur des Landes in tropischer Fülle prangte, so heimtückisch war das dortige Klima. Unter dem häufig auftretenden Fieber und seinen entnervenden Folgen hatte auch die sonst kräftige und gesunde Mary zu leiden, und sie kam dadurch selbst dem Tode nahe. In ihrer körperlichen Schwäche meldete sich auch mitunter das Heimweh mit seiner nagenden Sehnsucht. Sie begrüßte es deswegen mit Freude, dass sie im Sommer 1879 ihren ersten Urlaub antreten durfte. In sehr geschwächtem Zustand ging sie an Bord eines Dampfers, der sie der schottischen Heimat entgegenführte.
*
Im freundlichen Kreise der Ihrigen verbrachte sie ein volles Jahr und erholte sich in der Pflege ihrer Mutter und in der gesunden Luft Schottlands so gut, dass sie im Herbst 1880 wieder nach Kalabar zurückkehren konnte. Sie erhielt jetzt ihre Arbeitsstätte unter der Frauenwelt von Oldtown, einer Stadt etwas flussaufwärts von Duketown, die besonders übelberüchtigt war. Sie lebte hier wie eine Eingeborene in einer armseligen Hütte, die nur aus Erdmauern und Bambus errichtet war und ein Dach von trockenen Palmwedeln aufwies. Auch ihre Kost war die der Eingeborenen, bestehend aus Jams (einer Knollenfrucht), Pisang (einer Bananenart) und Fischen. Mancher Europäer hielt sich über ihre spartanische Lebensweise auf und machte darüber seine Bemerkungen, aber Mary Slessor hatte ihre guten Gründe, die sie niemandem verriet. Sie sparte, um ihre alte Mutter zu unterstützen.
Kalabarstädte im Flussgebiet
Ihr Einfluss im Gebiet von Oldtown machte sich bald bemerklich. Die Stadtbewohner beanspruchten das Recht des direkten Handels mit den europäischen Handelshäusern an der Küste für sich allein und hinderten die Inlandstämme, ihr Palmöl und sonstigen Landesprodukte direkt an die Küste zu bringen. Diese Handelssperre rief natürlich blutige Zusammenstöße hervor, zumal das Land damals noch nicht britisches Kolonialgebiet war. Mary Slessor dachte, das darf nicht so fortgehen und sann darauf, dem Übel entgegenzuarbeiten. Sie erlaubte den inländischen Händlern ihren Weg über das Grundstück der Mission zu nehmen und so hinter dem Rücken der Stadtwächter an den Flussstrand zu gelangen. Die Stadtleute waren zwar darüber aufgebracht, konnten es aber nicht verhindern. Schließlich mussten sie den direkten Handelsverkehr freigeben.
Nun galt es den Kampf gegen den Zwillingsmord aufzunehmen. Ihre Liebe zu den kleinen schwarzen Kindern war bald bekannt, und man nannte sie allgemein die „kinderliebende Ma“. Die Bezeichnung Ma ist in der Efiksprache ein Ehren- und Respektsname, den man angesehenen Frauen gibt, und da Mary Slessor von weiß und schwarz allgemein „Ma Akamba“ (die große Ma) oder einfach „Ma“ genannt wurde, so wollen wir uns im Folgenden auch gelegentlich dieses Ehrentitels bedienen.
Eines Tages kam ein junger schottischer Kaufmann zu ihr, der in seinen Armen ein kleines Negerkind trug. „Ma“, sagte er, „da habe ich draußen im Wald dieses Baby gefunden. Es ist ein Zwilling. Das andere Zwillingskind ist getötet worden, und auch dieses wäre bald gestorben, wenn ich es nicht rechtzeitig gefunden und aufgelesen hätte. Ich weiß. Sie haben die Kinder gern. Da ist es!“