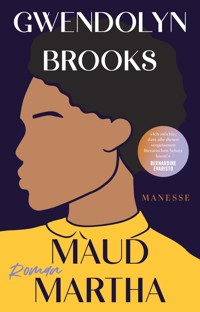
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
«In den Händen einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftstellerinnen erhebt sich das Alltägliche zu einem hinreißenden Porträt einer Schwarzen Frau.» Claudia Rankine
Die sensationelle Entdeckung aus der US-Moderne, erstmals auf Deutsch!
Maud Martha Brown wächst in den 1920ern in der South Side von Chicago auf. Inmitten von verfallenen Kneipen und überwucherten Gärten träumt sie von New York, von der großen Liebe, von einer heiteren Zukunft. Sie schwärmt für Löwenzahn, verliebt sich das erste Mal, dekoriert ihre erste eigene Küche, bekommt ein Kind. Auch ihr hellhäutigerer Mann hat Träume: vom «Foxy Cats Club», von anderen Frauen, vom Krieg. Und dann ist da als allgegenwärtiger Begleiter noch der Rassismus dieser Zeit, angesichts dessen es nicht immer leicht fällt, Gleichmut und Würde zu bewahren.
In lakonischen Vignetten skizziert Gwendolyn Brooks den Alltag einer jungen Schwarzen Frau und erschafft dabei große Weltliteratur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Ähnliche
Die sensationelle Entdeckung aus der US-Moderne, erstmals auf Deutsch!
Maud Martha Brown wächst in den 1940ern in der South Side von Chicago auf. Inmitten von verfallenen Kneipen und überwucherten Gärten träumt sie von New York, von der großen Liebe, von einer heiteren Zukunft. Sie schwärmt für Löwenzahn, verliebt sich das erste Mal, dekoriert ihre erste eigene Küchenzeile, bekommt ein Kind. Auch ihr hellhäutigerer Mann hat Träume: vom «Foxy Cats Club», von anderen Frauen, vom Krieg. Und dann ist da als allgegenwärtiger Begleiter noch der Rassismus dieser Zeit, angesichts dessen es nicht immer leicht fällt, Gleichmut und Würde zu bewahren.
In lakonischen Vignetten skizziert Gwendolyn Brooks den Alltag einer jungen Schwarzen Frau und erschafft dabei große Weltliteratur.
Gwendolyn Brooks
Maud Martha
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Andrea Ott
Mit einem Nachwort von Daniel Schreiber
MANESSE VERLAG
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 1953 unter dem Titel Maud Martha bei Harper & Row Publishers, New York.
Übersetzerin und Verlag danken dem Deutschen Übersetzerfonds e. V. für die Förderung dieser Übersetzung.
Copyright © The Estate of Gwendolyn Brooks, 1953
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe by Manesse Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Den Umschlag und den Vorsatz gestaltete das Münchener Favoritbüro
unter Verwendung von Motiven von © Eleonora Fadda/Arcangel Images
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-30052-4V003
www.manesse-verlag.de
Inhalt
1 Beschreibung von Maud Martha
2 Frühlingslandschaft: Ausschnitt
3 Liebe und Gorillas
4 Großmutters Tod
5 Du bist so lieb, so nett
6 Im «Regal Theatre»
7 Tim
8 Zuhause
9 Helen
10 Der erste Verehrer
11 Der zweite Verehrer
12 Maud Martha und New York
13 Bronze
14 Alle werden sich wundern
15 Die Kitchenette
16 Das junge Paar zu Hause
17 Maud Martha verschont die Maus
18 Wir sind die einzigen Farbigen hier
19 Wenn man hell ist und langes Haar hat
20 Eine Geburt
21 Stützen
22 Tradition und Maud Martha
23 Die Kitchenette-Bewohner
24 Eine Begegnung
25 Selbstbeschwichtigung
26 Maud Marthas Tumor
27 Paul im «011 Club»
28 Nächstenliebe
29 Hutsalon
30 Bei den Burns-Coopers
31 Auf der Vierunddreißigsten Straße
32 Mutter kommt zu Besuch
33 Kindheitsdämmerung
34 Zurück aus dem Krieg!
Nachwort: Eine Ballade gelebten Lebens
Editorische Notiz
Für meine Familie
Maud Martha wurde 1917 geboren. Sie lebt noch immer.
1
Beschreibung von Maud Martha
Sie mochte Schokolinsen und Bücher und gemalte Musik (tiefblau oder zartsilbern) und den sich wandelnden Abendhimmel, von den Stufen der hinteren Veranda aus betrachtet. Und Löwenzahn.
Sie hätte auch Lotosblumen gemocht oder Sommerastern oder Japanische Iris oder Wiesenlilien – ja, auch Wiesenlilien, weil sie schon bei dem Wort «Wiese» begann, tiefer zu atmen, entzückt die Arme hochriss oder gern hochgerissen hätte, je nachdem, wer bei ihr war, hinauf zu dem, was da womöglich vom Himmel aus zuschaute. Aber hauptsächlich sah sie Löwenzahn. Gelbe Alltagsedelsteine, mit denen das geflickte grüne Kleid ihres Hinterhofs verziert war. Sie mochte diese nüchterne Schönheit, mehr noch aber ihre Alltäglichkeit, denn darin glaubte sie ein Abbild ihrer selbst zu erkennen, und es war tröstlich, dass etwas, was gewöhnlich war, gleichzeitig eine Blume sein konnte.
Und gerngehabt werden konnte! Gerngehabt zu werden war der innigste Herzenswunsch von Maud Martha Brown, und manchmal, wenn sie ihren Löwenzahn nicht anschaute (denn man schaute ihn ja nicht ständig an, oft musste man Tische und Stühle abstauben oder Tomaten schneiden oder Betten machen oder einkaufen gehen, und in den kälteren Monaten gab es überhaupt keinen Löwenzahn), dann war es kaum zu glauben, dass ein Ding von nur alltäglichem Reiz – wenn man die Reize einer Blume überhaupt alltäglich nennen konnte – ebenso leicht zu lieben war wie etwas herzerobernd Schönes.
So wie ihre Schwester Helen!, die mit ihren fünf Jahren nur zwei Jahre jünger war als sie und fast genau so groß und schwer und stark wie sie. Aber ach, diese langen Wimpern, diese Anmut und die feinen Bewegungen ihrer Hände und Füße.
2
Frühlingslandschaft: Ausschnitt
Die Schule wirkte solide. Bräunlich roter Backstein, schmutzig weiße Steinsimse. Massiver Schornstein, unverkleidet, seriös. Der Himmel war grau, allerdings machte die Sonne irgendwo da oben kleine silberne Versprechungen, Andeutungen. Es windete. Das sollte ein Junitag sein? Er glich eher den letzten Novembertagen. Es war mehr als ziemlich düster. Trotzdem, es gab da diese kleinen Versprechungen, halb im Verborgenen; ob sie sich erfüllten, konnte niemand wissen.
Mit dem Wind wehten die Kinder die Straße entlang und bogen um die Ecke in den braunroten Backsteinschulhof. Es war wunderbar. Rosa Farbtupfer, blaue, weiße, gelbe, grüne, purpurrote, braune, schwarze, getragen von zappelnden kleinen Stängeln, braun, hellbraun oder schwarzbraun, wehten an den unschönen, grauen, verfallenen Wohnhäusern entlang, vorbei an den Fleckchen mit schmutzigem, spärlichem Gras, die tapfer ihre schmalen Fahnen hochhielten: Rasen bitte nicht betreten – frisch gesät. In den Gebäuden gab es Leben. An diesen klitzekleinen Leben wehten die Kinder vorbei. Zwang, Verbot, Würgegriff – darüber machten sie sich keine Gedanken. Sie unterhielten sich kreischend darüber, wie man Locken oder Pompadour-Frisuren fixierte, über «eklige» Jungs und «klasse» Jungs, über Joe Louis, über Eiscreme, Fahrräder, Baseball, über Lehrer und Prüfungen, über Duke Ellington, über Bette Davis. Sie sprachen – zumindest Maud Martha – über den Süßkartoffelpie, der zu Hause auf den Tisch käme.
Es war sechs Minuten vor neun. In einer Minute würde es zum letzten Mal klingeln. «Los! Ihr kommt zu spät!» Leise Rufe. Schnellere Schritte. Wippende Schultaschen. Unvermeidlich jedoch das dicke Mädchen, das unbedingt lässig wirken wollte, das so tat, als wäre es ihm egal, ob es zu spät kam, das auf keinen Fall rennen würde! (Weil dann alles an ihr so würdelos wabbelte.) Unvermeidlich auch die Jüngelchen in Kniebundhosen, zehn, zwölf, dreizehn Jahre alt, lässig einfach nur, weil es Spaß machte – trödelten noch auf dem roten Pflaster herum, warfen sich Bälle zu, lasen Zeitungen und Comics oder boxten einander halb spielerisch.
Aber am Ende war auch der letzte Windhauch nach drinnen geweht, und fünf Minuten nach neun war der Schulhof leer. Nirgendwo eine Kappe oder eine Haarschleife.
3
Liebe und Gorillas
Der Gorilla ist also tatsächlich entkommen!
Sie war sich sicher, jetzt, wo sie wach war. Denn wach war sie. Das war Wachsein. Sich räkeln, mit den Fingern wackeln – sie fühlte sich von dem zusammengeknüllten, dünnen rauchgrauen Bettzeug noch einigermaßen geschützt vor dem plötzlichen Angriff der roten Vorhänge mit den weißen und grünen Blumen, dem Bild mit der Mutter und dem Hund, die mit einem Baby schmusten, und der Kommode mit den blauen Papierblumen darauf. Aber auf keinen Fall gab es einen Zweifel daran, dass sie jetzt ernsthaft erwacht war.
Dieser Zug – eine Art Doppeldeckerbus, der durch blau gefüttertes Halbdunkel fuhr. Langsam fuhr. Langsam. Eher wie ein Boot. Vor dem Gorillakäfig hielt er an. Der Gorilla lag auf dem Rücken, die Arme unterm Kopf, ein Bein lässig über das andere geschlagen, und beobachtete die Leute. Dann stand er auf, trabte zur Käfigtür hinüber, spähte hindurch, umklammerte die Stäbe, rüttelte an den Stäben. Die Leute von unten kletterten alle aufs Oberdeck.
Aber warum stiegen sie nicht aus?
«Motorschaden!», rief der Busfahrer. «Motorschaden! Und der Gorilla wird wohl ausbrechen!»
Aber warum stiegen die Leute nicht aus?
Dann flackerte es grün und dann rot und dann orange, und sie war mittendrin, viele Male so alt wie ihre paar Jahre, kein Zweifel, denn sie wurde wie eine Erwachsene behandelt. Alle Leute hatten Angst, aber niemand stieg aus.
Alle Leute fragten sich, ob der Gorilla entkommen würde.
Als sie wach war, wusste sie es.
Sie war in Sicherheit, aber die anderen – hatte er sie gefressen? Und wenn ja, hatte er mit den Köpfen angefangen? Und konnte er solche Dinge wie Knöpfe und Uhren und Haare fressen? Oder riss er die vorher ab?
Maud Martha stand auf, und auf dem Weg ins Bad warf sie einen Blick auf die halb offen stehende Tür ihrer Eltern. Die Eltern lagen eng nebeneinander. Vaters Arm hielt die Mutter umschlungen.
Ach, wie schön!
Denn sie dachte an gestern Abend. Wie der Vater prahlerisch hinausgestiefelt war, in seinem besten Anzug und Hut, und die Mutter allein blieb. Später waren sie und Helen und Harry mit der Mutter zu einer «Nachtwanderung» aufgebrochen.
Wie sie diese «Wanderungen» liebte! Besonders am Abend, da war alles düster, seltsam, herrlich bedrohlich, immer geduckt und bereit, einen anzuspringen, was doch nie geschah. Östlich von Cottage Grove sah man weniger Leute, und die man sah, hatten alle weiße Gesichter. («Wie seltsam», dachte Maud Martha.) Dort drüben war dieses Geheimnisvolle, Hingeduckte noch dichter, hundertmal dichter.
Kurz nachdem sie heimgekommen waren, kam auch Daddy. Die Kinder wurden ins Bett geschickt, und Maud Martha entschwand in den Schlaf und zu ihrem Gorilla. (Obwohl sie das anfangs noch nicht gewusst hatte, o nein!) Mitten in der tiefsten Nacht war sie wach geworden, nur ein bisschen, und hatte «Mama» gerufen. Und Mama hatte geantwortet: «Klappe!»
Es machte dem kleinen Mädchen nichts aus, so barsch zum Schweigen gebracht zu werden, wenn die Mutter Ruhe haben wollte, damit sie und Daddy einander lieb haben konnten.
Denn sie war sehr, sehr froh, dass der Streit vorüber war und sie wieder nett zueinander waren.
Auch wenn Mama so furchtbar lieb und gut zu ihr war, solange der laute Hass oder die stumme Kälte andauerten.
4
Großmutters Tod
Sie mussten in einem kleinen Vorraum sitzen und warten, bis die Schwestern Gramma trockengelegt hatten.
«Sie hat das nicht mehr unter Kontrolle», erklärte Maud Marthas Mutter.
Ach, du liebe Zeit! Du liebe Zeit.
Als sie endlich hineindurften, gingen Belva Brown, Maud Martha und Harry auf Zehenspitzen in den fahlen Raum, im Gänsemarsch.
Gramma lag in einem Holzsarg, so kam es Maud Martha vor. An beiden Seiten des Bettes waren Bretter befestigt, damit die Patientin sich nicht verletzen konnte. Schon den ganzen Vormittag, teilte ihnen eine Schwester mit, habe Ernestine Brown versucht, aufzustehen und heimzugehen.
Sie blickten in den Sarg. Maud Martha wurde es übel. Das war nicht ihre Gramma. Konnte es nicht sein. Lang gezogenes, schwammig wirkendes Gesicht. Geschlossene Augen. Die Wimpern wie feucht, die Lider schwer. Eine gerade, flache, dünne Gestalt unter einer dunkelgrauen Decke. Und die Stimme dumpf und rau. «Oh … Oh … Oh …» Maud Martha hatte Angst. Aber das durfte sie nicht zeigen. Sie sprach die Halbtote an.
«Hallo, Gramma. Ich bin’s, Maudie.» Und einen Augenblick später: «Erkennst du mich, Gramma?»
«Oh …»
«Geht es dir besser? Tut dir irgendwas weh?»
«Oh …» Jetzt schüttelte Gramma leicht den Kopf. Sie schlug die Augen nicht auf, aber offenbar verstand sie, was man sagte. «Und vielleicht auch», dachte Maud Martha, «was wir nicht sagen.»
Wie allein sie waren, wie weit weg von dieser Frau, dieser gewöhnlichen Frau, die plötzlich zu einer Königin geworden war und für die sich bald die aufregendste aller Türen öffnen würde. Auch wenn sie mit ihrem «Oh …» zwischen Brettern eingesperrt dalag, war sie die haushoch Triumphierende, während sie selbst dastanden und all die dummen Fragen stellten, wie man sie Kranken aus Scheu stellt, halb entsetzt, halb neidisch.
«Ich habe noch nie jemanden sterben sehen», dachte Maud Martha. «Aber gerade sehe ich jemanden sterben.»
Was war das für ein Geruch? Wann wollte ihre Mutter gehen? Viel länger hielt sie das nicht aus. Was war das für ein Geruch? Sie wandte eine Weile den Blick ab. Die anderen Patientinnen im Zimmer anschauen, nicht Gramma! Die anderen waren weiße Frauen. Es waren drei; zwei verhutzelte, die schliefen, und eine dicke Frau um die sechzig, die verwirrt aussah, aufrecht im Bett saß und jammerte: «Warum kommt niemand und bringt mir eine Bettpfanne? Warum nicht? Niemand bringt mir eine Bettpfanne.» Sie packte Maud Marthas Mantelsaum, starrte aus blauen Augen, hell wie Glas, zu ihr hoch und bettelte: «Sagst du ihnen, sie sollen mir eine Bettpfanne bringen? Ja?» Maud Martha versprach es, und die schwache Hand fiel nach unten.
«Die Arme», sagte die dicke Frau mit einem zärtlichen Blick auf Gramma.
Als sie endlich das Zimmer und das letzte «Oh …» hinter sich ließen, berichtete Maud Martha einer Schwester, die gerade durch den Flur ging, von der Frau mit der Bettpfanne. Die Schwester verzog den Mund. «Die kann warten», sagte sie nach kurzem ungehaltenem Schweigen. «Das machen die den ganzen Tag, die ganze Nacht – nach der Bettpfanne jammern. Wir können ihnen nicht alle zwei Minuten eine neue Bettpfanne bringen. Vergessen Sie’s einfach, Miss.»
Sie zogen los, den langen Korridor hinunter. Maud Martha legte den Arm um ihre Mutter. «O Mama», wimmerte sie, «sie … sie sah furchtbar aus. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe noch nie ein so schreckliches … Geschöpf gesehen …» Es fiel ihr schwer, die Tränen zurückzuhalten. Und was ihren Bruder Harry betraf, so hatte der noch kein Wort gesagt, seit sie das Krankenhaus betreten hatten.
Als sie nach Hause kamen, erhielt Papa einen Anruf. Ernestine Brown war tot.
Sie, die mit den Kindern von Abraham Brown in den Zirkus gegangen war, ihnen rosa Popcorn und Peanut-Crinkle-Bonbons gekauft hatte, die gelacht hatte – diese Ernestine war tot.
5
Du bist so lieb, so nett
Maud Martha musterte das Wohnzimmer. Zerschrammtes altes Klavier. Abgewetzter Ledersessel. Drei oder vier Stühle, schon lange ohne jede Spur der kümmerlichen Würde, die sie anfangs gehabt haben mochten, und merklich angewidert von sich selbst und der Familie Brown. Ein Kaminsims mit verschnörkeltem Zierrat, der normalerweise durchaus geschmackvoll wirkte, seit heute früh aber unsäglich ordinär und untragbar geworden war.
In dem traurigen Teppich beim Sofa war ein kleines Loch. Kein ungeheuerliches Loch. Aber es schauderte sie. Sie stürzte zum Sofa und verschob es, bis das Loch nicht mehr zu sehen war.
Sie schnüffelte ein paarmal. Es hieß ja oft, die Häuser der Farbigen hätten unweigerlich einen bestimmten starken, unangenehmen Geruch. Das war Unsinn. Bosheit – und Unsinn. Aber sie öffnete alle Fenster.
Jetzt hieß es, die Theorie der Rassengleichheit in die Praxis umzusetzen, und sie hoffte nur, dass sie ausgeglichen genug für diese Gleichheit war.
Egal, wie angespannt man vor Furcht ist, der Absturz lässt sich nicht aufhalten …
Um sieben Uhr meldete sich ihr Herz zu Wort, und sie versicherte sich mit Nachdruck, dass sie Charles zwar mochte, dass sie Charles bewunderte, aber dass sie Charles nur an der Highschool sehen wollte.
Das war kein Willie oder Richard oder Sylvester, der da zu Besuch kam. Und sie war auch nicht Charles’ Sally oder Joan. Sie war die ganze «farbige» Rasse, und Charles war die Verkörperung des gesamten weißen Konzepts.
Drei Minuten vor acht klingelte es, zögerlich. Charles! Zweifellos bedauerte er seine Anwandlung schon. Zweifellos betrachtete er reumütig und voller Verachtung die Hausfassade, die dringend einen neuen Anstrich bräuchte. Die wackeligen Stufen. Sie zog sich ins Bad zurück. Kurz darauf hörte sie, wie ihr Vater zur Tür ging – langsam ging er, ihr Vater, geduldig, furchtlos, als würde er gleich einen Zeitungsjungen hereinlassen, der sich seine zwanzig Cent abholte, oder einen Versicherungsagenten oder Tante Vivian oder jemanden wie Woodette Williams, ihre alberne Freundin.
Was spürte sie jetzt? Keine Angst, nein, keine Angst. Eine Art Dankbarkeit! Ekelhaft war das. Als ob Charles’ Kommen ein Geschenk wäre.
Empfänger und Wohltäter.
Das ist so lieb von dir.
Du bist so lieb.
6
Im «Regal Theatre»
Der Applaus war lebhaft. Und die Stille … endgültig.
Das dachte Maud Martha, sechzehn und in betont aufrechter Haltung, als sie sich im Foyer des «Regal Theatre», Ecke Siebenundvierzigste und South Park, durch die schwerfällig hinausströmende Menge schob.
Über Ruhm dachte sie nach und über diesen Sänger, diesen Howie Joe Jones, ein riesiges, glänzendes braunes Etwas mit zu Wellen pomadisiertem Haar, vorlauten Zähnen, Augen wie dünnem Glas. Und mit – einer Stimme. Einer Stimme, die Howie Joes Agentur als «wilden Honig» beschrieb. Auf Maud Martha hatte sie keinen besonderen Eindruck gemacht. Es hatte sie nicht gepackt. Nicht einmal, als er den Kopf zurückwarf, sodass seine Locken nach hinten fielen, als er selig die Augen schloss, sich wand, die Arme ausbreitete (geradezu die ganze Welt umfasste) und leidenschaftlich ernst, bedeutungsschwer und wirkungsvoll donnerte:
«… Sa-WEET sa-OOOO
Jaust-a YOOOOOOO …»
Maud Martha runzelte die Stirn. Das Publikum hatte applaudiert. Befremdlich ausgelassen gestampft. Die Finger in den Mund gesteckt und gepfiffen. Die Augen funkeln lassen. Aber jetzt gingen die meisten nach Hause, wie sie selbst auch, und ihre Gesichter waren wieder leer. Es hatte ihnen nicht geholfen. Nicht so richtig. Nicht viel. Für eine leidenschaftliche halbe Stunde hatte es einen dünnen Schleier über ihre kleinen Nöte und Eintönigkeiten gebreitet, aber nun waren sie wieder da, unverhüllt, hartnäckig, bösartig wuchernd wie eh und je. Das Publikum hatte nur Feengold bekommen. Und es würde Howie Joe Jones keineswegs für den Rest seines Lebens dankbar sein, ja nicht einmal für den Rest des Abends. Nein, keiner hatte vor, ihm ein dauerhaftes Denkmal zu errichten.





























