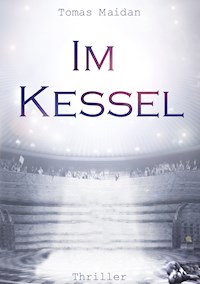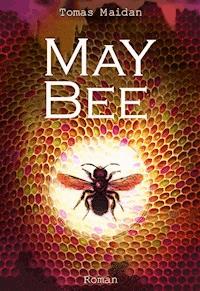
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mays Leben ist verzwickt. Erst entläuft ihr Kater Lou, dann rettet sie den falschen Mann vor dem Bus und schließlich bekommt sie die saure Gurke unter den verzwickten Fällen: Sie muss Konsul Bolaire finden, einen korrupten Widerling, der im Schloss Taubenschlag verschwunden ist. Man sagt, dort draußen würde eine Drogenbaronin ihre letzten Pillen an die Bienen verfüttern. Mysteriös. Entnervt von Bürokratie und Beamtenmief bricht May nur mit ihrer Freundin Tuh auf; einer durchgeknallten Kioskbesitzerin, die mit bengalischen Experimenten und der Laune einer rollenden Zitrone dafür sorgt, dass der Fall zum bunten Trip wird. Zwischen bösen Bienen und magischen Pilzen entdecken die beiden Entsetzliches. Zum Glück lernt May den schüchternen Jo kennen, der so romantisch die Krümel der Butter-Hörnchen wegwischen kann. Wird es den Drei gelingen, die Honig-Hölle zu versalzen? MAY BEE ist Märchen, Krimi, Rock and Roll. In einer Welt voller Bullen machen May und Tuh die Fliege - und entdecken, dass man auch im Alleingang die Richtigen retten kann. Ein kafkaeskes Abenteuer beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tomas Maidan
MAY BEE
Der Honig-Trip
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Zwei Wege
Vorweg
1. Jemand haut ab
2. Zur grünen Nixe
3. Reden ist Silber
4. Vorbereitung
5. Doom
6. Home Sweet Home
7. Ein edler Wilder
8. Tequila
9. Bienenfleiß
10. Wer A sagt muss auch B sagen
11. Der Mentor
12. Infraschall
13. It takes two
14. Feinstoffliche Resonanz
15. Landgang
16. Ein Flüchtling
17. Familie Zwerg
18. Land und Leute
19. In der Halle der Bienen-Königin
20. Daumen hoch für die Baronin
21. Hier würde selbst Neil sich ekeln
22. Sonnenbad zur Mitternacht
23. Vorwärts Kameraden, wir müssen zurück
24. Schnauze voll?
26. Zwischenbilanz
27. Von Gurken und Zitronen
28. Die Wahrheit und der Brei
29. Der einzige Weg hier raus führt nach unten
30. Im Keller
31. Nachtgespräch
32. Shooting Star
33. Magische Pilze
34. Heureka
35. Einmal Panzer, immer Panzer
36. The Sound of Music
37. Ertrunken im taumelnden Himmel
38. Heimkehr
39. Die Früchte der Liebe
40. Come as you are
Impressum neobooks
Zwei Wege
Kata im Karate ist eine Übungsform, die aus stilisierten Kämpfen besteht, welche gegen imaginäre Gegner geführt werden.
Kumite bezeichnet eine Trainingsform in japanischen Kampfkünsten. Im Wettkampf stellt das Kumite den Kampf zweier Gegner ohne vorherige Absprache der Techniken dar.
Die Gurke - Cucumis sativus - ist eine Gemüseart aus der Familie der Kürbisgewächse. Sie gehört zu den wirtschaftlich bedeutendsten Gemüsearten. Über ihren Geschmack findet sich bei Wikipedia kein Eintrag.
Die Zitrone ist die etwa faustgroße Frucht des Zitronenbaums - Citrus limon - aus der Gattung der Zitruspflanzen. Wegen ihres intensiven Geschmackes ist die Zitrone als Geschmacksverstärker seit jeher beliebt.
Vorweg
1. Jemand haut ab
»So ein Wahnsinn«, schrie May, »ein Kater darf doch nicht vorne auf die Straße raus!«
Busse donnerten wie motorisierte Büffel vor ihrer Haustür. Rushhour in Kujai-City. Die Hölle mit einer Million Kilowatt.
May hatte immer befürchtet, dass so ein Unglück eines Tages passieren könnte: Dass Lou aus Neugierde oder aus Blödheit den unglücklichsten Moment erwischte, und er auf seinen niedlichen aber treulosen Katerpfoten einfach abhauen würde. Genau das tat er jetzt! Und raus war er.
Die Innenstadt von Kujai-City stellte alles andere als ein Kleintierparadies dar. Seit Ende des Rückeroberungskrieges wuchs die Metropole zum Zentrum eines labyrinthischen Imperiums an. Hier donnerten Schwertransporter über achtspurige Fahrbahnen, hier schütteten Drogeriebesitzer bläuliche Kanister in den Hofeinfahrten aus. Und unter den anfeuernden Lichtern der Spielhallen zielten Jugendliche mit ihren Gummizwillen auf alles Mögliche. Bierdosen, Obdachlose und Ratten trafen sie im Schlaf. Dies war kein Ort für Kater.
May war gemeinsam mit Lou aus dem Keller heraufgekommen, doch der kleine Schnuffel bog im entscheidenden Moment einfach zur falschen Seite ab. Er lief nicht nach hinten in den Garten, wo er sein Reich mit Bäumen und einem alten Schuppen in Ruhe hätte durchkreuzen können, sondern er zwängte sich durch den Türspalt zur Straße hinaus. May fluchte und rannte. Dabei musste sie ihre typischen, strudelförmigen Gedanken denken, in denen fortwährend zwei Thesen miteinander Katz und Maus spielten: ›Im Leben hatte man immer zwei Möglichkeiten: rechts oder links. Hin oder her. Raus oder rein.‹
Und Lou zischte raus.
May stolperte die Stufen hinab und knallte gegen die Scheibe. Aua! Sie drückte die Klinke - doch nichts öffnete sich. Jemand hatte die Kindersicherung aktiviert! Weder für Kinder noch für Idioten und schon gar nicht für Katerfreundinnen gab es ein Hinauskommen. May rüttelte. Welcher verdammte Nachbar hatte die Idiotensicherung einrasten lassen? Sie sprang beim Zurücklaufen über ihr Rennrad im Flur - und in der Wohnung angekommen, durchwühlte sie das gesamte Schlüssel-Board. So eine Scheiße, dachte sie, seit wann brauchte man einen Schlüssel, um aus der Wohnung zu kommen? Überhaupt: Kinder! Wer hatte überhaupt noch Zeit für Kinder? May besaß nicht einmal Zeit, ein Kind zumachen. Ein Dreiviertelstündchen sollte man dafür schon übrig haben - und von Zeit für die Aufzucht konnte sowieso nicht die Rede sein.
Mit krallenartigen Fingern durchpflügte sie alle Fächer, während sie sich in katerblutroten Farben ausmalte, was genau Lou da draußen alles ›Schönes‹ erleben mochte. Ob er gleich von einem Bus zerquetscht würde, oder ob er vorher noch Knallfrösche um die Ohren bekam? Sie rannte hinaus.
Lärm, Autohupen, Menschen in hirnlosen Formen und Farben empfingen sie. Ein Strudel voller Hindernisse zwang sie in einen bunten Parcours. Von hinten röhrte ein Motorradfahrer mit Vollgas an ihr vorbei. Er raste auf dem Hinterrad zweihundert Meter über den Fußweg, drehte einen irrsinnigen Kreis und schaffte es sogar, über einen Müllbeutel hinweg zu springen. Super, dachte May, im Zirkus musste man dafür Eintritt zahlen, aber in Kujai-City gab es eben alles gratis. Benzingestank stach ihr in die Nase. Graue Fassaden schwitzten übellaunig in der Abendsonne. Aber kein Lou, kein Katerschwanz, nicht einmal ein einzelnes Barthaar konnte sie in dem dynamischen Inferno ausmachen. Verdammt, er konnte doch nur in die eine Richtung gerannt sein, Richtung Zentralplatz. May lief.
Oder in die andere Richtung? So war das immer im Leben: Man hatte immer genau zwei Möglichkeiten. So, oder so. Rechts oder links, Kater oder Katze, Mops oder Maus, Sein oder Nichtsein. Gurke oder Zitrone. Immer, wenn May Stress bekam, konnte sie nicht aufhören, solchen Quatsch zu denken.
Sie lief nach links.
Ihre Wut steigerte sich mit jedem Schritt, den sie - da war sie jetzt völlig sicher - in die falsche Richtung lief. Komischerweise verstärkte sich dieses Gefühl sogar dann, wenn sie die Richtung änderte. Je mehr Menschen an ihr wie Slalomstangen bei einer Skifahrt vorbeischossen, desto dicker schwoll in ihr der Klumpen aus Wut und Verzweiflung an.
Immer schneller lief sie. Und obwohl sie sich einzig für ein Wesen interessierte, das sechzig Zentimeter lang und rotbraun gestreift war, blieb ihr Blick plötzlich an diesem Mann hängen. Er bewegte sich so sonderbar. Wie in Zeitlupe ... Er glitt wie ein Taucher unter Wasser durch den Kosmos der Innenstadt. Dann drehte er sich und ließ sich rückwärts treiben - gegen den Strom der Menschen und gegen jede Vernunft. Gegen die Welt, gegen das Leben ... Er schien nicht mit dem Strom zu schwimmen, vielmehr sah es aus, als ob er aus einem fremden Universum hinüber geweht wurde, willenlos ... Sein Anblick fesselte Mays Aufmerksamkeit sofort. Er blickte viel zu häufig in die Höhe, wie sie fand, leicht hätte er auf ein kleines Tier am Boden treten können. Dann betrachtete er gedankenverloren die Häuserfassaden, so, wie man die Gemälde in einem Museum ansah. Er kniff dabei die Augen zu schwärmerischen Schlitzen zusammen und beobachtete auch viel zu lange einen Hubschrauber, der über dem Tempel kreiste. May wollte weiter nach Lou suchen, doch da wankte der Zeitlupen-Mann ohne klaren Blick auf sie zu. Und plötzlich geschah alles gleichzeitig: Ein Bus bog fauchend um die Ecke, die Welt des Tempos brach rücksichtslos in den Stillstand ein. May wollte weiter laufen, und den Hans-Guck-in-die-Luft nicht weiter beachten, da -
... packte sie ihn.
Sie dachte nicht nach, es war ein Reflex, etwas das man tut, ohne sein Hirn einzuschalten. Mays Spezialdisziplin. Der Bus dröhnte neben ihr, kampfbereit glänzten seine Scheiben und die rasende Trutzburg rauschte an ihr vorbei. Ein Ungeheuer aus rollendem Metall. Staub und Lärm flogen May ins Gesicht. Sie aber riss den Kerl mit aller Kraft an seiner Kapuze und schmiss ihn regelrecht zu Boden. Uhhh ...
Der Bus, der ihn mit Gewissheit überrollt hätte, schoss boshaft hupend geradeaus. Der Kerl wäre glatt davor gelatscht! Hätte May ihn nicht gepackt, wäre er überfahren worden, todsicher.
May besah sich das Werk ihres Zupackens. Er war so hart auf den Boden geschlagen, dass er benommen dalag. Hatte er sich ernsthaft verletzt? Sie wollte weiterlaufen und nach Lou suchen, aber etwas hielt sie auf. Der Kerl, er mochte in ihrem Alter sein, krümmte sich am Boden. May wischte sich die Haare aus der Stirn. Die Situation entwickelte sich gar nicht gut, schließlich sah es für Passanten jetzt womöglich so aus, als hätte sie ihn angegriffen. Schlägereien kamen in dieser Gegend pausenlos vor, meistens tauchten schnell Polizisten auf, und die diskutierten nicht lange. Die interessierten sich nicht für die Frage, wer Täter und wer Opfer war, das wusste May aus eigener Erfahrung, schließlich war sie selbst angehende Kommissarin. In Kujai regierten kühle Hektik, grauer Wahnsinn und urbane Idiotie.
Gehetzt blickte sie zu den Passanten, die wie Raben an der Haltestelle schliefen. Einige sahen sie fragend an, andere gingen blass und schmierig weiter. Keine Chance, Lou noch zu finden. Aber es war doch besser gewesen, fand May, den Kerl auf diese Weise zu retten, als wenn er vom Bus überfahren worden wäre!
»Was bist du für ein Idiot«, schrie May aus heiseren Lungen zu dem Mann hinunter. Der Wind riss ihr jedes Wort humorlos von den Lippen. Sie sah den Fremden an, wie er über die Platten kullerte. Er wirkte benommen, vielleicht stand er unter Schock. Auf jeden Fall schien er gar nicht mitbekommen zu haben, dass er jetzt eigentlich tot sein müsste. Stell dir vor, du bist tot, und merkst es nicht mal! So eine Scheiße, dachte May, jetzt geht der mir hier auch noch hops ... Und ich bin schuld daran! Sie sah zu den Leuten, die mit blassen Kuhgesichtern vorbei trotteten. Ein Kerl, der auf dem Müllcontainer vor einer Bar saß, griff bereits grinsend in seine Jackentasche und brachte eine Zwille zum Vorschein. May hasste diese Straße. Und am Ende würde womöglich May, die doch nur helfen wollte, sogar eine Anzeige bekommen.
Hätte sie den Heini doch einfach laufen lassen, dann könnte sie sich jetzt wenigstens um ihren eigenen Idioten kümmern; jenen, mit den weichen Pfoten. Sie strich sich die Haare aus der Stirn und betrachtete den Kerl. Dunkle Haare, Anfang dreißig, glatt rasiert, unmodische Scheitelfrisur. Vor vierzig Jahren liefen die Männer in Kujai vielleicht so rum. Sie fragte sich, ob er als Schauspieler womöglich gerade einen historischen Film drehte? Sein Gesicht wirkte etwas rundlich, das Kinn wattig. Er ähnelte einem Bär, fand May - allerdings ein kleiner Bär. Oder ein Fuchs? Wie hieß diese kleine Bärenart noch mal, die wie ein dicker Fuchs aussah? Ein Baumbär. Jetzt öffnete er die Augen und starrte zu May hinauf. Gott, er schien völlig verwirrt zu sein ... aber immerhin halbwegs okay. May wollte weiterlaufen. Bestimmt hätte Lou jetzt ihre Hilfe viel dringender nötig gehabt als dieser Trottel hier. Sie konnte sich schließlich nicht um alle Streuner der Stadt kümmern. Doch als sie jetzt aus der Nähe sein Gesicht betrachtete, erkannte sie zwei Dinge. Erstens: Der Kerl sah irgendwie interessant aus. Und zweitens: Er stammte nicht von hier. Vielleicht kannte er keine sechsspurigen Straßen - und offensichtlich kannte er keine Busse.
May verstand das eigentliche Problem: Er war ein Ausländer. Er trug keinen Code an der Schulter und seine Kleidung sah aus, als würden sie aus der Altkleidersammlung stammen. Sein Gesicht besaß die typischen Kennzeichen eines Einwanderers aus dem Norden: lange Augenbrauen, schmale Nase. Nach Kriegsende waren Tausende Söldner in die Metropole geströmt, und die Regierung hatte ganze Bezirke für sie absperren lassen, damit das Land nicht von Millionen entwurzelter Männer überschwemmt wurde. Niemals hätte einer von ihnen in der Stadtmitte herumlaufen dürfen - auch dann nicht, wenn er sich nur vor den Bus werfen wollte.
May atmete durch. Sie prüfte, ob eine Streife in Sicht kam. Damit war nicht zu spaßen. Manche Kollegen eröffneten sofort das Feuer, wenn sie Eindringlinge entdeckten. Links sah sie nichts. Gut. May beobachtete den Liegenden. Glasiger Blick. Der Baumbär befand sich irgendwo im Schlummerland. Sie überlegte, was er alles erlebt haben musste. Schließlich stellte die Innenstadt einen Hochsicherheitstrakt dar, in den nicht einmal eine Maus lebend hinein gekommen wäre. Aber dieser Kerl -
... musste etwas Besonderes sein.
Und wenn er einen Anschlag plante? May tastete schnell seine Jacke ab. Sie spürte, dass sich darunter nichts verbarg. Kein Messer, kein Stock - alles Fehlanzeige. Der Kerl schien ein friedliches Baby zu sein. Ein Idiot, genau wie Lou.
May räusperte sich. Nein, sie wünschte keinen Familienzuwachs. Das hätte ihr gerade noch gefehlt, dass man sie gerade jetzt, kurz vor ihrer Prüfung zur Hauptkommissarin mit einem illegalen Eindringling gesehen hätte. Sie blickte sich um. Ein älterer Mann blieb in einiger Entfernung stehen und glotzte dümmlich. Nicht heute, bitte nicht jetzt, dachte May und drehte den Kopf zur Seite. Sie hatte Feierabend - und jede Menge am Schreibtisch zu tun. Aber dort hinten ... Verdammt! May erkannte die Mützen zweier Polizistinnen, sie patrouillierten über zweihundert Meter entfernt, näherten sich aber zügig.
May richtete sich auf. Sie wischte sich den Schweiß ab, nickte einem alten Mann grüßend zu und eilte mit gesenktem Kopf fort. Was für ein Scheißtag.
2. Zur grünen Nixe
May flüchtete in Tuhs Bude, dem einzigen Ort in dieser Irrsinnsstadt, wo man Urlaub vom Wahnsinn machen konnte. Tuhs Kiosk hieß Zur Grünen Nixe und heute roch es drinnen noch stärker als gewöhnlich nach Badesalz und Honigkuchen. May fand, dass die Bude ein kleines Paradies darstellte, denn hier gab es einfach alles: Eis, Getränke, Spielsachen, Comics und einen Fernseher, in dem Rockmusik lief. Als Leuchtreklame hing über der Metalltür eine schielende Meerjungfrau, die abends den Vorplatz in ein wechselndes, radioaktiv anmutendes Grün tauchte. Nach dem Zwischenfall vor dem Bus war May mehr als froh über Tuhs Gesellschaft. Außerdem bot die Bude Schutz vor den Blicken der Passanten. Dies war kein Ort für Spießer, dies war ein Ort für normale Menschen.
Tuh hieß eigentlich Thusnelda, und oft hatte May sich gefragt, wie lange es dauern würde, bis die beiden dienstlich miteinander zu tun bekämen. Ihr Kiosk stellte nämlich auch für Käufer von Hehlerware, Drogen und anderem Klamauk ein Paradies dar. Alles illegal. Doch May kam nicht zum Schnüffeln, sie hatte Hunger. Großen Hunger.
Während May im Brei ihrer Champignon-Creme rührte, erzählte sie Tuh den Schlamassel mit Lou. Vor allem aber die Geschichte mit dem merkwürdigen Fremden wollte sie unbedingt loswerden.
»Und du hast dem Kerl nicht geholfen?« schnaufte Tuh und warf ihren Scheitel aus der Stirn. Fast einen halben Meter lang schwang die rote Haarsträhne über ihr Gesicht und fügte sich in das grellbunte Gewimmel aus Zigaretten- und Kaugummipackungen ein, zwischen denen sie mehr lag als saß. Ihre gelben Springerstiefel hatte sie fröhlich wackelnd auf den Tresen gelegt. Wie immer, wenn sie den Lauf der Welt kommentierte, verzog sie ihr schmales Gesicht zu einem Ausdruck, als würde sie an einer Zitrone lutschen.
»Ach, nein ...«, schmatzte May und winkte ärgerlich mit dem Löffel. Sie blickte skeptisch zu ihr hinüber. Tuh hatte ihren Scheitel hinter das mit Nieten verzierte Ohr bugsiert. Ihr Kopf, der auf einer Seite kahl geschoren war, und dort von Tätowierungen bemustert wurde, glänzte wie eine Kugel am Weihnachtsbaum. Aus dem Spalt ihrer Brüste fischte Tuh jetzt ein Feuerzeug und ratschte wie besessen an dem Zündstein. Manchmal schnappte vor ihrer spitzen Nase eine viel zu hohe Flamme empor und Tuh starrte lange hinein. Sie führte die Flamme bis an die Spitze ihrer Haare, die manchmal zu knistern begannen. Ihre Haare rochen immer komisch, und May fürchtete, dass Tuh sich irgendwann den ganzen Kopf in Brand setzen würde. Heute roch es nach Banane. Oder besser: nach verbrannter Banane.
Eigentlich besaß Tuhs Anblick bereits einen gewissen Unterhaltungswert, fand May. Genau das Richtige gegen Stress. Bis über beide Schultern kroch über Tuhs Haut ein tätowiertes Geflecht aus Totenköpfen, dornigen Rosen und wirbelndem Stacheldraht. Andere Leute lasen Zeitung, May guckte sich Tuh an. Immer was Neues.
»Und du hast den Kerl einfach liegen gelassen?« bohrte Tuh mit höher dosierter Zitrone in der Stimme nach.
»Ja nun«, schmatzte May, »was hätte ich machen sollen? Ich hatte es eilig und für Ausländerbekämpfung bin ich nicht zuständig.« Sie sah, dass Tuh heute Plastikelefanten als Ohrringe trug. May wusste nicht, ob sie über den modischen Einfall lachen sollte - oder über die Frage nachdenken, warum die Suppe nach Schuhcreme schmeckte.
»Ja, aber«, näselte Tuh, »du kannst doch nicht erst einen Typen auf der Straße niederschlagen, und ihn dann einfach liegen lassen?«
»Warum nicht?« May blickte wie ein Klempner, der eine Schraubmuffe über den Anschlag drehte.
»Also«, erwiderte Tuh und kratzte sich am Elefanten, »als ich so was das letzte Mal gemacht hab', kamen die Bullen und haben mir erzählt, das wäre irgendwie verboten.«
May sagte nichts und schaufelte schneller, um den rostigen Geschmack durch Anstrengung zu relativieren.
»Aber du hast den Typen doch gar nicht umgehauen, wenn ich das richtig verstanden habe«, nörgelte Tuh.
»Erzähl das mal den Bullen.«
»Bullen ... Ich dachte, du bist selber einer. Oder eine Bullin.«
»Eben. Ich bin vom Fach. Ich kenne Bullen. Außerdem bin ich kein Bulle, sondern eine moderne Oberkuh. Und mein Büro ist meine Weide.«
»Mannomann, bin ich froh, einen ordentlichen Beruf zu haben.«
»Richtig«, gratulierte May, »selbstständiger Kaufmann - das ist solide.« May sah, wie Tuh ihr Kaugummi zu einem Faden verarbeitet hatte und ihn jetzt als fröhliches Flechtwerk um den ausgestreckten Mittelfinger wickelte. May wollte sich von dem Anblick nicht den Appetit verderben lassen und baggerte konzentriert weiter. Als sie den Boden des Tellers freigelegt hatte, spürte sie sogar eine Art von Erleichterung, die man beinahe mit dem Gefühl von Sättigung hätte verwechseln können.
»Hat's gemundet?« fragte Tuh.
»Top!« May würgte und streckte einen Daumen in die Höhe, als hätte sie gerade einen Kampfjet auf einem Flugzeugträger bei Orkan gelandet. Dann griff sie nach hinten und packte in traumwandlerischer Routine einen Schoko-Riegel.
»Und der Typ ist dann einfach liegen geblieben?« fragte Tuh, ohne ihr klebriges Kunstwerk aus dem Schielblick zu lassen.
»Nee, halt dich fest, es kommt noch besser.« May knüllte die Folie des Schoko-Riegels zu einem Ball, ging zum Ausgang und spitzelte durch den Türspalt. Als eine Gruppe Jugendlicher am Fenster vorbei schlenderte, warf sie das Papier hinaus. Es traf den Größten der Gruppe am Ohr. May schlug schnell die Tür zu und schob den Riegel davor. Mittagspausen, fand sie, wurden erst durch kleinere Gesetzesübertretungen richtig schön.
»Von der anderen Straßenseite aus«, sagte sie, »habe ich gesehen, wie der Kerl sich wieder aufgerappelt hat.«
»Na, dann ist ja gut. Hat er sich wenigstens schnell verpisst, bevor er noch anhänglich wird? Manchmal sind solche Typen ja ziemlich streichelbedürftig.«
»Ja, das ist es ja«, kaute May die Worte hervor, »der Kerl muss total verpeilt gewesen sein. Wie er es in die Stadt hinein geschafft hat, ist mir schleierhaft. Man durchbricht doch nicht alle Barrieren, robbt womöglich durch die Rohre der Abgasanlagen, um sich anschließend einfach ein wenig die Beine zu vertreten.«
»Meinst du, der wollte was anstellen? Mensch May, hör mal, vielleicht wollte der etwas in die Luft jagen! Und du rettest den auch noch! Hättest ihn ruhig vom Bus überrollen lassen - und du hättest bestimmt noch die Ehrennadel bekommen. Kujai gratuliert Maria Birgit Calla, Sicherheitshauptobermeisterin des Sektors für Beamtenrecht und Ausländerbekämpfung.« Tuh hatte sich derart in Fahrt geredet, dass die Elefanten klapperten.
May beobachtete die Ohrringe. Wäre Lou jetzt hier, würde er bestimmt auf Elefantenjagd gehen. Sie griff noch einen Eisbecher. Honig-Creme. Mmmm! »Ach was«, schmatzte sie, »der Kerl hatte offenbar gar keinen Plan, wo es lang geht. Wer nicht einmal weiß, was ein Bus ist, der kann auch keine Bombe bauen.«
Tuh rollte die Augen. »Ja, so sind sie, die Typen von heute. Niedlich, aber doof. Träumer und Laschies. Schlimm.«
May gab sich keine Mühe, die letzten Reste von Pilzcreme vom Löffel zu lecken, sondern bohrte mit der Hartnäckigkeit eines Bergarbeiters in dem Eisklumpen. »Quatsch«, sagte sie, »der war harmlos. Aber interessant.« Sie meißelte ein großes Stück heraus und schnappte danach. Süßes Gold!
»Die richtig bösen Buben sind sowieso Mangelware«, schimpfte Tuh. May kannte dieses Lamento bereits zur Genüge. Die geringe Auswahl an für sie geeigneten Partnern stellte neben Kinderfilmen und Auto-Quartetten Tuhs drittes Lieblingsthema dar. Ärgerlich setzte Tuh nach: »Und du rettest sogar noch einen von den Softies. Nachher vermehren die sich sogar - und du hilfst dabei auch noch.«
»Warte mal ab«, sagte May, »die Geschichte wird noch besser. Was glaubst du, was der Kerl dann gemacht hat?«
»Weiss nicht. Hat er dir einen Hunderter geboten?«
»Ach, nun hör aber auf«, schmatzte May. »Der war schon okay.«
»Hört, hört. War der wirklich so niedlich?«
»Na ja ... Also Platz auf dem Sofa hätte ich jetzt ja schon, wo Lou weg ist.«
»Lou? War das der Sack aus der Rechtsabteilung?«
»Nee, mein Kater.«
»Ach so, sagtest du ja. Der war ja genauso fett, wie ein richtiger Typ. Ja nun, dann würde das ja gut passen: Kater weg, Vollidiot da. Sofadelle gefüllt. War der verträumte Fremde denn genauso niedlich, wie dein mausiges Schnuffeltier?«
»Hm, ich weiß nicht. Irgendwie hatte er etwas Interessantes.«
»Hey, hey, hey! Glückwunsch. Ein geistig behinderter Terrorist, gut angebraten durch die Abgase der Müllverbrennungsanlage - welche Frau kommt da nicht ins Träumen?«
May war froh, mit ihrem Eis genug zu tun zu haben, sodass sie nichts erwidern musste. Spontanität sollte reiflich überlegt sein. May setzte ihre Handwerkermiene auf und meißelte.
»Na komm schon«, bohrte Tuh nach, »Frau Polizeiobermeisterin, erzählen sie mir mehr über die Schmetterlinge in ihrem Bauch.«
»Meisterin. Noch bin ich Meisterin.«
»Aha. Na ja, das ist ja wohl nur noch eine Frage von Tagen, bis die Beförderung kommt, bei solchen Leistungen: Unschuldigen Passanten zu Boden geschlagen. Weitergelatscht. Keinen Bericht geschrieben, stattdessen Eis-Essen gegangen. Besser geht's gar nicht.«
May hatte einen katerkopfgroßen Eisklumpen aus dem Becher geholt und hievte die Kugel in Richtung ihrer magnetischen Lippen. Sie glaubte nämlich fest daran, dass sie eine Anziehungskraft zwischen ihrem Mund und jeder Art von Süßigkeit aufbauen konnte - wenn sie sich nur stark genug konzentrierte.
»Ja ja, faul und verfressen«, setzte Tuh ihre Live-Berichterstattung fort, »so lieben wir unsere Oberschicht von Kujai! Maul aufreißen, wenn es ums Futtern geht. Bis zum Feierabend kann man so den Arbeitstag mit jener ungeilen Action füllen, die andere Leute Arbeit nennen würden.«
»Also, der Kerl war schon in Ordnung«, schmatzte May. Auf Beamtenbeleidigung sollte man immer sachlich reagieren, hatte sie gelernt. Oder abwiegeln. »Also, der Kerl hatte irgendwie, na ja, etwas Besonderes.«
»Ui! Der Trottel vom Bus hatte also etwas Besonderes. Wie aufregend. Habt ihr schon ein Date? Wollt ihr euch mal gemütlich zu zweit vor den Bus werfen?«
»Ach hör doch auf. Ich meine, stell dir das doch einmal vor: Der ist ganz alleine aufgebrochen und hat sein Leben riskiert. Einfach nur so, um spazieren zu gehen. Was mich aber wirklich umgehauen hat«, fuhr May unbeirrt fort, »war, wie er dann weitergegangen ist.«
»Ach? Gehen konnte dein romantischer Tollpatsch dann doch?«
»Ja, und, halt dich fest: Er ist direkt in den Tempel marschiert.«
»Uhhh«, brummte Tuh in besorgter Oktave. »Na, da hat er sich ja die Königskrone im Reich der Vollidioten reserviert.«
»Mmm, könnte man so sagen.« May kratzte die Eispackung aus. Sie wandte dafür eine spezielle Technik an, bei der man den Löffel so schräg wie möglich hielt und die Reste vom Eis erst von der Seitenwand nach unten trieb, wo man dann am Ende alles mit einer tückischen Harke in die Enge kehrte und in einem Rutsch zusammenfegte. Sie nannte das: Kesseltreiben in der Honighölle.
May war, was selten vorkam, endlich satt und beschloss, diesen vermurksten Tag fürs Erste zu vergessen. Zumindest ihre magnetischen Kräfte funktionierten wieder.
3. Reden ist Silber
Über ein halbes Jahr verging voller Routine-Fälle, die May eifrig vom Schreibtisch aus bearbeitete. Drogendelikte, Körperverletzungen, Diebstähle, Einbrüche. Hirnrissige Streitereien voller Wenn und Aber. May sichtete die Protokolle, schrieb Dienstpläne und schleppte Akten zur Staatsanwaltschaft. Büroarbeit von der bienenfleißigen Sorte. In ihrem Herzen aber hatte sie den Verlust von Lou noch längst nicht verschmerzt. Ihr Sofa blieb weiterhin unbesetzt - und dass ein neuer Platzhalter in menschlicher Gestalt die Lücke eines Tages würde ausfüllen könnte, daran glaubte sie schon lange nicht mehr. Einzig die Vorbereitung für ihre Prüfung zur Kommissarin lenkte sie ein wenig von der leeren Sofadelle, dem Futternapf und der unbenutzt daliegenden Fellbürste ab. Und auch den Fremden hätte sie längst vergessen, wäre sein Bild nicht eines Tages wieder in ihrem Leben aufgetaucht. Es geschah auf der Elf-Uhr-Konferenz.
May saß eingezwängt zwischen Tim Vogler, einem jungen Kollegen, den sie seit der Schule kannte, und Frau Zmich, der gefürchteten Vorzimmerspinne aus der Recherche. May blinzelte durch den verdunkelten Konferenzraum. Zwischen den projizierten Lichtbalken dozierte Generalreferent Milton, ein hagerer Riese mit der Ausstrahlung eines müden Geiers. Er deutete auf Fahndungsfotos und Luftbilder, brummte Aktenzeichen und streute seine üblichen, schlüpfrigen Scherzbemerkungen ein, über die nur er selbst schmunzeln konnte. Immer wieder blickte er heimlich auf die Armbanduhr. Die Bilder zeigten aus verschiedenen Perspektiven das Umland von Kujai.
Aus jeder Ecke kroch ein Gähnen durch den Raum. Es roch nach verbranntem Kaffee, Lustlosigkeit und dem Aftershave von Gert Schmit, der vor May saß und ein sorgsames Technokraten-Schweigen schwieg. May wurde bereits von seiner Anwesenheit übel, und sie war sich nicht sicher, ob dies einzig an dem Geruch von Mandarinen in Kernseife lag.
Der Fall, den Milton referierte, war in die Kategorie »P« eingestuft worden. »P«, wie politisch brisant. Eine Mischform, die einerseits hohe Relevanz, andererseits einen gewissen Klärungsbedarf anzeigte. Für die Ressorts der Reviere bedeuteten diese Fälle zunächst einzig: zur Kenntnisnahme.
Und selbst die war schwer zu leisten. Den jüngeren Kollegen wie Kettler, Lowski und Vogler - zu denen auch May zählte - gelang es noch am besten, halbwegs interessierte Effekte auf ihre Gesichter zu zaubern. Hier lag der darstellerische Ehrgeiz sichtbar höher, als bei den Älteren, wie Frau Zmich und Projektkoordinator Ochsfort. Zmich prüfte den Schliff ihrer Fingernägel, während Ochsfort in einem Fachmagazin für Uhren blätterte.
Das Gesicht des Trottels tauchte völlig überraschend für May auf der Leinwand auf. Sie erkannte ihn sofort; sein sanfter Blick, der hilflose Ausdruck ... Die Güte eines kleinen Bären. Er war einer der Verdächtigen, die mit dem Verschwinden des Großkonsuls Frederick Bolaire in Verbindung gebracht wurden.
Milton bellte: »Bolaire ist tot. Wir wissen nicht, was genau mit ihm passiert ist, aber wir benötigen endlich ein ordentliches Staatsbegräbnis. Alle warten auf die normative Kraft des Faktischen.«
Prompt zischte die Stimme von Schmit durchs Aftershave: »Und wenn der Konsul noch lebt?«
»Ausgeschlossen«, schnaufte Milton mit der Selbstsicherheit einer Planierwalze. »Niemand vermisst Bolaire. Denn wenn er noch lebt - dann heißt das? Nun, hat jemand von ihnen eine Antwort parat?«
Der Schatten, der zu Miltons Stimme gehörte, schob sich zwischen die Linien aus Licht. Wie ein Magier in einem Varieté sah er aus, dachte May, und stellte sich vor, wie er einen Zauberhut aufsetzen und jemanden hypnotisieren würde.
»Dann heißt das nichts Gutes«, kam es aus dem Raum. Der nächste Schleimer war erfolgreich aktiviert worden.
»Richtig«, jubelte Milton, dem auch ohne Zauberhut eine ordentliche Show gelang. »Und warum verheißt das nichts Gutes?«
»Nur wer lebt, kann noch mal wiederkehren.«
»Bingo!« japste Milton. »So sieht es nämlich aus: Der größte Konsul aller Zeiten könnte zurückkehren. Agil und geschäftstüchtig, wie am jüngsten Tag.«
Jetzt regte sich eine Unruhe im Saal, die in Empörung umschlug, bis sie von Miltons Stimme wieder gedämpft wurde: »Dann wäre es Essig mit den kleinen Annehmlichkeiten der Marktwirtschaft, von denen«, er senkte die Stimme, »auch einige der Anwesenden gelegentlich profitieren. Also, ich weiß nicht, ob alle hier im Kollegium mit der Weitergabe von Materialfunden an den Herrn Konsul persönlich einverstanden wären.«
Langes Schweigen. Irgendwo schrumpfte ein Kichern zu einem belustigten Hüsteln. May atmete durch den Mund.
»Falls es noch nicht alle mitbekommen haben: Unser werter Frederick Bolaire ist vor vier Monaten von einem kleinen Jagdausflug nicht mehr zurückgekehrt. Irgendwo in der Gegend um Matruk ist er verschwunden. Ziemlich dünn besiedeltes Gelände.« Er zeigte auf die Einblendung einer Landkarte: Blasse Flächen, in deren Mitte ein Fleck wie eine Narbe lag. »Das einzige größere Gebäude ist das Anwesen einer gewissen Baronin Tanabe.« Er senkte die Stimme. »Vielleicht hat sie unseren Großkontrolleur zum Fressen gerne gehabt?«
Aus dem Kichern erhob sich wieder Schmits Stimme: »Aber, was sind denn die Fakten? Großkonsul Frederick Bolaire, Vorsitzender des Staatsrates für Auswärtiges, Schutzpatron der kujanischen Polizei, besucht ein Landwesen, von dem wir wissen, dass es 75 Kilometer nordwestlich der Stadt liegt, und das von ihm zu Jagdzwecken besucht wurde. Korrekt?«
»Korrekt.«
»Was sagt sein Büro zu der Sache?«
»Nichts. Private Termine werden nicht protokolliert.«
»Private Termine, sieh an. Und was wissen wir über diese Baronin? Steht sie in Verbindung mit regierungsfeindlichen Gruppen?«
»Genau das lässt sich kaum sagen. Wir haben Hinweise, dass sie sich mit Leuten umgibt, die zum Clan von Sandra Castiglione zählen. Alles deutet auf eine friedliche Koexistenz der Damen hin.«
»Was uns ja alles herzlich egal sein könnte, da die ganze Sache sowieso nicht zu unserem Distrikt gehört«, sagte Schmit. »Es stand bisher keinem Kujaner gut zu Gesicht, sich in die Angelegenheiten dieser Dame einzumischen. Die einen liefern ihr Koks, die anderen Nutten. Die Dritten holen die Schläger von der Straße und lassen sie im Tempel als Gladiatoren kämpfen.«
May dachte bei diesen Worten daran, wie der Fremde in Richtung des Tempels getorkelt war. Der Ärmste, dachte sie, da war er mitten hineinspaziert ins Zentrum der hiesigen Unterwelt.
»All das geht uns nichts an«, fuhr Schmit fort, »solange alles friedlich bleibt. Bolaire hat sich selbst eine goldene Nase verdient, bei seinen Geschäften mit der Castiglione. Es besteht kein Anlass, das Bienennest aufzuscheuchen.«
»Tja«, seufzte Milton, »wenn die Sache so einfach wäre. Wir haben Hinweise, dass sich illegale Einwanderer in der Gruppe um Frau Tanabe aufhalten.«
Sieben Gesichtern erschien auf der Leinwand. May sah, dass der Kleinbär eingerahmt wurde durch Bilder von sechs Frauen. Jetzt wollte May es doch genauer wissen. Sie holte Luft.
»Wissen Sie, Milton«, sagte May, »Entschuldigung, wenn ich mal rein frage, wissen Sie, wer dieser Mann ist?«
Milton drehte sich zu ihr. »Tja, Frau Calla, auch da fischen wir im Trüben. Der hier«, er zeigte auf den Mann, »ist vermutlich ein ehemaliger Soldat aus dem Feldzug in Neu-Sibirien.«
»Ein Killer?« fragte May.
»Tja, da müssten Sie vielleicht die Polizei von Kujai fragen.« Gelächter umkreiste May. »Eigentlich müssten wir eine Hundertschaft hinschicken und das gesamte Gelände umgraben.«
Jetzt ergriff wieder Schmit das Wort: »Kommen Sie Milton, wir schnüffeln doch nicht ohne konkreten Auftrag drauflos.«
»Also, ich verstehe das Problem nicht«, protestierte May. »Wir sind die Polizei von Kujai. Es geht um nichts weniger als das Verschwinden des Ministers für auswärtige Angelegenheiten.« Sie dachte nicht lange nach, als sie dies sprach. Es erschien ihr eine Selbstverständlichkeit zu sein, so, wie man einen Löffel in einen Eisbecher schob. Ein Reflex. Normal. »Es wird der Polizei von Kujai ja wohl gestattet sein, sich nach dem Verbleiben ihres Außenministers zu erkundigen. Warum muss da überhaupt diskutiert werden?«
Ihre Worte verflossen im Raum. Es wurde sonderbar still. Milton kratzte sich am Ohr, Schmit drehte sich zur Seite und betrachtete die Wand. Ochsfort notierte Zahlen in sein Heft. Kettler, ein dürrer Kollege aus der Abteilung D, blickte zu May und zog die Augenbrauen wie unter elektrischem Einfluss in die Höhe.
Gott, wieso sagte denn niemand etwas, dachte May. War dies eine Konferenz - oder eine Beerdigung? Gut, wenn die Herren derart maulfaul waren, dann könnte May gerne noch eine Frage nachschieben. Alte Regel der Kommunikationslehre: Wer fragt, der führt. Also sagte sie: »Was, meine Herren, hindert uns, dort rauszufahren und dieser Baronin ein paar Fragen zu stellen?«
Von draußen hörte man das Geräusch eines Flugzeuges im Landeanflug. Miltons Geierkopf duckte sich ein wenig zwischen seinen Schultern. »Gegenfrage, Frau Calla, wo Sie hier schon mit solchen rhetorischen Fragen operieren: Sind wir hier beim Quiz?«
»Quiz? Äh, nein, wieso Quiz? Ich wollte doch nur sagen, dass -«
»Sie ziemlich blauäugig an die Sache herangehen.«
Gelächter.
»Das hat doch nichts mit blauäugig zu tun.«
»Unterbrechen Sie mich nicht, Frau Kollegin«, fuhr Milton dazwischen, »ich verstehe ihre Unzufriedenheit, aber Sie sollten respektieren, dass wir hier einen kollegialen Umgangston pflegen. Und ich möchte auch die Jüngeren im Raum bitten, sich dem anzuschließen. Frau Calla, haben wir uns da verstanden?«
May nickte und spürte, wie ihr das Blut in den Wangen tanzte. Was wollte Milton nun eigentlich sagen? Wenn er Schiss hatte, auf dieses Schloss hinauszufahren, sollte er es doch einfach sagen. Innerlich biss sie sich auf die Zunge. Hätte sie bloß die Klappe gehalten. Worüber wollte der Mann sich eigentlich streiten? Er war der Leiter der Hauptaufklärung, es war allein seine Entscheidung. Mehr als Engagement zeigen, wie May es getan hatte, konnte er sich von seinen Leuten doch nicht wünschen. May hatte Bereitschaft gezeigt - im Gegensatz zum Rest des Kegelvereins. Nun war er dran.
Milton sagte: »Nun, Frau Calla, nun sind Sie dran.«
May zog verdutzt die Augen rund. »Ich?«
»Genau, Sie. Sie müssten sich jetzt entscheiden, was Sie eigentlich wollen. Möchten Sie denn diesen Fall übernehmen?«
May saß etwas ratlos da. Möchten, möchten ... Sind wir jetzt bei Wünsch-Dir-Was, fragte sie sich. Sie hatte doch nur Engagement zeigen wollen. Und, na ja, vielleicht war auch ein wenig Neugierde dabei, etwas über den Kerl zu erfahren, den sie damals gerettet hatte.
May schüttelte leichthin die Schultern, als hätte man sie gefragt, ob sie in der Lage wäre, einen Schoko-Riegel zu essen. Ja, natürlich, selbstverständlich. Sie war demnächst Polizeihauptmeisterin, sie war gesund, hatte keine weiteren Verpflichtungen. Zuhause konnte die Fellbürste auch alleine rumliegen. Warum sollte sie ihre Arbeit nicht tun? Gott, wie lächerlich. Sie blickte zur Decke. Jetzt musste sie sich auch noch dafür grillen lassen, dass sie den Willen gezeigt hatte, während ihrer Arbeitszeit zu arbeiten.
»Und?«
»Ja, natürlich.« May zuckte mit den Schultern.
»Was? Natürlich? Calla, Sie könnten ruhig einmal ihre Kommunikation den Regeln der allgemeinen Verständlichkeit anpassen. Dass würde ihrem hübschen Gesicht nämlich auch gutstehen.«
Was war dieser Milton für ein Arsch, dachte May und sagte: »Selbstverständlich würde ich eine solche Untersuchung leiten.«
Die Übrigen sahen sie stumm und backig an. Frau Zmich tat so, als würde sie innerlich ein endloses Für und Wider abwägen und ließ den Kopf erst zwei Millimeter nach links, dann drei nach rechts pendeln. Ochsfort polierte seinen Taschenrechner. Vogler rieb sich den Bart. Kettler steckte die Hände in die Hosentaschen und rutschte mit seinem Körper in eine diagonal liegende Position. Wäre ein Fahrtwind aus Richtung seiner Füße aufgezogen, dann besäße er nun optimalen Luftwiderstand. Schmit überprüfte den Würgegriff seiner Krawatte. Meine Güte, dachte May, die Lahmärsche würden hier so lange sitzen, bis sämtliche Verbrecher Kujais sich persönlich an der Pforte melden und um ihre Verhaftung bitten würden.
»Also gut, wenn Sie derart darauf drängen«, brummte Milton, »würde ich vorschlagen, wir machen Nägel mit Köpfen. Meine Herrschaften, ich denke, Sie sind einverstanden, wenn wir Kollegin Calla mit dem Fall betreuen. Wie haben Sie sich denn die Zusammenstellung ihres Teams vorgestellt, Frau Kollegin? Wir erwarten unverzüglich eine Aufstellung der Mitglieder ihres Einsatzkommandos.«
May blickte verblüfft um sich. War das jetzt eine Beförderung? Dafür ging alles ziemlich schnell.
»Wertes Kollegium, mit Blick auf die Uhr schließe ich die Sitzung und erwarte ihre Ergebnisse zum nächsten Dienstag.«
Stühle rückten ab. Weg frei für die Mittagspause.
May ging unschlüssig hinter den anderen her. Die ganze Sache war sonderbar schnell gelaufen, und sie wusste nicht, ob sie sich mit Kettler oder Vogler noch weiter darüber besprechen sollte. Dass es sich um ein schwieriges und bei den meisten Kommissaren unbeliebtes Projekt handelte, wusste sie. Eigentlich wollte sie nur an einer Art Kontroverse teilnehmen. Sich einbringen. Zumindest das Ausmaß des Einsatzes, die personelle und finanzielle Ausstattung und vor allem der zeitliche Rahmen hätte doch viel präziser definiert werden müssen. Sollte sie für einen Nachmittag da hinausfahren, oder eine wochenlange Observation organisieren? Auf welche Ressorts konnte sie für die Recherche zugreifen? Die privaten Aktivitäten des Konsuls waren ein höchst sensibler Bereich; seine Verbindungen zur Halbwelt offensichtlich. So ein Wahnsinn, dachte May, dort blind drauflos zu ermitteln.
Sie trat von hinten in die Ferse von Schmit.
»Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht ... Schmit, Pardon.«
»Schon gut, schon gut.« Schmit dreht sich um und sah sie aus problematischen Augen an. »Na, Sie haben es ja ganz schön eilig.«
Das stimmte. May wollte zügig in ihr Büro kommen und ein Gespräch mit Schmit war das Letzte, was sie gebrauchen konnte. Sie hielt Schmit für einen Schleimer der üblen Sorte. May sah ihn verlegen an. Seine Wangen pickelten voller Nikotin-Akne. Die Haare hingen ihm in dünnen Linien herab. Sie wich seinem Blick aus.
»Ich kann gut verstehen«, zischte Schmit, ohne die Lippen zu bewegen, »dass Sie ein wenig aufgeregt sind. Kurz vor der Beförderung noch mit einem solchen Projekt betreut zu werden, ist nicht ungefährlich. Der Konsul, der Konsul. Ein dicker Fisch.« Schmit beherrschte die Kunst, die Worte aus gemeißelten Lippen herauszupfeifen. Er blickte zu May, wie ein Arzt bei schlimmer Diagnose.
»Ja, das finde ich auch«, nickte May. »Wenn man nur mehr wüsste, über die Gegend dort draußen.«
»Tja, aber das werden Sie ja alles demnächst selbst in Augenschein nehmen. Frau Baronin scheint dort ein Sanatorium für müde gewordene Drogenkuriere zu betreiben. Vielleicht verfüttert sie ihre letzten Pillen an die Piepmätze?«
Endlich wurde es stiller um sie und May konnte ihre Gedanken sortieren. »Aber gut, dass ich Sie noch auf ein Wort treffe, Herr Kollege. Was ich nicht verstanden habe, ist die Sache mit dem Team.«
»Was gibt es denn daran, nicht zu verstehen?«
»Nun, Team ... Kann ich mir da irgendwen aussuchen?«
Schmit blieb stehen. »Irgendwen aussuchen?« Er wiederholte die Worte, als habe May vorgeschlagen, mit ihrer Oma auf Ermittlung zu gehen. »Gute Güte, Frau Kollegin.« Schmit schien völlig konsterniert. Er beugte sich dichter zu ihr, als fürchte er, jemand könne seinen Worten lauschen. »Haben Sie denn noch nie ein größeres Team für einen Einsatz zusammengestellt?«
»Doch, doch, aber das waren meistens Leute aus der Recherche. Und einer, der den Wagen gefahren hat.«
Schmit stellte seine Tasche zu Boden und sah May aus investigativen Augen an. »Aber Frau Kollegin, Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie noch nie von den Vorschriften zur Besetzung einer C3-Klassifikation gehört haben?«
»C3?«
»C3. Das hier ist ein ganz klarer Fall für eine C3-Klassifikation. Da braucht man doch gar nicht weiter drüber nachzudenken. Wir sind in solchen Fällen mehr als gut beraten, uns exakt an die Vorgaben zu halten. Calla, selbstverständlich beginnen Sie mit einem C3-Team, und wenn die Bedingungen für eine Vergrößerung gegeben sind - und erst dann«, er zog die Stimme empor, wie ein Kampfjet nach erfolgreichem Bombardement, »erst dann können wir über eine Ausweitung des personellen Rahmens überhaupt erst anfangen nachzudenken.«
May nickte. »Ja ja, selbstverständlich ...«
Schmit fing ihren absinkenden Blick auf und zog ihn mit forschendem Sog wieder nach oben. »Sie wissen doch, was die Klassifikation für einen C3-Einsatz vorschreibt?«
May nickte. Verdammt, nein, sie wusste es nicht.
»Ja, selbstverständlich, weiß ich das«, log sie.
Schmit sah sie prüfend an.
»Es ist nur eben«, stammelte May, »schon eine Zeit her, dass es auf der Akademie durchgenommen wurde.«
Schmit drehte den Kopf in einer taumelnden Bewegung zur Seite. Das hatte ihm offenbar gerade noch gefehlt: eine leitende Kommissarin, die nicht einmal die Fachbegriffe kannte. »Ich soll es ihnen erklären? Das ist ja wohl nicht ihr Ernst?«
»Ich wollte sowieso gleich in den Unterlagen nachsehen.«
Schmits Oberkörper begann, in einem unterdrückten Lachen zu wippen. »Hach, ihr jungen Leute macht mir Spaß. Gut, dass Sie nicht zur Fahrerin befördert wurden, sonst käme die Truppe nicht mal beim Rückwärts-Ausparken vom Hof.«
May verfluchte sich, dass sie überhaupt etwas auf der Konferenz gesagt hatte. War sie es, die diesen Konsul retten wollte? War sie die barmherzige Samariterin für diesen Paten der Polizei, der sich bei einem Ausflug von seinen Kokshändlern hatte umlegen lassen? Stand auf ihrer Stirn der Hinweis geschrieben Ein Herz für Trottel? Und wieso war sie nicht längst in ihrem Büro wie die anderen? Die würden jetzt an ihren Bildschirmschonern neue Muster einstellen und sich die Kringel so lange angucken, bis der Feierabend kam. Dann würden sie auf dem Heimweg die Funde des Tages an ihre Dealer verscheuern und alles hätte seine Ordnung. Nur May, blöde, wie sie war, hatte ihre Klappe nicht halten können. Und das hatte sie nun davon:
C3.
»Also Schmit, nun machen Sie es mal nicht schwieriger«, knurrte May, »als es eh schon ist. C3, ja klar, das ist ein Haufen von Bullen, von denen einer den Oberbullen macht und die anderen Flankierschutz geben. Meine Güte, nun tun Sie mal nicht so, als wenn man dafür in Cambridge studiert haben müsste.« Sie blies eine Haarsträhne vom Mund. So. Endlich mal Klartext.
Schmits Augen wurden klein und detailverliebt. Flapsigkeiten dieser Art waren nicht sein Ding. Er arbeitete ja auch nicht auf der Straße und Kundenkontakt hatte auf ihn nicht abgefärbt. Also sagte er wie ein englischer Lord, den man in der Teepause gestört hatte: »Ein C3-Kommando, ich sage es ihnen gerne, ein C3-Kommando besteht, wie der Name bereits sagt, aus zehn Mann. Meinetwegen auch aus zehn Damen.«
»Zehn?«
»Zehn. Soll ich ihnen das auch noch erklären?«
May schwieg. Sie wusste, dass es sinnlos war, mit Schmit darüber zu debattieren, was man hier unter Logik verstand.
»Die Vorschrift sieht zusätzlich zum leitenden Kommissar zehn Einsatzkräfte vor, von denen drei offen und sieben verdeckt arbeiten. Offen in Erscheinung treten der persönliche Assistent des OKLs, dazu ein Videotechniker mit integrierter Kamera, ebenso ein Audiotechniker, für akustische Dokumentation. Diese Drei bilden den sichtbaren Teil und sollten mit Manieren und wachem Hirn in das Sozialgefüge der Zielpersonen eingeführt werden. Sie können folgen?« Er hielt drei Finger in die Luft. May musste an Tuh denken, die in einer solchen Situation so lange herumgezaubert hätte, bis am Ende die Zahl Eins im Mittelpunkt gestanden hätte - und ihr ausgestreckter Mittelfinger übrig geblieben wäre. Aber Schmit war nicht Tuh. Er betrieb die Zahlzauberei mit schlauem Ernst: »Dazu kommen zwei Kräfte aus der Nahkampfabteilung, dazu zwei Mann aus der Kommunikation, auch Dolmetscher genannt. Falls Sie sich mit chinesischen Messerstechern unterhalten möchten.«
May nickte. Endlich nahm das Projekt anschauliche Züge an.
»Dann brauchen Sie noch einen Fahrer, Transport Mannschaftswagen und einen von der Sprengstoff-Erkennung. Die schönsten Razzien wurden schon vor Beginn beendet, weil beim Eintreten des Kommissars das ganze Bienennest in die Luft geflogen ist. Aber so etwas kennen Sie ja aus der Schulung.« Schmit machte eine aristokratische Pause. »Theorie beherrschen Sie ja ziemlich gut, wie ich höre. Theorie und Gymnastik.«
Mays Mund klappte auf. Sie wusste, worauf er anspielte: Darauf, dass May beim Polizeisport mehrmals in der Disziplin Kata teilgenommen hatte. Letzte Woche hatte sie sogar eine Silbermedaille gewonnen. Idioten wie Schmit nannten das Gymnastik - dabei trug Kata, eine Jahrtausende alte Bewegungsabfolge, den Geist des Karates viel klarer in sich als Kumite, dem eigentlichen Wettkampf gegen einen Gegner. Kata war genauso Karate wie Kumite - nur übte man alleine. Was für ein Arsch war Schmit, dass er versuchte, sich gerade darüber lustig zu machen?
May besah sich die Fläche an der Wand. Gymnastik, so so. »Und diese ganzen Leute, die darf ich mir alle selbst aussuchen?«
»Wer sonst? Immerhin sind Sie am Ende ja auch diejenige, die den Angehörigen bei der Beerdigung erklären muss, warum die Sache so glorios in die Hose gegangen ist.«
May nickte. »Danke, Schmit, jetzt wo Sie es sagen, fällt es mir wieder ein. Klar, C3, so war das.«
»So war das.«
Er hob seine Tasche, nickte und verschwand.
May schluckte. Bis Dienstag, zehn Mann, für eine Kamikaze-Aktion, die niemand wollte. Toll.
Sie starrte die blassgrünen Gänge entlang und blies den Atem aus. Was wohl der kleine, dicke Lou jetzt trieb?
4. Vorbereitung
Glatte zwei Stunden vor Dienstbeginn kam May am nächsten Tag ins Büro und begann sofort, am Computer zu arbeiten. Solide Vorbereitung war das A und O von strukturierter Arbeit. Ihre Laune blühte früh am Morgen immer prächtig, das war ihre Prime-Time. Und so umschmeichelte sie sämtliche infrage kommenden Ressorts mit präzise formulierten Mails: Fahrdienst, Tontechnik, Personenschutz, Team-Assistenz. Zehn Kollegen müsste man ja wohl zusammentrommeln können, dachte sie, für einen Ausflug ins Grüne. May würzte alle Anfragen mit professioneller Freundlichkeit.
Während sie für den Personenschutz bereits konkrete Vorstellungen hatte - Tim und Lowski, mit denen sie bereits zusammengearbeitet hatte - war ihr der Bereich Technik völlig fremd. Da sollten tatsächlich Leute mit versteckten Kameras neben ihr stehen? Gott! Normalerweise untersuchte May Tatorte, da gab es eingeschlagene Scheiben, aufgebrochene Schubladen und geschwätzige Nachbarn zu besichtigen, aber es kamen niemals versteckte Kameras zum Einsatz. May war Polizistin und keine Spionin. May Bond, im Auftrag ihrer Dicklichkeit ... Lachhaft. Was immer diese Baronin dort draußen auf dem Kerbholz hatte - man musste mit extrem unfreundlichen Reaktionen rechnen, sollten Mikrofone bemerkt werden. May seufzte. Ziemlich heikel das Ganze. Und man konnte durchaus den Eindruck gewinnen, Milton wäre es sehr recht gewesen, sollte May ebenso wie der Konsul von ihrem Landausflug nicht zurückkehren.
Sie überflog die erste Antwort. »... aber leider, mit Bedauern ... in diesem Quartal ausgelastet ... Weitergabe an Ressort Inneres ... nicht möglich.« May setzte ein Häkchen. Zur Kenntnis genommen.
Wenn man wenigstens etwas über dieses Schloss in Erfahrung bringen könnte. May öffnete das Programm fürs Archiv und las: staatliche Enteignung vor 90 Jahren, kurzzeitige Nutzung als agrarwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Kornlager, dann Aufgabe wegen Plünderungen ... Über zwei Dekaden schien das Gebäude keinen rechtmäßigen Besitzer besessen zu haben. Sperrvermerk durch das Ministerium. May fraß die Informationen wie Eiskugeln in sich hinein. Nur glücklich wurde man damit nicht.
Aber dafür ein bisschen neugierig. Offensichtlich kontrollierten dort Leute vom Castiglione-Clan gewisse Lieferungen für die Stadt, das verstand May sofort. Sie blätterte durch die Datenbank. Natascha Mitral, 25 Jahre alt, wegen Drogenbesitz in die Fahndung geraten, kein Konsum, Kurierdienste für Morris Heito, Cousin von Sandra Castiglione-Heito. May schob das Bild der schwarzhaarigen Frau beiseite und sah die Nächste: Anna, Nachname unbekannt, flüchtig. Vermutlicher Aufenthaltsort: Residenz Heito, auf dem Tempelgelände. Alle, der hier aufgelisteten Personen standen mit der Familie Heito-Castiglione in Kontakt. Alle hielten sich wie ein Bienenschwarm an die alte Madame gekuschelt. Die merkwürdige Sandra Castiglione ... Sie war keine Unbekannte in der besseren Gesellschaft von Kujai. Jeder wusste, dass ihre Brüder lupenreine Verbrecher waren, während sie das Schöne und Gute der Sippschaft repräsentierte. Die Regierung ließ ihr den Spaß, solange man sich in einigen Geschäften ergänzen konnte.