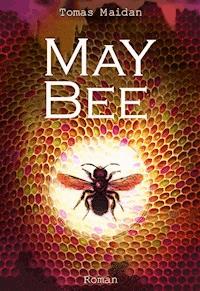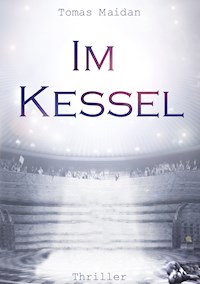
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben dreier Menschen verschränkt sich in einer Nacht: Die schüchterne Anoje fällt bei Madame in Ungnade, weil sie schlechte Ware geliefert hat. Josemin, der Fremde aus dem Vorort, überwindet die Grenzen seines Bezirkes und dringt in die verbotene Nachtstadt ein. Und die schöne Sai schließlich spielt mit doppelten Karten. Während im Kessel zwei Gladiatoren um ihr Leben kämpfen, versteht Josemin viel zu spät: Drei sind einer zuviel. IM KESSEL ist ein Thriller voller überraschender Wendungen - und eine Hommage an die Erotik des Kampfes. Maidan erzählt ein modernes Märchen voller gebrochener Amazonen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Schachmatt durch die Dame im Spiel. Kujai ist eine Parallelwelt, in der Madame Heito, die Chefin der mächtigsten Tirade, unbarmherzige Regeln aufstellt. Im Tempel der Lichter veranstaltet sie den Nationalsport des Landes: Gladiatorenspiele mit völlig gegensätzlichen Kämpfern.
Josemin, ein Fremder aus dem Vorort, überwindet die Grenzen seines Bezirkes, um in die verbotene Nachtstadt einzudringen. Zum ersten Mal in seinem Leben sieht er einen solchen Kampf im Kessel. Neben ihm kann die schöne Sai ihre Begeisterung kaum bremsen. Doch im Hintergrund hat auch die Sklavenhändlerin Anoje bereits ein Auge auf ihn geworfen. Wird auch Jo am Ende um sein Leben kämpfen müssen?
IM KESSEL ist ein Thriller voller überraschender Wendungen - und eine Hommage an die Erotik des Kampfes. Maidan erzählt ein modernes Märchen voller gebrochener Amazonen.
Die Autoren
Tomas Maidan schreibt zusammen mit seiner Schwester Sandra. In ihrem gemeinsamen Thriller IM KESSEL sind männliche und weibliche Blickweisen verschränkt. Tomas Maidan lebt in der Nähe von Bremen.
Inhaltsverzeichnis
1. Antreten
2 . Der Läufer
3. Schwache Zahlen
4. Lichter
5. Schließt die Fenster
6. Stille
7. Allekommen
8. Schach
9. Plätze aus Marmor
10. Angst
11. Rekrutierung
12. Am Ziel
13. Carl
14. Black Out
15. Bereit zum Kampf
16. Jos Fantasie
17. Donner
18. Jemand seilt sich ab
19. Barfuß
20. Am See
21. Drei Phasen
22. Kontrolle ist besser
23. Ende der Vorbereitung
24. Erwischt
25. Die Zeit rennt
26. Klimmzüge
27. Ende Phase Zwei
28. Unter dem Vulkan
29. Der Gürtel
30. Delfine
31. Der Sieger
32. The Day After
33. Down Under
34. Flucht
35. Zurück im Leben
Fortsetzung folgt
1. Antreten
Als Anoje den Saal betrat, wurde sie längst erwartet. Gleich drei Frauen taxierten sie mit giftigen Blicken, während Anoje schwankend auf ihren hohen Absätzen voran wackelte. Die Augen auf den Teppich niedergeschlagen, schob sie sich der Tischreihe entgegen. Ihre Hacken sackten ein. Nicht umzuknicken war schwer, auf dem Boden, der mit einem butterweichen Flaum bedeckt war. Anoje strauchelte. Sie fluchte leise.
Vor den hohen Wänden standen mehrere Sofas. Als wären diese unachtsam zur Seite gerückt worden, bildeten sie jetzt ein chaotisches Sammelsurium aus allen möglichen Sitzmöglichkeiten. Eigentlich kannte Anoje das große Zimmer von Madame gut, aber so leer geräumt wie heute hatte sie es noch nie gesehen. Offenbar hatte jemand die Fläche in der Mitte des Raumes eilig vergrößern wollen. Nun umrahmten die Möbel mit feierlicher Zurückgezogenheit die freie Fläche in der Mitte. Dort schwankte jetzt Anoje
Zu dritt erwartete man sie. Anoje äugte ängstlich zu Madame und ihren beiden Helferinnen hinüber, die schweigend hinter einem meterbreiten Holztisch saßen. Madame war eine Frau Anfang vierzig mit wallenden rotblonden Haaren, die sie meistens zu einer Steckfrisur zusammengerafft trug. Jetzt fixierte sie Anoje mit stiller Härte. Wie in einem Gerichtsprozess schlummerten vor ihren Händen einige Papierblätter auf der Holzplatte. Ängstlich blickte Anoje zu den Seiten. Eine Blumenbank ruhte mit blauen Gestecken an der linken Seite, daneben standen ein Bücherbord und mehrere kleine Beistelltische, auf denen Weinflaschen und Aschenbecher schwiegen. Anoje sah ein rostiges Piano und zwei altertümliche Holztruhen. Durch das meterhohe Fenster schwappte der Lärm des Abendverkehrs herein. Milchige Strahlen einer müden Abendsonne sackten durch den Staub. Es war warm.
Anoje wusste, dass es kein gutes Zeichen war, wenn Madame gleich zwei ihrer Assistentinnen mitbrachte. Auch wenn niemand darüber sprach, welche genaue Position Madame Heito zurzeit in der Tirade einnahm, so musste man sich vor ihr auf jeden Fall in acht nehmen. Mit Madame legte man sich besser nicht an - wenn man sämtliche Körperteile beieinander halten wollte.
Der Chefin war es mit einigem Aufwand gelungen, nach außen hin den Eindruck einer seriösen Geschäftsfrau zu hinterlassen. Sie war schlank und besaß ein kluges, bisweilen energisches Gesicht. Ihre Vorfahren stammten vermutlich aus einem europäischen Land, lange Zeit, bevor Kujai zum Mittelpunkt des Trabanten aufgestiegen war. Ihre Familie kontrollierte heute sämtliche Geschäfte, die rund um den zentralen Tempel getätigt wurden. Und das waren einige. Insbesondere die Schauprozesse hatten sich zur wichtigsten Einnahmequelle der Heitos entwickelt. Die Regierung ließ es sich einiges kosten, verurteilte Aufrührer dem Volk vorzuführen. Was immer man gegen Kujai sagen mochte - eines beherrschte dieser Staat in unvergleichlicher Weise: das Statuieren von Exempeln.
Madame saß mit geradem Kreuz in der Mitte der Tischreihe. Ihr spöttischer Mund schien auf einem Bonbon zu kauen. Sie bearbeitete ihn, als könne sie es nicht erwarten, das Ding endlich zum Verschwinden zu bringen. Nein, sie mochte ihn nicht.
Madame wippte ungeduldig in ihrem Lehnsessel und beobachtete mit stiller Wut, wie Anoje über den Teppich balancierte. Wie immer trug Anoje ihr violettes Kostüm, von dem sie fand, dass es einen seriösen und zugleich lieblichen Eindruck auf ihre Kunden machen würde. Ihre Handtasche hatte sie bereits in der Eingangshalle abgeben müssen. Noch nie hatte sie es ertragen können, wenn man sie nach Waffen abtastete - nach all den Jahren, die sie für die Heitos arbeitete. Heute war ihr allerdings zum ersten Mal der Gedanke gekommen, die Wächterin habe ihre Aufgabe wirklich ernst genommen. So penibel prüfend waren die Kontrollhände sonst nie über ihren zierlichen Körper gewühlt.
Was sollte das geben? Anoje, die eine unauffällige Frau mit durchschnittlicher Statur war, wich dem Echsenblick der Chefin aus. Madames grüne Augen waren ihr immer schon wie die eines Leguans vorgekommen. Sie blickten verschlagen und gierig und prüften alles, was sie sahen, nur unter einem einzigen Gesichtspunkt: Konnte man es verspeisen?
Nun sah der Leguan Anoje. Und bekam Appetit.
Anoje war nicht viel jünger als Madame, aber sie hatte sich der Chefin schon immer unterlegen gefühlt. Nicht, dass Madame intelligenter als sie gewesen wäre, das bestimmt nicht. Im Gegenteil: Es schien vielmehr eine Mischung aus impulsivem Instinkt und gesteigerter Eitelkeit zu sein, die Madame befähigte, ihre Position an der Spitze der Hierarchie auszufüllen. Und zu halten. Sie schien zum Herrschen geboren zu sein. Anoje dagegen hatte immer nur treu gedient. Bienenfleißig arbeitete sie alles zur vollsten Zufriedenheit aller ab. Fand sie selbst zumindest.
Das Muster am Boden fesselte jetzt ihre Aufmerksamkeit: Es zeigte eine vielfache verschlungene Blüte, die sich in orangefarbenen Kurven dutzendfach vervielfältigte. Die Bögen der Stile folgten mit einiger Beharrlichkeit dem Ruf der Sonne. Wie elastisch und zugleich zielstrebig sie waren... Die Blüten vergaßen nie ihr eigentliches Ziel, weil die Richtung der Sonne sie ständig anzog und formte. Das machte sie schön.
Madame räusperte sich.
Anoje kippte abrupt das Kinn nach oben, als müsse sie zeigen, dass sie nicht vergessen hatte, Haltung anzunehmen. Doch eigentlich schielt sie jetzt nervös über den Kopf von Madame hinweg. Deren rote Haare wurden von mehreren Bändern und einigen Klammern zu einer hochgetürmten Steckfrisur zusammengehalten. Auch ihr Kostüm, eine gegerbte Lederjacke in tailliertem Stil war in einem abgewetzten Rot gehalten. Madame trug diese Farbe bei allen wichtigen Anlässen.
Jetzt holte Madame tief Luft. Als müsse sie sich vergewissern, dass ihre Assistentinnen ordnungsgemäß neben ihr Platz genommen hatten, blickte sie zu den Seiten. Noch immer besaß ihr Bonbon Material. Ihre langen Fingern spielten mit der goldenen Kette.
Links neben ihr saß eine Frau, die Anoje nicht kannte. Sie trug braune Haare mit einem waagerecht geschnittenen Pony, darunter stieß eine Brille mit kreisrunden Gläsern an. Die rundlichen Wangen verliehen ihrem Gesicht einen kindlichen und gutmütigen Ausdruck. Ein bisschen zu dick war die Frau, wie Anoje fand. Sie blickte verträumt zu Anoje, die verunsichert vor dem Tisch stand. Ihre Beine, die mit grauen Strumpfhosen aus einem grünen Rock unter dem Tisch hervorstachen, hatte die Mollige gelenkig übereinandergeschlagen. An der Spitze ihres rechten Beines baumelte ein Schuh, nur lose aufgehakt über der Spitze ihres Zehs. Sie döste in einer schläfrigen Wohlgestimmtheit vor sich hin. Die Mollige saß ihre Zeit ab.
Anoje sah, wie die Dicke in ihrer linken Hand eine kleine Gabel schwenkte. Wie ein Dirigent wedelte sie damit durch die backige Zimmerluft - allerdings zu einem äußerst schläfrigen Takt. Anoje stutzte. Es war doch völlig unpassend, dass hier, in einer Versammlung bei Madame gegessen wurde! Seit wann war das denn erlaubt? So etwas hatte sie in all den Jahren, in denen sie für die Familie Aufträge erledigte, noch nie erlebt. Jetzt stach die Braunhaarige hinab in das Tortenstück. Sie musste regelrecht graben, da es unter einem Sahnehaufen verschüttet lag. Kauend spitzte sie die Lippen zu einem kleinen Genießermund. Sie blickte wie ein Kalb auf der Weide und musterte Anoje mit dummer Zufriedenheit.
Nein, Anoje war nicht die Serviererin, die zur Bedienung eilen würde. Und sie würde auf keinen Fall - was immer Madame von ihr fordern würde - irgendwelche Leckereien servieren.
Anoje hörte ihren eigenen Herzschlag. Sie erschrak, als sie erkannte, wer auf der rechten Seite von Madame saß. Es war Susan. Susan Konda war eine große, schlanke Frau mit blonden Haaren, die Anoje seit Langem kannte. Und fürchtete. Su verkörperte all das, was man gerissen und ehrgeizig nannte. Ihre spitze Nase ragte ein wenig zu lang aus ihrem hageren Gesicht heraus. Wie immer, wenn Anoje sie sah, hatte Su sich ihre Augenbrauen eine Spur zu dick mit dunklen Strichen nachgezeichnete. Wie ein blecherner Buchstabe „V“ den man weit auseinandergebogen hatte, wölbten sich diese Linien über ihren Augen. Diese Schwärze geriet in einen unguten Kontrast zu ihren blondierten Haaren, wie Anoje fand.
Anoje hatte nie eine gute Beziehung zu Susan gefunden. Dabei besaßen beide Frauen eigentlich viele Gemeinsamkeiten, wenn nicht sogar gleiche Interessen: Nur wenn alle Abläufe in Heitos Imperium halbwegs geräuschlos verliefen, konnten beide ein erträgliches Leben in ihren Diensten führen. Für ein gegeneinander war überhaupt kein Platz - es schadete nur der allgemeinen Reputation, welche die Familie dringend benötigte. Aber Anoje war nie gut mit Susan ausgekommen, was auch damit zu tun hatte, dass die Blonde mehreren Männern den Kopf verdreht hatte, von denen mindestens einer eigentlich mit Anoje befreundet war. Gewesen war. Aber so kam es jedes Mal: Kaum marschierte Susan mit wiegendem Schritt in einen Raum, richteten sich alle Scheinwerfer nur auf sie. Dabei konnte jeder sehen, dass ihre exaltierte Fröhlichkeit genauso grell und grob aufgetragen war, wie ihre Schminke. Aber Männern war so etwas egal, dachte Anoje. Männer wollten schlichtweg Dinge besitzen, die schnittig aussehen musste. Schlanke Geschosse. Autos, Kampfjets, Frauen: Schnittig, teuer, laut musste es sein. Alles andere war egal. Anoje seufzte in Gedanken. Sollten sie doch alle abstürzen, dachte sie, aus den Kurven fliegen, vor die Bäume knallen. Ihr wäre das recht. Anoje lebte gerne allein, sie liebte die Stille am Morgen und den Geschmack von Vanille-Tee.
Jetzt riskierte sie einen vorsichtigen Blick in das Gesicht der Blonden. Sah man genauer hin, erkannte man, dass ihre Schönheit von einer etwas brüchigen Natur war. In wenigen Jahren würde ihr Glanz abfallen, da war sich Anoje sicher, und man konnte sich mühelos vorstellen, dass Susan dann mit einer anderen Frisur eine grobe und geradezu hässliche Erscheinung abgeben würde. Ihre Gesichtszüge besaßen bereits heute einen Anflug von Herbheit - beinahe, wie die eines Mannes. Nur ihre glänzenden Lippen und die aufwendige Frisur übertünchten dies noch. Aber bestimmt nicht mehr lange.
War es der Stress, der Anoje all dies denken ließ? Susan blickte, wie eine Katze vor dem Sprung. Und Anoje wartete, dass jemand etwas sagte. Im Piano raschelte etwas. Gab es hier Mäuse?
Draußen rauschten die letzten Transporter dem Zentrum entgegen. Gegen Mitternacht würde der Tempel öffnen, doch bis dahin war noch Zeit. Anoje versuchte, locker zu bleiben, konnte aber den Blick nicht von Susans blasiertem Gesicht abwenden. Wenn die Blonde ihren Mund öffnete, was nicht sehr häufig vorkam, sprangen zwei scharfe Vorderzähne hervor, die ihre Attraktivität beträchtlich schmälerten. Nahm Susan ihre vollen Lippen ausnahmsweise zum Sprechen oder gar Lachen in Gebrauch, dann verzerrte sich ihr Gesicht abrupt in etwas Raubtierhaftes. Sie ähnelte dann einer gierigen Ratte. Vermutlich war dies auch der Grund, weshalb sie es vorzog, ihren hübschen Mund nach Möglichkeit geschlossen zu halten. Besser so. Im Ruhezustand wirkte sie wie eine makellose Schönheit, die ihre Wirkung auf Männer mühelos einsetzen konnte. Äußerlich entsprach sie dann dem Ideal einer perfekten, erotischen Frau. Wäre nur ihr Charakter nicht gewesen. Susans Lächeln konnte sich niemand entziehen - obwohl jeder leicht hätte bemerken können, dass ihr Gesicht eine Maske war. Anoje musste an eine Gestalt auf einer venezianischen Gondel denken, die in den Winterkarneval schwebte. Man durfte Susan nicht trauen. Sie war kühl und berechnend und zu jeder Grausamkeit fähig. In all den Jahren hatte Susan immer den entscheidenden Schritt schneller zugeschlagen als ihre Konkurrenten. Susan war in gewisser Weise Madames Mann fürs Grobe geworden. Niemand konnte sie leiden, aber keiner kam an ihr vorbei.
Anoje wusste, dass Susan mit einer beängstigenden Kaltblütigkeit ausgestattet war, wenn es darum ging, unliebsame Geschäftspartner von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Sie kannte auch gewisse Methoden, wie man Singvögeln die Flügel stutzen konnte. Man sagte ihr nach, sie beherrsche eine ganze Reihe von Techniken, mit denen sie Verhöre durchführte. Von chinesischer Folter war die Rede. Und Anoje hatte nie einen Zweifel gehegt, dass an den Gerüchten etwas dran war.
Mit stockendem Atem sog Anoje die Zimmerluft ein. Es war trocken. Es wäre ihr lieber gewesen, hätte sie Susan heute hier nicht sehen müssen. Sie blickte nervös auf die Hände der Blonden. Mit spitzen Fingernägeln klopfte diese auf der Tischplatte, als würde sie einen Regenwurm zerschneiden.
Susan knipste ihr klebriges Lächeln an. Das bedeutete niemals etwas Gutes. Als wolle sie ihren Charakter aufpolieren, hatte sie ihre Lippen heute mit einem transparenten Glanz lackiert. Gleichzeitig ging von ihr eine geradezu maskuline Ausstrahlung aus, was vermutlich an ihrem schwarzen Kostüm lag, deren Schnitt sich an einem Herrenanzug orientierte.
Aus der Mitte starrte Madame Heito zu Anoje. Sie fixierte sie und zischte nach einer endlosen Weile: »Da bist Du ja endlich.«
Anoje schwieg. Für einen Moment wollte sie etwas sagen, ein paar Freundlichkeiten daher flöten. Doch der Blick von Madame zeigte ihr, dass sie vorsichtig sein musste. Hier waren keine Reden gewünscht. Anoje strich den Saum ihres Rockes glatt.
»Anoje, meine Mondblume«, hob Madame an, und nannte sie damit süffisant bei ihrem Kosenamen, »du weißt, weshalb wir uns mit dir unterhalten möchten?«
Anoje blickte zu Boden. Die Blütengirlande war wirklich in raffinierten Mustern gestrickt. Eine Zweierpotenz; aus zwei Stilen wurden vier kleine Äste mit sechzehn Blüten. Bei Vier mal vier Seiten machte das insgesamt...
»Blümchen träumst du? Hast du wirklich nicht den blassesten Schimmer, warum wir dich eingeladen haben?«
Natürlich wusste Anoje es. Es hatte mit der Qualität zu tun. Der Qualität ihrer Ware. Es hatte damit zu tun, dass sie bei den letzten drei Abgaben nicht das gewünschte Niveau hatte bieten können. Sie hatte Flops geliefert. Dreimal.
Anoje schob trotzig die Lippen vor, als wollte sie einen Schutzschirm vor sich aufbauen. Es war nicht allein ihre Schuld gewesen, dass sich die Dinge so entwickelt hatten. Das hätte auch Madame wissen müssen. Das Geschäft der Rekrutierung lebte von vielen Faktoren. Eine gute Vorauswahl konnte schnell durch fremde Einflüsse ruiniert werden. Die Analyse war eigentlich gut gewesen, die Fehler kamen durch unvorhergesehene Einflüsse zustande. Man hätte bessere Informationen der Kandidaten gebraucht. Nicht, dass es Pech war, aber man müsse auch die andere Seite sehen. Das alles wollte Anoje sagen.
Sie schwieg.
Die Stille knirschte über den langen, hölzernen Tisch. Susan hantierte jetzt mit einer Nagelfeile und spitze damit ihre Fingernägel an. Der Ton raspelte in Anojes Hirn. Sie sah, wie die braunhaarige Frau auf der anderen Seite sich noch ein Kuchenstück in den Mund hievte. Auch wenn die Mollige dabei mit größter Vorsicht zu agieren schien - sie spreizte affektiert ihren Wurstfinger ab - so erzeugte sie mit ihrer Gabel dennoch ein fürchterlich schabendes Quietschen auf dem Teller. Anoje vermutete, dass die Dicke dies mit voller Absicht tat. Mit nachdenklichem Blick kaute sie dabei.
»Keiner der Männer, die du gebracht hast«, fuhr Madame fort, »hat es auf zehn Minuten gebracht.« Sie hob ein Blatt Papier vom Tisch und las vor: »Kamatschow: zwei Minuten dreiundzwanzig Sekunden.« Sie ließ eine bedeutungsvolle Pause entstehen. »Ravti, eine Minute, zehn Sekunden.«
Anoje kannte die Zahlen.
»Und schließlich Bogatu: Aus nach einer Minute.« Madame schob ihre Brille hinab zur Nasenspitze und blickte wie ein Raubvogel über das Gestell hinweg. »Eine jämmerliche Minute. Nicht einmal Sekundenangaben hat der Protokollant hinbekommen. Als er seinen Stift gefunden hatte, war die Sache schon vorbei.« Madame machte runde Augen und durchbohrte Anoje mit einem Blick aus Eis: »Die Kämpfer, die du uns für den Kessel angeschleppt hast, waren alle Flaschen. Flops. Fliegenfänger. Und nun?« Der Kugelfisch blies die Backen auf.
Die Stille schwappte wie ein klebriger Pudding zwischen Madame und der Angeklagten. Susan grinste feixend zu Anoje. Sie interessierte sich nicht für Zahlen. Hinter dem Fenster ging die Sonne in Deckung.
2. Der Läufer
Josemin lief seit Stunden. Jetzt erreichte er nach Kilometern sandiger Tundra endlich die Wiese. Sie erstreckte sich wie ein endloser Teppich vor ihm. Er atmete durch. Die dunkelgrüne Fläche empfing ihn mit einem feuchten Duft der Ruhe. Seit Ewigkeiten hatte er solch eine Stille nicht mehr erlebt. Überwältigt vom Anblick hielt er inne und sah aus schmalen Augen voran. Er erkannte in einigen Kilometern Entfernung die gewürfelten Schatten der Stadt, die sich als eine Silhouette funkelnd in den Abendhimmel hinauf zog. Davor lag ein Beet aus wilden Gräsern. Diesen Moment hatte Josemin lange herbeigesehnt.
Die Wiese war kein Ort, an dem man mit schweren Stiefeln marschieren sollte, dachte er. Der Krieg war lange vorbei. Jetzt, wo er in Kujai eine Bleibe gefunden hatte, war er längst nicht mehr auf der Flucht. Sein Leben war in ruhige Bahnen geraten. Während Jo begann, die Schnürsenkel aufzuschnüren, dachte er an sein neues Leben und wie glücklich er war, endlich in Kujai angekommen zu sein. Er hatte seinen Traum wahr machen können und tatsächlich eine feste Anstellung gefunden: Bei KPP, dem Systemvertrieb für elektronische Bauteile. Er besaß sogar einen eigenen Schreibtisch, die Bezahlung war gut, und sämtliche Überstunden wurden auf einem Konto erfasst. Die Räume waren viel prächtiger und luxuriöser ausgestattet, als er es aus seiner Heimat kannte. Wie das Paradies erschienen ihm die sauberen Flure, als er zum ersten Mal durch die herrlichen Gänge spazieren durfte.
An diesem Abend wollte Josemin Hawel es wagen, sein neues Leben endgültig in eigene Hände zu nehmen. Er würde den ihm zugewiesenen Bezirk verlassen. Er hatte einen Termin.
Noch war es hell. Jo atmete durch, schnürte die Stiefel auf und zog sie von den Füßen. Das tat gut. Viel zu verlockend war jetzt die Aussicht, einfach unbeschwert loszurennen. Monatelang hatte er im Büro gerackert und dazu auch noch abends im Wohnheim die Schulungsunterlagen studiert. Für die Umstellung des Systems, für die er ganz alleine zuständig war, hätte man eigentlich ein komplettes Team gebraucht. Aber Josemin Hawel war nicht irgendwer, er schaffte das ganz alleine. Er war zäh.
Jo fand, dass er sich für heute Abend etwas verdient hatte. Eine Entdeckungsreise, ein Abenteuer. Vielleicht sogar eine Frau.
In der Nachtluft mischten sich die Gerüche von Feldblumen mit verbranntem Kupfer. Jo knöpfte seine Fliegerjacke auf, nahm die Stiefel in die Hand und sprang mit großen Sätzen den Umrissen der Stadt entgegen. Die Strahlen der abtauchenden Abendsonne waren bereits ins Bläuliche gekippt, der Wind griff ihm in die Haare, und die Wiese, über die er nun der Metropole entgegen jagte, erwies sich als sehr viel größer, als zunächst vermutet. Immer schneller wurden seine Schritte, während er über den glucksenden Grund preschte. Der grasige Matsch erinnerte ihn an seine Kindheit. So hatte das Glück gerochen.
3. Schwache Zahlen
Klackernd lief die Perlenkette durch Madames Finger. Anoje, die verloren im Raum stand, wusste, dass dieses Tribunal sich wie eine Schlinge um ihren Hals ziehen würde. Bei Susan schien das Verhör allerdings eine Art von Hochstimmung ausgelöst zu haben. Wie kleine Klingen ließ sie ihre Fingernägel über den Tisch schneiden und fokussierte die Angeklagte mit einem zuckersüßen Röntgenblick. Schläfrig sackten dazu ihre Augenlider herab, als helfe ihr dies, sich in die Seele der Angeklagten zu vertiefen. Was war das bloß für ein Mensch? Diese - wie hieß sie gleich? Man brauchte viel Geduld, um die komplette Sonderbarkeit von einem derart verkorksten Menschen auch nur im Ansatzzu begreifen...
Anoje schwieg. Sie wusste genau, dass man Susan nachsagte, sie liebe es, anderen Menschen Schmerzen zufügen.
Madame fuhr mit leiser Stimme fort: »Wie vertragen sich eigentlich diese Zahlen mit den Grundsätzen des Tempels? Anoje, hörst du mich? Dürfte ich darum bitten, dass Du mir einmal kurz die Grundsätze des Tempels erklären könntest?«
Anoje räusperte sich. Diese Art der Vorführung hatte sie nicht verdient, das wusste sie ganz genau. Aber sie fügte sich in die Demütigung. Leise schmollte sie: »Der Tempel der Lichter fordert: absolute Gleichheit.«
»Bitte etwas lauter, wir wollen es alle hören!«
Anoje legte mehr Druck in die Stimme: »Der Tanz der Gegensätze kann nur bei absoluter Gleichwertigkeit erfolgen.«
Mit trägem Nicken folgte die Rothaarige ihren Worten. Sie könne das nur sehr schwer begreifen, schien ihre Mimik zu sagen. Als müsse sie auf dem Kopf eine kiloschwere Last balancieren, nickte Madame schließlich und wiederholte wie in einem Seegang aus Marmelade: »Richtig. Absolute Gleichheit. Wie wahr, wie wahr. Und wie ist es zu erklären, dass all die Künstler, die von Frau Anoje in den Tempel gebracht wurden, ihren Auftritt bereits beendet hatten, kaum dass die Einlasstüren geschlossen waren?« Madame ließ die Worte mit schneidendem Ton durch die Stille rollen. Die Gouvernante verlor allmählich ihre Geduld mit der Problemschülerin. »Das hat nichts mit Gleichwertigkeit zu tun«, fauchte sie, »sondern mit Versagertum! Oder sehe ich da etwas falsch?«
»Es war nicht allein mein Fehler«, protestierte Anoje. Irgendwie musste sie sich rechtfertigen. »Es hat auch mit der Ausbildung zu tun.«
Ihre Stimme erstarb unter dem Pfeil aus Eis, den Madame aus schmalen Augen schoss. Das Wort Ausbildung hätte sie nicht sagen sollen. Es war ein schmutziges Wort.
Klatschend plättete Madame das Papier unter ihrer Hand. »Die Ausbildung?« Ihre Stimme keifte jetzt schrill vor Entrüstung. Sie blickte hinauf zu einem sinnlosen Punkt unter der Decke, der sehr weit über Anojes Kopf schweben musste. In stummer Wut presste sie die Lippen aufeinander.
Anoje sah, wie die Blonde sich an Madames Ohr beugte. Zwar flüsterte sie mit demonstrativer Heimlichkeit, aber sie dosierte ihre Stimme doch derart geschickt, dass Anoje alles genau hören konnte. Wie durch einen Trichter drangen Susans Worte durch: »Darf ich mit der Kleinen ein bisschen Ausbildung machen?«
Die Leguanaugen prüften Anoje, als müsse der Vorschlag in allen Konsequenzen überdacht werden.
»Bitte gib die japanische Maus mir«, forderte Susan mit Nachdruck, und blickte gleichzeitig aus den Augenwinkeln zu Anoje. Die Katze bettelte geradezu und schnurrte: »Ich erteile ihr eine hübsche Lektion.«
Madame schien vor ihrem inneren Auge abzuwägen, wie eine solche Lektion aussehen könnte. Sie legte den Kopf ein bisschen hin, ein wenig her. Anoje fühlte sich in ihrer Rolle als Maus gar nicht wohl. Sie spürte, wie ihr Puls schneller wurde. Was hatte man mit ihr vor?
Madame nickte. Auf Susans blassem Gesicht stieg ein böses Frohlocken auf.
»Wir geben Dir jetzt unsere Art der Ausbildung«, verkündete Madame. Susan erhob sich. Das war ihr Einsatz.
4. Lichter
Als Jo den Stadtrand erreichte, schlich bereits die Nacht heran. Immer höher hatten sich die Häuser vor ihm aufgebaut, je näher er der Metropole kam. Er sah die gepanzerten Flächen aus Stahl und Beton, die ihn gleichermaßen abstießen, wie sie ihn gleichzeitig auch magnetisch anzogen. Auf vielen Dächern leuchteten grünliche Strahlen, die suchend in den Nachthimmel emporkrochen. Die fremde Stadt glühte mit einer Pracht, wie er sie zuvor noch nie gesehen hatte. Überall formten Lichtpunkte strudelförmige Linien an den Fassaden, mal bauten sie sich dort in Wellen auf, dann reisten die Lichter wie ein Bienenschwarm weiter und siedelten an einem anderen Gebäude. Sonderbar, dachte Jo. An einigen Stellen schien es, als fügten sich die Formen zu ganzen Bildern zusammen, obwohl die pulsierenden Rhythmen sie zu immer neuen Strukturen trieb. Ob die Lichter wie freie Energie durch die Luft schwebten? Oder handelte es sich um Lampen, die fest an den Häusern montiert waren, und nur durch ein elektronisches Programm miteinander verbunden waren? Jo konnte es sich nicht erklären.
Der Nachtwind blähte seine Jacke auf. Jo bemerkte, dass die Luft hier sandig schmeckte. Aber die Tatsache, dass er seinem Ziel nun zum Greifen nahe war, ließ ihn allen Schmutz und jede Widrigkeit vergessen. Es war also doch möglich, die Verbotene Stadt zu erreichen! Und das sogar aus eigener Kraft - zu Fuß. Man brauchte nur einen festen Willen.
Niemals hatte Jo daran gezweifelt, dass es einen unbewachten Weg auf der Rückseite der Siedlung geben musste. Nun war er atemlos vor Freude, als er vor sich das Zentrum von Kujai-City liegen sah. Er erkannte die Stadt an den Skulpturen, welche meterhoch die Fassaden der Häuser schmückten. In verschiedenen Größen tauchte Kujais Staatswappen überall auf. Früher hatte er das Symbol für ein kriechendes Insekt gehalten, bis ihn Carl empört zurechtgewiesen hatte: Es handele sich selbstverständlich um einen fauchenden Drachen, hatte ihm der aufgebrachte Kollege erklärt. Der gute Carl. Lange Zeit schon hatte Jo ihn nicht mehr gesehen, aber damals hatte er Jo alles über das Drachensymbol erzählt, was ein Fremder wissen musste: Seit dem Sieg gegen Neu-Sibirien repräsentierte der Drache Glanz und Größe des Imperiums von Kujai, das sich seit zwanzig Jahren über den Großteil des Trabanten erstreckte. Und Kujai-City, die sogenannte Nachtstadt, war Militärbasis und Regierungssitz zugleich. Kein Bewohner der Randbezirke hatte Zugang zu ihr. Und kein Fremder kannte ihre genaue Lage.
Bis auf einen.
Schweiß sickerte Jo in die Augen. Ob er jemals den Weg zurückfinden würde, war ihm nun völlig gleichgültig. Er wollte nur noch vorangehen; hinein in die Verbotene Stadt. Manchmal schien es ihm, als würden die Büsche um ihn herum seine Wanderung begleiten. Wie eine Art von geistigem Rückenwind, der sogar die Schatten des Unterholzes ergriff, glitten die Schemen neben ihm her. Sie begleiteten ihn, wie ein wandernder Wald. Ein Gefühl des Triumphes stieg in ihm auf.
Nach einer halben Stunde erreichte Jo den Gürtel aus Schutt. Felsbrocken und Glasscherben bildeten hier ein steiniges Feld, welches das Umland vom eigentlichen Stadtbereich trennte. Diese Barriere musste er noch überwinden, dann war er drin! Ein Kinderspiel. Jo stülpte seine Stiefel über, zurrte die Schnüre fest und betrat das knirschende Geröll.
Mit balancierenden Armen überquerte er die Steinbrocken. Wie ein Flieger überquere ich das, dachte er und machte mit dem Mund das Geräusch eines Propellers. Er wusste aus seiner Recherche, dass dies einst eine unbewohnte Siedlung aus mehrstöckigen Wohnblöcken gewesen sein musste. Die Bäume hatten zunächst mit ihren Wurzeln den Stein von unten aufgebrochen. Über Jahre hinweg entstand ungefähr zu gleichen Anteilen ein Gemisch aus Holz und Beton. In all den Jahren hatte es keine Verwendung für die Häuser gegeben, hatte er gelesen, sodass der gesamte Bereich irgendwann mit Dynamit gesprengt worden war. Sämtliche Pflanzen wurden mit dem Schutt vermischt. Dann hatte man die Asche meilenweit ausgestreut. Nichts Neues wurde an die Stelle gebaut, und nun erstreckte sich rund um die Stadt ein glitzernder Bach aus felsigem Schutt.
Als Jo das Feld passiert hatte, konnte er besser erkennen, wie die Stadt aufgebaut war. Der Schuttgürtel bildete eine Art Schutzwall, und die Hochstraßen verliefen kreisförmig im Innenbereich. In der Luft schwebten surrende Lichtpunkte, die von unbemannten Drohnen stammen mussten. Manchmal stürzten sie wie Raubvögel abwärts, so, als wären sie defekt. Aber tatsächlich verschwanden sie dann in unterirdischen Röhren, tuckerten dröhnend durch die Kanäle, die wie offene Wasserrohre in den Untergrund führten.
Jo blinzelte in die Richtung, aus der er gekommen war. Dort draußen sah er graugrüne Büsche. An manchen Stellen bildeten sie ein undurchdringliches Dickicht, aber plötzlich erkannte er dort noch mehr. Es mochten ungefähr hundert Meter sein, die ihn von dem Objekt trennten - und dennoch erkannte er es ganz genau: Es hatte sich mit einer geisterhaft schnellen Bewegung verraten. Jo kniff die Augen zusammen. Das Mondlicht rieselte nun so schwach herab, dass alle Konturen in einem ermüdenden Grau zu verschwinden drohten. Doch Jo sah etwas. Er stand jetzt hinter dem Schuttfeld und blickte zurück in die Wildnis, die er überwunden hatte. Er sah einen großen, rötlichen Schatten, den er zunächst für einen Busch gehalten hatte. Aber jetzt bewegte er sich! Zwar langsam, aber merklich. Und nun duckte er sich sogar; der ganze Körper sank sprungbereit auf die... Pfoten. Ja, das war es!
Erschrocken schnappt Jo nach Luft. Er hatte es all die Zeit gewusst - und doch war er wie ein Traumwandler einfach durch die offenkundige Gefahr hindurch spaziert! Jetzt stürzten die Erinnerungen an seine Recherchen wieder auf ihn ein. Es war wie ein Schock. Natürlich hatte er es gewusst, und bei seinem Aufbruch dann aus unerfindlichen Gründen wieder vergessen. Verdrängt...
Unter einem Anfall von Stress musste sich eine Art von schwarzem Loch in seinen Verstand gefressen haben. Wie konnte er nur alleine durch die Tundra wandern? Dabei war es doch so offensichtlich: Der seltsame Schuttgürtel, der eine Barriere aus spitzem Gestein darstellte, war als Schutz gegen Raubtiere angelegt worden. Raubtiere mit empfindlichen Pfoten! Keine Großkatze ging gerne über steinige Scherben.
Der Tiger lauerte ohne jede Bewegung.
Oh mein Gott, die ganze Gegend dort draußen muss voll von den Biestern sein, dachte Jo. In ihm fror das Entsetzen zu einem pulsierenden Kloß. Was wäre geschehen, hätte ihn ein solches Biest angegriffen?
Aber jetzt war er in sicherer Entfernung. Und plötzlich änderte sich seine Stimmung; Jo begann, sich zu entspannen und lauschte auf den Abendwind. Nun erfüllte ihn die Anwesenheit der Raubkatze mit einer sonderbaren Ruhe. Wie ein hoher Ton in einem Musikstück, der jubilierend gehalten wird, und so die Schönheit der gesamten Komposition deutlich machte, so herrlich erschien ihm jetzt dieses Tier. Der Tiger würde ihm nicht folgen, daran hatte Jo keinen Zweifel. Jetzt, da sich Jo sicher hinter dem Schuttgürtel befand, spürte er, dass ihn das Tier all die Zeit auf eine friedliche Weise begleitet hatte. Als wäre Jo ein Verbündeter, ein Freund der Katze gewesen. Auch Jo war zu einem Nachtaktiven geworden, ein einsamer Schleicher. Ebenso wie er selbst umkreiste auch der Tiger die Stadt, beobachtete die fremden Lichter und hoffte, dass noch weitere Bezirke an ihn und die Wildnis zurückfallen würden. Nicht auszumalen, was geschehen würde, sollte ein Tiger den Weg in die Stadt hinein finden. Der Ärmste wäre verloren.
5. Schließt die Fenster
Die Kuchengabel kratzte die letzten Tortenkrümel zusammen. Als die Dicke sie sorgsam aufgespießt, balancierend zum Mundgehievt und genüsslich zerlutscht hatte, glotze sie zu Anoje. Und Anoje starrte zuMadame.