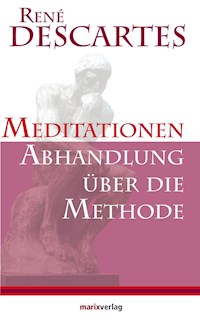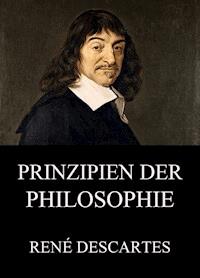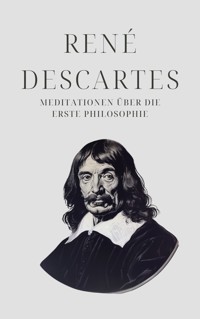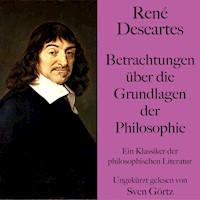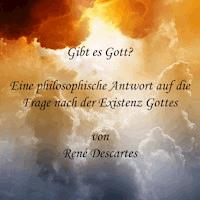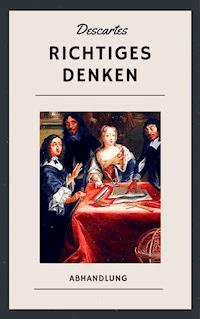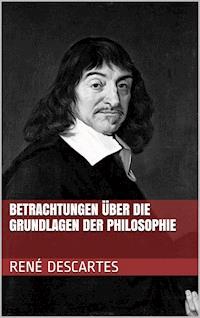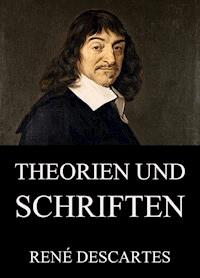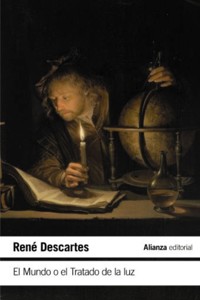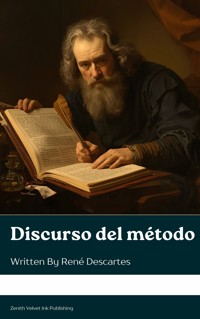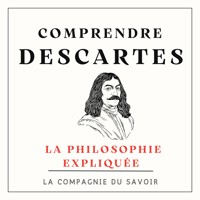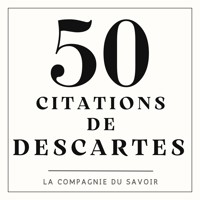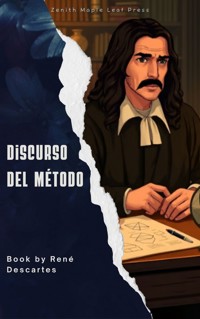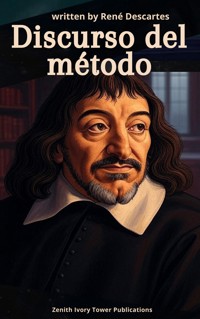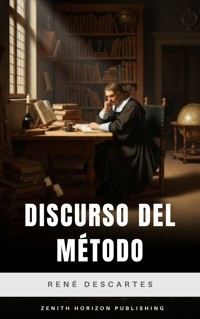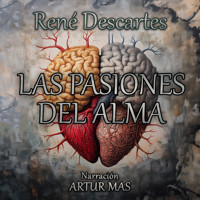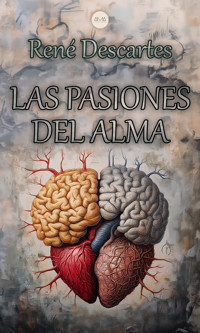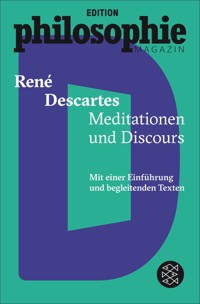
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Edition Philosophie Magazin: Eine exklusive Auswahl zentraler philosophischer Texte durch das »Philosophie Magazin«. Mit dem ungekürzten Originaltext sowie - einer sachkundigen Einführung in Werk und Vita - einer Zeitleiste zu Leben und historischem Kontext - Erläuterungen der Grundbegriffe Descartes' - mit Beiträgen von Manfred Schneider, Hilal Sezgin sowie Jean-Didier Vincent zur bleibenden Bedeutung des Werks Mit Descartes' ›Meditationen‹ beginnt die neuzeitliche Philosophie. Mit seinem radikalen Skeptizismus sucht Descartes nach einem unerschütterlichen Fundament, auf das man bauen kann. In seiner berühmten Formulierung lautet es: »Ich denke, also bin ich« (cogito ergo sum).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
René Descartes
Meditationen und Discours
Mit einer Einführung und begleitenden Texten
Über dieses Buch
Edition philosophie Magazin: eine exklusive Auswahl zentraler philosophischer Texte durch das »philosophie Magazin«.
Mit den ungekürzten Originaltexten sowie
– einer sachkundigen Einführung in Werk und Vita
– einer Zeitleiste zu Leben und historischem Kontext
– Erläuterungen der Grundbegriffe des jeweiligen Werks
– mit Beiträgen von Manfred Schneider, Hilal Sezgin sowie Jean-Didier Vincent zur bleibenden Bedeutung des Werks
Mit Descartes’ ›Meditationen‹ und seinem ›Discours‹ beginnt die neuzeitliche Philosophie. Mit seinem radikalen Skeptizismus sucht Descartes nach einem unerschütterlichen Fundament, auf das man bauen kann. In seiner berühmten Formulierung lautet es: »Ich denke, also bin ich« (cogito ergo sum).
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hauser lacour kommunikationsgestaltung gmbh, Frankfurt
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403689-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung
Die Mathematik als Triebkraft
Daten zu Descartes’ Leben
Daten zum geschichtlichen Kontext
Descartes’ Grundbegriffe
Ich denke, also bin ich
Die Einheit von Seele und Körper
Die Idee von Gott
Freiheit und Edelmut
Die Methode
Der Körper
Zum Werk Descartes’
Weiterführende Lektüre
Stimmen zu Descartes’ Bedeutung
Transparenz für alle Von Manfred Schneider
Tierischer Irrtum Von Hilal Sezgin
Visionäre Demut Von Jean-Didier Vincent
Einführung in die »Meditationen«
René Descartes Meditationen: Untersuchungen über die Grundlagen der Philosophie
Untersuchungen über die Grundlagen der Philosophie, in welchen das Dasein Gottes und der Unterschied der menschlichen Seele von ihrem Körper bewiesen wird
(Meditationes de prima philosophia, in qua dei existentia et animae immortalis demonstratur)
Vorwort an den Leser.
Inhaltsübersicht
der folgenden sechs Untersuchungen.
Anhang
Die auf geometrische Art geordneten Gründe, welche das Dasein Gottes und den Unterschied der Seele von ihrem Körper beweisen.
René Descartes Abhandlung über die Methode, richtig zu denken und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen.
Abhandlung über die Methode, richtig zu denken und die Wahrheit in den Wissenschaften zu suchen.
(Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)
Editorische Notiz
Einleitung
Von Emmanuel Fournier
»Maskiert gehe ich meinen Weg.« Indem er aus seinem Leben ein Rätsel machte, hat René Descartes zahlreiche Biographen in Ratlosigkeit gestürzt. Es ist verständlich, dass sich mit diesem Bild des Rückzugs vor den Blicken der Mitmenschen ein Missverständnis etablieren konnte: Wenn Descartes im Verborgenen lebte, heiße das, dass er etwas zu verbergen hatte. Mitglied einer Geheimgesellschaft, Libertin, der geschickt seine Überzeugungen kaschierte. Der Verfasser der »Abhandlung über die Methode« war eine Persönlichkeit, wie geschaffen dafür, dass sich um seinen Namen Legenden ranken.
Geboren wird er am 31. März 1596 in La Haye, einem Städtchen in der Touraine, das inzwischen nach ihm benannt ist. Sein Vater Joachim ist Rat am Obersten Gerichtshof von Rennes. Seine Mutter, Jeanne Brochard, stammt aus einer angesehenen Ärztefamilie. Sie ist – Ironie des Schicksals – von eher zarter Gesundheit, und der junge René kommt um das mütterliche Erbe nicht herum. Erst mit mehr als 20 Jahren bekommt er den blassen Teint und den trockenen Husten los, die ihn seit der Kindheit begleitet haben. Seine schwache Konstitution wird zum Trumpf, als Descartes mit elf Jahren ins Jesuitenkolleg von La Flèche eintritt. Er bekommt dort eine Vorzugsbehandlung: Während seine Kameraden jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen, um am gemeinsamen Gebet teilzunehmen, gesellt er sich nicht vor zehn Uhr zur restlichen Truppe hinzu, nach mehreren Stunden des Sinnierens im Bett.
Beim Austritt aus dem Kolleg entschließt sich Descartes, vermutlich dem Willen seines Vaters nachgebend, zu einem Studium der Rechte in Poitiers. Doch den jungen Mann dürstet es nach Abenteuern. Nach so vielen Jahren, die er in der stickigen Atmosphäre der Bibliotheken verbrachte, will er gern reisen, andere Sitten und Bräuche entdecken. Das Einzige, was ihn fortan interessiert, ist jenes »große Buch der Welt«, das er Jahre später in der »Abhandlung über die Methode« erwähnt. Mit 21 Jahren verdingt er sich in den Niederlanden als Freiwilliger im Heer von Moritz von Nassau, damals Prinz von Oranien.
Die Mathematik als Triebkraft
Die Erfahrung erweist sich als Desaster. Er, der seit dem Kolleg immer in die Gunst eines Zimmers gekommen war, in das er sich zurückziehen konnte, fühlt sich verloren inmitten von Landsknechten, deren Rohheit und Unwissenheit ihn deprimieren. Nach zehn Monaten Selbstquälerei irrt er ziellos durch die Straßen von Breda, als sich eine Begegnung ereignet, die sein Leben verändert. Der junge Mann heißt Beeckman. Kaum älter als Descartes, ist er auf der Höhe der wissenschaftlichen Arbeiten seiner Zeit und offenbart dem künftigen Denker, was dieser noch nicht weiß: dass zahlreiche physikalische Probleme mittels mathematischer Formeln gelöst werden können. Die Überlegungen des jungen Franzosen mit dem Ziel einer Ausweitung der mathematischen Gewissheit auf das gesamte Wissen haben hier zweifelsohne ihre Wurzeln.
Für den Augenblick zerstreut er sich auf Reisen. Er bricht nach Deutschland auf, wo sich der Dreißigjährige Krieg anbahnt, um sich im bayerischen Heer zu verpflichten und an den Schlachten teilzunehmen. Später wird er sagen, er sei nicht »unempfänglich für den Ruhm« gewesen. Doch in diesem Bereich wie in anderen zeigt Descartes die Unstetheit der Passionierten: schnell begeistert, schnell enttäuscht. Rasch vergeht ihm die Lust, sich zu schlagen. Er ist in Neuburg, an den Ufern der Donau, als sich ein Ereignis zuträgt, das ihn in seiner wissenschaftlichen Berufung bestärkt. In der Nacht vom 10. zum 11. November 1619 hat er eine Reihe von Träumen, die er als hinreichend wichtig beurteilt, um sie gleich am nächsten Morgen in einem Abschnitt seines Notizbuchs, den er »Olympica« nennt, zu beschreiben. Diese Träume symbolisieren die Zweifel des Philosophen, der sich anschickt, die Welt nach anderen Schemata zu denken als den aus der göttlichen Offenbarung übernommenen. Sie bringen seine Berufung an den Tag. Er verlässt die Armee, um sein Leben künftig der Wissenschaft zu widmen.
Im Herbst 1623, noch immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen, begibt sich der Philosoph nach Italien, jenem Land, »wo stets tagsüber unerträgliche Hitze und abends ungesunde Frische herrschen, und wo die Dunkelheit der Nacht Diebstahl und Mord birgt«. Er geht dort in Gelehrtenkreisen ein und aus, wie er es auch nach seiner Rückkehr in Paris tut. Doch seine Arbeiten schreiten kaum voran, da er sich nicht zurückziehen kann, um seine Überlegungen zu vertiefen und auszuarbeiten. Er beschließt also, sich in der Bretagne auf dem Lande einzurichten. Unglücklicherweise muss er sich dort mit einem gesellschaftlichen Leben und mit sozialen Gepflogenheiten auseinandersetzen, die ihn beinahe Paris nachtrauern lassen. Überzeugt davon, in Frankreich keinen Hort des Friedens zu finden, bricht er Ende 1628 wieder in die Niederlande auf. Er hat sie als Land in Erinnerung, in dem es jedem freisteht, seinen Angelegenheiten nachzugehen, ohne sich um die von anderen kümmern zu müssen. Descartes beendet hier seine Wanderjahre. Er kehrt nur dreimal nach Frankreich zurück, ohne je lange zu bleiben.
Während seiner Jahre in den Niederlanden wechselt der Philosoph oft seinen Wohnsitz. So oft, dass Adrien Baillet, sein erster Biograph, sein Einsiedlertum beschrieben hat als ein Leben »ohne etwas Beständigeres, als es die Israeliten auf ihrem Zug durch die arabische Wüste hatten«. Was gleichwohl sein Werk nicht daran hindert, Gestalt anzunehmen. 1633 beendet er den Text, an dem er seit seiner Ankunft arbeitet. Die »Abhandlung über die Welt« unterstützt die Theorie der Bewegung der Erde. Doch im gleichen Jahr wird Galilei für eine identische These verurteilt. Descartes verzichtet aus Angst vor einer Kontroverse auf die Publikation. Er zieht es vor, die Öffentlichkeit auf anderen Wegen zu erreichen. Im Juni 1637 erscheint anonym die »Abhandlung über die Methode«, 1641 mit den »Meditationen« ein Werk, das Epoche machen sollte.
Er hätte, nachdem er endlich das lange herangereifte Werk veröffentlicht hatte, seinen Frieden finden können, doch wird er brutal mit dem Verlust zweier enger Angehöriger konfrontiert. Einige Jahre zuvor war ihm aus einer Beziehung zu einer Bediensteten eine Tochter geboren worden. Eine vorübergehende Beziehung, zu der Descartes vermerkte, »dass das Kind in Amsterdam am Sonntag, dem 15. Oktober des Jahres 1634 gezeugt wurde«. Der Tod seiner Tochter Francine 1640 und einen Monat später der seines Vaters sind für den Philosophen entsetzlich harte Prüfungen. Nichts kann ihn von seinem Kummer ablenken, nicht einmal die Debatten des intellektuellen Lebens. Seine Thesen sind weit davon entfernt, unter den Theologen einhellige Zustimmung zu finden: Man ist beunruhigt, dass der Zweifel und die Skepsis in seinen Schriften eine solche Wichtigkeit einnehmen, was ihn schließlich den Kirchenoberen verdächtig macht. Noch im Jahr 1640 wird, ohne dass er benachrichtigt wird, in Paris vom Jesuiten Bourdin eine öffentliche Diskussion seiner Philosophie organisiert. Im folgenden Jahr übernehmen die holländischen Theologen mit doppelter Heftigkeit: Gisbert Voetius, der größte Eiferer unter ihnen, beschuldigt Descartes gar des Atheismus. Geduldig antwortet der Philosoph seinen Widersachern. Die Polemik setzt sich mehrere Jahre lang fort, um nach einer Intervention des Prinzen von Oranien schließlich abzuebben.
Descartes wäre zweifellos in seiner Wahlheimat gestorben, hätte er im Herbst 1649 nicht der dringlichen Einladung der Königin Christina von Schweden Folge geleistet. Es dauert nicht lange, bis er sich über seinen Fehler klar wird. Während er für gewöhnlich nachts zehn Stunden schläft und seinen Geist noch mehrere Stunden schweifen lässt, bevor er sich aufrafft, muss er nun jeden Morgen um vier Uhr aufstehen, um die Herrscherin in die Feinheiten seiner Metaphysik einzuweihen. Bald hat er nur noch einen Gedanken im Kopf: seinen friedlichen Ruhestand wiederzufinden. Doch die Temperaturen im hohen Norden lassen ihn zu Eis erstarren, und am 2. Februar 1650 manifestiert sich eine Lungenentzündung. Nach tagelangen Unterredungen mit dem Leibarzt der Königin über das Für und Wider des Aderlasses stirbt Descartes am 11. Februar im Morgengrauen, ohne Zeit zur Beichte gehabt zu haben.
Das gesamte Dasein des Philosophen konzentriert sich in dieser Episode: Seine letzten Worte »Nun, meine Seele, heißt es Abschied nehmen« hätten die eines Gläubigen sein können oder die eines Gelehrten, der mit einem ausländischen Kollegen debattiert. Descartes hat den Glauben seiner Kindheit nie aufgegeben. Wissenschaft und Religion, dachte er, schließen sich nicht aus: Sie stützen und vervollständigen sich gegenseitig. Doch durch diese letzte Pirouette des Schicksals hat er es geschafft, bis zum letzten Atemzug den Zweifel an der Ernsthaftigkeit seines Glaubens am Leben zu halten.
Daten zu Descartes’ Leben
René Descartes kommt am 31. März als drittes Kind eines Gerichtsrats in La Haye en Touraine zur Welt
1604Er wird Internatsschüler eines Jesuitenkollegs, wo er eine klassische sowie mathematische Ausbildung erhält
1618Descartes widmet seinem Freund Isaac Beeckman sein erstes naturwissenschaftliches Werk »Leitfaden der Musik«
1625Descartes lässt sich in Paris nieder und tritt in Austausch mit verschiedenen Intellektuellen. Er verkehrt in gehobenen Kreisen
1629Descartes verkauft seinen Besitz in Frankreich und zieht in die republikanischen Niederlande, wo er sich mehr Gedankenfreiheit erhofft
1637Anonym veröffentlicht Descartes die »Abhandlung über die Methode«, um weitere Konflikte mit der Kirche zu vermeiden
1641In Paris erscheint sein Hauptwerk »Meditationen über die Erste Philosophie«
1644Er veröffentlicht »Die Prinzipien der Philosophie«. Wie immer verfasst er sein Werk nicht in seiner Muttersprache, sondern in Latein
1650Descartes stirbt in Stockholm, vermutlich an seinem Lungenleiden. Bis heute ranken sich Gerüchte um einen vermeintlichen Gifttod
Daten zum geschichtlichen Kontext
Henri IV. unterzeichnet das Edikt von Nantes zur Anerkennung der Religionsfreiheit für Anhänger der Reformation. Zeitgleich Höhepunkt der Hexenverbrennung
1618Mit dem Ständeaufstand in Böhmen beginnt der Dreißigjährige Krieg
1620Francis Bacon veröffentlicht sein »Novum organon scientiarum«
1633Verurteilung Galileis durch die Kirche, da in einem seiner Werke das Weltbild des Kopernikus dem des Ptolemäus als überlegen dargestellt wird
1637Der niederländische Forscher Isaac Beeckman stirbt in Dordrecht, ohne sich mit Descartes nach einem Zerwürfnis versöhnt zu haben
1643Geburt von Isaac Newton
1648Ende des Dreißigjährigen Krieges mit der Verkündung des Westfälischen Friedens
1663Verbot der kartesianischen Schriften durch die katholische Kirche
Descartes’ Grundbegriffe
Von Pierre Guencia
Descartes begründet eine neue Erkenntnistheorie und eine neue Metaphysik: der Körper als Maschine, die Seele als Refugium des freien Willens, der Mensch als mysteriöse Einheit von Körper und Seele.
Ich denke, also bin ich
Die sogenannte Cogito-Formel ist der bekannteste Ausspruch des Philosophen. Descartes’ Argumentation lässt sich dabei wie folgt zusammenfassen: Selbst wenn ich mich bemühen würde, an allem zu zweifeln: an der Existenz wahrer Dinge außerhalb von mir, an der Existenz jenes Körpers, den ich für den meinen halte, und selbst an den einfachsten Wahrheiten wie zwei plus zwei gleich vier, ist der Gedanke »Ich denke, also bin ich« ein Satz, dessen Wahrheit ich mit der größten Gewissheit äußern kann. Denn auch wenn ich an all den oben genannten Dingen zweifeln kann, kann ich nicht daran zweifeln, dass ich zweifle und dass ich, der ich zweifle, etwas bin und nicht nichts. Es ist logisch unmöglich, dass ich nicht bin, wenn ich denke, dass ich bin: Die Gewissheit meiner Existenz hängt also von der Gewissheit des sich in mir vollziehenden Aktes des Denkens ab. Seit dieser Satz geäußert wurde, fühlten sich die Philosophen ständig von der Form der kartesianischen Argumentation bedrängt, in der sie einen verborgenen Sophismus vermuteten, doch waren sie auch erstaunt über die unendliche Ergiebigkeit einer dem Anschein nach so schlichten Formel. Es ist nicht übertrieben zu behaupten, die gesamte moderne Philosophie sei aus ihm hervorgegangen. Descartes glaubte also nicht zu Unrecht, mit dieser ersten Wahrheit den »festen Grund«, das Fundament gefunden zu haben, auf dem sich ein klares und wahres Denken errichten ließe.
Die Einheit von Seele und Körper
Zwei Erkenntnisse hält Descartes in Bezug auf die Seele (bzw. den Geist) für gegeben: 1. Sie ist eine Sache, die denkt; 2. Sie ist mit einem Körper vereint und bildet mit ihm ein einziges Ganzes. Obwohl Descartes von einem Dualismus zwischen Leib- und Seelensubstanz ausgeht, betont er dennoch die Einheit beider Substanzen im Menschen. Jenen, die nicht verstehen, wie zwei so unterschiedliche Dinge wie die Seele und der Körper aufeinander einwirken können, entgegnet der Liebhaber klarer und deutlicher Ideen stets: Weder Räsonieren noch der Vergleich mit etwas anderem könnten uns das begreiflich machen, sondern allein die unbezweifelbare Erfahrung dieses Wirkens, die ein jeder macht, wenn er seinen Arm oder sein Bein bewegt oder einen Schmerz verspürt. Der Mensch ist für Descartes nämlich – entgegen einem hartnäckigen Missverständnis – kein Geist, der in einem Körper haust, sondern eine Realität besonderer Art, die sich nicht auf eine der Substanzen, aus denen er zusammengesetzt ist, reduzieren lässt. Die Seele ist im ganzen Körper gegenwärtig (und nicht nur in der Zirbeldrüse, in der sie die aus allen Körperteilen kommenden Informationen empfängt), umgekehrt ist der Körper immer mein Körper, ebenso unteilbar wie die Seele.
Die Idee von Gott
Im Unterschied zu den Scholastikern, die in ihrem Erkenntnisstreben von der Welt ausgehen, um sich Gott immer weiter zu nähern, betrachtet Descartes nur die Ideen, die er in sich findet und die »wie Gemälde oder Bilder der Dinge« sind. Jede Idee repräsentiert etwas – seien es reale Dinge (ein Baum, ein Mensch usw.), seien es Fiktionen (eine Meerjungfrau zum Beispiel), sei es eine wahre Natur, wie die Idee eines Dreiecks oder die Idee von Gott. Genauso wenig, wie ein Dreieck ohne seine Grundeigenschaften gedacht werden kann, kann Gott ohne seine Hauptattribute gedacht werden, die zu einem einzigen vereint werden können: der Vollkommenheit seiner Natur. Gott ist jenes einzigartige, unendliche Wesen, dem es an nichts fehlen kann. Dem Menschen mangelt es nun an allen (oder fast allen) Vollkommenheiten, die zu einem unendlichen Wesen gehören. Der Geist, der endlich ist, folgert Descartes, kann die Idee von einem unendlichen Wesen also nicht gänzlich selbst konstruiert haben. Diese in ihm vorhandene Idee des Unendlichen, in Gestalt Gottes, repräsentiert ferner ein wahrhaftiges und notwendiges Sein und nicht etwa eine Fiktion oder auch ein zufällig existierendes Ding wie einen Baum oder einen Menschen. Descartes’ Beweise für die Existenz Gottes sind sehr komplex und bedürfen der Kenntnis der gesamten kartesianischen Philosophie. Festzuhalten ist, dass die Idee von Gott oder vom Unendlichen die höchste von allen Ideen ist, die der menschliche Geist konzipieren kann, und dass er gerade in der Fähigkeit, diese Idee klar zu erfassen, das Zeichen einer höheren, anderen Macht in sich trägt. Die Lehre aus der kartesianischen Meditation über Gott ist damit auch, dass ein endliches Wesen sich nicht selbst denken kann, ohne sich auf die Idee von einem unendlichen Sein zu beziehen.
Freiheit und Edelmut
In seinen »Meditationen« hat Descartes gezeigt, dass der freie Wille lediglich darin besteht, eine Sache eher als eine andere zu wählen. Folgende Tatsache nämlich lässt sich mehr als jede andere unzweifelhaft erkennen: Entscheiden wir uns in einer Situation eher für A als für B, verspüren wir keinen Zwang. Wir nehmen sie frei und willentlich vor. Das einzige Problem, auf das der Mensch trifft, besteht also nicht darin, zu wissen, ob er »wirklich« frei ist, sondern darin, von jener Freiheit (bzw. jenem Vermögen, das zu wählen, was er in sich fühlt) guten Gebrauch zu machen, indem er eher das Wahre als das Falsche, eher das Gute als das Schlechte wählt. Doch hier ist jeder die Regel seiner selbst, kann nur auf seine eigenen Erkenntnisse und Kräfte zählen – andernfalls wäre er ja nicht frei. Diese Möglichkeit, uns durch uns selbst zu bestimmen, ist für den Philosophen wahrlich eine wunderbare Sache. Sie macht uns Gott ähnlich, emanzipiert uns von ihm, aber erlaubt es andererseits auch, die Vernunft seiner Gesetzgebung vernünftig nachzuvollziehen. Das Einzige, das uns einen wahren Grund geben kann, uns selbst zu schätzen, ist der regelgeleitete Gebrauch unseres freien Willens.
Die Methode
»Besser ist es, nie nach der Wahrheit zu suchen, als es ohne Methode zu tun.« Die Methode ist für Descartes jener »Weg«, der den Geist von einer Wahrheit zur nächsten führt, regelmäßig fortschreitend von der einfachsten zur komplexesten. Die intellektuellen Fähigkeiten genügen nicht, wenn der Geist nicht geordnet und aufmerksam vorgeht. Eine solche Methode ist bei den Mathematikern gebräuchlich: Indem sie von den einfachsten Dingen ausgehen und nach strengen Herleitungen verfahren, finden sie – keineswegs zufällig – solide Wahrheiten und exakte Beweisführungen. René Descartes, der ein großes mathematisches Talent besaß, strebte stets danach, der Philosophie eine Methode zu geben, die es erlaubt, zu sicheren und klaren Erkenntnissen zu gelangen und sie somit von den endlosen und eitlen »Disputen« zu emanzipieren.
Der Körper
Descartes glaubte, sämtliche Körperfunktionen besser erklären zu können, indem er den Körper mit einer Maschine oder einem Automaten gleichsetzte. Entgegen den Lehren des Aristoteles ist es für Descartes nicht die Seele, die aus dem Körper einen lebendigen Körper, also einen Leib, macht. Man muss die wichtigsten Körperfunktionen – Verdauung, Bewegung, Atmung, aber auch Gedächtnis und Imagination – erklären können, als ob sie aus einem Mechanismus hervorgingen, den Gott hatte automatisieren wollen, wie eine Uhr, die dazu bestimmt ist, die Stunden anzuzeigen, einzig aufgrund der Anordnung der Rädchen und Gewichte. Die Annahme einer kleinen Seele, die jede wichtige Funktion lenken und sie zur Verwirklichung des Zweckes führen würde, für den sie entworfen wurde, ist folglich nutzlos. Diese mechanistische Herangehensweise in Bezug auf die Sphäre des Lebendigen stellt eines der Schlüsselstücke des kartesianischen Denkens dar. Auf ihr beruht die metaphysische Unterscheidung von Seele und Leib wie auch die Erklärung von deren Einheit innerhalb ein und desselben Wesens – des Menschen. Nicht zuletzt bietet sie den Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Emotionen und Leidenschaften. Denn um zu verstehen, wie sich die Leidenschaften in der Seele ereignen und wie man ihnen widerstehen kann, muss zunächst das Wirken des Körpers auf die Seele erkannt werden.
Zum Werk Descartes’
Aufgrund seiner andauernden Konflikte mit der katholischen Kirche ließ Descartes seine naturwissenschaftliche »Abhandlung über die Welt« unvollendet. Stattdessen arbeitete er an der »Abhandlung über die Methode«. Zu Lebzeiten wurde dieses 1637 anonym veröffentlichte Werk sein größter Erfolg.
Weiterführende Lektüre
Für einen Überblick eignet sich Hans Poser: »Descartes. Eine Einführung« (Reclam, 2012), empfehlenswert ist zudem der Aufsatzband »René Descartes: Meditationen über die Erste Philosophie« (Akademie, 2009). Zu Descartes’ Einfluss auf die Philosophie siehe Hans-Peter Schütt: »Die Adoption des ›Vaters der modernen Philosophie‹« (Klostermann, 1998).
Stimmen zu Descartes’ Bedeutung
Transparenz für alle Von Manfred Schneider
In der Nacht von Sankt Martin 1619 hatte René Descartes einen Traum: Er glaubte von einem Donner zu erwachen, und als er die Augen öffnete, erblickte er lauter feurige Lichtpunkte, die sich von seinem Auge aus im Zimmer verbreiteten. Schon öfters hatte er mitten in der Nacht erlebt, dass ihm seine Augen mit wunderbarer Leuchtkraft Dinge in seiner Nähe erkennbar machten.
Aus diesem Traum ging Descartes’ philosophisches Projekt hervor, das Erkennen der Dinge wie das Licht der Sonne arbeiten zu lassen. Die »Meditationen«, die für radikale Klarheit des Denkens sorgen sollten, sind die Gründungsurkunde der philosophischen Transparenz. Für den Denker hieß Transparenz die wesentliche Eigenschaft der Luft. Sie lässt das Licht passieren, anders als das Wasser, das den Lichtstrahl ablenkt. In den »Meditationen« aber ist der Held, der für diese Transparenz sorgt, der Verstand, der auch lumen naturale heißt und für Wahrheit sorgt. Die erste Denkregel der dritten Meditation lautet entsprechend: »Alle Dinge, die wir sehr klar und sehr unterschieden erfassen, sind allesamt wahr.« So arbeitet das natürliche Licht des Verstands als Transparenzmaschine, die zwischen hell und dunkel, wahr und falsch, gut und böse unterscheidet und entscheidet.
Heute wird dem Begriff Transparenz erneut eine beispiellose Bedeutung zugeschrieben. Während der Philosoph seinen Optimismus, dass die Welt und der Kosmos völlig begriffen werden können, auf die Technik des Teleskops gründete, hängt unser Transparenz-Optimismus an der digitalen Technologie. Für uns ist Transparenz nur noch eine Metapher des Wissenswunsches. Tatsächlich haben wir den Traum totalisiert: Wir wollen bis in den Anfang des Kosmos blicken, wir wollen die Operationen des Gehirns beobachten, und wir wollen die Rätsel der Materie lösen. Allerdings sorgt nicht mehr das lumen naturale für das tiefste Erkennen, sondern Computerberechnung. Vielleicht hatte Descartes, der geniale Mathematiker, auch bereits diese Erkenntnis.
Manfred Schneider ist Professor für Germanistik und Ästhetik an der Ruhr-Universität Bochum. Im Herbst 2013 erschien sein Buch »Transparenztraum – Literatur, Politik, Medien und das Unmögliche« (Matthes & Seitz)
Tierischer Irrtum Von Hilal Sezgin
Schweine erkennen sich selbst im Spiegel, Krähen lassen Nüsse von Autos knacken, und Elefanten trauern, wenn ein Mitglied der Herde gestorben ist: Bei jeder Meldung zu den kognitiven und emotionalen Leistungen der Tiere sind wir beeindruckt und bewegt, dass Tiere so vieles vermögen, was man ihnen gar nicht zugetraut hätte. Aber warum eigentlich? Ist es denn überraschend, dass Herdentiere sozial empfinden oder dass intelligente Tiere ihre Umgebung erforschen und nutzen? In jedem solchen Staunen zeigt sich der Nachhall von Descartes’ Ansicht, dass das Innere der Tiere mit einem Uhrwerk zu vergleichen sei (und ihre Schmerzensschreie mit dem Quietschen eines Rades). Erst langsam strampeln sich Philosophie und Biologie von dem Joch frei, das diese Lehre unserem Denken übers Tier auferlegt hat. Nicht nur Jane Goodall berichtete, wie oft sie der Vermenschlichung gescholten wurde, weil sie den beobachteten Schimpansen Namen gab statt Nummern. Bis heute halten sich Forscher bedeckt, wenn sie von tierischen Freundschaften sprechen, und nennen sie lieber »enge Sozialkontakte unter nichtverwandten Tieren«. Doch die Evolution hat nicht alle Subjektivität, alle Gefühle, alles Denken auf einen Schlag erschaffen, und zwar zufälligerweise mit dem Erscheinen des Menschen. Sondern wir teilen Empfindungsfähigkeit und subjektives Bewusstsein mit unseren tierischen Verwandten. Unsere Moral muss lernen, dem Rechnung zu tragen.
Hilal Sezgin ist studierte Philosophin und freie Publizistin. Zuletzt erschien von ihr »Artgerecht ist nur die Freiheit. Eine Ethik für Tiere oder Warum wir umdenken müssen«.
Visionäre Demut Von Jean-Didier Vincent
Descartes, so könnte man fast sagen, war der Wegbereiter der Neurowissenschaften. Wenn er von der Seele sprach und sie vom Körper unterschied, mit dem er sie nur über die »Zirbeldrüse« verbunden sah, dann nur, um sie beiseitezuschieben. Diese Sicht hat den Aufstieg der Neurowissenschaften erst möglich gemacht: Sie hat den Weg geebnet für die Vorstellung des Gehirns als Organ, in dem sich das Sein des Subjekts abspielt. Das hindert nicht daran, sich die Existenz einer »Seele« oder eher einer Psyche vorzustellen, die dem Gehirn anhängt und gewissermaßen sein Ausdruck ist und es ihm erlaubt, seinen Schmerz, seine Freude und seine Vorlieben zu zeigen. Hier liegt der Irrtum gewisser Anhänger der Neurowissenschaften, die denken, es würde im Grunde reichen, ein elektronisches Gehirn nachzubilden, um eine menschliche Person zu schaffen. In ihrem selbstgefälligen, illusorischen Triumphalismus bilden sie sich manchmal ein, die neuen Herren über das Wesen des Menschen zu sein. Anders gesagt, die Neurowissenschaftler hätten selbst einiges von Descartes’ Schrift »Die Leidenschaften der Seele« zu lernen! Die Wissenschaftler können uns wohl zeigen, wie das Gehirn funktioniert, doch auch wenn sie diese oder jene Fähigkeit an einer bestimmten Stelle verorten, werden sie uns nie erklären können, wie es dazu kommt, dass diesen Hirnarealen die Psyche angebunden ist. Descartes hat uns die schönste wissenschaftliche Lektion erteilt: Das größte aller Rätsel, das unseres tiefsten Wesens, wird die Wissenschaft nie bewältigen können.
Jean-Didier Vincent ist emeritierter Professor für Physiologie und Neurobiologie und einer der führenden Hirnforscher Frankreichs. Von 1991 bis 2004 war er Direktor des Instituts für Neurobiologie des CNRS.
Einführung in die »Meditationen«
Von Denis Moreau
Wer bereit ist, das von Descartes vorgeschlagene Spiel mitzuspielen, den erwartet auf den folgenden Seiten ein einzigartiges gedankliches Abenteuer. In den Worten Michel Foucaults präsentieren die »Meditationen« nämlich nicht etwa eine Argumentation, also eine »Menge von Sätzen, die ein System bilden«, sondern er lädt ein zu einem Parcours, zu einer »Menge von Modifikationen, die eine Übung bilden, der jeder Leser nachgehen kann, und die jedem Leser nahegehen kann«. Wer mitspielt, indem er Descartes ins Land des methodischen Zweifelns folgt, erfährt die Befriedigung, eine Art philosophischer Held zu werden. Denn letztlich wird er oder sie Skeptiker aller Couleur und Herkunft besiegen, angefangen mit jener hartnäckigen Stimme, die in jedem von uns schlummert und immer wieder Zweifel anmeldet, ob das, was wir zu wissen glauben, auch wirklich wahr ist.
Alles beginnt mit der Feststellung einer intellektuell unbefriedigenden Situation, die heute so gültig ist wie anno 1641, dem Erscheinungsjahr von Descartes Hauptwerk: Seit unserer Kindheit empfangen wir passiv und in sehr verschiedenen Bereichen eine beträchtliche Anzahl an Informationen. Das Ganze formt sich zu dem Geflecht unserer »Meinungen«. Die Skeptiker profitieren davon, um ihr galliges Süppchen zu brauen, indem sie ganz grundsätzlich fragen: Was sind diese Meinungen wert? Sind sie überhaupt wahr? Und wenn sie wahr werden, wie ließe sich ihre Wahrheit zweifelsfrei beweisen?
Descartes behauptet, dass es sich unbedingt lohne, einmal in seinem Leben (man beachte den einmaligen Charakter des Vorgangs) auf radikale Weise die Frage nach der Wahrheit unserer Meinungen zu stellen. Man lasse sie dafür Revue passieren und untersuche, ob sie dem Feuer aller vorstellbaren Zweifelsgründe standhalten, so extravagant diese auch sein mögen. Dieser große Test des Geistes wird von Descartes methodisch organisiert nach einem mehrfach zu wiederholenden Dreierschema: 1. Identifizierung eines Bereichs meines (vorgeblichen) Wissens; 2. Aufbietung eines Grundes dafür, diese Inhalte zu bezweifeln; 3. Identifizierung eines neuen Bereichs meines (vorgeblichen) Wissens, der dem vorherigen Zweifelsgrund standhält und gegen den man einen neuen Zweifelsgrund mobilisiert.
Beginnt man mit der gelassenen Sicherheit desjenigen, der meint, für den Moment der Wahrheit bereit zu sein, verkehrt sich das skeptische Verfahren schnell in ein Rückzugsgefecht, schließlich in einen philosophischen Albtraum: Ganze Bastionen des Wissens stürzen zusammen, eingeschlossen die vermeintlich solidesten. Die Vernunft mag noch so sehr versuchen, das Gespenst des Wahnsinns zu bannen, in dem jeder Satz, den ich für wahr halte, sich als falsch erweisen wird. Der Boden beginnt unter den Füßen zu wanken. Und wenn alles nur ein Traum wäre? Oder das Werk eines bösen Zauberers, der mit uns ein ewiges Täuschungsspiel treibt? Um sich vor (möglicherweise falschen) Vorurteilen zu schützen und den Weg der Skepsis konsequent zu Ende zu gehen, muss man sich an den Rand des Wahnsinns begeben, muss man bereit sein, an der Vernunft und der Gesundheit des eigenen Geistes zu zweifeln. Descartes wagt dieses Experiment. Auf der Suche nach einer neuen Philosophie, einem neuen Fundament des Wissens meditiert er sich eine lange Nacht in einen Taumel grundsätzlichster Zweifel und Wahnannahmen.
Im Morgengrauen endlich stößt er auf einen Fakt, der über jeden Zweifel erhaben ist: Um die Operationen des radikalen Zweifelns zu vollbringen, muss das in Frage stehende, denkende und also zweifelnde Subjekt zumindest existieren. Auf den ersten Blick hat die Art und Weise, wie man diese Entdeckung formuliert, wenig Bedeutung: Ich zweifle, also bin ich; »ich denke, also bin ich« (das cogito ergo sum aus der »Abhandlung über die Methode«); oder auch, wie im vorliegenden Text, »ich bin, ich existiere« (ego sum ego existo). Diese letzte Formulierung des sogenannten Cogito-Arguments ist vielleicht am bemerkenswertesten. Denn sie beinhaltet das Thema des Denkens nicht eigens, hat nicht die Form einer logischen Ableitung, sondern setzt auf die Schlichtheit eines einmaligen Aktes des Geistes. Sie scheint letztlich den Namen wiederaufzunehmen oder zu verkehren, den sich der Gott der lateinischen Bibel (der, die Descartes las) im 2. Buch Mose (III, 14) gibt: ego sum qui sum, »ich bin, der ich bin«. Ich bin, ich existiere: Das ist unbezweifelbar, das ist wahr.