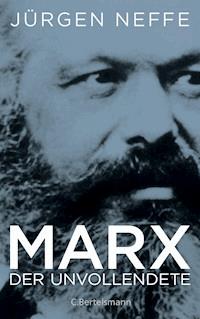9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Roman unserer Zeit vom Bestsellerautor und hoch gelobten Biografen Jürgen Neffe
In einer Zeit, in der es kaum noch handschrift liche Zeugnisse gibt, stößt ein Biograf auf die Lebensgeschichte von Janush Coppki. Der weltfremde Chemielaborant ist Anfang des 21. Jahrhunderts auf der Suche nach der »Weltformel des Lebens«. Dabei entdeckt er ein Elixier, durch das Menschen nicht mehr schlafen müssen. Das Mittel steigert Kreativität, Ausdauer, Zuversicht und Libido. Doch wer es einmal nimmt, ist schnell davon abhängig. Zwischen dürfen und müssen liegt nur ein kleiner Schritt. Coppki gelingt es, mit seinem Wundermittel die Liebe der Fotografin Vera zu gewinnen. Über Veras Tochter Jenny und ihren Kreis der »Freunde der Nacht«, die von einer besseren Welt träumen, sowie mit Hilfe ihres Vaters, des Journalisten Leon Hard, verbreitet sich die Wachdroge bald über die ganze Welt, die zusehends aus den Fugen gerät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jürgen Neffe
Mehr als wir sind
Roman
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Der Autor dankt Caprice Crawford für das Aufspüren des Umschlagmotivs und den Vorschlag der Titelformulierung.
1. Auflage
© der Originalausgabe 2014
beim C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-13982-7V002www.cbertelsmann.de
Für uns
Erster TeilDer Dilettant
Wer Biograph wird, verpflichtet sich zur Lüge, zur Verheimlichung, Heuchelei, Schönfärberei und selbst zur Verhehlung seines Unverständnisses, denn die biographische Wahrheit ist nicht zu haben, und wenn man sie hätte, wäre sie nicht zu brauchen.
Sigmund Freud, Brief an Stefan Zweig, 31.5.1936
1
Wäre ich Coppki, würde ich mir nicht erlauben, seine Geschichte zu erzählen. Damit ist eigentlich alles gesagt. Zumindest habe ich das lange geglaubt. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Worüber man nicht schweigen kann, davon muss man reden. Wir sind nur so krank wie unsere Geheimnisse. Am Ende zählt allein die Frage, ob wir leben mussten oder durften. Das Übrige sind Details.
Meine Tätigkeit im Dienst der Schrift lässt mir keine Wahl. Nach altklösterlicher Tradition leiste ich sie als freiwillige Pflicht, fernab vom Treiben der Welt. Ich schreibe Texte ab. Briefe, Manuskripte, Notizzettel, Kochrezepte, Haushaltshefte, Tagebücher. Besser gesagt, entziffere ich handgeschriebene Zeilen, vor denen die Lesegeräte kapitulieren, und diktiere sie einem Schreibautomaten. Der macht daraus Vorlagen, die ich in einem zweiten Arbeitsgang zum lesbaren Ganzen ergänze. Inselbegabten Schnelllesern soll das mechanische Erfassen im Akkord sogar ein ordentliches Einkommen sichern. Inhalte lenken dabei nur ab. Ich als einfacher Wortklauber, der den Sinn im Zusammenhang sucht, muss mich mit der Lust am Lesen schadlos halten.
In einem fort lasse ich mir Material kommen, berühre die Seiten durch die weiße Seide meiner Handschuhe, stelle mir Menschen vor, Szenen, Dramen, Schicksale. Jede Einkaufsliste versetzt mich in Entzücken, jede Urlaubsgrußpostkarte lässt Welten vor mir erstehen. Ich sonnenbade, lüge, plane, feiere und fiebere mit, verliebe oder trenne mich, als wär’s ein Stück von mir.
Anfangs irritiert mich das Gefühl, Intimität zu verletzen, wenn ich Schriftzüge aus der Hand fremder Menschen vor mir sehe. Wie darf ich ohne ihr Einverständnis lesen, was nicht für mich bestimmt ist? Bald verwandelt sich meine Scheu in ungezügelte Schaulust. Gerade das Nackte, Schutzlose, Unmittelbare zieht mich an.
Auf einmal rücken Menschen in den Mittelpunkt meines Schaffens. Dass es sich durchweg um Tote handelt, stört mich weniger. In ihren Zeilen bleiben sie lebendig und einzigartig. Es berührt mich bis heute, jemanden allein in der Linienführung seiner Hinterlassenschaften vom ersten Schuldiktat bis zu letzten Notizen reifen und welken zu sehen.
Ich habe nie so recht verstanden, warum unsere Vorfahren die handliche Technik aufgeben mussten, Gedanken aufs Papier zu malen. Schriftkundige, so heißt unser aussterbender Beruf, sehen in den Windungen und Schnörkeln einen Ausdruck sprechender Seelen. Gefühlslagen zeigen sich als Fingerabdrücke des Denkens wie Gehirnströme in einem Elektrodiagramm.
Unsere Großeltern haben die Kunst noch beherrscht. Jeder konnte sie mühelos im Kindesalter lernen. Wie schwer es fällt, sie sich noch als Erwachsener anzueignen, muss ich am eigenen Leib erfahren. Lange male ich Wörter unbeholfen wie damals Grundschüler in ihren Anfängerübungen. Umso erstaunlicher, wie sich dann doch meine ganz eigene Handschrift herausgebildet hat.
Das Schreiben schärft meinen Blick. Bald kann ich schludrigste Kritzeleien ohne Probleme vom Blatt lesen. Manchmal übertrage ich Sätze und Passagen mit einem Bleistift in mein Notizbuch wie Maler im Museum Skizzen der Meisterwerke. Aus dem Panoptikum der Figuren und Ereignisse errichte ich mir im Kopf ein Panorama, das mich an besseren Tagen begleitet, an schlechteren verfolgt. Dabei nehme ich mal diese, mal jene Rolle ein und führe sie im Guten wie im Bösen zu Ende.
Auf Dauer bleibt es nicht aus, das Alltagsgeschäft der Typen und ihrer Beziehungsmuster zu durchschauen. Irgendwann kommt der Augenblick, tausend Charaktere und Konstellationen sind durchgespielt, da kämpft sich ein Anflug von Langeweile ins Gemüt. Das ist der Zeitpunkt, von seiner Passion zu lassen. Oder sie als Mission zu verstehen, die nächste Herausforderung zu suchen und wenigstens eine Person ausfindig zu machen, deren Dasein noch Unentdecktes bereithält.
Alles aber, was das Archiv der Einmaligen Originale noch zu bieten hat1, jedes Blatt und jeder Zettel ist längst durch zahllose Hände gegangen, jede halbwegs reizvolle Rolle vergeben. Eines Tages bemerkt eine der letzten Bibliothekarinnen2 die Verzweiflung hinter meiner Geschäftigkeit. Echte Chancen, sagt sie, biete Forschern wie mir allenfalls noch der Anonyme Friedhof. So nennen Großarchivare die Abteilung für Restbestände handschriftlicher Zeugnisse, die wegen Unleserlichkeit noch nicht erfasst oder keinem Urheber zuzuordnen sind.
Seit das Gesetz seine Bürger verpflichtet, alle noch in ihrem Besitz befindlichen Originalschriftstücke von Verstorbenen bei zentralen Sammelstellen abzugeben, seit die letzten Raritäten entdeckt, sämtliche Dachböden, Keller und Kisten durchwühlt worden sind, hat das Archiv für unbeschriebene Erinnerungen eine letzte kurze Blüte erlebt. Es hütet seine Schätze, Unikate aus der Zeit vor dem Großen Vergessen, in den Hallen und Stollen eines aufgelassenen Salzstocks. Die trockene Luft dort unten tut den Dokumenten gut, meinen Schleimhäuten weniger. Dennoch wüsste ich keinen besseren Ort für meine Arbeit als die weiß glitzernden Höhlen im ewigen Kristall.
Anfangs füllten die Hinterlassenschaften noch mächtige Hallen im Salz. Inzwischen herrscht auch hier der Kampf um letzte Claims. Für dessen Befriedung sorgt ein strenges, eigens für Schriftsachverständige geschaffenes System. Man sitzt, durch Trennwände vom Nachbarn abgeschirmt, in einer Art Kabine. An deren offener Vorderseite schiebt sich langsam ein Fließband mit Schriftstücken vorbei. Jeder darf sich ein Buch, ein Heft oder ein Zettelchen herunternehmen und so lange begutachten, wie es nötig erscheint, und dann gegen ein anderes eintauschen. Alle zwei Stunden ist eine Viertelstunde Pause erlaubt.
Wer nicht zurückkommt, verliert seinen Platz. Dann rücken alle um eine Kabinenbreite weiter nach vorn. Eine verborgene Mechanik faltet die freie Seitenwand samt dem dazugehörigen Fußboden zusammen, befördert sie ans Ende der Schlange und schafft dort eine neue Zelle. Nach Inkrafttreten des Gesetzes liefen noch Tausende solcher Bänder. Inzwischen ist ihre Zahl auf ein knappes Dutzend zusammengeschmolzen.
Es verlangt einiges an Ausdauer (und Proviant), sich allmählich dorthin vorzuarbeiten, wo noch echte Funde winken. Als die dritte Nacht anbricht, kann ich die Schleuse in der Ferne sichten, aus der die Stücke in geschlossenen Reihen an den Arbeitsnischen vorbeifließen. Wer sich hier vorbeugt, kann wie in einem Register Arme vorschnellen sehen, Hände in weißen Handschuhen, die greifen, sich zurückziehen, erneut auftauchen, ablegen und zufassen.
Gerade blättere ich durch eine handgeschriebene, offenbar nie eingereichte Doktorarbeit über die ersten Endlosromane der Literaturgeschichte, da läuft ein Buch in schwarzem Ledereinband auf mich zu. Wahrscheinlich ist es sein süßherber Duft, weiches Leder, das mit einem Raucher zusammengelebt hat, der mich bewegt, es gegen die Dissertation einzutauschen.
Glaubte ich noch an Zufälle, so könnte ich jetzt von glücklicher Fügung sprechen. Wenn ich zurückblicke, bin ich mir dagegen sicher, der schwarze Band – ich halte ein schwer entzifferbares Tagebuch in Händen – hat mich gesucht und gefunden. Richtig ist, dass ich wahllos eine Seite aufschlage, oben links zu lesen beginne, weiter über die Zeilen wandere und für eine Weile das Fließband vergesse. Da äußert sich in linkshändiger Seitschrift ein namenloser Pädagoge über einen Jungen, der Janush heißt und offenbar außergewöhnliche Talente besitzt.
Der Lehrer, Nachforschungen zufolge ein Mann namens Francke, hat seine Klasse aufgefordert, einen Lebenslauf in der dritten Person zu schreiben – die Vergangenheit anhand der Erinnerung, die Zukunft aufgrund der Erwartungen. Sosehr er bedauert, dem jungen Autor die schlechteste Note gegeben zu haben, so glühend bewundert er die Kühnheit, mit der dieser J. C. sich über die Aufgabe hinweggesetzt hat. Ausgerechnet der Zurückhaltendste der Klasse habe als Einziger eine eigene Stimme erhoben mit seinem Fichte’schen Ich, das sich betrachten könne, als wäre es ein anderes.
Als ich weiterblättere, fällt ein zweimal eingeschlagenes Stück Papier aus dem Buch. Ich ziehe mich tiefer in meinen Kubus zurück, entfalte den Streifen im Schatten meiner Brust und streiche ihn behutsam glatt. Säuberlich vom oberen Rand einer Seite abgetrennt, trägt er den Text, der den Lehrer so innig schwärmen lässt, einen einzigen Satz. Die ameisenkleine Schrift, mit Bleistift zu Papier gebracht, stammt offenbar aus der Hand des jungen Mannes, den er Janush nennt.
Ich höre sonst keine Stimmen. Aber in dem Moment spricht eine zu mir. Es ist meine eigene, die etwas sagt, was ich nicht verstehe, aber richtig als Weckruf deute. Die Handschrift ähnelt, wenn auch auf ein Mindestmaß an Lesbarkeit verkleinert, aufs Äußerste der meinen.
Ich fordere mein Schicksal heraus und melde mich in der Systemzentrale an. Als der Kontakt hergestellt ist, gebe ich den Satz durch. Aufatmen. Null Treffer. Den Text habe ich offenbar als Erster entdeckt. Nun kommt der Moment, auf den alle hinfiebern.
Ist dieses Leben noch zu haben?
Ich schließe die Augen, buchstabiere j a n u s h leerzeichen c o p p k i, lasse mir die Schreibweise bestätigen und höre schließlich das erlösende Wort: frei.
Mein Erstanspruch wird ohne Weiteres akzeptiert. Ich lege das Tagebuch zurück auf das Band, lasse das Zettelchen verschwinden, verlasse meine Kabine, passiere ohne Probleme die Ausgangskontrolle und laufe der nächsten Hoffnungsvollen in die Arme. Es ist zum Glück die Psychologin, mit der ich mich bestens verstehe.
»Darf ich fragen, was Ihre Laune erhellt?«
»Eine unbeschriebene Figur, die einen seltsamen Satz hinterlassen hat.«
»Gratuliere, Herr Kollege, da hat sich die Mühe ja gelohnt. Wie nennt sie sich denn, Ihre Figur?«
»Coppki heißt sie, Janush Coppki.«
»Nie gehört. Aber guter Name. Coppki?«
Auf die Buchstabenfolge bin ich im System noch ein paarmal gestoßen, jeweils mit dem gleichen Erschrecken, ein anderer könnte ihm ebenfalls auf die Spur gekommen sein. Es stellt sich in allen Fällen als verfrüht und unbegründet heraus.
Zuerst finde ich das Wort in der Klarschrift einer verwischten Ablichtung des Handbuchs der Münzen Großbritanniens und Irlands im Britischen Museum von Herbert Appold Grueber aus dem Jahr 1899 auf Seite 209 in der Anmerkung 218 zu einer Bildtafel mit Kupfermünzen von 1692. Als ich das Originalexemplar in der Britischen Nationalbibliothek schließlich in Händen halte, erweist sich mein Fund als ebenso nichtig wie zwei weitere Quellen in verzerrten Kopien australischer Zeitungen nach 1900. Es geht um ein Metall, nicht um einen Menschen.
Im tasmanischen Mercury, in Hobart verlegt, Hauptstadt der grünen Inselprovinz im Süden, taucht am 22. Juli 1914 in der Transkription einer längeren Meldung über die bisher größte Kupferlieferung des Britischen Commonwealth nach Australien auf Seite 4 ebenfalls das Wort Coppki auf, wenn auch aufgrund der mangelhaften Lesbarkeit des Originals mit einem Fragezeichen versehen. Im Originalbild der Zeitungsseite ist ziemlich deutlich statt »Coppki?« wie im Münzkatalog das Wort »Copper« zu erkennen.
Die rund 600 Kisten mit 15 Tonnen Penny- und Halfpennymünzen im Wert von etwa 6000 Pfund Sterling werden von Bord der R. M. S. Egypt unverzüglich in den Tresor der Staatskasse von Melbourne geschafft. Weltweit herrscht Knappheit an wertvollen Metallen.
Am selben Tag berichtet das Blatt auf Seite 5 in einer 19-zeiligen Meldung von Kursstürzen an den Börsen in Wien und Berlin infolge der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Ferdinand in Sarajevo drei Wochen zuvor und des Ultimatums der kaiserlich-königlichen Regierung an Serbien. »Angst vor Krieg« ist die Überschrift untertitelt.
Am 14. August 1918, Mensch- und Materialschlacht stehen kurz vor dem Ende, erscheint, ebenfalls in der Ablichtung einer australischen Zeitungsseite, in diesem Fall des Argus aus Melbourne, erneut das Wort Coppki, das in der Auflistung der Aktienkurse von Bergbauunternehmen in Form einer Zwischenüberschrift eine neue Rubrik einleitet. Anhand des faksimilierten Originals ist es allerdings wiederum deutlich als Copper zu erkennen, diesmal im übertragenen Klartext aber mit einem Ausrufezeichen versehen.
Coppki! Der Spurlose. Solange ich suche, weitere Treffer erziele ich nicht. Sein Name ist, zumindest im schriftlich erfassten Teil der Geschichte, unbekannt. Ein weißer Fleck auf der Landkarte des Großen Gemeinsamen Gedächtnisses. Der Wechsel vom Frage- zum Ausrufezeichen hat mich gleichwohl noch lange beschäftigt. Er passt wie die Schablone eines allgültigen Horoskops auf sein Leben, das vor allem aus Fragen und Antworten besteht. Womöglich hat es mit Kupfer zu tun, einem chemischen Element mit der Ordnungszahl 29, und die Umbruchphase 14/18 könnte auf den Zeitenwandel hinweisen, wie er ihn hundert Jahre später ähnlich erlebt.
Angesichts meiner Entdeckung – ein vergessener Unbekannter, dessen Leben nicht nach den Regeln des Ruhms verlaufen ist – sehe ich mich genötigt, mir ein Arbeitsfeld zu erschließen, dessen billigen Verlockungen ich bis dahin berufsstolz widerstanden habe: der Biografie. Historiker haben Lebensschilderungen längst als Quelle von Einkommen und Ansehen entdeckt. Darunter Koryphäen, die es verstehen, Dutzende Male ausgeschlachtete Vermächtnisse mit handwerklichem Geschick immer wieder in klingende Münze zu verwandeln. Eine Handvoll unbekannter Briefe oder persönlicher Notizen genügt, das Dasein eines vergangenen Menschen in ziegelsteindicken Werken von Grund auf neu zu bewerten.
Um meine Chancen auszuloten, schließe ich mich zum ersten Mal in meiner Laufbahn einem Berufsverband an und besuche die anstehende Jahrestagung Analytischer Biografen. Sollte je vom Jahrmarkt der Eitelkeiten die Rede sein, hier findet er sich in Reinkultur, wo sie zusammenkommen, die Sportler und Forscher und Denker, Politiker, Pop- und Filmstars und anderen Meister von Bild, Ton und Text – verkörpert von ihren Stellvertretern auf Erden.
Zwischen den Disziplinen herrscht freundliches Wohlwollen. Man versichert sich seiner Größe, der Musiker kennt gern mal einen Physiker, die Affenforscherin unterhält sich angeregt mit dem Golfprofi, der auf die Saxofonistin oder den Unternehmensgründer schielt.
Doch schon auf dieser Ebene lassen sich Unterschiede in Rang und Namen ausmachen. Philosophen stehen hoch im Kurs. Entdecker, Religionsgründer und Revolutionsführer schweben über allen. Maler halten sich für wichtiger als Dichter und umgekehrt. Aber beide rangieren weit unterhalb der Boxer.
Die Rangeleien bleiben in der Regel überschaubar, da alle ihr Gebiet ohnehin zum bedeutendsten erklären. Ganz anders innerhalb der Fächer. Ich wünschte, mir stünde das zoologische Vokabular zur Hand, das Gezerre angemessen zu beschreiben, sobald sich Rang- in Hackordnungen verwandeln.
Selbst wenn es den Experten einmal gelingt, sich auf die größten Physiker, Frauenrechtlerinnen oder Verleger zu einigen, hält jeder seine Lesart von deren Leben für die einzig gültige. Am Ende läuft alles darauf hinaus, den Markt möglicher Leser als Erster mit seiner Version zu überschwemmen. Prominente gleichen in dieser Hinsicht Bergen. Ihre Erstbeschreibung verheißt den größten Ruhm.
Einen Ausweg bietet das Jubiläumsjahr. Runde Geburts- und Todestage, hin und wieder auch das Jahr einer Entdeckung, können den Marktwert einer Persönlichkeit beträchtlich steigern und Platz für weitere Lebenslaufschilderungen schaffen. Den Preis zahlen die Biografen, die sich die Haut des Helden mit anderen teilen müssen.
In diesem Jahr stehen pünktlich zum fünfzigsten Jahrestag seiner Machtübernahme ein Staatsmann und seine einflussreiche Frau im Mittelpunkt – verkörpert von nicht weniger als acht Biografinnen und Biografen. Die Regie für das abendliche Bankett hat mich als Neuling ohne Person und Funktion an ihren Tisch gesetzt. In ihrem Oktalog nimmt die Runde kaum Notiz von mir. Das gibt mir Gelegenheit, ungestört fünf Staatsmänner und ihre drei mächtigen Frauen zu belauschen. Zu meiner Linken die Gattin in ihrer resolut rachsüchtigen Rolle, rechts neben mir gleich dreimal der Präsident, einmal tragisch groß, daneben bescheiden im Triumph und an dritter Stelle als Opfer seiner versteckten Homosexualität.
In ihrer Rechthaberei neutralisieren sich die Wettbewerber vollständig. Kein Wort des Abends wäre es wert, erwähnt zu werden. Nur eine Ausdrucksweise ist mir aufgefallen, eine Verwendung des Verbs anlegen, wie ich sie vorher nur aus der Welt der Darsteller kannte. »Ich finde, Sie legen Ihren Präsidenten zu schwermütig an.« – »Ihr Scheitern steckt schon in der Anlage seiner Persönlichkeit.« – »Ich habe sein Leben so angelegt, dass sein Schutzengel stets erkennbar bleibt.«
Am folgenden Morgen gerate ich eher beiläufig in den spärlich besuchten Vortrag eines biografischen Theoretikers. Soweit ich folgen kann, schlägt er neue Analysemethoden vor, unbekannte Helden aufzuspüren. Manchmal lasse sich der Lauf der Geschichte nur unter der Annahme handelnder Personen verstehen, die in den Büchern nicht verzeichnet seien. So wie niemand wisse, wer zuerst dem Rad eine Achse gegeben, einen Stift in die Hand genommen oder die Null als Zahl erkannt habe, so gingen mit Sicherheit auch in jüngerer Zeit gefeierte Ideen auf Einfälle vergessener Stichwortgeber zurück. Die üblichen Verdächtigen – Laborhelfer, Geliebte, Gärtner oder Fahrer – seien in der Regel gut überprüft. Doch dahinter, im Rauschen alltäglicher Begegnungen, vermutet der Professor eine weitere Ebene fehlender Bindeglieder, die das Fundament weltbewegender Ideen gelegt haben könnten.
Historiker messen unterschiedliche Dichten der Geschichte wie Geologen Schichten von Stein und Sediment oder Biologen Jahresringe in Baumstämmen. Die Lagen geben Auskunft über einstmals vorherrschenden Druck und Stress. Dabei verhält sich die Chronik ähnlich wie die Erdkruste. Wo deren Platten sich verschieben, bauen sich an ihren Rändern zunächst Spannungen auf, die sich dann in schweren Beben entladen.
Am entscheidenden Knackpunkt der jüngeren Menschheitsgeschichte, so der Professor, falle eine merkwürdige Diskrepanz ins Auge. Hätten sich die Verlaufskurven großer Epochen und ihrer prägenden Persönlichkeiten bis dahin entsprochen wie jährlicher Baumzuwachs und Klimaverhältnisse, so klafften sie hier auseinander, als ob sich der wichtigste Umbruch seit Urzeiten ohne Urheber ereignet hätte.
Alles und alle sprechen dagegen, die Geschichte könnte einen solch bedeutenden Anstifter oder Antreiber übersehen haben. Sie oder er müsste sich unsichtbar gemacht und sämtliche Spuren verwischt haben. Durch den Resonanzraum der Fachwelt aber geistert wie ein Yeti der Biografik ein geheimnisvolles Wesen, dessen Nicht-Existenz sich ebenso wenig beweisen lässt wie sein Vorhanden- oder Gewesensein. Ihn dingfest zu machen, darüber sind sich die Experten einig, käme einem Gottesbeweis gleich. Es mag vermessen klingen. Aber als ich den Kongress verlasse, fühle ich mich beseelt von der Idee, dem Schneemenschen der Moderne bereits auf der Fährte zu sein.
Bis an den Rand der Epoche, von der hier die Rede sein soll, die ersten Jahrzehnte des dritten Jahrtausends alter Zeitrechnung, konnte ein Menschenleben verstreichen, ohne wesentliche Spuren zu hinterlassen. Mit ein wenig Geschick ließ sich verhindern, dass viel mehr davon übrig blieb als der standesamtliche Nachweis von Geburt, Heiraten, Mutter- oder Vaterschaften und Tod.
Doch selbst, wer umgekehrt Briefe, Tagebücher, Fotos und Filme säuberlich sammelte, konnte die Erosion der Erinnerung nicht aufhalten. Spätestens mit dem Ableben verlor sich das Dasein der Dokumente ins Anekdotische, das nach einer, höchstens zwei Generationen vollends verschwand.
Innerhalb weniger Jahre verkehrten sich die Verhältnisse in ihr Gegenteil. Jeder musste nun ständig damit rechnen, nicht nur beobachtet zu werden, sondern sich auch in allen Bewegungen und Äußerungen wie fürs Jüngste Gericht in ewiger Erinnerung aufbewahrt zu wissen. Ein Segen im Zeitalter wachsender Mobilität und Migration, die alles zur Last machte, was Volumen und Gewicht besaß. Zugleich aber der Fluch all jener, denen die Gewalt über ihre eigenen Hinterlassenschaften entzogen war.
Keine Jugendsünde, kein unbedachtes Wort oder verfängliches Bild, keine längst bereute Tat, die vor dem Großen Gemeinsamen Gedächtnis und damit dem Zugriff der Nachwelt noch sicher gewesen wären. Was immer man von sich gab, sagte, fragte, meinte, bestellte, verkaufte, wozu man politisch neigte, wie man sich benahm, wo man ging und stand, wen man dort traf, geriet in die Fänge einer krakenhaften Maschinerie, die es fraß, verdaute und mit Gewinn an zwielichtige, gleichermaßen aus der Deckung operierende Abnehmer veräußerte. Die Matrix des werdenden Weltgeistes, damals noch Internet genannt, die uns heute so fern und grob gestrickt erscheint wie Coppkis Zeitgenossen die Anfänge von Telegrafie und Telefonie, steckte noch in ihrer vorbewussten Phase.
Bald konnte niemand mehr sicher sein, irgendetwas außerhalb der eigenen Schädelwände verborgen zu halten. Statt sich jedoch zu schützen, ließ die Mehrheit der Menschen plötzlich alle Vorsicht fahren und stellte von sich aus immer weitere Teile des vormals so sorgfältig gehüteten Privaten einem ständig wachsenden Publikum zur Schau.
Wahrscheinlich reagierten die Betroffenen auf die öffentliche Bloßstellung, indem sie sich in einer Art Vorwärtsverteidigung selbst enthüllten – anfangs noch unbefangen und ohne Sinn für die Folgen. Dann aber formten sie wie einst nur ihre Stars und Prominenten mit professioneller Perfektion das Bild ihres Selbst und wurden zu dessen besten Darstellern. Das Öffentliche geriet zunehmend zum Schauplatz allgemeiner Selbstvermarktung. Die Menschen inszenierten ihre Leben nach den Regeln von Angebot und Nachfrage. Ohne Profil und Portfolio war einer keiner.
Innerhalb weniger Jahre war die Welt eine andere geworden. Der neue Geist erfasste alle Bereiche. Kaum eine Berufsgruppe erlebte den Wandel so drastisch wie die Biografen. Herrschte bis in jene Tage noch Mangel an Lebensdaten, so drohten sie nun förmlich im Material zu ertrinken. Plötzlich schrieb jede und jeder täglich neue Folgen der Fortsetzungsgeschichte, in der sie oder er die Hauptrolle spielte. Die Zahl der Aufnahmen, die täglich von einem Menschen entstanden, erreichte Werte wie in Coppkis Kindheit nicht einmal pro Jahr.
Alle bastelten vor den Augen aller anderen an ihrer Biografie. Nur wenige widerstanden der Verlockung, ihr Selbstbild vorteilhaft zu gestalten und Schwächen zu kaschieren. Der Sinn des Lebens ergab sich aus der Stimmigkeit seines fabrizierten Verlaufs. Erinnerungen passten sich an. Täuschung und Fälschung blühten, bis die Beziehung von Schein und Sein den Charakter einer inszenierten Selbstlüge annahm, die sich für die Wahrheit hielt.
Die willkürliche Aneignung einer fremden Person erfüllte in jenen Tagen noch nicht den Tatbestand eines Vergehens. Erst Jahre später tauchte die verbriefte Urheberschaft am eigenen Leben, verbunden mit dem Grundrecht auf Vergessenwerden, in den Verfassungen auf. Damals konnte noch jeder alles über jeden behaupten, solange es nicht beleidigend war. Das galt aber nur für noch lebende Zeitgenossen. Die Toten waren vogelfrei.
Der Tisch, an dem ich dies schreibe, hat einmal Coppki gehört. Er steht im Keller der chemischen Laboratorien hinter dem Ausgabeschalter des Material- und Gerätelagers, das er als leitender Laborant ein Jahrzehnt lang in alleiniger Verantwortung führte. Dazu passend ein vierbeiniger Hocker gleicher Bauart aus Edelstahlrohr und geleimtem Schichtholz.
Hier saß er, wenn er sich leise murmelnd dem Denken überließ. Kreuzgerade, die Ellbogen aufgestützt, die Finger unterm Kinn verschränkt, die Augen nach Art der liegenden Acht auf unendlich gerichtet. Nun hocke ich auf seinem Platz in seiner Haltung und folge seinem Blick zurück bis zu jenem Tag, an dem er den Auftrag seines Lebens erhält.
Draußen vor dem Schalter hat sich eine Warteschlange gebildet. Mittags kommen alle auf einmal, am Ende der Pause, auf dem Weg von der Kantine, und holen ihre bestellten Chemikalien und Utensilien ab. Diplomanden, Doktoranden, Laboranten, die ihre verschmierten Kittel nicht einmal zur Mahlzeit ablegen. Chemikerstolz. Titelträger in reinweißen Gewändern finden eher selten den Weg in Coppkis Katakomben.
Wie fremdartiger Blütenduft hängt ätzend süß der Geruch von Lösungsmitteln in der Luft. Geübtere Nasen können Chloroform, Benzol und Benzine auseinanderhalten, Essig, Äther, Alkohole. In der Zentralkammer reihen sich abertausende Behältnisse vom fassdicken Blechbottich für Nährböden bis zum fingerhutkleinen Glas mit Feinheiten der Chemie des Lebens.
Ich schaue auf seine Uhr. Die Zeit treibt die Zeiger voran. In einer knappen Minute müsste er den Schalter öffnen. Was wäre, wenn er es nicht täte? Unruhe vor der Tür, der Betrieb geriete ins Stocken, Stress mit der Leitung, Anstellung gefährdet. Aber wäre das dann nicht genauso seine Bestimmung wie wenn er einen kräftigen Sprengstoff angerührt und sich mit dem Haus in die Luft gejagt hätte?
Die Frage, wie weit wir uns gegen die Vorsehung wenden können, hat sein Leben beherrscht. Sein Kosmos ist der Konjunktiv. Es war einmal, das war einmal. Was wäre, wenn: So fangen seine Märchen an. Er nennt sie Gedankenexperimente. In ihnen kann er sich so weit über den Rand seiner Wirklichkeit hinauslehnen, sogar das Unmögliche zu fragen: Was wäre, wenn es mich nicht gäbe? Nie gegeben hätte?
In zwanzig Minuten hat er die Wartenden abgefertigt. Ruhe kehrt ein im Keller der Chemie. Oben, in den Laboren des Lebens, sondert der Apparat der Erkenntnis sein tägliches Soll neuer Details über die Mechanismen des menschlichen Metabolismus ab. Ein mühseliges Geschäft detailversessener Spezialisten, die das Geflecht der Reaktionen wie ein Räderwerk auseinandernehmen, um mit chemischen Tricks Leistungskraft und Libido, Konzentration und Kondition zu steigern.
Hier unten, in Coppkis Kopf, drehen sich die großen Fragen. Was wäre, wenn es gelänge, einen Menschen Molekül für Molekül nachzubauen? Wäre das dann der gleiche Mensch? Oder würde sich herausstellen, dass der Kreatur etwas fehlt, etwas hinter den Dingen, ein unbekanntes, übermächtiges Prinzip, dem sich die Stoffe unterordnen? Alles ist Chemie, sagen die Erforscher des Lebens. Aber ist Chemie wirklich alles? Sind wir nicht mehr, als wir sind?
Niemand könnte ihm darauf eine Antwort geben. Stattdessen sieht er einen weltweiten Apparat wie ferngelenkt sein Pensum abarbeiten, als folgte er einem Programm, das er selbst nicht versteht. Sollte irgendwo eine Vorsehung walten, die sich durch nichts aufhalten lässt, so hätte Coppki hier ein beredtes Beispiel vor Augen. Die Wissenschaft geht unbeirrbar ihren Weg, Irrwege eingeschlossen.
Die Uhr zeigt kurz vor fünf. Feierabend naht. Wie jeden Tag um diese Zeit klappt er sein Werkbuch zu und verstaut es in seiner Leinentasche. Ich benutze die gleichen Kladden wie er, gebunden aus karierten, auf der oberen Ecke in schnörkelloser Stempeltype durchnummerierten Seiten. Manchmal lasse ich mich sogar dazu hinreißen, etwas in seiner Schrift hineinzuschreiben.
Als ich die Stahltür zum Lager abschließe und mich zum Gehen wende, steht wie eine Diva ex machina zart und zäh jene Frau vor mir, die sein Leben verändert hat. Sie schleppt eine schwere Umhängetasche und sieht überwältigend müde aus, irgendwie traurig, aber untilgbar anziehend. Ob sie hier richtig sei am Ausgabeschalter des Material- und Gerätelagers. Sie suche einen Herrn Coppki. Ich stelle mich vor und versuche mir auszumalen, was in jenem Moment in ihm vorgeht.
Vor der Frau um die vierzig steht ein Mann Anfang dreißig, der wie zwanzig wirkt. Seine Gedankenwelt besteht aus Stoffkaskaden und Reaktionszyklen. Er fühlt sie in sich wie innere Berührungen. Plötzlich bemerkt er ein neues, unbekanntes Signal. Es trifft ihn wie ein Pfeil und durchdringt sein System mit seinem schnellen Gift. Als Erstes stellt er fest, dass ihm die Worte fehlen. Hier ist etwas am Werk, das stärker wirkt als alle Versuche, es zu benennen.
Wer nun versucht, seinen Gedanken nachzugehen, so wie ich seinem Heimweg folge, aus dem Keller ins Erdgeschoss, durch die Glastür quer über den winterlichen Campus und das kurze Stück Hauptverkehrsstraße hinweg in die belebte Flaniermeile und von dort auf den Fußweg in seine Wohnsiedlung aus identischen Blöcken, der bekommt einen Eindruck von seiner Denkart, die so anders ist als die aller anderen.
Warum – er hat das Brausen der Hauptstraße schon im Ohr – ist ihm zumute, als hätte er gerade seine eigene Hinrichtung überlebt? Hätte er seine Symptome zusammenfassen können, das unruhige Herz, Hitzewellen und gelähmte Zunge: Der Boulevard mit seinen Kneipen und Bars hielte die gleiche uralte Antwort parat wie das branchenübliche Handbuch seelischer Befindlichkeiten. Er aber muss die fremde Macht erst von der Seite seiner Theorie her betrachten und huscht zwischen den Häusern hindurch auf seine heimische Bleibe zu.
Welche Kräfte könnten sein System von einem Augenblick auf den anderen so vollständig umkrempeln, dass er es gleichzeitig in Herz und Magen spürt, in Lidern und Fingerkuppen? Geht es ihm nicht ähnlich, wenn er plötzlich einen Einfall hat und eine Welle ihn durchfährt, die ihren Ursprung allein in gedachten Wörtern hat? Worüber könnten Ideen sich so scharf in feinstoffliche Abläufe übertragen, wie er sie in diesem Augenblick in sich wahrnimmt?
Der Fahrstuhl bringt mich in den fünften Stock. Bis zu seiner Wohnung sind es nur wenige Schritte. Von drinnen meine ich eine Stimme zu hören. Coppki kann am besten denken, was er gleichzeitig ausspricht. Als müsste er sich seine Gedanken diktieren. Kaum verständlich gemurmelt, wenn er sich in Gesellschaft weiß, deutlicher ausgesprochen, sobald er sich allein wähnt. Dabei aber stets in der gleichen monotonen Tonlage, alsläseerbuchstabenreihenohneleerzeichenvoneinemlaufendentextbandab.
Ich lege mein Ohr an das Türblatt. Gregorianische Stille.
Jeder hinterlässt auf seiner Reise durch Raum und Zeit eine eigene Weltlinie im Gedächtnis der Geschichte. Coppkis roter Faden verläuft quer zu diesen durchs Traumreich seiner theoretischen Versuche. Alles kreist um einen Kern, den er noch sucht, jenes Achsenglied an der Schnittstelle von Seele und Leib, wo Wortfolgen sich in Chemie verwandeln. Was wäre, wenn sich aus allem Gesagten anhand seiner Wirkung eine universelle Sprache ableiten ließe, die jede Seele versteht?
Ich halte seinen Schlüssel in der Hand. Das Haus ist still, als wären wir allein auf der Welt. Die Fußmatte vor seiner Tür trägt das Wahrzeichen der Optimisten. Ein selbstbewusstes, lang gestrecktes, unlöschbar ins Gewebe gewirktes Ausrufezeichen.
Biografen gleichen Exorzisten, die vergangene Leben wieder auferstehen lassen, um sich von ihren Dämonen zu befreien. So wie ich mir Coppki einverleibt habe, Jahr um Jahr, Tag um Tag, so muss ich ihn mir nun wieder austreiben, Seite für Seite, Zeile für Zeile. In seinem System bildet mein Bericht das letzte Glied in der Kette seiner Vorhersagen. Ich soll seine Kopfgeburten in fremde Gehirne übertragen, die sie nicht mehr vergessen und weiterverbreiten. Er leiht mir seine Geschichte, damit ich sie unsterblich mache. Der Beweis seiner Existenz hängt an der Kraft meiner Worte. Ich lege sein Leben in die Hände meiner Leser.
1Schätzungen zufolge hat sich deutlich weniger als ein Milliardstel dessen, was je handschriftlich zu Papier gefunden hat, erhalten.
2Aus dem Griechischen. Das Wort stammt noch aus der Zeit gedruckter Bücher.
2
Seine Mutter lebte am steinigen Strand einer einsamen Insel in einer Kolonie freier Nackter, die in vulkanischen Höhlen an den Hängen einer unzugänglichen Bucht ihre Lager teilten. Als erste Gebärende einer Gemeinschaft, in der jede und jeder mit jeder und jedem schlief, fiel ihr die befremdliche Rolle einer Stammmutter zu, die den Erzeuger ihres werdenden Sprosses nicht benennen konnte. Das stand durchaus im Einklang mit den Idealen der Kommune, sechs Männern und sechs Frauen, die dem Einzelnen Eigentum und Besitz, zumal an Partner oder Kind, zugunsten gemeinsamer Rechte und Pflichten absprachen.
Da der berechnete Zeitpunkt der Empfängnis überdies auf die Tagundnachtgleiche im Frühjahr fiel, von den Kolonisten wie üblich mit Sex und Drogen und Rockmusik begangen, hätte ohnehin jeder männliche Bewohner die Vaterschaft für sich beanspruchen können.
Die Nackten feiern die Nachricht der Schwangerschaft mit schamanischen Fruchtbarkeitsritualen am nächtlichen Feuer beim Spiel ihrer Trommeln. Dabei bekräftigen sie ihren Willen, den Nachwuchs gemeinsam aufzuziehen.
Die einhellig beschlossene Wassergeburt am Tag nach der Wintersonnenwende muss wegen hohen Seegangs und schweren Regens ins Trockene der geräumigen Versammlungshöhle verlegt werden. Unter tatkräftiger Mithilfe aller bringt die neunzehnjährige Rianna nach einer Nacht schwerer Wehen einen gesunden Jungen zur Welt, der auf Wunsch der Gemeinschaft Mephias heißen soll.
Doch die Biologie spielt nicht mit. Spätestens als der Knabe nackt und gewaschen auf seinem weichen Lager aus Pfeifengrasähren liegt, die sie eigens in den Bergen gesammelt haben, ist seine Ähnlichkeit mit einem der sechs möglichen Erzeuger unübersehbar. Gegen alle Regeln der Vergemeinschaftung sieht sich der einundzwanzigjährige Josh, der damit am wenigsten gerechnet hat, zum Vater bestimmt.
Gemäß der Beschlusslage der Vollversammlung erklären sich die leiblichen Eltern einverstanden, die Aufzucht des Kindes in der allgemeinen Verantwortung zu belassen. Allein in einem Punkt bittet Josh, den seine Papiere als Jost Heinrich Coppki ausweisen, um eine Ausnahme von den Regeln, die ihm nach kurzer Debatte gewährt wird: Mit Einverständnis Riannas wird das Neugeborene noch am selben Tag mit körperwarmem Meerwasser auf den Namen Jan Hendrik getauft und in der Tradition seiner väterlichen Familie Janush gerufen.
Sein Geburtstag fällt, ohne dass die Höhlenbewohner davon wüssten, auf den Tag, als ein ehemaliger Studentenführer und Held ihrer Generation – »Der Kampf geht weiter!« – den Spätfolgen eines Attentats erliegt. Der Tod beendet das Jahr, in dem die Menschheit nach damals verfügbaren Parametern wie Sicherheit und Gerechtigkeitsgefühl den Höhepunkt ihrer Möglichkeiten überschritten hat.
Im selben Jahr befällt mit der Wahl einer Eisernen Lady ein Gespenst die Welt, das sie im transatlantischem Schulterschluss über eine Achse des Bösen jahrzehntelang gefangen halten wird. Ein strenger Geistlicher kehrt aus dem Exil in seine morgenländische Heimat zurück und errichtet dort einen autoritären Gottesstaat. Andere Länder folgen seinem Beispiel.
Da die Strandbewohner jeden Kontakt mit örtlichen Behörden meiden, die ihr Treiben mehr aus Trägheit denn aus Wohlwollen dulden, verzichten sie darauf, ihren Zuwachs im öffentlichen Geburtsregister eintragen zu lassen. So verbringt Janush unbeachtet vom Rest der Welt seine ersten Lebensjahre im Schoß einer Gruppe, die ihn wie seine künftigen Schwestern und Brüder als Verkünder ihrer Lehre im Geiste des Wir erziehen will.
Dass er mit zwei Jahren nur Babylaute von sich gibt und keine Anstalten unternimmt, erste Schritte zu tun, werten sie als Ausdruck seines Andersseins, zumal er sich zwischen den Felsen und runden Steinen am Strand geschickt auf allen vieren bewegt und schon im Säuglingsalter als sicherer und ausdauernder Schwimmer beweist.
Er soll alle Freiheiten genießen, wird gefüttert, wann ihm danach ist, darf kuscheln, mit wem, und schlafen, wann und wo er will. Nur gestillt wird er von keiner. Drei Ziegen liefern Milch für den täglichen Bedarf. Ein Brei aus zerstoßenem wildem Hafer, geriebenen Wurzeln und Früchten sorgt für eine ausgewogene Ernährung, bald um das Fleisch frisch gefangener Fische und Meeresfrüchte ergänzt.
Der Knilch gedeiht prächtig. Er genießt die geteilte Aufmerksamkeit von sechs Müttern und sechs Vätern. Ihm ist es auch zu verdanken, dass die Razzia der Inselpolizei, die dem paradiesischen Treiben der Nackten nach drei Jahren unbeschwerten Zusammenlebens ein jähes Ende setzt, einigermaßen glimpflich verläuft. Da ist er gerade zwei.
Die Beamten überraschen die Bewohner im Schlaf. Sie landen mit ihren Booten in der Morgendämmerung, stellen sich vor den Höhlen auf und brüllen wie auf ein Kommando los. Dann geht alles nur noch schnell. Die Nackten begreifen, was ihnen die Stunde geschlagen hat, kommen aus ihren Löchern hervor und folgen dem Befehl, sich anzukleiden und in einer Reihe aufzustellen. Als hätten sie früher oder später mit dem Schock gerechnet, haben sie ihre Kleider seit der Ankunft sorgfältig aufbewahrt. Nur für einen gibt es nichts anzuziehen.
Die Uniformierten entdecken das nackte Kind im hintersten Winkel der Versammlungshöhle. Es hat sich in den Vorratsberg aus Pfeifengras gegraben. Fast hätte es der Stiefel am Kopf getroffen, der mit Tritten den Haufen durchwühlt. Kaum lugt es hervor, setzt eine Stille ein, die das Wort Andacht nur unzureichend beschreibt. Wie das herzige Kerlchen mit den schlaubraunen Augen sie unerschrocken anschaut, verzaubert die Männer und stimmt sie milde gegen die friedfertigen Erwachsenen. Andere hätten in seinem Alter vor Angst drauflosgeschrien, dieser bleibt ruhig, beinahe gelassen.
Tatsächlich endet mit dem Erwachen an diesem Morgen sein Traum vom unbeschwerten Leben. Das Gebrüll wie von fremden Tieren, die unbekannte Kraft männlicher Gewalt, die Starre, die ihn befällt und nie wieder ganz loslassen wird, begründen sein Ringen mit dem Schlaf, das seine anbrechende Kindheit im Gewahrsam strenger Erwachsener prägen wird.
Der Schrecken ist ihm nur nicht anzusehen, weil das Staunen noch größer ist. Janush sieht zum ersten Mal andere Menschen als die zwölf, die für ihn die einzigen auf der Welt gewesen sind. Die Neuen gehören zu einer dritten Art, zwar ausgewachsen wie die anderen und alle von kräftigerem männlichem Typ, aber in seltsame Hüllen gepackt. Tarnfarbene Kampfanzüge werden zum Urbild seiner Erinnerung an Kleidung.
Bei aller biografischen Unschärfe könnte sich hier erstmals seine unvergleichliche Haltung gegenüber allem Neuen zeigen. Das Fremde als solches macht ihm keine Angst. Er untersucht die Eindringlinge mit Blicken, denen niemand lange standhalten kann. Auf die unangemeldeten Besucher muss er wirken wie ein furchtloser Erdenbewohner auf Außerirdische, vor denen sonst alle weglaufen.
Keiner wagt den Kleinen anzufassen, als er zwischen ihren Beinen ins Freie krabbelt. Dort lauert die nächste Sensation. Seine zwölf Eltern, die er nur unbekleidet kennt, haben sich ebenfalls verhüllt, wenn auch farbenfroher als die Amtsleute. Als ob er das Ganze als Spiel begreift, lässt er sich bereitwillig in ein buntes Tuch wickeln.
Als alle und alles an Bord gebracht sind, zerstören die Polizisten vor den Augen seiner Erbauer deren Idyll und stecken die Überreste in Brand. Sie lenken ihre Boote zum Fährhafen auf der anderen Seite der Insel.
Was Janush da erwartet, hätte das Zeug zur frühkindlichen Verwundung. Dass es noch mehr große Menschen gibt, in seinen Augen sogar unvorstellbar viele, die hinter Absperrungen Ankunft und Abtransport der Kommunarden verfolgen, berührt ihn weniger als der Anblick der Kinder, die ihn begaffen, auf ihn zeigen, ihm Unverständliches zurufen. Wie hätte er wissen können, dass er Artgenossen hat, kleine Menschen in allen denkbaren Ausführungen, manche so winzig wie er, andere größer, fast schon wie Erwachsene mit kindlichen Zügen, und wie jene in zwei Sorten aufgeteilt, die unterschiedlich angezogen sind?
Falls einem Zweieinvierteljährigen, der weder sprechen noch laufen kann und sich von einem Mann durch die Menge tragen lässt, eine derartige Gefühlsregung möglich ist, erlebt Janush beim Betrachten der Mädchen erstmals die Anziehungskraft des Unheimlichen. Eines sitzt auf den Schultern eines grauhaarigen Alten, wie er ihn ebenfalls noch nie zu Gesicht bekommen hat. Kaum älter als er, lässt sie ihre Augen nicht von ihm, ohne dabei eine Regung zu zeigen. Eine andere winkt und lächelt schüchtern, wendet sich jedoch sofort ab, als er ihre Blicke erwidert. Eine Gruppe in Röckchen steckt die Köpfe zusammen und kichert.
Die örtliche Presse liefert am folgenden Tag mit ihrem reißerischen Bericht über Die Wilden den einzig erhaltenen Beleg für die Existenz der Kolonie. Lange hat das wertvolle Dokument unentdeckt im vergessenen Koffer einer ausgewanderten Familie geschlummert. Den Artikel schmückt ein Gruppenfoto. Ein kleiner Junge sitzt auf dem Arm eines der Männer. Die Ähnlichkeit ist unübersehbar.
Die Polizei verzichtet auf eine Anzeige. Erfasst nur die Personalien der dreizehn und erkundigt sich nach den Eltern des Kindes. So sehen sich Marianna van Kampen und Jost Heinrich Coppki vor den Augen der anderen gezwungen, sich zum Paar zu erklären und den Geburtstag ihres Sohns anzugeben. Sie datieren ihn wahrheitsgemäß auf den zweiten Tag nach der winterlichen Sonnenwende vor gut zwei Jahren. Nur beim Geburtsort gibt Josh seinen eigenen an und verschweigt den wahren Hergang der Dinge. Als Nachnamen des Kleinen notieren die Beamten gemäß damaliger Gepflogenheiten den des Vaters, und niemand aus der Sippe, die gerade aufhört zu sein, wagt zu widersprechen.
Die junge Familie wird mit Fahrscheinen versorgt und samt ihrer wenigen Habe auf die nächste Fähre verfrachtet. Die anderen müssen sich noch mehrere Tage Verhören unterziehen, die sich im Wesentlichen auf Details ihres gemeinschaftlichen Geschlechtslebens beschränken, bevor auch sie von der Insel entfernt werden. Da stehen Rianna und Josh mit Janush auf dem Arm nach einer abenteuerlichen Reise per Anhalter über den halben Kontinent bereits vor dem Haus der Familie Coppki. Das Zerwürfnis, das dem Auszug Jostens aus dem Elternhaus voranging, ist augenblicklich vergessen, als ihnen der verschollene Sohn wie aus heiterem Himmel unverkennbar ihren ersten und einzigen Enkel vorstellt.
»Na, mein Kleiner, wie heißt du denn?«
»Er heißt Janush, Mutter. Können wir ihn bei uns aufnehmen?«
Rianna beobachtet die Szene aus dem Hintergrund. Sie gibt zu verstehen, ihre Eltern würden sie verstoßen, tauchte sie mit einem unehelichen Kind auf. Sie sagt nicht, dass sie mit dem Jungen wenig mehr verbindet als Schwangerschaft, Geburt und das Gruppenprojekt seiner Aufzucht. Sie spricht nicht von den losen Bindungskräften einer Sechstelmutterschaft. Sie redet auch nicht von der Freiheit, als Frau über ihren künftigen Lebensweg zu entscheiden. Stattdessen erkundigt sie sich höflich, ob die Großeltern dem Kleinen das Elternhaus bieten können, das sie ihm wünsche.
Selbst wenn sie gewollt hätten, wie hätten Ommka und Oppa, so nennen sie sich fortan, Nein sagen können? Schon nach wenigen Minuten verabschiedet sich Rianna, um zu ihrer Familie im Süden des Landes weiterzureisen. Sie nimmt das Bündel mit ihren Siebensachen und hält an der nächsten Hauptstraße ihren Daumen in den Wind.
Kaum ist sie aus dem Haus, wollen die Alten alles wissen. Josh, verstockt, wie sie ihn seit seiner Pubertät kennen, zeigt sich wenig geneigt, ihnen die wahre Geschichte anzuvertrauen. Fragen nach Janushs Herkunft und seinen ersten Jahren bleiben unbeantwortet. Das Papier der Inselbehörde dient als Grundlage einer ordentlichen Geburtsurkunde. Nach den Buchstaben des Gesetzes wächst der Enkel also an seiner Geburtsstätte in ihrer Heimatstadt auf.
Der Junge lernt bald laufen. Mit dem Sprechen hapert es weiterhin. Nur gelegentlich lässt er einzelne Wörter fallen. Seinen eigenen Namen benutzt er, um in der dritten Person von sich zu brabbeln. Hanush hatschi bedeutet, er müsse niesen, und wenn er Hanush haschaschine ruft, will er in der Küche vor dem Bullauge der Waschmaschine dem Drehen der Wäsche in der Trommel folgen.
Er gewöhnt sich bestens ein, was seinem biologischen Vater nicht gelingen will. Wie vor seinem Verschwinden bleibt Josh häufiger und länger fort. Er meidet seinen kleinen Sohn, als scheute er väterliche Verantwortung. Wortkarg lässt er seine Altvorderen nur wissen, er bemühe sich um ein Studium der Dichtkunst.
Neun Monate nach ihrer Trennung ist die junge Familie für wenige Momente wieder vereint. Rianna steht mit einem Campingbus vor der Tür. Ihr Sohn schläft in seinem Bett unterm Kruzifix. Sie streicht ihm übers Haar, er schlägt die Augen auf und fällt gleich in seinen Schlummer zurück. Josh steht in der Tür zum Kinderzimmer, das er selbst fast fünf Jahre bewohnt hat. Das ist, wenn er es überhaupt wahrgenommen hat, das Letzte, was Janush von seinen Eltern sieht.
Der Großvater besteht darauf, die beiden mit seiner Kleinbildkamera zu fotografieren. Die Aufnahme bekommt er erst Wochen später zu sehen, nachdem sein Rollfilm, so ging das damals, zu Ende belichtet und vom Fotolabor entwickelt worden ist. Das Bild zeigt ein junges Paar mit langen Haaren und Stirnbändern vor dem Camper, beide barfuß und in Hüfttüchern, sie im Bikinioberteil, er mit Bart, lächelnd für die Kamera. Es findet Platz auf dem Nachttisch der Großmutter.
Janush folgt seinen Instinkten, nimmt Oppa und Ommka, ohne ihnen je herzlich nahe zu kommen, als Bezugspersonen und ihr Haus als neue Heimstatt an. Seine Eltern erreichen nach wenigen Tagen ihr Ziel. Sie lassen sich in Richtung der einsamen Insel einschiffen. Die Fahrt dauert zwei Tage und zwei Nächte. Sie kehren nie wieder zurück.
3
Das Erste, was mir in seiner Wohnung auffällt, wäre mir beinahe entgangen. Dort riecht es nach nichts. Als hätte der Bewohner beim Verlassen seiner Bleibe alle Gerüche eingepackt und mitgenommen. Dabei steht und liegt noch alles an seinem Platz.
Fast zwanzig Jahre, vierzehn allein, hat Coppki in den Möbeln seiner Großmutter gelebt. Sie hat ihm die gemeinsame Zweiraumwohnung im Zentralbezirk der Hauptstadt vermacht, als sie starb. Ihr Zimmer hat er verschlossen wie seine Erinnerung an die Jahre mit ihr. Angrenzend die geräumige Wohnküche. Einbauschränke aus honiggelbem Nadelholz, ein schlichtes Ensemble aus Tisch und vier Stühlen vom gleichen Schlag sowie ein wuchtiger Schreibsekretär.
Ich nehme Platz, drehe den Schlüssel in der Decklade und rieche wieder nichts, obgleich mir die Augen Holzwachs, Scharnieröl, Tinte und welkes Papier versprechen. Die Schieberschienen arbeiten einwandfrei. Genau in der Waagerechten haken sie geräuschlos ein. Im selben Augenblick sorgt ein verborgener Mechanismus dafür, dass eine Leselampe zwischen den Fächern und Schubladen anspringt.
In die Platte hat der Erbauer eine rechteckige Vertiefung gefräst, in der eine dunkelgrüne Linoleumunterlage klebt. Auf der rechten Seite, vor einer Ablage mit Lochstanzer, Heftzange, Klammerlöser und Holzlineal, liegt flach auf seinem Gesicht ein postkartengroßer, in dunkle Leisten gefasster Bilderrahmen. Aus seinem Rücken ragt wie der gebrochene Flügel eines abgestürzten Vogels die Pappraute seiner Standvorrichtung in die Luft.
Ich lasse ihn liegen, mache die Platte wieder zur Klappe, drücke sie sanft in die Führung zurück und schließe ab. Bei der ersten Bestandsaufnahme kommt es darauf an, mögliche Beweisstücke unberührt in Augenschein zu nehmen und nichts zu verändern. Später lässt sich der Urzustand kaum wieder herstellen.
Links neben der Wohnungstür die Garderobe. An einem Haken seine sandfarbene Leinenjacke, an einem anderen der zementgraue Wollmantel. Auf der Hutablage leichte und schwere Schiebermütze. Am Boden zwei Paar Schnürschuhe, die einen flach, schwarz und auf Hochglanz gewienert, die anderen mit dickem Gummi besohlt und knöchelhoch aus wildem Leder, das sich an Schaft und Spitze blank genutzt hat.
Alles passt wie für mich gemacht.
Daneben schließlich sein Reich. Mitten auf das schleiflackweiße Türblatt, ziemlich genau auf Augenhöhe, hat er mit einer Schablone in eisvogelblauem Signallack tellergroß sein Zeichen gesprüht. c i t e !Die Farbe lässt sich nicht mehr datieren. Nach Vergleich der Pigmentmischung mit Spuren auf jahrgangsbekannten Oberflächen müsste Coppki an die dreißig gewesen sein, als sie aufgebracht wurde. Das bis heute übliche internationale Format des Kürzels für das Zentralinstitut für Gedankenexperimente3spricht eher dafür, dass er älter war, die Verwendung des Ausrufezeichens sogar, dass sie erst nach seinem Verschwinden auf die Tür geraten ist.
Der Raum misst ungefähr vier mal sechs Meter. Vor Eingangs- und Rückwand erstrecken sich in voller Breite zwei baugleiche Stahlblechregale von geringer Tiefe. Unter der Zimmerdecke kleben Spiegelkacheln. Dort, wo sie mit ihren Ecken aneinanderstoßen, hängen Fäden von der Decke, und an deren Enden, mit Händen greifbar, die gleichen mannigfaltig geformten, wolkenhaften weißen Schaumstoffskulpturen, wie sie sich auch im Regal an der östlichen Wand aufreihen.
Die Ablagen gegenüber tragen in geradliniger Ordnung handliche, kinderfaustkleine Glasfläschen mit Schliffkorken und Etiketten. Allesamt sind sie gleich hoch mit klarer Flüssigkeit gefüllt.Durch die schablonenhaft beschrifteten Etiketten erinnern sie an den Inhalt von Apothekerschränken. Nur dass keiner der Namen in chemischen oder pharmakologischen Schriften zu finden ist. Euphorin, Memoral, Cognitax, Erotil, Libidox, Relaxan, Melanchosol.
Auf Zehenspitzen, als könnte ich stören, verlasse ich seine Werkstatt. Ich bin gerade im Begriff, mich aus der Wohnung zu stehlen, da reißt mich die Türklingel aus meiner Gedankenstille. Wie aus alter Gewohnheit hebe ich den Hörer der Gegensprechanlage aus seiner Halterung und lausche.
»Coppki, was machst du mit mir? Ich hab alle Hände voll, warum drückst du mir nicht einfach auf und lässt mich rein?«
Ich halte die Luft an.
»Was ist los? Ich hör dich atmen, aber du sagst nichts.«
Jetzt kommt es darauf an.
»Entschuldige bitte, ich war in Gedanken.«
»Das ist ja mal was ganz Neues.«
Offenbar treffe ich seinen Ton.
»Wärst du so freundlich, deinen Zeigefinger durchzustrecken und den Türdrücker damit so fest zu pressen, als wolltest du ihm wehtun?«
Ich höre aus einem verborgenen Lautsprecher in dem Kasten, wie unten die Haustür aufspringt. Der Klang scheint mitten durch meinen Kopf gewandert zu sein, als die gleiche Tonfolge wie vorhin, nun klar und unverzerrt, über den Spalt der Wohnungstür durch das Treppenhaus an mein anderes Ohr dringt. Hier draußen besitzt die Welt auch wieder eine erkennbare Note. Sie riecht nach Hausflur wie nur in diesem Gebäude, eine schwer aufschließbare Mischung aus trocken gealtertem Acryl, schwarzem Gummiabrieb und Sisalstaub.
Die Fahrstuhltür schiebt sich auf. Der Mann, mindestens zwanzig Jahre älter als ich, grüßt nur knapp, unternimmt keine Anstalten, mir die Hand zu reichen oder sonst irgendwie näher zu kommen. Sein dickes Haar trägt er zusammengebunden auf dem Hinterkopf, was sein bärtiges Gesicht noch länger macht, als es ohnehin ist. Seine glatten Hundeaugen schauen an mir vorbei, wenn er mit mir spricht.
»Wird ja immer schlimmer mit dir. Du guckst, als hättest du mich noch nie gesehen.«
Ich nicke freundlich.
»Ich bin’s, Wendsel, dein Überlebenshelfer.«
»Komm doch rein und mach’s dir bequem, Wenzel.«
Die Kenntnis eines Namens kann wertvoll sein, die von Fehlern ist mit Gold nicht aufzuwiegen. Ticks und Schwächen, Makel und Marotten verraten mehr über einen Menschen als alle gewöhnlichen Gewohnheiten. Nur wer sie kennt, schafft den Schritt vom Darstellen zum Verkörpern. Und wenn es nichts als ein typischer Gang oder eine eigentümliche Aussprache ist.
»Wie oft habe ich dir schon gesagt: Wendsel. Mit Deh und Ess. Nicht mit Zett.«
Ich halte ihm die Tür auf. Er geht geradewegs an mir vorbei in die Küche. Die Einkaufstüten in seinen Händen bemerke ich erst, als mir der Duft von Bratgeflügel in die Nase steigt. Die Hähnchenhälften sind in Aluminiumhaut eingewickelt. Er packt sie aus und lässt sie auf der Metallfolie liegen.
Offenbar essen wir dieses Gericht mit den Fingern. Er legt einen Packen Papierservietten auf die Mitte der Tischplatte, eine Pappschüssel mit ölgetränktem Krautsalat und zwei Schälchen mit Engelslocken-Pommes-frites, unserer Lieblingssorte. Bevor ich mich versehe, habe ich zwei eiskalte Flaschen Bier aus dem Kühlschrank genommen, einen Kronkorkenheber aus der Küchentischschublade, und die Deckel entfernt. Wir prosten uns zu. Flaschenwände schlagen aneinander. Zwischen uns dampfen die Speisen wie an jedem Tag um diese Zeit.
Wie alle gewerblichen Lebenslaufdeuter leide ich unter dem Dilemma der Distanz. Eine Art Berufskrankheit bei analytischen Biografen, die ihren Helden nur zu fern bleiben oder zu nahe kommen können. Hält man sie sich vom Leib, um ihnen nicht auf den Leim zu gehen, kriegt man sie nicht in den Griff. Rückt man ihnen auf den Pelz und geht ihnen unter die Haut, verheddert man sich unweigerlich in ihren Fängen.
Kollegen, die sich darauf einlassen, kennen die erste Umarmung, wenn sich Protagonisten für ein paar Jahre als Untermieter bei ihnen einnisten. Die neuen Bewohner können Freunde vergrätzen, Ehen zerrütten, Nachbarn zum Schweigen bringen. Sie sitzen mit am Tisch, mischen sich ein, beherrschen Gespräche, und wenn es ihnen gefällt, finden sie auch ihren Weg ins nächtliche Gemach.
Ich gehöre zur Gruppe der analytischen Biografen, die es vorziehen, sich bei ihren Helden häuslich einzurichten. Nur so glaube ich, ihre Beweggründe erforschen, ihre Entscheidungen verstehen zu können. Coppkis Haut etwa verträgt nur getragene und gewaschene, aber keine fabrikneuen Kleidungsstücke. Ich weiß, was er meint, wenn ihm Textilien wie schlecht sitzende Rüstungen vorkommen.
Die Sprache schreit ihn mit ihren Bildern an. Ob einem der Schädel platzt, das Herz bricht oder Hals und Bein, ob etwas ins Auge sticht oder unter den Nägeln brennt, es schmerzt ihn, obwohl er es besser weiß.
Mit Rücksicht auf seine Empfindlichkeiten müsste alles über ihn im seelenlosen Code einer automatisch lesbaren Maschinensprache protokolliert werden, die nur Tatsachen kennt und keine Zweideutigkeiten zwischen den Zeilen. Ein Datensatz aus Lebensfakten in der chronologischen Abfolge ihres Auftretens. Geboren am in von durch, Schulen von bis, Wohnsitze, Begegnungen, Erlebnisse, Partnerschaften und Nachwuchs mit, Ausbildungen, Abschlüsse, Beruf und Werdegang, Trennung von, Tod am in durch, Wirkung auf, Vermögen und Erbe.
Wer dem Einsiedlerkrebs zu nahe kommt, treibt ihn in sein Schneckenhausversteck zurück. Um dorthin vorzudringen, müssen wir das Gehäuse aufbrechen und uns wie Chirurgen ins lebende Gewebe hineintasten, um das schlagende Herz eines Wehrlosen freizulegen. Wollen wir zum Kern eines Helden vorstoßen, müssen wir Grenzen überschreiten, Intimbereiche ausloten, Geheimnisse lüften. Ein schmutziges, oftmals unappetitliches Geschäft, und wer es betreibt, tut das mit der gleichen seriös verkleideten Lust wie heimliche Spanner und Voyeure im Schutz bürgerlicher Harmlosigkeit.
Biografen zählen nicht ohne Grund zu den infamen Menschen, deren Leben besser unerzählt bleibt. Doch ohne professionelle Lüsternheit kommen selbst wissenschaftliche Lebenslaufanalytiker nicht aus. Sie kann indes auch unser Verderben bedeuten. Unversehens tappen wir, ebenfalls in der Zunft verbreitet, in die Falle der Identifikation.
Irgendwann siehst du ihn überall. Er fährt dir auf einer Rolltreppe entgegen, schaut dich in der U-Bahn vom Rücken einer Zeitung an, steht im Supermarkt in der Schlange hinter dir. Hier seine Augen, Lippen oder Ohren, da Statur und Haltung, dann wieder ein Blick, eine Geste, eine Gangart, die du nachahmen musst: Auf die eine oder andere Weise steckt er in jedem, den du triffst.
Die Formel für das Gesamtbild hast nur du im Kopf. Schon sitzt er dir im Blut. Ist er neurotisch, wirst auch du es, wenn du es nicht schon bist. Versagt er im Bett, kannst du dir sicher sein, bald selbst an deiner Potenz zu zweifeln. Sein Zorn wird dein Zorn, seine Kühnheit steckt dich an.
Wenn Ferne in Nähe umschlägt, gilt es daher gegenzuhalten. Erfahrene Segler kennen solche Momente. Wenn sie aus einer stillen Bucht in die stürmische See stechen und aus den Daten der Wetterkarte urplötzlich Naturkräfte werden, wissen sie, was zu tun ist. Sie passen sich den Verhältnissen an, steuern hart an den Wind und durchkreuzen seine Richtung. Folgten sie tatenlos seinem Willen, wären sie verloren.
So in etwa stellt sich die Lage von Biografen dar, die ins Kraftfeld ihrer Protagonisten geraten. Plötzlich sehen wir uns Zwängen ausgesetzt, die jeden beherrschen, der sie nicht unterwirft. Wie Richter um faire Urteile hinter den Aussagen ihrer Zeugen deren wahre Motive erforschen, müssen wir den Menschen hinter dem Mythos sehen, den er selbst geformt hat, müssen erkennen, woher die Winde wehen, welche Motive sich hinter ihren Handlungen verbergen. Was tun sie für sich und was für uns, damit wir sie nach ihren Plänen zeichnen?
Insbesondere wir mitfühlenden unter den analytischen Biografen teilen Schmach und Triumph mit unseren Figuren, erleiden ihre Krisen, folgen Denkwegen und berauschen uns an ihren Erfolgen und Erkenntnissen, wenn sie ihre Heurekas haben. Denk ich an Coppki in der Nacht, schlafe ich sogar schlecht, wenn mein Protagonist kein Auge zubekommt, weil es wieder einmal um alles oder nichts geht. Und wenn die Liebe zuschlägt, brennt mein Herz.
Darüber helfen wir uns in Gesprächskreisen hinweg, in denen wir einander über unsere Fälle berichten. Zu meiner Gruppe, einem reinen Kreis der Wissenschaft und Künste, gehören neben Coppki, vertreten durch mich, in Person ihrer Biografen eine Komponistin, ein Filmregisseur, eine Architektin, eine Chirurgin sowie ein Tänzer.
Coppkis Vorgänger, angeblich ein genialer Mathematiker, hat sich erfolgreich von seinem Chronisten gelöst, indem er die Formel für seinen Nachfolger fand, mich. Nach seinen Berechnungen soll das letzte Individualgenie der Naturforschung, bevor nur noch Teams und Arbeitsgruppen Durchbrüche erzielen, ein unbekannter Amateurwissenschaftler sein, der allein mit seinen Ideen den Entwicklungssprung der Spezies zu Beginn des dritten Jahrtausends auslösen kann.
In unserem Kreis wenden wir die dramatische Methode an. Die gemeinsam erarbeiteten Szenen liefern uns wichtige Anhaltspunkte für unsere schriftlichen Schilderungen. Jeder verkörpert dabei seine Heldin oder seinen Helden und Nebenfiguren im Leben der anderen. Es dauert meist eine Weile, bis ausgehandelt ist, wer wen spielen darf (oder muss), aber bis jetzt hat sich noch jede Gruppe geeinigt.
Das Treffen findet jeweils in den Arbeitsräumen jenes Autors statt, dem das Referat zufällt, inmitten der Materialien, die seine Erzählung voranbringen. Wir sehen uns einmal im Monat, sodass jede und jeder zweimal im Jahr als zentraler Held zum Zuge kommt. An den übrigen zehn Wochenenden sind wir Figuren in den Welten der anderen. Da bin ich Assistent der Architektin, Geliebter der Komponistin, Sohn der Chirurgin, Widersacher des Regisseurs und Trainer des Tänzers.
3Central Institute for Thought Experiments
4
Ich höre noch, wie der Mechanismus aus- und gleich wieder einrastet. Sie zielt, ihre Augen auf meine gerichtet, aus freier Hand und kurzer Entfernung mitten in mein Gesicht. Ich kann gerade erkennen, wie sie die Luft anhält, als ihr Zeigefinger einknickt. Bevor ich mich wehren kann, hat sie abgedrückt.
Sie gehört zu denen, die nur einen Versuch benötigen, dafür aber umso mehr Zeit. Für gewöhnlich suchen sie zunächst das Gespräch, stellen harmlose Fragen, gehen auf Einwände ein, tasten sich allmählich vor, bis ihr Gegenüber Vertrauen gewinnt und sich öffnet. Erst wenn sie sich nahe genug wissen, lösen sie aus. In der Regel treffen sie punktgenau.
Jeden Werktag um fünf habe ich Coppkis Schalter geschlossen, Lichter gelöscht und die schwere Tür hinter mir zugezogen. Als ich diesmal den Schlüssel ins Schloss stecke, ihn zweimal herumdrehe und dann mich selbst, steht sie vor mir. Ich habe keine Schritte gehört. Sie muss den langen Kellerflur vom Fahrstuhl aus mit ihrer schweren Umhängetasche herübergeschwebt sein.
Die Komponistin aus meinem Gesprächskreis meistert ihren ersten Auftritt überzeugend. Ihrem entwaffnenden Wortschwall aus Entschuldigung, Auftrag und Termin habe ich nichts entgegenzusetzen. Schon gleitet sie auf leisen Sohlen durch die Regalreihen, zieht Schubläden auf, rückt Geräte zurecht, hält ihre fünfunddreißig Millimeter auf Destillen, Kolben, leere Reagenzglasständer, gefüllte Fläschchen, Säcke und Bottiche mit aufgeklebten oder angebundenen Etiketten. Dabei spricht sie unentwegt von einem Motiv, von Druck, Zwang, von ihrem Auftraggeber und einem Aufmacher, den sie noch am gleichen Abend liefern müsse.
Um Coppki kümmert sie sich zuletzt. Zwei Tage später hält er ihren Umschlag in Händen. Sein Foto steckt in einer Hülle aus milchtransparentem Papier, am oberen Rand zusammengehalten von zwei Büroklammern aus Edelstahl. Darunter eingeklemmt ihre Visitenkarte, Vera Linden, Fotografie. Links von der Schrift ist eine Kleinbildkamera abgebildet, aus deren Objektiv ihr Smaragdauge blickt. Auf die Rückseite hat sie in sauberer Schrift gemalt: Vielen Dank! PS: Habe Ihr Bild nicht verwendet. V. L.
Das hat sie ihm zusichern müssen, bevor sie ging.
»Keine Sorge«, hat sie sein Bitten beruhigt, »ich hab’s nur für mich gemacht. Die brauchen eher was symbolisch Mysteriöses, ohne Menschen.«
Mit diesen Worten ist sie von dannen gezogen. Erst da erkennt Coppki das Durcheinander, das die Frau in seinem Revier hinterlassen hat. Während er alles an seinen Platz zurückbefördert, bis die gewohnte Ordnung wiederhergestellt ist, findet er auch seinen inneren Kompass wieder.
Der Sachverhalt ist schnell rekonstruiert. Eine Fotojournalistin, ein paar Jahre älter und einen halben Kopf kleiner als er, die Erscheinung einer Tänzerin mit goldbraunen Naturlocken, zu der mir Worte wie flink und flott in den Sinn kommen, ist auf der Suche nach einem geeigneten Bild für die Universitätszeitung in seine Gefilde geraten und dort offenbar fündig geworden.
Was dann geschieht, wie sie ihm näherkommt und ihr kleines, gemessen am jugendlichen Schwung ihrer Bewegungen fast altes, eingefallenes Gesicht zeigt, aus dem ihr Mund wie durch den Schlitz einer Pappmaske plaudert, das begreife ich erst, als sich unsere Blicke treffen. Keine Frau hat ihn, seit er sich als Mann fühlt, so unbefangen angesehen wie diese. Solche Blicke kennt er sonst nur von Reklametafeln. Sie beunruhigen ihn wie das undurchdringliche Schauen der Tiere.
»Wie war noch Ihr Name? Coppki? Klingt lustig.«
»Sie lachen ja gar nicht.«
Sie steht mit dem Rücken zum hölzernen Giftschrank, zu dem nur er einen Schlüssel besitzt. Ich lehne an seinem Schreibtisch rechts vom Ausgabeschalter, einen knappen Meter von ihr entfernt. Sie redet in einem fort und sieht mich dabei geradeheraus an.
»Ich fühle mich richtig wohl bei Ihnen hier unten, wissen Sie das?«
»Woran macht sich das fest?«
»Lösungsmittelflaschen, Pulverdosen, die Gerüche, das Flair, fast wie bei mir zu Hause.«
Sie stehe im Ruf, altmodisch zu sein, weil sie auf Chemie setze, klassische Rollfilme, nur schwarz-weiß, die sie eigenhändig entwickle, in ihrer Dunkelkammer, wo sie auch ihre Abzüge belichte. Dabei schwöre sie auf Mechanik, so rein und perfekt wie möglich.
»Eine Kamera muss präzise funktionieren wie eine Waffe, von der das eigene Leben abhängt. Sie muss das kleinste Fingerzucken in jeder Lage zuverlässig in den gewünschten Schuss verwandeln können.«
Die Komponistin hat sich sorgfältig vorbereitet. Sie spricht vom Druckwiderstand, vom Verlauf der Verzögerung, von der kalkulierbaren Belichtung im besten Moment, der sich meist lange vorher ankündige. Denn anders, als oft behauptet, sei die Zukunft über gewisse Zeiträume sehr wohl vorhersehbar. Gespräche, Gesten und Gesichtszüge entwickelten sich nach berechenbaren Mustern. Wie alle Geschichtenerzähler passe sie instinktiv den Höhepunkt ab, forme das werdende Bild in ihrem Geist, ziele mit geübter Hand auf den gedachten Rahmen und senke den Auslöser genau jenen Bruchteil einer Sekunde früher über den Anschlagpunkt, den die Mechanik brauche, um ihr Werk im gewünschten Augenblick zu verrichten.
Ich reagiere auf ihren Vortrag wie erwartet und suche den Zeigefinger ihrer rechten Hand. Sie hält ihre Kamera in Manier einer Revolverheldin mit gebeugtem Arm seitlich vor ihre Brust. Dabei lässt sie mich nicht aus den Augen, als verfolgte sie im Spiel meiner Gesichtsmuskulatur den Gang meiner Gedanken. Da sie ihren Verschluss fast geräuschlos auslösen kann, begreife ich zu spät, was sie im Schilde führt.
Coppki hat stets penibel darauf geachtet, dass sich nie jemand ein Bild von ihm macht. Der Gedanke, andere könnten es ohne sein Zutun betrachten, erscheint ihm unerträglich. Er will unerkannt durchs Leben gehen. Doch als im Kameragehäuse der Spiegel vor- und zurückschlappt, lässt er es ohne Gegenwehr geschehen.
Umso größer muss sein Erstaunen gewesen sein, als er sein Foto aus der Zellophanhülle zieht. So hat er sich noch nie gesehen. Zuerst denkt er, sie habe das Bild retuschiert. Seit seiner Kindheit probiert er Grimassen aus, sobald er einen Spiegel sieht, immer neue Gesichter, mal ernst oder verschlagen, dann wieder fröhlich, wütend oder würdevoll. Dieses ist nie dabei gewesen. Was ihn noch heftiger verstört als das Fremde seines Anblicks: Sein Bild gefällt ihm. Er kann sich gar nicht sattsehen am anderen Ich.
Er tritt vor den kleinen Spiegel über seinem Handwaschbecken, hält das Foto neben seinen Kopf und versucht, die gleiche Miene noch einmal aufzusetzen. Es will um keinen Preis gelingen. Da muss er lachen, wie man nur über große Dummheiten lachen kann.