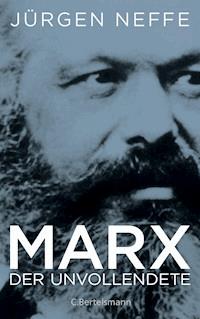
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die aktuelle Biografie über Leben und Werk des Philosophen und Gesellschaftskritikers
Karl Marx, der revolutionäre Querkopf und Vordenker des 19. Jahrhunderts, ist wieder da. Seit der Kommunismus in seinem Namen – aber nicht in seinem Sinne – Geschichte ist, feiert er ein bemerkenswertes Comeback. Anlässlich seines 200. Geburtstags erkundet Jürgen Neffe dessen Ursachen – in Marx´ Schriften wie in seiner Biografie. Er schildert das Leben eines Flüchtlings und geduldeten Staatenlosen, der für seine Überzeugungen keine Opfer scheut. Weder Krankheit, Armut, Ehekrisen noch Familientragödien halten ihn davon ab, beharrlich an seinem Werk zu arbeiten. Mit seiner Analyse des Kapitalismus als entfesseltes System sagt er die globalisierte Welt unserer Tage bis hin zur Finanzkrise voraus. Neffe zeichnet die Entwicklung der Marx'schen Gedankenwelt von Entfremdung und Ausbeutung in den Frühschriften bis zur ausgereiften Krisentheorie im Kapital nicht nur nach. Als erfahrener Popularisierer der Wissenschaft erklärt er die Theorien in verständlicher Form und konfrontiert sie mit der Realität des 21. Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1098
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Karl Marx, der revolutionäre Querkopf und Vordenker des 19. Jahrhunderts, ist wieder da. Seit der Kommunismus in seinem Namen – aber nicht in seinem Sinne – Geschichte ist, feiert er ein bemerkenswertes Comeback. Jürgen Neffe erkundet dessen Ursachen – in Marx’ Schriften wie in seiner Biografie. Er schildert das Leben eines Flüchtlings und geduldeten Staatenlosen, der für seine Überzeugungen keine Opfer scheut. Weder Krankheit, Armut, Ehekrisen noch Familientragödien halten ihn davon ab, beharrlich an seinem Werk zu arbeiten. Mit seiner Analyse des Kapitalismus als entfesseltes System sagt er die globalisierte Welt unserer Tage bis hin zur Finanzkrise voraus. Neffe zeichnet die Entwicklung der Marxschen Gedankenwelt von Entfremdung und Ausbeutung in den Frühschriften bis zur ausgereiften Krisentheorie im Kapital nicht nur nach. Als erfahrener Popularisierer der Wissenschaft erklärt er die Theorien in verständlicher Form und konfrontiert sie mit der Realität des 21. Jahrhunderts.
Autor
Jürgen Neffe, geboren 1956, ist promovierter Biochemiker und ein mehrfach ausgezeichneter Journalist und Autor. Besonderes Aufsehen erregte er mit seinen vielgerühmten Biografien von Albert Einstein und Charles Darwin, die beide große Bestseller waren.
JÜRGEN NEFFE
MARX
DER UNVOLLENDETE
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
© 2017 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: Karl Marx, 1867 © akg-images
Lektorat: Rainer Wieland
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-17242-8V001www.cbertelsmann.de
Für meine Frau und Kollegin
»Was immer man aus Marx gemacht hat: Das Streben nach Freiheit, nach Befreiung der Menschen aus Knechtschaft und unwürdiger Abhängigkeit war Motiv seines Handelns.«
Willy Brandt, 1977
Inhalt
Prolog
Marx und kein Ende
ERSTER TEIL
1 – Aufbruch, Flucht, Revolte
Muster eines Lebens
2 – Das Nest
Trier – Brutstätte eines Hochbegabten
3 – Teurer Vater, teurer Sohn
Studium totale
4 – Im Club der toten Denker
Hegels langer Schatten
5 – »Dr. Marx, so heißt mein Abgott«
Zwischen Zeitung und Zensur
6 – Sieben Jahre Einsamkeit
Fräulein von Westphalen wird Frau Marx
7 – »Oder sollen wir es gut pariserisch anfangen?«
Exil als Befreiung
8 – Trau keinem über dreißig
Die Entwicklung der Marxschen Gedankenwelt
A. Arbeit und Entfremdung
B. Herrschaft und Eigentum
C. Kollektiv und Plan
D. Welt und Gott
E. Kopie und Original
9 – Bis dass der Tod euch scheidet
Das Kreativteam Marx & Engels
10 – Brüsseler Spitzen
Wie Marx und Engels zu Kommunistenführern werden
11 – »Alles Ständische und Stehende verdampft«
Das Kommunistische Manifest
12 – Revolutionäre Ernüchterung
Ein Monat in Paris
13 – Der kurze Weg zum langen Abschied
Das »rasende Jahr« 1848/49
ZWEITER TEIL
14 – Aufbruch mit offenem Ziel
Der multiple Marx
15 – Being Jenny Marx
Das Drama der begabten Gattin
16 – Marx’ verdammte Männer
Der Abwickler
17 – Zwischen allen Zeilen
Noch einmal Zeitungsmacher
18 – Honorarkraft
Der Korrespondent
19 – »Der jüdische Nigger«
Marx und Lassalle
20 – Selbstbild und Fremdbild
Der ewige Jude
21 – Gedankenexperimente
Der Visionär
22 – Geld oder Leben
Der Haushälter
23 – Fremde Mächte
Das Kapital – eine Schauergeschichte
A. Die Geburt der Theorie
B. Vom Doppelcharakter zum Warenfetisch
C. Aus Geld wird Kapital
D. Im Maschinenraum des kapitalistischen Systems
E. Das Kapital im 21. Jahrhundert
F. Der Sündenfall des Kapitals
G. Das Unvollendete
H. Bestätigungen
I. Postkapitalismus
J. Postskriptum
24 – Krankheit als Symptom
Der Dauerpatient
25 – Entwicklungsgesetze
Marx und Darwin
26 – Family matters
Vater Marx
27 – »Mächtige Maschine«
Die Internationale und die Pariser Commune
28 – Showdown in Abwesenheit
Marx gegen Bakunin
29 – »… ich sei der berüchtigte KM«
Vergänglicher Ruhm
30 – Wer hat wen verraten?
Marx und die Sozialdemokratie
31 – Im Osten geht die Sonne auf
Marx’ russische Seele
32 – »Mein Herz blutet«
Freud und Leid im Hause Marx
33 – Freundschaftsdienst
Marxens Werk und Engels’ Beitrag
34 – Einsamer nie
Die letzte Reise des Karl Marx
Dank
Anmerkungen
Bibliographie
Register
Bildteil
Prolog
Marx und kein Ende
Man kann diese Geschichte auch anders erzählen. Vom Denkmal her etwa, das seine letzte Ruhestätte überragt. Sie liegt im Norden von London, auf dem Friedhof von Highgate, wo das Leben mit Efeuranken und Moos und wilden Blumen die Steine der Toten überwuchern darf. Kontrollierter Verfall, so nennen sie das hier, wenn kopf- oder flügellose Engel, zu Boden gegangene Kreuze und versinkende Grabplatten in gärtnerisch eingehegter Wildnis der Verwitterung anheimgegeben werden.
Nur das Grabmal im Quadranten C2 auf dem Ostteil des Gottesackers widersetzt sich der inszenierten Vergänglichkeit. Das gepflegte Geviert mit seinen sauberen Plattenpfaden und gemähten Rasenflecken hinter eisernen Trittschutzzäunen verleiht dem Ort einen offiziellen Charakter, der das Morbide seiner Umgebung verneint. Darüber erhebt sich ein massives Monument, Manifestation eines Materialismus, der die Ewigkeit im Blick zu haben scheint: Vom übermannshohen Sockelblock aus grau meliertem Granit schaut, wie zur Demonstration menschlicher Unsterblichkeit, grimmig ein wuchtiger Bronzekopf auf die übrigen Gräber und die unablässig vorbeiziehenden Besucher herab.
Die Friedhofsverwaltung weiß um den Wert ihrer Attraktion. Vier Pfund Eintritt verlangt sie für diesen Teil des Areals. Das hält aber niemanden davon ab, dem Bärtigen mit dem finsteren Ausdruck seine Aufwartung zu machen. An guten Tagen sind es mehrere Hundert, die zu ihm pilgern, manche um die halbe Welt gereist. Die meisten verweilen ein paar Minuten, einige legen Blumen ab, andere ganze Sträuße an den Fuß des Quaders. Chinesen aus der Roten Republik nähern sich in Busladungsstärke der Nekropole, wo sie ihrer Pflicht als Volksgenossen mithilfe von Selfie-Sticks Genüge tun.
Jenseits touristischer Erbauung besitzt dieser Ort eine eigene, ganz eigentümliche Anziehungskraft, besonders für jüngere Leute aus aller Sprachen Länder. Eine Gruppe spanischer Studenten, die in stiller Andacht einen Anstecker der neuen Linkspartei Podemos auf dem Vorsprung des Sockels abgelegt hat, beschreibt ihn als »Kraftquelle« zur Inspiration ihrer Hoffnung auf eine bessere, gerechtere Welt. Als Erster habe Marx das unheimliche, übermächtige System beschrieben, dem sich die Menschheit auf Gedeih und Verderb ausgeliefert hat: jenen von Menschen gemachten, aber von ihnen nicht kontrollierbaren Moloch der Moderne namens Kapitalismus.
Wie ein Seher hat er erkannt, dass sich Kapital nicht als fassbarer Gegenstand, sondern nur in seiner Bewegung begreifen lässt. Als Fetisch, dem Leben innezuwohnen scheint wie einem Wesen – »ein beseeltes Ungeheuer, das zu ›arbeiten‹ beginnt, als hätt’ es Lieb’ im Leibe«1. Ein System, verrückt und vernünftig, rational und irrational in einem. Und die Spezies, die es betreibt, »gleicht dem Hexenmeister, der die Unterirdischen Gewalten nicht mehr zu beherrschen vermag, die er heraufbeschwor«2.
Als die jungen Iberer zur Welt kamen, waren Kalter Krieg und Ostblock schon Geschichte. In Marx sehen sie einen Vordenker und Kritiker des Kapitalismus, nicht den geistigen Übervater der sozialistischen Staatenwelt, die an ihrem Höhepunkt im 20. Jahrhundert beinahe die Hälfte der Menschheit umfasste. Die gehört für sie, trotz Kuba und Co., in das gleiche Reich von Schwarz-Weiß-Erinnerungen wie Franco und die Nazizeit. Der Anblick einer Gruppe marxistischer Veteranen und ergrauter Antifaschisten aus der ehemaligen Sowjetunion wirkt auf sie befremdlich oder, wie sie sagen: »exotisch«.
Die alten Herrschaften, manche am Gehstock, die Rote Fahne als Sticker am Revers, stellen ihrem Säulenheiligen Kerzen zu Füßen. Dann verneigen sie sich und blicken schweigend auf zu dem Riesenkopf, der auf einem Friedhof eigentlich nichts zu suchen hat: Denkmäler, die Lebende darstellen, gehören in die Welt der Lebenden, auf Plätze, Straßen, nicht ins Reich der Toten. Dass er dennoch dort steht und bleiben wird, unerschütterlich und unberührbar bei aller Hinfälligkeit, die ihn umgibt, erscheint wie ein Symbol der Widersprüche, die Marx bis heute begleiten.
Es war die Kommunistische Partei Großbritanniens, die das Monument 1956 an dieser Stätte gelebter Sterblichkeit errichten ließ. Im selben Jahr distanzierte sich Generalsekretär Chruschtschow in Moskau vom Heldenkult seines Vorgängers Stalin, die Ungarn begehrten gegen ihr stalinistisches Regime auf, und die britischen Kommunisten erlebten im Streit um ihr Verhältnis zur Sowjetunion bald ihre schwerste Krise. Nach Ende des Ostblocks kamen sie ihrem Untergang 1991 durch Selbstauflösung zuvor. Auf dem Friedhof lebt ihre Erinnerung weiter als Kuriosum aus einer seltsam entrückten Zeit.
Gleich unter dem bulligen Schädel haben sie die Buchstabenfolge workers of all lands unite in den Granit schneiden und golden ausschlagen lassen. Das klingt im Englischen um einiges zeitloser als das preußisch-deutsche Original von 1847: »Proletarier aller Länder, vereinigt Euch.« Der Satz am Fuß des Sockels hingegen – THE PHILOSOPHERS HAVE ONLY INTERPRETED THE WORLD IN VARIOUS WAYS • THE POINT HOWEVER IS TO CHANGE IT – verliert in der Übersetzung einiges von seiner ursprünglichen Poesie: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern.«
Im Frühjahr 1845 aufs Papier gekritzelt und erst nach dem Tod des Verfassers von seinem Freund Friedrich Engels im Nachlass entdeckt, bedeutet diese »Elfte These ad Feuerbach« Aufbruch und Vermächtnis in einem. Die beiden Zitate liegen kaum mehr als zwei Jahre auseinander. In Marx’ Schaffen markieren sie den Schritt vom Denker zum Kämpfer, vom revolutionären Theoretiker zum Theoretiker der Revolution. In diesem Umschwung wurzeln alle modernen Arbeiterbewegungen, die sich auf das unzertrennliche Duo aus Deutschland berufen.
Schräg gegenüber dem Großkopf liegt eine bescheidene Grabstätte, die Besucher mitunter als Rastbank zum Verzehr mitgebrachten Proviants missbrauchen. HEREIN LIE THE ASHES OF HERBERT SPENCER, lautet ihre schlichte Inschrift. Das muss man nicht übersetzen, wenn man weiß, dass sich dahinter die sterblichen Überreste eines notorisch Backenbärtigen verbergen, der mit Fug und Recht als weltanschaulicher Antipode von Marx und Konsorten gilt.
Der Soziologe, zwei Jahre nach Marx geboren und zwanzig nach ihm gestorben, hat die Lehre des Sozialdarwinismus begründet. Sie sieht das menschliche Miteinander als unerbittliches Gegeneinander im Kampf ums Dasein – Individuen in totaler Konkurrenz, Kapitalismus als Fortsetzung der Evolution mit ökonomischen Mitteln. Von Spencer, nicht von Darwin, stammt der Schlachtruf vom »Survival of the Fittest«, der dem Recht des Stärkeren gelehrte Weihen verlieh. Obwohl wissenschaftlich unhaltbar, hat seine eingängige Doktrin Karriere gemacht. Sie liefert bis heute der neoliberalen Ideologie von globalem Wettbewerb und »freien« Märkten die ideale biologistische Basis.
So verkörpern Marx und Spencer den Widerspruch der spätkapitalistischen Welt, die seit mehr als einer Generation scheinbar ungebremst in ihre Frühphase zurücktaumelt: Revolution von oben statt von unten, wenn auch dank der Wählerstimmen von dort, Egoismus und Einzelkampf statt Kollektivgeist und Solidarität.
Wer Marx verstehen und würdigen will, muss das Gegenteil immer gleich mitdenken, zum Segen den Fluch und umgekehrt. Welcher Denker hat die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt tiefer und nachhaltiger bewegt als er? Gemessen daran rangiert er auf Augenhöhe mit berühmten Religionsstiftern. Doch seit im Namen seiner Lehre Regime geherrscht haben und immer noch herrschen, die ihre Bürger gängeln und überwachen und nur mit Stacheldraht, Mauer und Schießbefehl vom Massenexodus abhalten, sieht er sich als Prophet zum Paria verflucht. Sogar die Schuld am Gulag wird ihm in die Schuhe geschoben.
Dass sein Name bis heute Ehrfurcht wie Furcht hervorruft, verdankt Marx einem perfiden Pakt, den andere in seinem Namen geschlossen haben. Er war ihr Faustpfand, mit seiner Lehre haben sie Diktatur, Gewalt und Unfreiheit begründet, wie er sie nie gebilligt hätte. Damit haben sie ihn in aller Welt prominent gemacht, aber eben auch als jene Hassfigur, die er im Echoraum antilinker Ressentiments bis heute geblieben ist.
Kein Theoretiker ist je so mit monströsem Terror und Millionen Toten in Verbindung gebracht worden wie Marx von seinen immer noch zahlreichen Gegnern. Ohne seine »Vorarbeit«, so der häufig wiederholte Vorwurf, wären der Welt Despoten wie Stalin und Ceaușescu, Mao, Pol Pot oder die nach wie vor herrschenden Steinzeitkommunisten Nordkoreas erspart geblieben. Darüber gerät seine wahre Leistung oft in Vergessenheit.
Einer Rückkehr zum vorbehaltlosen Umgang mit Marx und seinem Werk stand und steht noch immer der -ismus im Wege, den man seinen vier Buchstaben angehängt hat wie Christus das Christentum. Marx hat nie einen Marxismus begründet. Nichts lag ihm ferner, als ein abgeschlossenes System zu schaffen. Die Welt im Wandel durch Widerspruch verträgt in seiner Sichtweise keine dogmatische Erstarrung.
Das Wort haben seine Gegner geprägt. Offiziell ist es damals wohl erstmals in Polizeiakten aufgetaucht. Wenn es heute in amtlichen Unterlagen erscheint, verheißt das in der Regel nichts Gutes. Bereits 1993, die Mauer lag kaum in Trümmern, war in der Zeit zu lesen: »Erst nach Aussterben der Marxisten kann Marx zu seiner kompletten Statur aufwachsen.«3 Ein Vierteljahrhundert später erklärt das gleiche Blatt, »was man von ihm heute noch lernen kann – dem Marxismus zum Trotz«.4
In Fachkreisen, denen es mehr um seine Ideen geht als um Ideologie, kursiert seit geraumer Zeit ein Bonmot in diesem Sinne: »Man muss Marx vor den Marxisten retten.« Man erlebt Redner, die zu Beginn ihres Vortrags betonen, keine Marxisten zu sein. Aber Marxologen und unter Umständen auch Marxianer. Von ihm selbst ist aus seinen letzten Lebensjahren, als die Vergiftung seiner Lehre schon im Gange war, der berühmte wie berührende Satz überliefert: »Alles, was ich weiß: Ich bin kein Marxist.«5 Dennoch wäre es, wie der französische Philosoph Jacques Derrida warnt, ein großer Irrtum, Marx gegen den Marxismus auszuspielen.
Sein zentrales Thema, von Skeptikern und Gegnern jeder Couleur noch immer leidenschaftlich bestritten, war die Freiheit. Und da, wo sie an ihre Grenzen stößt, die Befreiung. Im Einstehen für freies Wort und freie Presse als demokratische Grundrechte verlor er erst seine deutsche Heimat und dann gleich mehrfach sein Zuhause im Exil. Den Großteil seiner Erdentage fristete er als geduldeter Flüchtling ohne Staatsangehörigkeit.
Wie ein Hohn der Historie mutet dagegen die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in Staaten an, die mit Marx und seinen Lehren ihr Süppchen kochten oder es noch immer tun. Die der Freiheit mit dem oft zynisch zitierten Hegel-Wort als »Einsicht in die Notwendigkeit« begegneten. Die ihren Kindern die Sätze von Papa Marx verdrehten und aus »Die Freiheit des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Freiheit aller« das Gegenteil bastelten: Nur alle oder keiner.
Beinahe religiös erscheint der säkulare Eifer, mit dem seine systemtreuen Jünger dem erklärten Atheisten Marx den Heiligenschein wanden. Sie haben ihn wie einen Erlöser feiern lassen, seine Schriften aber manipuliert und dann mit einem biblisch anmutenden Unfehlbarkeitsbann belegt. Aus dem Opium des Volkes, das sich der Mensch nach Marx verabreicht, um sein Schicksal zu ertragen, wurde Opium fürs Volk in Gestalt seiner Worte. Für den Hundertmarkschein Ost haben sie sein Foto bearbeitet, die Züge geglättet, die Augen aufgehellt, so dass er wie ein Siegfried mit Stalinblick in die Ferne schaut. Seiner Frau haben sie sogar die Ohrringe aus ihrem Porträt retuschiert, damit sie darauf nicht allzu mondän erscheint.
Kaum hat der Kommunismus, der in seinem Sinne keiner war, nach langem Kalten Krieg als einziges Gegenmodell zum Kapitalismus ausgedient, kann es manchen gar nicht schnell genug gehen, Marx mit einem Wort seines Lehrmeisters Hegel zum »toten Hund« zu erklären. Das »Ende der Geschichte« wird ausgerufen, die sogenannte freie Marktwirtschaft mit einem Wort der Eisernen Lady als System ohne Alternative gefeiert und Marx als Anstifter auf einen überholten Denker des 19. Jahrhunderts gestutzt, der als falscher Prophet das 20. geprägt und dem 21. nichts mehr zu sagen hat. Seine Analysen, Erkenntnisse, Theorien? Überholt, widerlegt und ohne Wert. Hauptsache, er schweigt.
Eine Zeitlang wird es dann in der Tat recht still um ihn. »Karl Marx ist tot«,6 meldete der Kölner Stadtanzeiger zu seinem 175. Geburtstag im Mai 1993. Etwas Besseres hätte Marx damals vermutlich nicht passieren können. Er brauchte die Jahre, um den Fluch abzuschütteln, der sich mit seinem Namen verbindet. Die scheinbare Totenstarre erwies sich indes als Puppenstadium in der Metamorphose eines Untoten. Noch vor Ende des 20. Jahrhunderts, dem er nicht unmaßgeblich seinen Stempel aufgedrückt hat, tauchte Marx prominent aus seiner Versenkung wieder auf.
Im Oktober 1997 verkündete der New Yorker mit sicherem Trendinstinkt »Die Rückkehr des Karl Marx« und widmete dem »nächsten Denker« eine ausführliche Würdigung. »Je länger ich an der Wall Street war«, zitiert das Blatt darin einen Investmentbanker, »desto überzeugter wurde ich, dass Marx recht hatte.«7 Kurz darauf fragte der Nouvel Observateur: »Karl Marx – der Denker des dritten Jahrtausends?«8
Das wird der Ton der nächsten Jahre. Die Briten küren ihn bei einer Abstimmung zum bedeutendsten Denker des vergangenen Millenniums, vor Einstein und ihren Säulenheiligen Newton und Darwin. Kurz vor der Jahrtausendwende feiert ihn der Economist, des Marxismus sicher unverdächtig, in seiner Weihnachtsnummer als »Prophet des Kapitalismus«. Die sonst so kritische Redaktion zeigt »Respekt vor dem erstaunlichen Weitblick und intellektuellen Streben seines Denkens«.9
Ganz sicher war keine Heldenverehrung im Spiel, als Nature, das Weltjournal der Wissenschaft, auf einer Rangliste der meistzitierten Autoren aller Zeiten an erster Stelle den Namen eines Mannes aufführen musste, der sich als »roter Terrordoktor«10 verunglimpft sah – und das durchaus genoss.
Als 2013 das Kommunistische Manifest und Band 1 des Kapital von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt werden, erfährt Marx posthum mehr als eine kleine Genugtuung: Kein Autor hat es mit einem vergleichbaren Text auf die Liste der Weltorganisation geschafft. »Marx rises again«,11 titelt im Jahr darauf die New York Times, »Marx steht wieder auf.«
Totgesagte leben bekanntlich länger, und Totschweigen hat Vordenker von seiner Größe noch selten dauerhaft zum Verstummen gebracht. Spätestens seit Ausbruch der heutigen Finanzkrise ist sein Name wieder in aller Munde – nun aber wie in einem Fegefeuer gereinigt vom Geruch der »Schwefelbande«, als deren Anführer er sich eine Zeitlang verrufen sah.
Niemand kann bis heute sagen, wie nahe das System 2007/8 am Abgrund stand – oder heute noch steht. Aber Menschen fühlen sich plötzlich an die prophetische Stimme aus dem 19. Jahrhundert erinnert, die dem Kapitalismus – früher oder später – den unweigerlichen Zusammenbruch verhieß. Hat Marx nicht auch recht behalten mit seiner Krisentheorie der periodischen Zyklen von Auf- und Abschwung, Bildung und Vernichtung von Kapital?
Sind seine Vorhersagen der Globalisierung und ihrer Folgen nicht in einer Weise eingetroffen, dass man sich beim Lesen der Texte mehr als hundertsiebzig Jahre später die Augen reiben möchte? Hat er nicht die totale Kommerzialisierung angekündigt, wie wir sie gar nicht mehr anders kennen? Hat nicht er als einer der Ersten die ökologische Frage gestellt, den »Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur« kritisch untersucht und neben der »Ausbeutung des Menschen durch den Menschen« auch die des Planeten thematisiert?
Und hat er nicht mit der zunehmenden Entfremdung und Verdinglichung des Menschen im Zuge des Fortschritts ein Lebensgefühl benannt, in dem sich viele von uns Heutigen wiederfinden? Warum sollte sich bei einem, der dem »Gespenst des Kapitals« so tief in die Seele geschaut hat, nicht auch seine These von dessen kommendem Kollaps bewahrheiten?
Rechtzeitig zu den Feierlichkeiten um das 150-jährige Jubiläum seines Hauptwerkes, Das Kapital, und zum Marx-Jahr anlässlich seines 200. Geburtstages 2018 erlebt der lange Verfemte mit seinen Erkenntnissen eine regelrechte Renaissance. Kein Zweiter hat der Menschheit, ihrem Wirtschaften und ihren Gesellschaften Diagnosen gestellt, die noch nach so langer Zeit mit ihrer Aktualität verblüffen können. »Hatte Marx doch recht?« ist im Januar 2017 in großen Lettern auf der Titelseite der Zeit zu lesen. »Gierige Manager, schreiende Ungerechtigkeit und der Aufstand der Vergessenen: Karl Marx sah alles kommen.«12
Nur wer die Welt versteht, davon ist er überzeugt, der kann sie auch verbessern. Im Schaffensrausch seiner jungen Jahre hat er in einem einzigen Satz den Plan für sein Leben vorgezeichnet: »Man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt!«13 Es grenzt fast an Exerzitien zum Zwecke des Exorzismus, wenn er im selben Atemzug erklärt: »Man muss das Volk vor sich selbst erschrecken lehren, um ihm Courage zu machen.«14
Seine Analysen und Vorhersagen scheinen wie für unsere Zeit gemacht. Seine Methode, Fragen zu stellen und Antworten aus Antagonismen zu gewinnen, hat bis heute nichts von ihrer Attraktivität verloren. Sein Werkzeug, die Welt aus ihren Widersprüchen zu begreifen, die Dialektik, hat er von Hegel übernommen und dann, wie er für sich reklamiert, »vom Kopf auf die Füße« gestellt. »Alternativlos« brächte es bei ihm zum Unwort des Jahres.
Das schließt sein eigenes Werk nicht aus. Was Marxianer Satz für Satz wie eine Offenbarung lesen, findet vor den Augen seiner nicht zuletzt auch wissenschaftlichen Widersacher oft keinerlei Gnade. Zu fast jeder theoretischen Äußerung lassen sich glühender Zuspruch und heftigster Widerspruch finden. Deutungen seiner Schriften klaffen auseinander, wie man es sonst nur von künstlerischen Texten kennt, die zum Polarisieren geschrieben wurden. Sein Schaffensprozess lässt sich daher nur angemessen würdigen, wenn man ihn in seiner Offenheit und Unfertigkeit gerade wegen seines experimentellen Charakters als den eines bedeutenden Schriftstellers erkennt.
Wie alle großen Kunstwerke verändert auch seines mit der Zeit den Charakter, so dass es jeder Generation in eigentümlicher Weise frisch und unverbraucht erscheint. Seine weite Optik für die Welt und ihre Entwicklung reichte vom kleinen Schicksal bis zum großen Ganzen. Er träumte von Vereinigung, von einer Harmonie im Bereich des Theoretischen, durch die es gelingt, zwischen den Weltreichen des Denkens und des Handelns zu vermitteln. Welcher Philosoph hat je so tief in die Ökonomie geblickt, welcher Ökonom so philosophisch gedacht und so literarisch geschrieben wie er?
Damit erfüllt sich sein Vermächtnis im dialektischen Widerspruch gelebter Erinnerung. Sie verleiht noch seinem Andenken eine Art von »Doppelcharakter«. So lautet ein Grundmotiv seines Denkens über die gesamte von Menschen gemachte Welt. Darin verbirgt sich bis heute das Geheimnis dessen, was wir seit Marx Kapitalismus nennen. Er hat das Wort nicht erfunden, aber prominent gemacht.
Wer wirklich verstehen will, warum Marx sich nicht auf dem Schindanger der Geschichte entsorgen lässt, wird die Antwort kaum auf der sichtbaren Oberfläche seiner Schriften finden. Selbst wer es fertigbrächte, sie in jedem Punkt zu widerlegen, käme nicht an den tieferen Wahrheiten vorbei, mit denen er der Spezies die Augen geöffnet hat. Sein Genie steckt weniger in der Theorie vom Arbeitswert oder seinen Überlegungen zum tendenziellen Fall der Profitrate. Sie stellen herausragende wissenschaftliche Leistungen dar, so wie durch seine und Engels’ Geschichtsauffassung der Blick auf die Historie für alle Zeiten ein anderer wurde: Wer hätte noch nie davon gehört, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt?
Marx’ Unsterblichkeit rührt auch nicht daher, dass er die herrschende Meinung als Meinung der Herrschenden entlarvt hat und die Ausbeutung der Lohnabhängigen beim Namen genannt hat. Seinen Glauben, die Menschheit habe eine höhere Bestimmung und strebe unweigerlich auf deren Erfüllung zu, teilt er mit vielen anderen Revolutionären, den Aufbruchsgeist und robusten Optimismus mit seiner ganzen bewegten Generation.
Was ihn von allen anderen abhebt, auch seinem Kompagnon Engels, was ihm für immer seinen Platz auf dem Olymp der Geistesgeschichte sichert, haben vermutlich diejenigen am wenigsten begriffen, die ihn wie einen Zeusdarsteller in Form zerstörungssicherer Statuen in die Ewigkeit zu retten versuchen. »Ein ›Denkmal‹«, sagte nach seinem Tod Wilhelm Liebknecht, »wollte Marx nicht haben.«15 Nichts Statisches zeichnet seine eigentliche Leistung aus, nichts, was sich in Stein meißeln oder in Formen gießen ließe, sondern die Einsicht in eine Art von Bewegung, die über die Geschicke der Menschen bestimmt.
Seine entscheidende Entdeckung reicht an die Genietaten der Giganten heran, die unser Bild von Kosmos und Leben mitsamt ihrer Entstehung und Entwicklung für alle Zeiten geprägt haben. Gleichzeitig berührt sie das Reich der Psychologie, die Welt von Wille und Vorstellung, und umkreist ein kollektives Unbewusstes als Richter und Lenker menschlichen Schaffens, zwischen Chaos und Ordnung, Zufall und Notwendigkeit.
Damit verdanken wir Marx eine Erkenntnis unserer Lage, die sich den drei großen Narzisstischen Kränkungen durch die Wissenschaft hinzugesellen lässt. Drei Jahrhunderte vor ihm hat Kopernikus auf Basis astronomischer Daten unsere Heimat aus dem Mittelpunkt der Welt entfernt. Marx’ Zeitgenosse Darwin hat den Glauben an eine göttliche Schöpfung erschüttert, als er natürliche Auslese und gemeinsame Abstammung aller Lebewesen dagegenstellte. Zwölf Jahre nach Marx’ Tod hat Freud dem Ich, wie man sagt, die Herrschaft im eigenen Haus streitig gemacht. Demnach bildet sich der Mensch nur ein, dass seine Handlungen und Entscheidungen auf bewusstem Willen basieren. In Wahrheit regiert in aller Regel das Unbewusste, dem wir mehr oder weniger hilflos ausgeliefert sind.
So ähnlich verhält es sich Marx zufolge mit dem Wir, sobald es in der modernen kapitalistischen Gesellschaft angekommen ist. Wir sind Gefangene unserer eigenen Kreatur, Teile einer von Menschen gemachten lebendigen Maschinerie, die ihr Programm unabhängig vom menschlichen Willen abspult – und doch von ihm betrieben wird. Ihr und unser Überleben hängen wie bei einem Krebsgeschwür vom stetigen Wachstum ab. Dazu muss sie in alle verfügbaren Bereiche vordringen, Raum und Zeit erobern, und schließlich auch sämtliche sozialen Beziehungen kolonialisieren.
Marx verbindet das Verhängnis jedoch mit einem Versprechen: Eines Tages können wir den Zustand überwinden. Sein gesamtes Sein beruht auf der Überzeugung, die Menschen seien ihrem Schicksal ausgeliefert und hätten es gleichzeitig selbst in der Hand. So wie die Schwerkraft uns auf die Erde zieht, und dennoch ist Planet Mars als nächster Horizont der Reise des Menschen bereits ausgemacht. Auch der Planet Marx weiß um seinen beweglichen Horizont. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Gerade darin gründet sich seine Popularität, die jedoch nichts mit Populismus gemeinsam hat.
Nach dem Jammertal kapitalistischer Sachzwänge winkt uns nach Marx ein Reich der Freiheit, in dem jeder nach seinen Fähigkeiten leben soll und jedem nach seinen Bedürfnissen gegeben wird. Er nennt es Kommunismus. Allerdings meint er einen Kommunismus, wie es ihn auf Erden noch nie gegeben hat. Weil in ihm nämlich die Freiheit des Einzelnen Voraussetzung für die Befreiung aller ist. Alle können nach ihrer Façon glücklich werden, weil sie nicht mehr arbeiten, um zu leben, sondern leben, um nach eigenem Gusto Arbeit und Freizeit als Teil eines gelungenen Daseins zu erleben.
Denn das, so Marx als gelernter Philosoph, der er bis zum Ende geblieben ist, das und nichts anderes ist der wahre Kern aller Philosophie. Genaueren Beschreibungen hat er sich dagegen lebensklug verweigert. So etwas kann, davon war er überzeugt, kein Einzelner vorwegnehmen, das müssen die Menschen unter sich ausmachen, wenn die Zeit gekommen ist.
Was man von Marx am wenigsten lernen kann: Wie man Revolutionen macht. Eher schon, wie man es nicht anstellen soll. Allen Weltveränderern, und besonders den Hitzköpfen unter ihnen, hat er eine klare Botschaft hinterlassen: Revolutionen als »Lokomotiven der Geschichte« lassen sich nicht gegen deren Lauf, sondern nur mit ihm in Bewegung setzen.
Auf dem Friedhof von Highgate haben sie dem Falschen ein richtiges Denkmal gesetzt, dem Richtigen aber das falsche. Er hat das Gewese um Personen und ihre Leben abgelehnt, ja verachtet. Biografien haben ihn, nach allem, was wir wissen, nicht interessiert. Für ihn sind es allein die Werke eines Menschen, die zählen, Produkte von Hirn oder Hand, nicht ihre alltäglichen Verrichtungen. Damit hat er der Nachwelt einen unmissverständlichen Auftrag erteilt: Messt mich an meinen Ideen, meinen Worten, meinen Schriften, weniger an meinen Taten oder Lebensdaten.
Doch hinter allen Unsterblichen haben einmal sterbliche Wesen gestanden mit ihren Hoffnungen und Ängsten, Stärken und Schwächen. Im Falle Marx trifft das am besten sein Begriff vom doppelten Charakter, den er dem Drama entlehnt hat. Kaum einer hat so viel und tief über das Wesen des Geldes nachgedacht. Doch außerstande, zwischen Theorie und Praxis zu vermitteln, hat er die besten Jahre seines Lebens in bedrückender Armut verbracht. Zu einer Freundschaft fähig, wie sie die Weltgeschichte nicht häufig erlebt, kann er andrerseits Weggefährten verstoßen, bekämpfen und mit einem Hass überziehen, der kaum Vergleiche erlaubt.
Mal Weiser, mal Wüterich, hier zurückhaltend, dort zupackend, guter Vater, schlechter Vater: gelebte Dialektik, wenn man so will. Erst im Zusammenspiel der Extreme ergeben seine vielen Ichs die vollständige Figur. Sie wird indes schon lange vom Licht des Posterhelden überblendet. Zum Menschen Marx aus Fleisch und Blut, das geht im Denkmalstreit zu häufig unter, gehört ein großes Herz, das nicht nur als Pumpe lebenserhaltend wirkte. Er war gewiss kein einfacher Ehemann, wer ist das schon, aber ein guter Gefährte, vielleicht gelegentlich untreu, aber niemals treulos.
In den Granitsockel unter Marx’ Bronzehaupt ist eine verwitterte, in ihrer Mitte gespaltene Marmorplatte eingelassen. Sie verrät, dass er mit seinen Gebeinen hier nicht allein untergekommen ist. Er teilt mit seinen Lieben eine Familiengruft. Zwei Jahre vor ihm, das sagt die Gravur, ist JENNY VON WESTPHALEN bestattet worden, THE BELOVED WIFE OF KARL MARX. Die Geschichte ihrer gemeinsamen Liebe straft den berühmten Eingangssatz zu Anna Karenina Lügen, kaum dass Tolstoi ihn in jenen Tagen niedergeschrieben hat. Ihre Ehe und Familie waren auf eine ganz eigene, unvergleichliche Weise glücklich und unglücklich.
Das ursprüngliche Grab der Familie verfällt nach Plan in einer Reihe schlichter, dicht gedrängter Grüfte ein paar Schritte hügelab vom Bronzekopf im Schatten dichter Bäume – dort, wo zu Zeiten ihrer Bestattung noch ein baumloses Areal für Gottlose lag. Genau so hat Marx sich selbst sehen wollen: als kleinen, vergänglichen Menschen, nicht als Ikone, geschaffen für irgendeine Ewigkeit.
Gerade einmal sechzehn Trauergäste versammeln sich zum letzten Gruß an seinem Grab, Familie und engste Vertraute. Umso gewichtiger fällt die Abschiedsrede aus, die Männerfreund Engels hält. Sie endet mit der Wucht einer biblischen Prophezeiung, wie sie dem Entschlafenen nicht angemessener hätte sein können: »Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk!«16
Erster Teil
1
Aufbruch, Flucht, Revolte
Muster eines Lebens
Brüssel, 3. März 1848. Ein trübkalter Tag neigt sich seinem Ende zu. Lampenmänner sind unterwegs, um die Gaslaternen zu entzünden. Im Justizministerium macht sich Gerichtsdiener Jean Joseph Polack zu seinem letzten Dienstgang an diesem Freitag auf den Weg. Er trägt ein brisantes Schreiben bei sich, das er rechtzeitig an den Mann bringen soll. Anweisung von ganz oben.
Der Brief richtet sich an einen Ausländer, der, aus Frankreich ausgewiesen, vor drei Jahren mit Frau und neugeborener Tochter in das junge Königreich Belgien geflohen ist. In seiner deutschen Heimat hätte ihm damals als politisch Verfolgter die sofortige Verhaftung gedroht. Daran hat sich bis dato nichts geändert.
Ein Steckbrief zeichnet ihn dort wenig später als etwa einen Meter siebzig großen, untersetzten Mann von gesunder Gesichtsfarbe, die Haare »schwarz, gelockt«, »schwarz« auch Augenbrauen und Bart, die Augen aber »dunkelbraun« und »etwas blöde«. Besondere Kennzeichen: »a) erinnert in Sprache und Äußerem an seine jüdische Abkunft« und »b) ist schlau, kalt und entschlossen«.1
Gegen fünf Uhr nachmittags erreicht der Bote sein Ziel. Das Bois Sauvage, ein kleines Hotel, liegt im Schatten der Kathedrale St. Gudule, Hauptkirche von Brüssel und als Nationalkirche des Landes noch heute Schauplatz königlicher Hochzeiten und ehrwürdiger Staatsbegräbnisse. Nur wenige Gehminuten von der Grand Place mit dem prächtigen gotischen Rathaus entfernt, prägt sie mit ihren zwei stämmigen, wie abgesägt endenden Türmen die Silhouette der Brüsseler Altstadt.
Die Herberge und mit ihr das gesamte Viertel sind einer der Abrisskampagnen zum Opfer gefallen, durch die sich die dicht bebaute Metropole regelmäßig aus ihrer Enge zu befreien versucht. Dort, wo sich in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts der monumentale Gebäuderiegel der Belgischen Nationalbank in die Stadtlandschaft schob, verlangt Gerichtsdiener Polack an jenem 3. März einen Gast zu sprechen, der unter der Adresse gemeldet sei.
Hotelier Jean Baptiste Lannoy wüsste wohl auch ohne Erwähnung des Namens, um wen es sich handelt. Am Morgen um zehn hat ihn ein Untersuchungsrichter namens Charles Berghmans aufgesucht und ausführlich zu der betreffenden Person vernommen. Besonders interessierte sich der Jurist für den 28. Februar, an dem der Verdächtige eine größere Summe Bargeld auf eine Bank getragen haben soll.
Möglich, dass der Wirt seinen Gast, den er mit seiner Familie schon mehrfach beherbergen durfte, daraufhin gewarnt hat. Der herbeigerufene Mann zeigt sich jedenfalls wenig überrascht, als ihm der Bote den Inhalt des Schreibens präsentiert. Das Dokument trägt die Signatur des Königs. Darin verfügt »Léopold, Roi des Belges«, dass »Marcx, Charles, Docteur en Philosophie«2, das Land binnen vierundzwanzig Stunden zu verlassen habe.
Kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag hält der Heimatlose zum zweiten Mal einen Ausweisungsbefehl in Händen. Es wird nicht der letzte sein. Bespitzelung, Haftbefehle, Flucht und Exil prägen seine erste Lebenshälfte wie Armut und Krankheit die zweite. Radikaler Publizist, Kommunist, Revolutionär: bedrohte Spezies, schon damals. Dann auch noch Atheist und Religionskritiker. Im Geiste seiner Generation von Säkularisierung und Demokratisierung jedoch beileibe kein Einzelfall. Weltveränderer sind en vogue in dieser Glutphase der Geschichte.
Europa brodelt. Revolution – das Thema einer Generation, die einen beispiellosen Modernisierungsschub erlebt. Menschen, Güter, Nachrichten bewegen sich mit vorher unvorstellbaren Geschwindigkeiten. Dampfschifffahrt, Eisenbahn und Telegrafie verschieben die Grenzen von Raum und Zeit. Die schier unaufhaltsame Beschleunigung aller Bereiche des Lebens steht am Anfang einer globalen Vernetzung der Menschheit wie dann erst wieder mit Containerschiffen, Massenflugverkehr und Internet. Allgegenwärtige Uhren bestimmen den Takt eines Lebens mit Terminen, Fahrplänen, Arbeitszeiten, Schichtbetrieb.
Das intellektuell verdichtete Klima gebiert in atemberaubendem Tempo Entdeckungen und Ideen, die bis heute die Welt bewegen. Die wohl weitreichendsten reifen während jener Jahre in den Köpfen zweier Männer heran, die bald nur noch eine Kutschfahrt voneinander getrennt leben werden, sich aber nie begegnet sind: Charles Darwin und Karl Marx. Zwei strahlende Sterne im Kosmos des Denkens, so würden es vielleicht romantisch gestimmte Dichter jener Zeit formulieren, zwei Sterne, die aus einer anderen Welt zu uns herüberfunkeln.
Hier das Entwicklungsgesetz des Lebens, dort das Bewegungsgesetz der Geschichte – gemeinsam Ausdruck des Geistes ihrer Zeit: Dynamik als Paradigma. Irritierendes Pendant: Die nach 1839 aufkommende Fotografie versöhnt Stillstand und Ewigkeit im Augenblick eingefangener Zeit. Sie treibt die Malerei zu nie gekanntem Realismus, bevor sie sich in die Abstraktion flüchtet, und erlaubt den Menschen einen neuen Blick auf sich selbst und andere. Erste Splitter jenes gewaltigen Spiegels, der sich gerade vor ihren Augen zusammensetzt. Marx gehört zu den Ersten, die das Bild erfassen.
Städte und Metropolen sehen in ihren Zentren oft noch aus wie im Mittelalter. Nur die nächtliche Finsternis ist künstlichem Licht gewichen. Beleuchtung, Bewegung und Beheizung erfordern bis dahin unvorstellbare Mengen an Energie. Sie wird zum Leitmotiv des Jahrhunderts. Mancherorts erreicht fließendes Wasser die Wohnungen. In den Peripherien und in völlig neuen Siedlungsgebilden wächst die Welt von morgen.
Die Industrielle Revolution mit ihren Fabriken zur maschinellen Produktion standardisierter Güter für Märkte rund um den Globus ist zum Sinnbild des Wandels geworden. Ihr unverkennbares Kennzeichen, neben Schloten, Rauch und Lärm: ein wachsendes Heer einfacher Arbeiter, darunter mehr und mehr Frauen und Kinder, die für zwölf oder vierzehn, manchmal achtzehn Stunden täglich hinter den Toren von Produktionsstätten verschwinden. Ihren Alltag prägen Ausbeutung und Zwang, ihr Leben Elend, Leid und frühes Ende.
Die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse hinken der ökonomischen Wirklichkeit immer weiter hinterher. Bald sind die Börse und das Böse eins, hat der Kapitalist den König in der Tasche als wahrer Herrscher über das Volk. Wirtschaft findet mehr und mehr in legalen Räumen realer Rechtlosigkeit statt. Fabrikherr und Fabrikarbeiter stehen zueinander wie Freibeuter und Freiwild unter Vertrag. Die alten Eliten schauen darüber hinweg und halten am Überholten fest, den Verlust ihrer Welt vor Augen. Dagegen stehen die Jungen, die eine Welt zu gewinnen haben und zum Aufbruch drängen.
Wie ihre Wiedergänger im 20. Jahrhundert, die 1968er, verstehen sich die 1848er als Systemkritiker, prangern Missstände an, unmenschliche Lebensbedingungen, Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Sie probieren alternative Arbeits- und Lebensformen im Geiste sozialistischer Genossenschaften aus. Sie wollen Demokratie, nicht Monarchie, Republik statt Ständestaat, Gewerkschaften und verbindliche Regeln für die Arbeitswelt. Sie fordern moderne Verfassungen mit garantierten Freiheitsrechten für politische Vereinigungen und Versammlungen, für Wort und Rede, für eine Presse ohne Zensur.
Frankreich hat bereits einen Schritt in die Richtung getan. Seit dem Umsturz von 1830 regiert in Paris mit Louis Philippe ein »Bürgerkönig«. In England fordern die »Chartisten«, bedeutendste britische Oppositionsbewegung jener Zeit, mehr demokratische Teilhabe. Polen kämpft um seine Existenz, Ungarn für seine Unabhängigkeit, Italien träumt von der Patria unità, Deutschland vom einig Vaterland. Nation und Revolution, die mächtigen politischen Mythen des 19. Jahrhunderts3, rahmen die Bühne der Marxschen Jugend. Sie geht an diesem denkwürdigen Tag, dem 3. März 1848, zu Ende.
Die königliche Order erwischt ihn zunächst auf dem richtigen Fuß. Er sitzt auf gepackten Koffern. Vor wenigen Tagen haben er und seine Frau Jenny – ihr Haushalt ist seit der Ankunft um eine Bedienstete, eine zweite Tochter und einen Buben auf sechs Köpfe angewachsen – ihre letzte Wohnung geräumt. Sie wollen zurück nach Paris, in die Mutterstadt der Revolution. Dort wird seit ein paar Tagen wieder Geschichte gemacht. Nachdem die Polizei auf friedliche Demonstranten geschossen hat, ist das Volk erfolgreich aufgestanden, zum dritten Mal nach 1789 und 1830.
Bis dahin ist die Generation Marx’ in einer historisch bewegten, dabei aber bemerkenswert friedlichen Zeit aufgewachsen. Seit der Niederlage Napoleons 1815 schweigen die Waffen in Europa. Bis zum Ausbruch des Krimkrieges 1853 tragen die Briten als einzige europäische Macht einen militärischen Konflikt aus: Mit ihrem Sieg im Ersten Opiumkrieg zwischen 1839 und 1842 zwingen sie das riesige Kaiserreich China, sich dem Westen und seinen Produkten zu öffnen. So besiegelt die Sicherung von Absatzmärkten und eines Monopols zum Drogenhandel den ersten kolonial-kapitalistischen Krieg der Geschichte.
Nach dem Wiener Kongress 1814/15 scheinen die Spannungen zwischen den Staaten Europas beherrschbar. Aber innerhalb ihrer Grenzen drohen die Dinge mehr und mehr aus dem Ruder zu laufen. Reformstau erzeugt Druck, er entlädt sich in Revolten. Die Achtzehnvierziger erleben eine Reihe von Erhebungen, am bekanntesten wohl der Aufstand der Schlesischen Weber 1844. Armuts- und Nahrungskrisen der Hungry Forties verschärfen länderübergreifend die Lage. Zum traurigen Höhepunkt wird der Hungerwinter 1846/47, die letzte derartige Krise der europäischen Agrarwirtschaft, mit Millionen Toten. Dazu kommt die Welthandelskrise 1847. Von der Revolte zur Revolution reicht dann oft ein Funke.
Marx kann es kaum abwarten, sich ins Getümmel zu stürzen. Aus Paris soll er am Nachmittag, noch vor Eintreffen des gerichtlichen Dieners, einen weiteren wichtigen Brief erhalten haben, unterzeichnet vom Herausgeber der liberalen Zeitung La Réforme: »Wackerer, aufrichtiger Marx, der Boden der französischen Republik ist eine Freistätte für alle Freunde der Freiheit. Tyrannenmacht hat Sie verbannt, das freie Frankreich öffnet Ihnen seine Tore wieder. Ihnen und all denen, die für die heilige Sache, die brüderliche Sache aller Völker kämpfen. Ferdinand Flocon, Mitglied der provisorischen Regierung.«4
So könnte es gewesen sein, so steht es in den Büchern, so hat es Marx selbst berichtet. Er hätte es eigentlich besser wissen müssen. Die Herausgeber der Marx-Engels-Gesamtausgabe – MEGA – haben das Schriftstück noch einmal gründlich unter die Lupe genommen. Der Befund der Forscher, beispielhaft für die Wissenschaft um Marx’ Schaffen, findet sich in einer Fußnote auf Seite 868 des Bandes 17 der ersten Abteilung (von vier), erschienen 2016: Der vermeintliche Punkt hinter der Eins ist offensichtlich eine Null. Das Datum auf dem Flocon-Brief ist nicht der erste, sondern der zehnte März.
Scheinbar eine Petitesse. Doch die Lesart, von Marx und seinen Anhängern aus Versehen oder mit Absicht verbreitet, nährt fortan ein gut gehütetes Gerücht: Die Revolution ruft den Revolutionär. So schreiben sich Helden ihre Geschichten. Tatsächlich steht das Schriftstück nicht für eine Einladung, sondern für die Bestätigung, dass der Deutsche nach seiner Ankunft in Paris dort willkommen ist – ein Sympathisant unter vielen.
Das Ende des Brüsseler Exils ist gleichwohl schon länger beschlossene Sache. Am selben Nachmittag, also noch vor Erhalt des königlichen Dekrets, hat Marx den Leiter der belgischen Staatssicherheitsbehörde durch seinen Anwalt wissen lassen, er und andere deutsche Oppositionelle wollten die Stadt am kommenden Tag verlassen. »Herr Marx trifft Reisevorbereitungen«, notiert entsprechend Jean-Joseph Bricourt, liberaler Parlamentarier im Abgeordnetenhaus, »und erklärt sich bereit, am andern Morgen den Grenzposten zu bezeichnen, an dem er das Königreich zu verlassen gedenkt.«5
In der Anordnung, die ihm der Bote zustellt, sieht Marx folglich nur den nächsten Schritt im amtlichen Ablauf der Ereignisse. Der Brüsseler Stasi-Chef, ein Mann namens Baron Alexis-Guillaume-Charles-Prosper Hody, lässt ihn und seine Mitstreiter im Glauben, alles gehe seinen geregelten Gang. In Wahrheit führt der »Generaladministrator der belgischen Sicherheitsbehörde« etwas ganz anderes im Schilde.
Bei seiner Einreise hat Marx sich verpflichten müssen, »in Belgien keine Schrift über Tagespolitik zu publiciren«.6 Da hätte man ihm gleich das Atmen verbieten können. Der Justizminister ordnet folgerichtig an, den Flüchtling polizeilich zu überwachen. An den Bürgermeister der Hauptstadt schreibt er: »Sollte es Ihnen zur Kenntnis gelangen, dass er wortbrüchig geworden ist oder sich sonst feindlich gegen die Regierung Preußens, unseres Nachbarn oder Verbündeten, betätigt, so bitte ich Sie, es mir sofort zu melden.«7
Nicht erst seit Marx im Exil lebt, weiß er sich im Visier von Behörden. Geöffnete Briefe, gebrochene Siegel, Überwachung auf Schritt und Tritt gehören für ihn zum Alltag. Die belgischen Behörden wissen um seine Mitarbeit beim Oppositionsblatt Deutsche-Brüsseler-Zeitung, um seine Aktivitäten beim Arbeiterbildungsverein, in der Demokratischen Gesellschaft und vor allem im Bund der Kommunisten. Diese erste international agierende Oppositionsgruppierung, vielerorts in Geheimbünden organisiert, ist der Staatssicherheit besonders ein Dorn im Auge. »Kommunist« – wie »Radikaler« ein Schreckensbegriff und Grund zur Verfolgung – steht für Umsturz und Gewalt.
Die Belgier haben die Wirkung erfolgreicher Aufstände noch frisch im Gedächtnis. Ihr junger Staat ist Ergebnis der belgischen Revolution im Gefolge der französischen von 1830. Dabei haben die protestantischen Niederlande ihren überwiegend katholischen Süden verloren, nun Herrschaftsgebiet von König Leopold. Der versteht sich als »Bürgerkönig« wie Louis Philippe, dessen Tochter Louise er 1832 ehelicht. Sein Land, industrialisiert wie sonst nur Großbritannien, gilt wie dieses anfangs als eines der liberalsten in Europa und Brüssel als bevorzugter Zufluchtsort politisch Verfolgter.
Doch Bürgerkönige reichen den bewegten Bürgern nicht mehr aus, Handwerkern und Arbeitern erst recht nicht. Im Verein mit linken Intellektuellen stellen sie nicht nur gekrönte Häupter infrage, sondern das ganze politische und ökonomische System. Die radikalste Antwort heißt Kommunismus, und dessen herausragender Vertreter Karl Marx, zumindest in einschlägigen Kreisen politischer Aktivisten. Unter gewöhnlichen Arbeitern ist er durchweg unbekannt.
Am Abend jenes 3. März 1848 versammelt sich die Führung der in Belgien organisierten Kommunisten zum letzten Mal in seiner Unterkunft. Erst vor zwei Tagen hat die Londoner Führung des Kommunistenbundes wegen der Ereignisse auf dem Kontinent dem Brüsseler Kreis ihre Befugnisse übertragen. Nun beschließen die Männer im Bois Sauvage, dem Gastgeber persönlich alle Vollmachten und Unterlagen anzuvertrauen. Er soll den Bund im »befreiten« Paris neu aus der Taufe heben. Dort sind Kommunisten bisher als Kraft neben republikanisch gesinnten Sozialisten und anderen liberalen Gruppierungen kaum in Erscheinung getreten. Das soll sich ändern.
In diesem Moment sieht Stasi-Chef Hody die Gelegenheit gekommen, das revolutionäre Räubernest auszuräuchern. Marx betrachtet er als Rädelsführer, der illegale Waffenkäufe für Aufstandsbereite finanziert haben soll. So steht es in fast allen Schilderungen seines Lebens. So gibt auch Jenny Marx in ihren Lebenserinnerungen die offizielle Lesart wieder, die sie den Berichten von Mitstreitern verdankt: »Die Regierung sieht Komplott in dem Ganzen«, schreibt sie mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen. »Marx bekommt Geld, kauft Waffen, muss entfernt werden.«8
Die Gerüchte sind vermutlich falsch. Marx hat sich nie durch Militanz ausgezeichnet. Zwar hat ihn in jenen Tagen aus väterlicher Erbschaft der größte Geldbetrag erreicht, den er je in Händen halten wird. Einiges spricht jedoch dagegen, dass er damit Schießzeug erworben hat. Zu dem Zeitpunkt jedenfalls, als die fraglichen Käufe erfolgt sein sollen, waren die Händler in Brüssel wegen der drohenden Unruhen bereits angewiesen, keine Pistolen, Gewehre oder auch nur Munition mehr zu verkaufen.
Gegen die These des konspirativen Waffenkaufs spricht auch die Vehemenz, mit der sich Marx kurze Zeit später in Paris weigern wird, einen wahnwitzigen Waffengang deutscher Revolutionäre zu unterstützen. Die schlecht ausgerüsteten und ausgebildeten Freischärler wollen den Aufstand aus Frankreich in die Heimat tragen, obwohl dort gut ausgestattete Truppen nur darauf warten, sie aufzureiben. Genau so ist es dann auch gekommen.
Spätestens hier, inmitten der revolutionären Unruhen, zeigt sich erstmals ein neues Element seines Verhaltens. Marx kann sich zwar für Krieg und Kampf begeistern, besonders gegen das verhasste Russland in seiner zaristischen Rückständigkeit. Als Mittel zum Umsturz aber, wenn die Zeit noch nicht reif ist, rät er von sinnlosem Blutvergießen ab – auch wenn er es im Nachhinein manchmal gutheißen kann. In dem Augenblick, wo er das historische Gesetz erfasst, nach dem die Geschichte auch die zu früh Gekommenen bestrafen kann, verwandelt sich der »junge« in den »reifen« Marx.
Dass er sich bei aller revolutionären Emphase immer einen realpolitischen Blick bewahren wird, geht auch auf jenen Tag in Brüssel zurück, der anders endet, als er sich das vorgestellt hat. Kurz vor Mitternacht macht sich von seinem Schreibtisch in der Wache des siebten Polizeibezirks Hilfskommissar Gommaire Daxbeek, ein Mann Mitte vierzig, mit einer Handvoll Gendarmen zum letzten Einsatz vor dem Wochenende auf. Ihr Ziel: das Bois Sauvage. Diesmal wird der Staatsmacht ihre Überraschung gelingen.
In einem Brief an La Réforme schildert Marx die Ereignisse der Nacht: Während er sich auf die Abreise vorbereitet habe, »drang ein Polizeikommissar in Begleitung von zehn Polizisten in meine Wohnung ein, durchwühlte das ganze Haus und nahm mich schließlich fest unter dem Vorwand, ich hätte keine Papiere«9. Das ist rein rechtlich nicht korrekt. Allein der Ausweisungsbefehl hätte als gültiges Dokument genügt. Aber die Aktion zeitigt den beabsichtigten Zweck: Bei ihrer Durchsuchung beschlagnahmen die Beamten Schriftstücke des Kommunistenbundes und mit ihnen die Namen der Kreisvorstände. Außerdem fällt ihnen das Protokoll der nächtlichen Geheimsitzung in die Hände. Abschriften gehen in nachbarschaftlicher Verbundenheit der Königreiche an den preußischen Gesandten.
Marx wird verhört, verhaftet und in ein nahes Gefängnis mit dem einladenden Namen Amigo verfrachtet. Unweit der Grand Place gelegen, beherbergt das Gebäude heute ein Sternehotel gleichen Namens. In seinen Gemäuern logiert neben anderen ranghohen Politikern regelmäßig die deutsche Kanzlerin bei ihren Aufenthalten im Machtzentrum der Europäischen Union.
Der Verhaftete verbringt dort eine weniger komfortable Nacht als heutige Gäste. Das Unerhörte geschieht ihm zum ersten und letzten Mal in seinem Leben – abgesehen von einem harmlosen Arrest während der Studienzeit wegen Randalierens und, in seiner zweiten Lebenshälfte, einer Nacht in einer Londoner Zelle, als man ihm nicht abnimmt, rechtmäßiger Besitzer des Familiensilbers zu sein, das er versetzen will.10
Anders als den meisten Mitstreitern bleiben ihm Misshandlungen erspart. Am schlimmsten trifft ihn, nichts über das Schicksal der Seinen zu wissen. Während er wenigstens glauben darf, sie seien im Gasthaus gut aufgehoben, wird kurz nach ihm die Mutter seiner Kinder, Baronesse von Westphalen, ziemlich unwirsch ab- und ebenfalls der Justiz vorgeführt.
»Sie erscheint schließlich vor dem Untersuchungsrichter«, berichtet Marx den Lesern der Réforme, »der ganz erstaunt darüber ist, daß die Polizei in ihrer Fürsorge nicht auch die kleinen Kinder festgenommen hat. Die Vernehmung konnte nichts anderes als ein Scheinverhör sein, und das ganze Verbrechen meiner Frau besteht darin, daß sie trotz ihrer Zugehörigkeit zur preußischen Aristokratie die demokratischen Auffassungen ihres Mannes teilt.«11
Hinter den Gittern des Rathausgefängnisses muss die Frau mit dem adligen Namen eine erniedrigende Nacht mit »obdachlosen Bettlern« und »verlorenen Frauen« verbringen. In ihren Lebenserinnerungen beklagt sie sich bitter über ihre Behandlung durch die belgischen Behörden. »Man stößt mich in ein dunkles Gemach. Schluchzend trete ich ein, da bietet mir eine unglückliche Leidensgefährtin ihr Lager an. Es war eine harte Holzpritsche.«12
Der Realitätsschock reicht tief. Wenn man so will, hat die Nacht auf der Gefängnisbank Karl und Jenny Marx ein entscheidendes Stück vom Möglichkeits- zum Wirklichkeitssinn gebracht: Man soll seine Rechnung nie ohne den Wirt machen und die Herrschenden nur dann herausfordern, wenn man ihnen gewachsen ist.
Der Einschnitt in ihr Leben deckt sich mit einer Zäsur in der europäischen Geschichte. Die nicht minder schockierten Machthaber setzen alles daran, die Revolution auf das Maß einer Episode zu reduzieren. An deren Ende werden sie – aus Schaden wird man klug – noch sicherer im Sattel sitzen als davor. Bis 1905, die gescheiterte Pariser Commune von 1871 bewusst ausgenommen, bleibt Europa revolutionsfrei.
Der 3. März 1848 lässt sich mit gleichem Recht als archimedischer Punkt der Marxschen Biografie begreifen wie das Jahr 1848 als Gravitationszentrum des »langen« 19. Jahrhunderts. Dem britischen Historiker Eric Hobsbawm zufolge erstreckt es sich vom Sturm auf die Bastille 1789 bis zum Attentat auf den österreichischen Thronfolger 1914, von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. Ihm folgt nach dieser Einteilung das »kurze« 20. Jahrhundert von 1917 bis 1989, in dem der »Kommunismus« erst siegt und dann untergeht. Dessen Wurzeln gehen bis in jene bewegten Tage in Brüssel zurück.
Die Ereignisse haben ihre Spuren als »Affäre Marx« im Archiv der belgischen Hauptstadt hinterlassen. Die Akte mit der Nummer 73946 erzählt vom Komplott, dem der politische Flüchtling und seine Genossen zum Opfer gefallen sind: Beschattungen, falsche Anschuldigungen, Schikanen. Mehrfach debattiert der Stadtrat den Skandal. Hilfskommissar Daxbeek wird aus dem Dienst entfernt.
Die Unterlagen verraten auch manches über die angespannte Lage. Monarchen fürchten um ihr Leben. Leopold hat seinen Landsleuten sogar angeboten, unter gewissen Umständen von sich aus abzudanken. Dazu ist es aber nicht gekommen, nachdem fast alle ausländischen Verdächtigen verjagt und viele der inländischen eingesperrt worden sind.
Was die Akte nicht weiß: Die schärfste Waffe des ausgewiesenen Doktors der Philosophie ist weder Geld noch Schießgerät, sondern seine spitze Feder. Die bis zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich magere Bilanz des Schriftstellers Marx mag den Geheimdienst getäuscht haben. Lediglich einige Zeitungsartikel hat er veröffentlicht, in der Regel anonym, ein paar – für die Fachwelt allerdings ziemlich bedeutende – Essays sowie zwei Schmähschriften in Buchform, über die heute kein Mensch mehr reden würde, wären sie nicht von Marx.
In seinen Unterlagen finden sich ansonsten zahllose Exzerpte, Texte, Tabellen, Zeichnungen aus Büchern und Fachzeitschriften, oft seitenweise in Hefte und Kladden übertragen. Mit jedem Umzug nimmt die Zahl der Kisten voll zugekritzelter Zettel zu. Im Gepäck zum Abschied aus Brüssel verbirgt sich ein Schatz unpublizierter Schriften. Die Manuskripte enthalten vieles vom Besten, was der junge Marx bis dahin gedacht und geschrieben hat.
Nach Aktenlage haben die Behörden auch keinerlei Hinweis auf sein berühmtestes politisches Pamphlet, Anfang 1848 in wenigen Wochen des Brüsseler Winters zu Papier gebracht. Wie es das Schicksal will, erscheint der erste Teil des Textes just an jenem 3. März 1848 als Auftakt einer Zeitungsserie in London. Er beginnt mit der legendären Formel: »Ein Gespenst geht um in Europa.«
Damit erreicht die Schrift ungleich mehr Leser als über die tausend Exemplare des gebundenen Büchleins, in diesen Tagen ebenfalls in London gedruckt. Den Namen des Autors suchen sie hier wie dort vergebens. Stattdessen steht da jene Gruppierung, in deren Auftrag er den Text geschrieben hat: Manifest der Kommunistischen Partei.
Marx erfährt an dem bewussten Tag natürlich nichts von dessen Veröffentlichung in der Presse. Selbst wenn es ihm jemand aus London berichtet hätte, wäre die Post mehrere Tage unterwegs gewesen. Die Telegrafie für den Privatmann, das Telegramm, kommt erst Jahre später in Mode.
Die aufkommenden Massenmedien, anfangs nur Druckerzeugnisse, verdanken ihren Aufstieg einer historisch einmaligen Massenalphabetisierung. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wird Schulerziehung mit Lesen, Schreiben und Grundrechenarten mehr und mehr zum Standard in Europa und Amerika – zumindest für Jungen. Bis zu den Penny Papers, für Arbeiter erschwinglichen Billigblättern in England und den USA, ist es dann nur noch ein kleiner Schritt von einer Generation. Die erste Rotationsdruckpresse geht 1846 in Betrieb.
Bildung ist nicht mehr nur den Eliten vorbehalten. Information und Wissen, Fakten und Einschätzungen erreichen auch einfachere Leute. Marx profitiert doppelt: Journalismus als Brotjob beschert ihm wenigstens zeitweise einen Lebensunterhalt. Umgekehrt findet er als ökonomisch interessierter Leser Futter für seine Theorien, besonders im Economist, seit 1843 auf dem Markt. Zum Geheimnis seiner Karriere gehören Glück und Geschick, immer wieder zur richtigen Zeit am rechten Ort zu sein. Oder weiter gefasst: in einer Phase der Geschichte zu leben, die ihm gleichsam in die Hände spielt.
Beredter Ausdruck der Entwicklung sind Arbeiterbildungsvereine, in der Regel Anhängsel und legale Arme von ansonsten im Geheimen wirkenden politischen Organisationen. Parteien im modernen Sinne kommen erst einige Zeit später auf. Noch wenige Wochen vor seinem Abschied aus Brüssel hat Marx dort Handwerkern und Arbeitern in seiner Vortragsreihe »Lohnarbeit und Kapital« in verständlicher Sprache seine ökonomischen Einsichten und Überzeugungen dargelegt. »Die Arbeit ist also eine Ware«, hat er dem wissenshungrigen Publikum erklärt, »die ihr Besitzer, der Lohnarbeiter, an das Kapital verkauft. Warum verkauft er sie? Um zu leben.«13
Das Kommunistische Manifest, so heißt das revolutionäre Pamphlet bald nur noch, setzt statt eines Punktes ein Ausrufezeichen ans Ende der frühen Schaffensphase des Schriftstellers Marx. Es enthält alle Elemente seines philosophischen, politischen und ökonomischen Denkens bis zur Zäsur. Danach lässt er seine wissenschaftliche Arbeit erst einmal ruhen. Wäre ihm während der Polizeiaktion oder im Gewahrsam etwas zugestoßen – dieses Statement wäre in der Welt. Erst nach seinem Tod wird es allbekannt, setzt seinen Namen als Landmarke auf die geistige Karte der Spezies, bis es es schließlich in Sachen Auflage mit der Bibel aufnehmen kann.
Der König von Belgien besitzt seinerseits ebenfalls keinerlei Kenntnisse der Kampfschrift. Sie hätte ihm mit ihrem Aufruf zum »gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung«14 die passende Begründung nicht nur für die Ausweisung, sondern für die Auslieferung des staatenlosen Gastes an seine preußische Heimat liefern können. So lassen die Behörden Marx am Nachmittag des 4. März laufen.
»Ich will nur erwähnen«, zitiert ihn die Réforme, »daß nach unserer Freilassung die vierundzwanzig Stunden gerade verstrichen waren, und daß wir abfahren mußten, ohne auch nur das Nötigste mitnehmen zu können.«15 Ein belgischer Getreuer nimmt sich ihrer Habe an. Freund Engels, der einen gültigen Pass für Belgien besitzt und noch etwas länger in Brüssel weilt, schickt sie ihnen nach.
2
Das Nest
Trier – Brutstätte eines Hochbegabten
Zum Leben in einer Kleinstadt muss man geboren sein. Dort auf die Welt zu kommen und aufzuwachsen reicht dafür nicht aus. Wem das innere Korsett fehlt, Enge und Nähe zu ertragen oder gar zu genießen, muss hinaus in die Welt. Trier als kleine Bezirkshauptstadt mit damals rund zwölftausend, heute fast zehnmal so vielen Einwohnern war und ist so ein Ort, wo zwar nicht jeder jeden kennt, aber viele über viele Bescheid wissen.
Sollte es eine »allpfiffige Vorsehung«1 geben, wie Marx sie im Kapital beschreibt, dann hat sie ihm den Auftrag in die Wiege gelegt, nach dem Schlüpfen und Flüggewerden mit dem elterlichen Nest auch die heimatlichen Gefilde hinter sich zu lassen. Jeder, dem es ähnlich ergangen ist, kennt diesen unwiderstehlichen Drang. Da draußen wartet eine ganze Welt.
»Die Geschichte nennt diejenigen als die größten Männer, die, indem sie für das Allgemeine wirkten, sich selbst veredelten«, schreibt er in seiner Abiturarbeit im Fach Deutsch, »die Erfahrung preißt den als den Glücklichsten, der die meisten glücklich gemacht; die Religion selber lehrt uns, daß das Ideal, dem alle nachstreben, sich für die Menschheit geopfert habe und wer wagte solche Aussprüche zu vernichten?«2 Mit siebzehn hat man noch Träume.
Als Marx diese Zeilen am 12. August 1835 hinter den altehrwürdigen Mauern des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums zu Papier bringt, ist er am Punkt angelangt, wo die Provinz einem Heranwachsenden zu klein werden und als Zwangsjacke erscheinen kann. Das spricht nicht gegen die Provinz, im Gegenteil. Als prägende Umgebung hat sie dem Jungspund unersetzliche Dienste geleistet. Im Lichte dessen, was aus Marx geworden ist, lässt sich die Moselstadt sogar als geradezu idealer Ort für sein Heranreifen begreifen.
Das liegt besonders an der Lage der Kreisstadt. Weiter entfernt vom Königssitz Berlin kann ein Preuße nicht leben. Und wie bei allen Rheinländern nimmt mit der geografischen auch die mentale Distanz zum Machtzentrum des Staates zu.
Zwei Jahrzehnte, von 1794 bis 1813, steht der linke Niederrhein mit Trier im äußersten Westen unter französischer Besatzung. Statt aber nur unter dem Joch der Fremdherrschaft zu leiden, genießen die Bürger der Stadt die Früchte der Französischen Revolution – von der Abschaffung ständischer Privilegien über die Säkularisierung geistlichen Besitzes bis zur Emanzipation der Juden. Der Code civil – das moderne Napoleonische Zivilrecht von 1804 – bleibt dem Rheinland auch erhalten, nachdem es beim Wiener Kongress 1815 Preußen zugeschlagen wird.
Ansonsten beschert die »Verpreußung« der Moselregion mehr Rück- als Fortschritt. Die wirtschaftlich schlechte Lage von Stadt und Land, besonders bei den notleidenden Winzern, seit der Weinexport nach Westen weggefallen ist, bestimmt das soziale und politische Klima. Die Armut ist nicht zu übersehen, der Protest dagegen kaum zu überhören, das Aufbegehren gegen die preußischen Herren fast so etwas wie ein Lebensgefühl. Aufmüpfigkeit und Widerstandsgeist reichen bis in die Spitze der städtischen Gesellschaft.
Anlässlich des Umsturzes 1830 in Paris legen Trierer Buchhändler selbstbewusst Literatur über die Aufstände in ihre Schaufenster. »Hätten wir die französische Julirevolution nicht erlebt«, erklärt ein Kollege von Marx’ Vater, »so müssten wir jetzt Gras fressen wie das Vieh.« Etliche Moselwinzer finden sich Ende Mai 1832 unter den zwanzig- bis dreißigtausend oppositionellen Bürgern, die am Hambacher Schloss gegen Restauration für Freiheit, nationale Einheit und Demokratie demonstrieren. Nach einem Polizeibericht aus demselben Jahr hoffen die Trierer heimlich darauf, die Franzosen würden sie von den Preußen befreien.
Marx’ Geburtshaus liegt in der Brückenstraße. Die Hausnummer 10 erkennt man an Asiaten mit Kamera und Selbstauslöserstange, die sich vor dem Eingang ablichten. Chinesen stellen die größte ausländische Gruppe unter den mehr als vierzigtausend Gästen pro Jahr. Für sie gehört der Abstecher zum Pflichtprogramm ihrer Deutschlandtour. Wenigstens einmal wollen sie das Gemäuer betreten, in dem Karl Heinrich Marx am 5. Mai 1818 um zwei Uhr morgens den ersten Schrei ins Leben getan hat – jener weise Mann, auf dessen Werk sich ihre kommunistische Führung bis heute beruft.
Die Immobilie befindet sich im Besitz der Friedrich-Ebert-Stiftung und somit der SPD. Jener Traditionspartei also, die ihrem einstigen Vordenker 1959 mit dem Godesberger Programm endgültig abgeschworen hat. Aus diesem schwierigen Verhältnis ergibt sich ein merkwürdig verklemmter Umgang mit dem Mann, dem das »Karl-Marx-Haus« gewidmet ist: Leben und Werk des Geistesmächtigen werden weniger gefeiert als dargestellt wie das irgendeines Denkers des 19. Jahrhunderts mit mächtigem, auch schädlichem Einfluss auf das nachfolgende.
Immerhin haben sie in ihren Archiven ein Zitat des größten Sozialdemokraten der jüngeren Zeit aus dem Jahre 1977 ausgegraben: »Was immer man aus Marx gemacht hat«, so begrüßt der damalige SPD-Vorsitzende und vormalige Kult-Kanzler Willy Brandt die Besucher, »das Streben nach Freiheit, nach Befreiung der Menschen aus Knechtschaft und unwürdiger Abhängigkeit, war Motiv seines Handelns.«
Den Chinesen sagen Willy und Sozen wenig. Wie andere Gäste nehmen sie das Bild einer angemieteten Kleinbürgerbehausung an einer schmalen Straße und die falsche Vorstellung mit, ihr Held könnte hier aufgewachsen sein. Der verwinkelte Bau mit lauschigem Innenhof und hübschem Garten gehört zu den seltsamen Sehenswürdigkeiten, die Besuchern neben der Dauerausstellung – sie könnte auch an jedem anderen Ort aufgebaut sein – nur wenig zu sagen haben. Der kleine Karl hat ihn in den fünfzehn Monaten, die er dort gelebt hat, ganz sicher nicht bewusst wahrgenommen.
Dagegen nimmt sich das Haus an der Simeongasse (heute Simeonstraße), Domizil zwischen zweitem und achtzehntem Lebensjahr, deutlich bescheidener aus. Aber es ist im Eigentum der Familie und liegt nahe am Puls des städtischen Treibens. Die Marxens gehören zu den oberen fünf Prozent der Gesellschaft. Sie sind zwar nicht reich, aber wohlhabend genug, es dem Jungen und seinen Geschwistern an nichts fehlen zu lassen. Seine Unfähigkeit im Umgang mit Geld nach Verlassen des Elternhauses lässt vermuten, dass er dort als verwöhntes Kind Verantwortung in finanziellen Dingen niemals gelernt hat – überbehütet und vernachlässigt in einem.
Das sorglose, unbeschwerte Leben der ersten Jahre spielt sich in der unvergleichlichen historischen Umgebung der ältesten Stadt Deutschlands ab. Die Spuren der Römerzeit, noch heute zu besichtigen, mit Thermen, Amphitheater und Basilika, machen es schwer, nicht ein gewisses Maß an Geschichtsbewusstsein zu entwickeln. Vor allem, wenn man wie Karl in unmittelbarer Nähe zur fast zweitausend Jahre alten Porta Nigra aufwächst. Das Nordtor der römischen Augustusstadt und heutige Wahrzeichen von Trier kann er nicht übersehen, wenn er daheim aus dem Fenster schaut oder das Haus verlässt.
Eine bescheidene Hinweistafel auf der Fassade ist alles, was den Kameras der Gäste geboten wird. Im Erdgeschoss bietet ein »Euroshop« seine Billigstwaren an, die meisten aus China. Trash as trash can mit Gruß an den ersten Kapitalismuskritiker und größten Sohn der Stadt. Hegel hat für so was seinen Begriff von der Ironie der Geschichte geprägt.
Noch trostloser stellt sich die Erinnerungskultur bei dem trüben Straßenzug dar, den die Trierer nach ihrem berühmtesten Bürger benannt haben. Wer von der Römerbrücke die enge, baumlose Karl-Marx-Straße Richtung Innenstadt geht, durchquert eine Art Rotlichtbezirk im Kleinformat mit Nachtclubs, Tabledance- und Shishabars, Friseur- und Waschsalon und jeder Menge »Zu-vermieten«-Schilder in den Schaufenstern.
Ein Versuch der Trierer Sozialdemokraten, dem Missverhältnis ein Ende zu bereiten, die Brückengasse in Karl-Marx-Straße umzutaufen oder einen Namenstausch zwischen beiden vorzunehmen, scheitert Anfang 2017 im Bauausschuss der Stadt – zum zweiten Mal nach 1945. Die Absage verrät manches über das gespaltene Verhältnis der Einwohner zum einzigen Ex-Mitbürger von Weltruf.
Noch krasser treten die Gegensätze zutage, als die Volksrepublik China der Stadt zum Marx-Jahr 2018 eine Statue ihres kommunistischen Säulenheiligen schenken will. Widerstand regt sich, verschärft durch die schieren Ausmaße der Skulptur: Mitsamt Sockel soll sie fast sechs Meter messen.





























