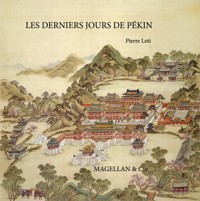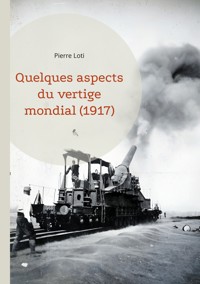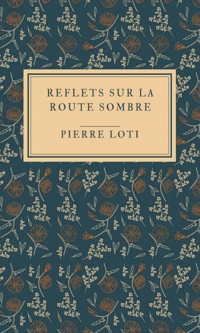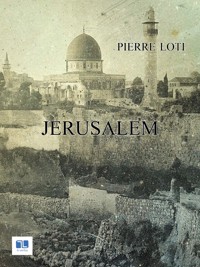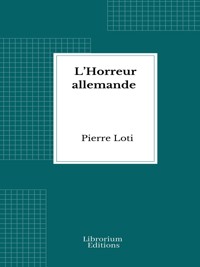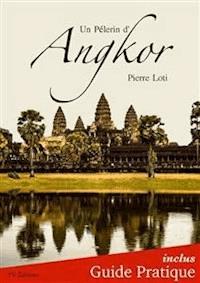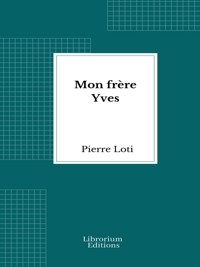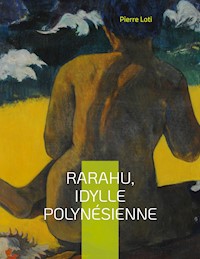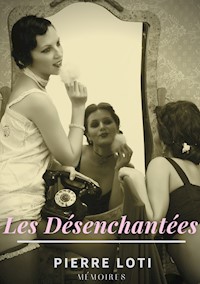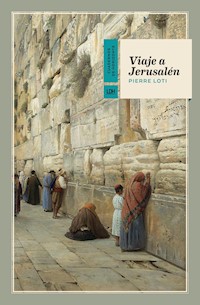13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Männerschwarm Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bibliothek rosa Winkel
- Sprache: Deutsch
Als Angehöriger der französischen Kriegsmarine lernte Julien Viaud Weltmeere und Kontinente kennen, als Pierre Loti formte er aus seinen Erlebnissen eine Fülle von Romanen und Reiseberichten, die den Leser nach Konstantinopel, Palästina, Marokko und bis nach Japan und China führen. In seinem frühen Roman Mein Bruder Yves (1883) geht es um ferne Länder nur am Rande; im Zentrum steht das Leben auf dem Schiff und die besondere Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler und Yves Kermadec, dem »geschicktesten, seetüchtigsten Mann« an Bord, der jedoch an Land dem Teufel Alkohol nicht entrinnen kann. Seine Schönheit – er ist »groß, schlank wie eine Antike, mit muskulösen Armen, dem Hals und den Schultern eines Athleten« – fasziniert den Erzähler. Er sieht es als seine Aufgabe an, Yves vor seiner eigenen Zügellosigkeit zu schützen, hat dies auch Yves' Mutter versprochen. Der autobiografische Hintergrund des Romans ist besonders deutlich. Die beiden fast gleichaltrigen, aber vom Temperament und von der sozialen Stellung her ungleichen Männer verband eine lebenslange Freundschaft, von der diverse Notate, Briefe und Fotos Zeugnis ablegen; der auch zeichnerisch begabte Pierre Loti imaginierte seinen »Bruder« dabei auch als nackten keltischen Heroen in mythischer Landschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Pierre Loti
Mein Bruder Yves
Übersetzt von Robert Prölß
Nachwort von Wolfram Setz
Männerschwarm Verlag
Bibliothek rosa WinkelBand 77
Titel der Originalausgabe:Mon frère Yves(Calmann-Lévy, Éditeurs, Paris 1883)Die deutsche Übersetzung erschien 1901(Union Deutsche Verlagsanstalt,Stuttgart, Berlin, Leipzig)
Umschlagmotiv (von Jules Adler) aus:Romans complets illustrées de Pierre Loti(Paris 1923)
Umschlaggestaltung: Carsten Kudlik (Bremen)Frontispiz (Lucien Lévy-Dhurmer, Portrait de Pierre Loti)aus: Bruno Vercier (Hg.), Pierre Loti Portraits(Paris 2002)
© 2020 Männerschwarm VerlagSalzgeber Buchverlage GmbH, BerlinHerstellung: Strauss GmbH, MörlenbachISSN 0940–6247ISBN 978-3-86300-077-6eISBN 978-3-86300-099-8
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Kapitel XXXVI
Kapitel XXXVII
Kapitel XXXVIII
Kapitel XXXIX
Kapitel XL
Kapitel XLI
Kapitel XLII
Kapitel XLIII
Kapitel XLIV
Kapitel XLV
Kapitel XLVI
Kapitel XLVII
Kapitel XLVIII
Kapitel XLIX
Kapitel L
Kapitel LI
Kapitel LII
Kapitel LIII
Kapitel LIV
Kapitel LV
Kapitel LVI
Kapitel LVII
Kapitel LVIII
Kapitel LIX
Kapitel LX
Kapitel LXI
Kapitel LXII
Kapitel LXIII
Kapitel LXIV
Kapitel LXV
Kapitel LXVI
Kapitel LXVII
Kapitel LXVIII
Kapitel LXIX
Kapitel LXX
Kapitel LXXI
Kapitel LXXII
Kapitel LXXIII
Kapitel LXXIV
Kapitel LXXV
Kapitel LXXVI
Kapitel LXXVII
Kapitel LXXVIII
Kapitel LXXIX
Kapitel LXXX
Kapitel LXXXI
Kapitel LXXXII
Kapitel LXXXIII
Kapitel LXXXIV
Kapitel LXXXV
Kapitel LXXXVI
Kapitel LXXXVII
Kapitel LXXXVIII
Kapitel LXXXIX
Kapitel XC
Kapitel XCI
Kapitel XCII
Kapitel XCIII
Kapitel XCIV
Kapitel XCV
Kapitel XCVI
Kapitel XCVII
Kapitel XCVIII
Kapitel XCIX
Kapitel C
Kapitel CI
Kapitel CII
Nachwort
Pierre Le Cor (Yves Kermadec), gezeichnet von Julien Viaud (Pierre Loti)
I
Das Führungsbuch meines Bruders Yves gleicht allen anderen Büchern anderer Seeleute. Es hat einen Umschlag von gelbem, pergamentartigem Papier, und da es in verschiedenen Schiffskasten viel auf dem Meere herumgereist ist, sieht es schlecht genug aus. Mit großen Buchstaben steht auf dem Umschlag:
KERMADEC, 2091. P.
Kermadec ist sein Familienname, 2091 seine Nummer in der Marine und P. der Anfangsbuchstabe seines Gestellungsortes: Paimpol.
Schlägt man es auf, so findet man auf der ersten Seite folgende Angaben:
Kermadec (Yves-Marie), Sohn des Yves-Marie und der Jeanne Danveoch. Geboren am 28. August 1851 in Saint-Pol-de-Léon (Finistère). Größe 1 m 80. Haare kastanienbraun, Augenbrauen kastanienbraun, Augen gelblichgrau, Nase mittel, Kinn gewöhnlich, Stirn gewöhnlich, Gesicht oval.
Besondere Kennzeichen: Die linke Brust zeigt die Tätowierung eines Ankers, das rechte Handgelenk die eines Armbands mit einem Fisch.
Diese Tätowierungen waren vor etwa zehn Jahren unter den echten Seeleuten noch Mode. An Bord der »Flore« von der Hand eines dienstfreien Kameraden ausgeführt, sind sie für Yves zu einem Gegenstande der Verzweiflung geworden, und mehr als einmal schon hatte er sich vergeblich abgequält, sich von ihnen zu befreien. Der Gedanke, auf eine unvertilgbare Weise gezeichnet zu sein und immer und überall an diesen kleinen blauen Bildern erkannt zu werden, war ihm unerträglich.
Blättert man weiter, so findet man eine Reihe bedruckter Seiten, welche kurz und bestimmt die Vergehen aufzählen, die unter Matrosen üblich sind, mit den darauf stehenden Strafen – von den leichtesten Übertretungen an, die mit ein paar in Eisen verbrachten Nächten bestraft werden, bis zu den schweren Widersetzlichkeiten, auf denen Todesstrafe steht.
Leider hat die tägliche Lektüre dieser Strafbestimmungen nicht genügt, unserem Freunde Yves, wie allen übrigen Seeleuten auch, den beabsichtigten heilsamen Schrecken einzuflößen.
Es folgen sodann einige beschriebene Seiten, welche die Namen von Schiffen, mit blauen Siegeln, den Zeichen und Zeitangaben enthalten. Die Schiffsschreiber, Leute von Geschmack, haben diesen Teil mit eleganten Namenszügen geschmückt. Hier stehen seine Seefahrten verzeichnet und die Löhne, die er dafür erhalten hat.
Zuerst kamen Jahre, in denen er fünfzehn Franken monatlich bezog, von welchen er zehn für seine Mutter zurücklegte; Jahre, die er, die Brust den Winden preisgegeben, halbnackt, hoch oben auf den großen, schwankenden Masten verbrachte und sorglos die wechselvolle Wüste des Meeres durchirrte; hierauf kamen bewegtere Jahre, in denen die Liebe erwachte und Gestalt in der noch jungfräulichen, naturwüchsigen Seele gewann, um sich bald in Träumen naiver Unschuld, bald in den brutalsten Ausschweifungen zu entladen, je nach dem Ort, an den der Wind ihn gerade hintrieb, und je nach den Frauen, die ihm der Zufall in die Arme warf; furchtbares Erwachen, mächtiger Aufruhr des Herzens und der Sinne, denen die Rückkehr zu dem enthaltsamen Leben des weiten Meeres, zu der Abgeschlossenheit des fliegenden Klosters folgte. Dies alles ist hinter diesen Zahlen, Namen und Zeitangaben verborgen, die sich von Jahr zu Jahr in dem armseligen Führungsbuch eines Seemannes anhäufen. Ein ganzes, großes, fremdartiges Gedicht von Abenteuern und Elend ist in diesen vergilbten Blättern enthalten.
II
Der 28. August 1851 war, wie es scheint, zu Saint-Pol-de-Léon in Finistère ein schöner Sommertag.
Die bleiche Sonne der Bretagne lächelte festlich auf den kleinen neuen Ankömmling herab, der einst die Sonne und die Bretagne so lieb gewinnen sollte.
Yves trat in die Welt in Gestalt eines großen, ganz runden und ganz braunen Kindes. Die bei seiner Ankunft gegenwärtigen Frauen nannten ihn Bugel-du, was in unsrer Sprache soviel wie kleiner schwarzer Kerl heißt. Es war übrigens die Familienfarbe, dieses Bronzebraun, da die Kermadecs seit langem von Vater auf Sohn Seeleute und dem Sonnenbrand des Meeres ausgesetzt waren.
Ein schöner Sommertag zu Saint-Pol-de-Léon ist eine seltene Sache in diesem Landstrich der dicken Nebel. Eine Art schwermütigen Glanzes ist dann über alles gebreitet; die alte, mittelalterliche Stadt wie aus ihrem tiefen Nebelschlafe geweckt und verjüngt; der alte Granit erwärmt sich dann an der Sonne; der Glockenturm Creizker, der Riese der bretonischen Glockentürme, badet im vollen Lichte des blauen Himmels seine feinen, grauen, von gelben Flechten durchäderten Ausschnitte. Und ringsumher haucht die wilde Heide mit ihrem rötlichen Heidekraut und ihrem goldgelben Ginster einen zarten Blütenduft aus.
Bei der Taufe nahm ein junges Mädchen und ein Matrose Patenstelle ein und hinter ihnen reichten die beiden kleinen Brüder, Goulven und Gildas, ihren beiden kleinen Schwestern, Yvonne und Marie, mit Blumensträußen die Hand.
Als der Zug in die alte Kirche der Bischöfe von Léon trat, hielt der an dem Glockenstrange hängende Küster sich schon bereit, mit dem fröhlichen Glockenspiel, wie es die Veranlassung forderte, zu beginnen. Der herzutretende Pfarrherr rief ihm jedoch mit harter Stimme zu: »Verhalte dich um Gottes willen ruhig, Marie Bervrac’h! Diese Kermadecs sind Leute, die der Kirche nie ein Opfer spenden. Und der Vater trägt alles ins Wirtshaus. Für diese Sorte Menschen haben wir unser Geläute nicht, verstehst du!«
Und so kam es, daß mein Bruder Yves seinen Einzug auf dieser Erde wie ein Gemeindearmer hielt.
Jeanne Danveoch horchte von ihrem Bette mit Unruhe auf und lauerte mit schlimmem Vorgefühl auf die ehernen Schwingungen, die immer noch ausblieben. Sie horchte lange und hörte nichts, sie begriff diese öffentliche Beschimpfung und weinte.
Ihre Augen waren ganz in Tränen gebadet, als die Taufgesellschaft betreten heimkehrte.
Diese Demütigung bedrückte Yves lebenslang das Herz; er vermochte den schlechten Empfang, den man ihm beim Eintritt in die Welt bereitet hatte, nie zu vergeben, noch die grausamen Tränen, die seine Mutter darüber vergoß; er trug der römischen Geistlichkeit deshalb einen unvergeßlichen Groll nach und verschloß unserer Mutter Kirche sein bretonisches Herz.
III
Vierundzwanzig Jahre später, an einem Dezembertag in Brest.
Der Regen fiel fein, kalt, durchdringend und ununterbrochen; er rieselte über die Mauern, indem er die hohen Schieferdächer, die hohen Granithäuser noch schwärzer färbte und wie zum Vergnügen sich auf die lärmende Menge des Sonntags ergoß, die nichtsdestoweniger, durchnäßt und beschmutzt, sich in der traurigen grauen Dämmerung durch die engen Straßen drängte.
Diese Menge bestand aus betrunkenen Matrosen, die sangen, aus Soldaten, die, über ihre Säbel stolpernd, einen klirrenden Lärm machten, dazwischen drängten sich Leute aus dem Volke – Arbeiter der großen Stadt, mit abgespannten, bleichen Gesichtern, Weiber in kleinen wollenen Shawls und spitzen Musselinhauben, mit brennenden Blicken und hochgeröteten Wangen, einen Branntweingeruch um sich her verbreitend, greise Männer und Frauen, im Zustand ekler Trunkenheit, die, nachdem sie gefallen waren, und sich wieder aufgerafft hatten, kotbedeckt weiter taumelten.
Der Regen fiel und fiel, alles durchnässend, die bretonischen Hüte mit Silberschnallen, die übers Ohr gezogenen Mützen der Matrosen, die betreßten Tschakos, die weißen Hauben und Regenschirme.
Die Luft war so trübe und lichtlos, daß man sich nicht vorstellen konnte, es gäbe irgendwo eine Sonne. Man hatte das Bewußtsein davon ganz verloren. Man fühlte sich wie gefangen in den Niederschlägen und dem Dunste der großen feuchten Wolken, die alles überströmten; es schien kaum möglich, daß sie sich je wieder teilten und sich ein Himmel dahinter befände. Man atmete Wasser. Man wußte nicht mehr, welche Zeit am Tage es wäre, und ob diese Dunkelheit nur vom Regen herrührte oder die wirkliche Winternacht schon hereingebrochen sei.
Die Matrosen brachten mit ihren offenen Gesichtern und ihren Gesängen, mit ihren großen hellen Kragen und ihren roten, vom Marineblau ihres Anzugs scharf abstechenden Litzen einen Ton übermütiger Jugend und Fröhlichkeit in diese Gassen hinein. Sie gingen und kamen von Schenke zu Schenke, alles beiseite stoßend und von unsinnigen Dingen schwatzend, über die sie unbändig lachten. Oder sie stellten sich wohl auch unter den Dachrinnen vor die Schaufenster aller der Läden, wo Sachen, wie sie sie gebrauchten, verkauft wurden: rote Tücher, die in der Mitte mit schönen Schiffen bedruckt waren, welche den Namen »La Bretagne«, »La Triomphante« oder »La Dévastation« führten; Bänder für ihre Mützen mit schönen goldenen Inschriften; kleine, kunstvoll verschlungene Seilerarbeiten, womit sie die Leinwandsäcke zu verschließen pflegten, in denen sie ihre geringe Habe an Bord bewahrten; elegante Knüpfarbeiten aus gedrehten Schnüren, an denen die Marsgasten sich ihre großen Messer um den Hals hängen; silberne Pfeifchen für die Bootsmaaten, und endlich rote Gürtel, kleine Kämme und Spiegel.
Von Zeit zu Zeit kamen heftige Windstöße, welche die Mützen mit in die Luft nahmen und die Betrunkenen ins Schwanken brachten, und der Regen fiel dann noch dichter und rascher und peitschte wie Hagel.
Die Zahl der Matrosen wuchs immer mehr. Man sah sie truppweise in die Siamstraße strömen; sie kamen vom Hafen und aus der unteren Stadt die großen Granittreppen herauf und verbreiteten sich singend in den Gassen.
Die von der Reede kamen, waren noch nässer, als die andern, noch mehr vom Regen und Seewasser übergossen. Ihre kleinen Segelboote, von den kalten Windstößen ganz auf die Seite gelegt, hatten sie, auf den schaumbedeckten Wellen dahinspringend, im Fluge nach dem Hafen gebracht. Und sie stiegen lustig die in die Stadt führenden Treppen hinauf, während sie sich wie begossene Katzen schüttelten.
Der Wind stürzte in die langen grauen Gassen herein und kündigte eine böse Nacht an.
Auf der Reede – an Bord eines am Morgen von Amerika angekommenen Schiffs – hatte mit dem Glockenschlag vier ein Bootsmann das Zeichen mit einem langen, schrillen Pfiff gegeben, dem kunstvolle Triller folgten, was in der Seesprache hieß: »Die Schaluppe bereit!« Worauf ein Freudengemurmel durch das Schiff ging, auf dem die Matrosen wegen des Regens unter der Kuhbrücke zusammengepfercht standen. Man hatte nämlich eine Zeitlang gefürchtet, daß das Meer zu hoch ginge, um nach Brest gelangen zu können, und man wartete mit Ungeduld auf das Zeichen, das die Frage entschied. Nach einer Fahrt von drei Jahren sollte man zum erstenmal wieder den Fuß auf französische Erde setzen, und die Ungeduld war daher groß.
Als die diensthabenden Männer alle in ihren kleinen Anzügen von strohgelbem Wachstuch die Schaluppe bestiegen und ihre Sitze in vorschriftsmäßiger und symmetrischer Anordnung auf den Bänken eingenommen hatten, pfiff derselbe Bootsmann aufs neue und rief: »Die Beurlaubten zum Appell!«
Der Sturm und das Meer brausten, die Reede war ganz in einen weißlichen Nebel gehüllt, in dem der Regen mit dem aufspritzenden Wasser der Wellen zusammenfloß.
Die beurlaubten Matrosen kamen eiligst aus ihren Luken hervor und stellten sich auf Deck der Reihe nach, wie man sie bei ihrer Nummer und ihrem Namen gerufen hatte, auf, die Gesichter glühend vor Freude, Brest wiederzusehen. Sie hatten ihre schönen Sonntagskleider angelegt und gaben unter strömendem Regen ihrer Toilette noch den letzten Schliff, sich einander mit einer Art von Koketterie dabei helfend.
Als man »218 Kermadec!« rief, trat Yves in ernster Haltung hervor, ein großer Bursche von vierundzwanzig Jahren, den sein gestreifter Anzug mit dem breiten blauen Kragen gut kleidete.
Groß, schlank wie eine Antike, mit muskulösen Armen, dem Hals und den Schultern eines Athleten, machte seine Erscheinung im ganzen den Eindruck stiller, doch selbstbewußter Kraft. Das Gesicht zeigte unter einer gleichmäßig vom Wetter gebräunten Hautfarbe etwas unerklärbar Bretonisches mit einem Anfluge von arabischem Teint. Seine Rede mit dem Accente von Finistère war kurz; die tiefe Stimme vibrierte auf eine ganz eigentümliche Weise, wie Instrumente von mächtigem Klang, die man kaum zu berühren wagt, aus Furcht vor dem Lärm, den sie machen. Die gelblichgrauen Augen standen etwas eng aneinander und lagen ziemlich tief unter den geschwungenen Brauen mit einem unveränderlichen Ausdruck des nach innen gerichteten Blicks; die Nase war sehr fein und regelmäßig, die untere Lippe stand, wie mit einem Ausdruck von Verachtung, etwas vor.
Sein Gesicht war unbeweglich, wie von Marmor, ausgenommen in den seltenen Augenblicken, da ein Lächeln erschien. Dann veränderte sich alles und man bemerkte, daß Yves sehr jung war. Das Lächeln derer, welche gelitten haben, ist von kindlicher Sanftheit und durchleuchtet die harten Züge, fast wie die Strahlen der Sonne, die gelegentlich auf die bretonischen Klippen fallen.
Als Yves erschien, sahen ihn die anderen Seeleute, die zugegen waren, mit wohlwollendem Lächeln und einem ungewohnten Grade von Achtung an.
Es war, weil er zum erstenmal auf seinem Ärmel die doppelten roten Streifen der Bootsmaaten trug, die man ihm eben verliehen hatte. Und an Bord hat ein Maat des Takelwerks etwas zu bedeuten. Diese armseligen wollenen Streifen, die in der Landarmee so schnell an den ersten besten erteilt werden, stellen in der Marine lange Jahre des Elends dar, die Kraft und das Leben junger Männer, die sie zu jeder Stunde des Tages und der Nacht, dort oben im Mastwerk, diesem Reich der Marsgasten, von allen Winden des Himmels geschüttelt, verbrauchen. Der Oberbootsmann, der sich genähert hatte, reichte Yves die Hand. Er war ja auch einst ein Marsgast bei harter Arbeit gewesen, und wußte, was starke, mutige Männer bedeuten.
»Nun, Kermadec«, sagte er, »werden jetzt diese Streifen begossen werden?«
»Gewiß«, erwiderte Yves mit tiefer Stimme, ohne sein ernstes, träumerisches Wesen zu verändern.
Es war aber nicht das Wasser der Wolken, von dem der alte Seemann sprach, denn, was dieses betraf, so war das Begießen ja sicher. Nein, in der Schiffssprache versteht man unter dem Begießen der Abzeichen, sich ihnen zu Ehren den ersten Tag, an dem man sie trägt, einen Rausch zu holen.
Die Notwendigkeit dieser Feier hatte Yves nachdenklich gemacht, weil er mir nur eben erst das heilige Versprechen abgelegt hatte, sich nie wieder zu betrinken, und er dieses Versprechen auch zu halten wünschte.
Und dann hatte er nachgerade auch diese Schenkscenen satt, die sich in allen Teilen der Welt wiederholten. Sich während der Nächte an der Spitze der unbändigsten Trunkenbolde in allen schmutzigen Löchern herumzutreiben und sich des Morgens von den Rinnsteinen auflesen zu lassen – ist ein Vergnügen, dessen man, so sehr man Matrose ist, doch endlich müde wird. Auch ist der folgende Tag immer scheußlich und sie gleichen sich alle. Das wußte Yves recht gut und wollte davon nichts mehr wissen.
Es war sehr finster, dieses Dezemberwetter, für einen Tag der Heimkehr. So sorglos und jung man auch war, so warf dieses Wetter doch auf die Freude der Rückkunft eine Art schwarzer Nacht. Yves empfand diesen Eindruck, der ihm unwillkürlich ein trauriges Staunen verursachte; denn dieses alles war doch schließlich seine Bretagne. Er fühlte sie in der Luft und erkannte sie selbst noch an dieser traumhaften Dunkelheit.
Die Schaluppe stieß ab und trug alle ans Land. Ganz vom Westwinde zur Seite gelegt, fuhr sie dahin, von Welle sprang sie zu Welle mit dem hohlen Ton einer Trommel, und bei jedem Sprung, den sie machte, stürzte eine Masse Seewasser über sie hin, wie von wütenden Händen geworfen.
Sie fuhren sehr rasch in einer Art Wasserwolke, deren große salzige Tropfen ihnen ins Gesicht peitschten. Sie hielten dieser Sintflut mit gesenkten Köpfen stand, einer eng an den andern gedrückt, wie die Schafe es beim Gewitter tun.
Keiner sprach ein Wort, obschon sie ganz von der Erwartung der Vergnügungen erfüllt waren. Es gab junge Leute darunter, welche seit einem Jahre den Fuß nicht mehr ans Land gesetzt hatten; ihre Taschen waren ohne Ausnahme mit Gold gefüllt und heiße Begierden kochten in ihrem Blute.
Auch Yves dachte ein wenig an jene Weiber, die in Brest ihrer warteten und unter denen man nur zu wählen brauchte. Doch gleichviel, er allein war traurig. Noch niemals hatten so viele Gedanken auf einmal den Kopf dieses armen Verlassenen bestürmt.
Schon manchmal hatte er wohl in der Stille der Meernächte solche schwermütige Anwandlungen gehabt, dann aber war ihm die Heimkehr von dort unten immer in goldigen Farben erschienen. Und jetzt war diese Heimkehr doch da, und sein Herz zog sich im Gegenteil mehr als jemals zusammen. Das begriff er nun nicht, da er wie die Einfältigen und Kinder gewöhnt war, die Eindrücke hinzunehmen, ohne sie sich zu erklären.
Den Kopf gegen den Sturm gewendet, unbekümmert um das Wasser, das auf seinen blauen Kragen niederströmte, stand er da, nur von der Gruppe Matrosen, die ihn umdrängten, aufrecht gehalten.
Die ganze Küste um Brest, die man in ungewissen Umrissen durch die Schleier des Regens erblickte, sandte ihm Erinnerungen seiner Schiffsjungenjahre herüber, die er auf dieser großen, nebelreichen Reede in Sehnsucht nach der Mutter verbracht hatte. Wie hart war diese Vergangenheit, und jetzt, das erste Mal seit er lebte, dachte er auch an das, was die Zukunft wohl bringen würde.
Die Mutter! Wohl war es wahr, daß er ihr seit bald zwei Jahren nicht mehr geschrieben hatte. Allein die Matrosen machen es so, und trotz allem lieben sie sie doch so sehr, ihre Mutter! Das macht die Gewohnheit, man verschwindet für Jahre, und dann, eines glücklichen Tags, kommt man unangemeldet mit Litzen am Ärmel zurück, mit vielem sauer verdientem Geld, Freude und Wohlstand in der armen, einsamen Wohnung verbreitend.
Sie fuhren noch immer in dem eisigen Regen, auf den grauen Wellen einherspringend, verfolgt von dem Pfeifen des Windes und dem wilden Brausen des Wassers.
Yves dachte an viele Dinge, und seine starrenden Augen unterschieden nichts mehr. Das Bild seiner Mutter hatte plötzlich eine unendliche Sanftheit gewonnen; er fühlte sie so nah, in jenem kleinen bretonischen Dorfe, in derselben winterlichen Dämmerung, die auch ihn umfing; noch zwei oder drei Tage und mit welcher Freude würde er sie überraschen und umarmen können!
Die Stöße des Meeres, die schnelle Fahrt und der Wind verhinderten den stetigen Gang seiner Gedanken, die hin und her sprangen. Nun empfand er wieder peinlich, seine Heimat bei so trübem Wetter wiederzusehen. Da unten hatte er sich an die Hitze und die blaue Klarheit der tropischen Gegenden gewöhnt, und hier schien es ihm, als ob ein Leichentuch finstere Nacht über die Erde würfe.
Und dann bestärkte er sich in seinem Vorsatz, nicht mehr zu trinken; nicht, daß es gerade etwas Böses wäre – sei es doch die Gewohnheit aller bretonischen Seeleute! – aber er hatte es ernstlich versprochen – und dann ist man mit vierundzwanzig Jahren doch ein erwachsener Bursche, man ist von manchen Dummheiten zurückgekommen, man fühlt, wie es scheint, das Bedürfnis, etwas gesetzter zu werden.
Er stellte sich dann die erstaunten Mienen der anderen an Bord, besonders seines großen Freundes Barrada, vor, wenn sie ihn morgen früh aufrecht und gerade zurückkommen sähen. Bei dieser drolligen Vorstellung sah man plötzlich über sein männliches, strenges Gesicht ein kindliches Lächeln gleiten.
Sie waren jetzt fast beim Schlosse von Brest angekommen, und unter dem Schutze der ungeheuren Granitmassen wurde es jählings ruhig. Die Schaluppe tanzte nicht mehr, sie fuhr still unter dem Regen hin; die Segel wurden eingezogen und die Männer im gelben Wachstuch fuhren nun mit den taktmäßigen Schlägen ihrer großen Ruder weiter.
Vor ihnen öffnete sich die tiefe, schwarze Bucht, die den Kriegshafen bildet. Auf den Quais standen Reihen von Geschützen und andere zum Seedienst gehörige Dinge von furchtbarem Aussehen. Man sah nichts als endlose Baulichkeiten von Granit, die, alle einander gleich, das schwarze Wasser überragten und sich übereinander auftürmten mit ihren regelmäßigen Reihen von kleinen Türen und Fenstern. Darüber zeigten noch die ersten Häuser von Brest und von Recouvrance ihre feuchten Dächer, aus denen kleine weiße Rauchwolken hervorbrachen; man sah ihnen ihr kaltes, feuchtes Elend an, und der Wind drang überall mit traurigem Sausen dazwischen.
Die Nacht brach nun völlig herein und die kleinen Gasflammen fingen an, ihre gelben Brillanten auf die grauen Steinmassen zu heften. Die Matrosen hörten bereits das Rollen der Wagen und den Lärm der Stadt, der ihnen von oben, über das leerstehende Arsenal, mit dem Gesang der Betrunkenen entgegenkam.
Yves hatte aus Klugheit an Bord seinem Freunde Barrada alles Geld, das er für seine Mutter bestimmt hatte, anvertraut, und nur fünfzig Franken für die Nacht in der Tasche behalten.
IV
»Und mein Mann, Madame Quéméneur, schläft ebenfalls, die ganze Zeit über, wenn er betrunken ist.«
»Sie machen sich also mit auf den Weg, Madame Kervella?«
»Ich erwarte ja doch auch meinen Mann, der heute auf dem ›Catinat‹ angekommen ist!«
»Und der meine, Madame Kerdoncuff, als er von China zurückgekommen war, schlief zwei volle Tage durch. – Und ich hatte mich ebenfalls betrunken, Madame Kerdoncuff, ja! O, wie ich mich darüber geschämt habe! Und auch meine Tochter, sie fiel die Treppe herunter!«
Dieses Geschwätz in dem singenden, taktmäßigen Accent von Brest flog unter den alten, vom Winde umgestülpten Regenschirmen hin und her zwischen den Frauen in Waterproofumhängen und spitzigen Musselinhauben, die dort oben am Eingang der großen Granittreppen warteten.
Ihre Männer waren auf demselben Schiffe wie Yves zurückgekommen und sie hatten sich nun dort aufgestellt und standen, nachdem sie sich erst durch etwas Branntwein gestärkt, mit halb begehrlichem, halb gerührtem Blick auf der Wacht.
Die alten Seeleute, die sie erwarteten, waren vielleicht vor Jahren recht tüchtige Marsgasten bei harter Arbeit gewesen; der Aufenthalt in Brest und die Trunksucht hatten sie aber verdorben, so daß sie diese Geschöpfe geheiratet hatten und in den Schmutz der untersten Schichten herabgesunken waren.
Hinter diesen Weibern standen aber noch andere Gruppen, auf denen der Blick um so lieber verweilte: junge Frauen von anständigem Wesen, echte Seemannsfrauen; die, sich in der Freude des Wiedersehens ihres Bräutigams oder ihres Mannes zurückhaltend, ängstlich hinab in den großen, gähnenden Schlund des Hafens blickten, aus dem die Ersehnten hervorsteigen sollten. Es gab Mütter darunter, die von den Dörfern hereingekommen waren, ihr schönes Festtagsgewand, die große Haube und das schwarztuchene, mit Seide gestickte Kleid, angelegt hatten; und doch verdirbt ihnen der Regen diese kostbaren Sachen, die man nicht zweimal im Leben erneut; man mußte dem Sohn aber Ehre machen, den man nun gleich vor den anderen umarmen sollte.
»Da kommen die Leute vom ›Magicien‹ in den Hafen, Madame Kerdoncuff.«
»Und nun auch die vom ›Catinat‹. Sie kommen gleich dahinter, Madame Quéméneur!«
An den schwarzen Quais, dort ganz hinten, legten die Boote an, und sie, die erwartet wurden, stiegen herauf.
Zuerst die Männer dieser schwatzenden Weiber, dem Alter zu Ehren, allen voran. Das Teerwasser, der Wind, die Sonnenglut, der Branntwein hatten ihre Gesichter wie die von Affen verzerrt. Und man geht Arm in Arm in der Richtung nach Recouvrance in eine der alten finstern Gassen mit den hohen Granithäusern, man steigt zu einem feuchten Zimmer empor, das nach den Gossen und dem Moder der Armen riecht, wo auf den Möbeln sich Muscheln im Staube herumtreiben und Flaschen und chinesischer Tand kunterbunt durcheinander stehen. Und dank dem in einer der Schenken da unten gekauften Schnaps, vergißt man die lange grausame Trennung und glaubt wieder jung, wie mit zwanzig Jahren zu sein.
Dann kommen die anderen, die jungen Männer, die von ihren Bräuten, Gattinnen oder ihren alten Müttern erwartet werden; – und endlich, je zu vieren, die Granitstufen heraufspringend, die ganze Bande der großen, wilden Burschen, die Yves zur Feier seiner Litzen führte.
Die, welche auf diese warteten, standen schon in der Siebenheiligengasse vor der Tür auf der Lauer. Frauen, die Haare ›à la chien‹ tief in die Augen gekämmt, mit vertrunkenen Stimmen, und abschreckenden Gebärden.
Ihnen fällt nun die Kraft, das verhaltene Feuer, das Geld dieser jungen Menschen zur Beute. Denn sie bezahlen gut, die Matrosen, am Tage der Heimkehr, und das, was sie geben, wird noch von dem überboten, was man ihnen stiehlt, wenn sie sich glücklich von Sinnen getrunken haben.
Die jungen Leute blickten ungewiß, wie verstört, vor sich hin, schon durch nichts als die Vorstellung berauscht, sich wieder auf festem Land zu befinden.
Wohin nun zuerst? Womit seine Freuden beginnen? Dieser Wind, dieser winterkalte Regen, dieses unheimliche Hereinbrechen der Nacht – das alles erhöht wohl für die, die ein Heim, einen Herd haben, die Freude der Rückkehr – jenen aber machte es nur das Bedürfnis fühlbar, irgendwo Schutz und Wärme zu suchen, sie hatten kein Heim, diese aus der Verbannung zurückkehrenden Armen.
Sie irrten zunächst, einer den anderen unter den Arm fassend, über alles lachend, wie losgelassene gefangene Tiere, im Zickzack herum.
Dann traten sie im Wirtshaus »A la descente des navires« bei Madame Creachcadec ein. Die »Descente des navires« war eine Winkelkneipe der Siamgasse.
Die heiße Luft roch hier nach Alkohol. In einem Korbe brannte ein Kohlenfeuer und Yves nahm davor Platz. Seit zwei oder drei Jahren saß er zum erstenmal wieder auf einem Stuhl. Und Feuer! Wie er sich an dem so ganz ungewohnten Wohlgefühl erlabte, sich an einem glühenden Kohlenfeuer trocknen zu können! An Bord ganz unmöglich! Selbst bei der großen Kälte am Kap Horn oder in Island, selbst in der durchdringenden, anhaltenden Nässe der hohen Breitengrade erwärmt man sich nie, trocknet man sich nie. Tage und Nächte lang bleibt man in den nassen Kleidern und sucht, sich bis zum Aufgang der Sonne Bewegung zu machen.
Es war eine wahre Matrosenmutter, diese Madame Creachcadec; alle, die sie kannten, mußten es zugeben. Und dann berechnete sie ihnen die Mahlzeiten und Gelage stets zum niedrigsten Preis.
Auch erkannte sie alle wieder. Da sie schon etwas Alkohol in ihrem großen, roten Kopf hatte, so versuchte sie ihre Namen so zu wiederholen, wie sie sie von ihnen untereinander gehört hatte; sie erinnerte sich recht gut, sie schon gesehen zu haben, da sie noch Bootsgasten an Bord der »Bretagne« gewesen waren; ja, sie glaubte sich ihrer selbst noch als Kinder, als Schiffsjungen auf dem »Inflexible«, zu erinnern. Wie groß und wie schön sie aber seitdem geworden waren! Wahrhaftig, man mußte ihr Auge haben, um sie so verändert noch wiederzuerkennen.
Und im Hintergrunde der Schenkstube kochte das Mittagessen im Ofen, das einen so leckeren Suppengeruch verbreitete.
Auf der Straße aber hörte man großen Lärm. Ein Trupp Matrosen kam an, aus vollem Halse auf eine lustige Melodie den Kirchentext singend: »Kyrie Christe, Dominum nostrum; Kyrie eleison . . .«
Sie traten, die Stühle umwerfend, herein, während ein heftiger Westwindstoß die Flammen der Lampen zu verlöschen drohte.
»Kyrie Christe, Dominum nostrum . . .« Die Bretonen liebten diese Art des Gesanges zwar nicht, der ohne Zweifel aus dem Hafen einer großen Stadt kam. Der Widerspruch zwischen den Worten und der Musik aber erschien ihnen drollig, und sie lachten darüber.
Übrigens waren es Leute, die von der »Gauloise« kamen. Da gab es ein lärmendes Wiedererkennen, da einige zusammen als Schiffsjungen gedient hatten. Einer von ihnen kam und umarmte Yves. Es war Kerboul, sein Hängemattennachbar an Bord des »Inflexible«. Auch er war groß und stark geworden. Er war Baleinier des Flaggschiffs, und da er ziemlich ordentlich war, so trug er schon lange die roten Litzen am Ärmel.
Es fehlte an Luft in der Stube, die von furchtbarem Toben erfüllt war. Madame Creachcadec brachte den dampfenden Glühwein, das erste Gericht des bestellten Mahls – und die Köpfe fingen an, sich zu drehen.
Es gab in Brest viel Lärm diese Nacht. Die Patrouillen hatten zu tun.
In der Siebenheiligengasse und in der St. Yvesstraße hörte man bis zum Morgen Gesang und Geschrei. Es war, als ob man Wilde, als ob man dem alten Gallien entsprungene Banden dort losgelassen hätte. Es gab dort Scenen der Lust, die an die Roheit der ältesten Zeiten erinnerten.
Die Matrosen sangen. Und die Weiber, die auf ihre Goldstücke lauerten, mischten, erregt und zerzaust von diesem wilden Freudensturm der Rückkehr, ihre gellenden Stimmen mit den tiefen der Männer.
Die letzten Ankömmlinge vom Meere waren an der noch tieferen Bronzefarbe, an dem noch freieren Wesen erkennbar; auch schleppten sie allerlei exotische Gegenstände mit sich herum; manche kamen mit durchnäßten Papageien in Käfigen, andere mit Affen.
Sie sangen aus Leibeskräften, diese Matrosen, mit einer Art von naivem Ausdruck, Dinge, die einen hätten schaudern lassen, oder auch südliche Weisen, baskische Lieder und besonders traurige bretonische Gesänge, die alte Dudelsacküberlieferungen der keltischen Vorzeit zu sein schienen.
Die schlichten, besseren Burschen bildeten Chöre zusammen; sie gruppierten sich nach ihren Heimatdörfern und wiederholten in ihrer Mundart die langen Klagelieder des Landes, selbst noch in der Trunkenheit den Wohlklang ihrer jugendlichen Stimmen bewahrend. Andere lallten wie kleine Kinder und fielen sich in die Arme; unfähig, die Kraft ihrer Fäuste zu beurteilen, zertrümmerten sie Türen und schlugen Vorübergehende nieder.
Die Nacht wurde lang und länger; schließlich waren nur noch die übelsten Orte geöffnet, und in den Straßen fiel der Regen ohne Unterlaß auf die Auswüchse wilder Fröhlichkeit.
V
Am nächsten Tage, sechs Uhr früh. Eine schwarze Masse, wie ein Mensch anzusehen, lag in einem Rinnstein am Rande einer einsamen Gasse, die von Wällen überragt war. Es war noch finster; noch immer derselbe feine und kalte Regen, noch immer dasselbe Heulen des Winterwindes, der, wie die Seeleute sagen, »gewacht« und die ganze Nacht durchächzt hatte.
Es war unten, ein wenig unterhalb der Brester Brücke, am Fuße einer großen Mauer, dort wo die obdachlosen Matrosen zu liegen pflegen, die, toll und voll, noch dunkel die Absicht gehabt haben, auf ihr Schiff zurückzukehren, unterwegs aber zu Boden gefallen sind.
Schon brach die Dämmerung an, trübe und fahl, ein Wintertag über Granit. Das Wasser strömte über die menschliche Gestalt, die am Boden lag, und ergoß sich dann dicht nebenan in das Loch der Schleuse.
Es begann etwas heller zu werden. Eine Art von Licht entschloß sich, langsam an den hohen Granitmauern herabzugleiten. Der schwarze Gegenstand in der Pfütze war wirklich ein großer menschlicher Körper, ein Matrose, der, die Arme kreuzweis ausgestreckt, dalag.
Ein erster Vorübergehender klappte mit seinen Holzschuhen auf dem harten Pflaster, wie wenn er taumelte. Ein anderer folgte, dann mehrere. Sie schlugen alle dieselbe Richtung in eine tiefere Straße ein, die zu dem eisernen Gittertor des Kriegshafens führte.
Das Klappen der Holzschuhe nahm bald außerordentlich zu, ein ermüdendes, fortgesetztes Geräusch, das die Stille wie die Musik eines quälenden Traumes durchhämmerte.
Hunderte und Hunderte von Holzschuhen klappten, von allen Seiten aus der Dämmerung kommend, durch jene tiefere Straße; eine Art frühzeitiger, übelangebrachter Prozession. Es waren die Arbeiter, die nach dem Arsenale zurückkehrten, noch taumelnd, weil sie die Nacht zu viel getrunken hatten, mit unsicherem Schritt und stumpfem Blick.
Auch häßliche, elende und durchnäßte Frauen kamen, die sich bald rechts, bald links wendeten, als ob sie nach jemand suchten. Sie blickten den Männern mit den großen bretonischen Hüten tief ins Gesicht, forschend, ob der Mann oder der Sohn endlich das Gasthaus verlassen habe, ob er sein Tagewerk wieder anzutreten gedenke.
Der in dem Rinnstein liegende Mann wurde ebenfalls von ihnen untersucht; zwei oder drei bückten sich, um sein Gesicht besser unterscheiden zu können. Sie erblickten junge, doch harte und wie zu leichenhafter Unbeweglichkeit erstarrte Gesichtszüge, zusammengezogene Lippen, aufeinandergepreßte Zähne. Nein, sie kannten ihn nicht. Auch war es kein Arbeiter, dieser da; er trug den großen blauen Kragen eines Matrosen.
Eine jedoch, die einen Sohn unter den Seeleuten hatte, versuchte, aus Herzensgüte, ihn aus dem Wasser zu ziehen. Er war ihr aber zu schwer.
»Uf! Welcher Klumpen!« sagte sie, indem sie seine Arme wieder fallen ließ.
Dieser Körper, auf den der Regen der ganzen Nacht herabgeströmt war, – war Yves.
Ein wenig später, als es völlig Tag geworden war, erkannten ihn vorübergehende Kameraden und nahmen ihn mit sich. Man legte ihn, ganz durchweicht vom Wasser des Rinnsteins, auf den Boden der großen, vom Sprühen der Wellen durchnäßten Schaluppe und machte sich segelfertig auf den Weg.
Das Meer war wild, der Wind entgegen. Sie lavierten lange und wurden seekrank, bevor sie das Schiff erreichten.
VI
Yves erwachte langsam gegen Abend; es waren zunächst Schmerzempfindungen, die ihm eine nach der anderen zum Bewußtsein kamen, wie wenn er vom Tode erwachte. Er fühlte sich in all seinen Gliedern durchkältet, kalt bis ans Herz.
Er war matt und wie zerschlagen – hatte er doch stundenlang auf einem harten Lager gelegen. Nun machte er fast bewußtlos den ersten Versuch, sich umzuwenden. Aber sein Fuß, an dem er plötzlich einen heftigen Schmerz empfand, wurde von etwas Starrem festgehalten, gegen das, wie er fühlte, kein Widerstand möglich war. – Ach ja, er erinnerte sich dieser Empfindung, er begriff nun – die Eisen.
Er kannte nur zu gut diese unausbleibliche Folge der tollen durchzechten Nächte: tagelang mit einem Ringe an die eiserne Stange geschlossen zu sein. Und den Ort, wo er sein mußte, erriet er, ohne sich nur erst die Mühe zu geben, die Augen zu öffnen. Der Winkel, in dem er lag, war eng, wie ein Schrank, und dunkel und feucht, er roch nach ungelüfteten Löchern, nur von ganz oben fiel durch eine Spalte ein matter Schein des Tages herein: er befand sich im Bauch, im Wasserraum des »Magicien«.
Nur vermischte sich ihm diese traurige Nachfeier noch mit früheren, die er an anderen Orten erlebt hatte – dort unten im fernen Amerika oder in den Häfen von China. War es, weil er die Polizisten in Buenos-Ayres durchgeprügelt hatte? Oder hatte ihn das blutige Handgemenge von Rosario hierher geführt? Oder waren es gar die Händel mit den russischen Matrosen in Hongkong? Er vermochte seine augenblickliche Lage nicht auf einige tausend Meilen mit Sicherheit zu bestimmen, da er keine Ahnung hatte, in welchem Lande er sich gerade befand.
Alle Winde und alle Fluten der Meeres hätten den »Magicien« wohl zu allen Ländern der Welt hintreiben können; hatten sie ihn doch zusammengeschüttelt, geschlingert, gequetscht, ohne daß es ihnen möglich geworden wäre, die Anordnung aller der Dinge in diesem Raume zu stören, auch nur eine dieser Taurollen in den Fächern von der Stelle zu rücken, noch die Taucherausrüstung, die hier mit ihren großen Augen und ihrem Walroßgesichte hinter ihm hängen mußte, herunterzuwerfen, noch diesen Ratten-, Moder- und Teergeruch zu verändern.
Er hatte noch immer ein so schneidendes Gefühl von Kälte, daß ihm der Schmerz bis in die Knochen ging; er begriff nun auch, daß seine Kleider bis auf die Haut durchnäßt waren. Der ganze Regen des gestrigen Tages, der Wind und der düstere Himmel kehrten ihm dunkel ins Gedächtnis zurück. Man war also nicht mehr da unten in den blauen Äquatorialländern! Nein, er erinnerte sich jetzt, daß er sich in Frankreich, in der Bretagne, in der so langersehnten Heimat befände.
Was aber hatte er getan, um, kaum zurückgekehrt, schon wieder in Eisen gelegt zu werden? Er suchte und konnte nichts finden. Dann aber kehrte ihm die Erinnerung wie an einen Traum zurück; während man ihn an Bord heraufzog, war er ein wenig erwacht, indem er sagte, daß er schon ganz allein heraufsteigen könne, und er hatte dabei gerade vor sich einen alten Bootsmann, den er nicht leiden konnte, gesehen. Er hatte ihn sofort mit recht garstigen Schimpfworten angefahren, worauf es ein Gebalge gegeben hatte, und dann wußte er nichts mehr, weil er gleich darauf wie tot und bewußtlos zu Boden gefallen war.
Doch nun – die Erlaubnis, die man ihm versprochen hatte, sein Dorf Plouherzel zu besuchen – sie würde man ihm nun verweigern! Alle seine Erwartungen, die Wünsche dreier Jahre des Elends, sollten unerfüllt bleiben! Er dachte an seine Mutter und fühlte im Herzen einen tiefen Stich. Er öffnete die Augen verstört, mit einem nach innen gerichteten Blicke, obschon sie ihm in starrer Unbeweglichkeit von dem inneren Aufruhr weit auseinandergerissen wurden. Und in der Hoffnung, daß es nur ein böser Traum sei, suchte er seinen zerquetschten Fuß aus dem Eisenringe zu lösen.
Da brach ein schallendes Gelächter wie eine Rakete aus dem dunkeln Raume hervor; ein Mann in fest anliegendem gestreiftem Trikot stand vor Yves und betrachtete ihn. Er warf, indem er lachte, einen prächtigen Kopf zurück und ließ seine weißen Zähne mit einem katzenartigen Ausdrucke sehen.
»Du erwachst also endlich?« fragte der Mann mit seiner scharfen Stimme, die an den Accent von Bordeaux erinnerte.
Yves erkannte seinen Freund Jean Barrada, den Kanonier, und den Blick zu ihm aufrichtend, fragte er ihn, »ob ich es wüßte?«
»Bah!« erwiderte Barrada in der spöttischen Weise des Gascogners, »ob er es weiß! Er ist dreimal heruntergekommen, und selbst den Arzt hat er hergeführt, dich zu besehen; du warst ja ganz starr und hast ihnen angst gemacht. Und ich stehe hier Posten, um es ihnen zu melden, sobald du dich rührst.«
»Und warum? Es ist unnötig, daß er oder überhaupt jemand kommt. Geh nicht hin, Barrada, hörst du? Du sollst nicht!«
So war es denn wieder geschehen. Er war aufs neue und immer wieder in sein altes Laster zurückgefallen. So selten er auch ans Land kam, immer wieder endete es so und er vermochte nichts dagegen. So erfüllte sich denn, was man ihm oft gesagt hatte, daß diese Gewohnheit schrecklich und todbringend, und man verloren wäre, sobald man sich ihr ergeben hätte. Vor Wut gegen sich selbst rang er die muskulösen Arme, daß sie knackten; er richtete sich halb auf, die Zähne zusammenbeißend, daß man sie knirschen hörte, und fiel dann mit dem Kopf auf den harten Boden zurück. Ach, seine arme Mutter, sie war ihm so nahe und er würde sie nun nicht sehen, wonach er sich doch drei Jahre gesehnt hatte! Das also war die Heimkehr nach Frankreich! Welches Elend, welche Herzensangst!
»Wenigstens solltest du dich umziehen«, sagte Barrada. »So naß wie du bist, zu bleiben, ist ungesund, du kannst dir eine Krankheit an den Hals ziehen.«
»Um so besser, Barrada. Jetzt aber laß mich!«
Er sagte es mit einem harten Tone, mit einem finsteren und bösen Blick; und Barrada, welcher ihn kannte, begriff, daß man ihn wirklich in Ruhe lassen müßte.
Yves wendete den Kopf und verbarg zuerst das Gesicht unter die beiden erhobenen Arme, dann, weil er fürchtete, daß Barrada sich einbilden könnte, er weine, veränderte er aus Trotz diese Stellung wieder und sah vor sich hin. Seine Augen waren in ihrer Abgespanntheit von einer wilden Starrheit und seine mehr als gewöhnlich vorstehende Lippe drückte jene Verachtung der Wilden aus, die er innerlich auf alles warf. In seinem Kopfe entstanden Pläne; Gedanken, die er schon früher in den finsteren Stunden des Aufruhrs gehabt hatte, kehrten aufs neue zurück.
Ja, er wollte davongehen, wie sein Bruder Goulven, wie seine beiden Brüder, diesmal sei es entschieden und unwiderruflich beschlossen. Das Leben der vogelfreien Männer, denen er bei den Walfischfahrern Ozeaniens oder in den Lusthöhlen der Städte La Platas begegnet war, dieses nur von den Zufällen des Meeres abhängige Leben, ohne Gesetz und Zügel, zog ihn lange schon an. Lag es ihm doch im Blute, es war ein Familienzug.
Flüchtig zu werden, um zur Handelsschiffahrt im Ausland oder zur Fischerei im großen zu gehen, ist ja immer der Traum, von dem die Matrosen, und gerade die besseren, in den Augenblicken der Auflehnung besessen sind.
Es gibt in Amerika für die Flüchtigen schöne Zeiten! Ihm freilich würde es nicht glücken damit, er sagte sich’s wohl; er war zu sehr dem Leid und dem Unglück geweiht; wenn aber selbst dort wieder das Elend lauert, so ist man doch wenigstens frei!
Die Mutter! Je nun, auf der Flucht würde er, um sie zu umarmen, eine Nacht in Plouherzel zubringen. Gerade wie sein Bruder Goulven, der dies dereinst ja auch so gemacht hatte; er erinnerte sich, ihn eines Nachts verstohlen kommen gesehen zu haben; man hatte während des Abschiedstags, den er zu Hause verbracht, alles verschlossen gehalten. Die arme Mutter hatte, ’s ist wahr, viel geweint! Was aber ist da zu tun? Es ist das Verhängnis! Und wie entschlossen und stolz sah dieser Bruder Goulven nicht aus!
Außer der Mutter hatte Yves in diesem Augenblicke auf die ganze Welt seinen Haß geworfen. Er dachte an die im Dienst verbrachten Jahre in der strengen Abgeschlossenheit der Kriegsschiffe, unter der Geißel der Disziplin, und er fragte sich, für wen und warum es geschehen sei? Sein Herz floß über von bitterer Verzweiflung, von Rachlust, von wildem Freiheitsdrange. Und da ich daran schuld war, daß er sich wieder auf fünf Jahre vom Staate hatte anwerben lassen, so grollte er auch mir und warf mich mit allen anderen zusammen.
Barrada hatte ihn verlassen und die Dezembernacht war gekommen. Durch den Lukendeckel des Schiffsraums fiel das graue Licht des Tages nicht mehr herein, nur ein feuchter Dunst, welcher eisig war, drang von dort noch herab.
Ein Mann der Runde kam an, das Licht einer vergitterten Laterne anzuzünden, und alle Gegenstände des Raums zeigten sich nun in unsicherer Beleuchtung. Yves hörte über sich den allabendlichen Kommandoruf: »Hängematten auf!« – Er hörte, wie diese aufgehängt wurden, er hörte den Ruf der Wache, durch den man die halben Stunden anzeigt. Draußen stürmte es fort, und in dem Maße als die Menschen stiller wurden, machten sich die mächtigen Stimmen der leblosen Dinge um so stärker bemerkbar. Oben gab es ein ununterbrochenes Sausen im Mastwerk; auch das Meer, in dessen Mitte man war, wurde laut und rüttelte von Zeit zu Zeit, wie aus Ungeduld, alles zusammen. Bei jedem Stoß rollte es den Kopf des armen Yves über den feuchten Boden, er aber hatte seine Hände darunter gesteckt, damit es ihn weniger schmerzte.
Und auch das Meer war diese Nacht düster und bösartig; man hörte es an den Schiffswänden, so lang sie waren, heranspringen und sein Geheul ausstoßen.
Sicher würde nun niemand mehr in den unteren Schiffsraum herabsteigen. Yves war also allein, auf dem Boden, in die Bujen geschlossen, den eisernen Ring um den Fuß – und jetzt klapperte er mit den Zähnen.
VII
Nach einer Stunde kam Jean Barrada doch wieder herunter und tat so, als ob er eine der Taljen instand setzen wollte, mit denen man die Kanonen heraufzieht.
Jetzt aber rief ihm Yves ganz leise zu: »Barrada, sei doch so gut und gib mir etwas Wasser zu trinken.«
Barrada rannte spornstreichs davon, um seinen kleinen Blechbecher zu holen, den er tags über an seinem Gürtel trug, nachts aber in einem Kanonenrohr versteckte; er goß Wasser hinein, das aussah wie Rost, da es von La Plata in einem eisernen Behältnis mitgeführt worden war, und etwas Wein, den er aus der Kombüse gestohlen, und tat Zucker dazu, den er in der Kajüte des Kommandanten stibitzt hatte.
Und dann erhob er Yves’ Kopf ganz sanft und sacht und gab ihm zu trinken.
»Nun, und möchtest du jetzt dich umziehen?« fragte er.
»Ja«, antwortete Yves mit leiser und kläglicher Stimme, die fast kindlich geworden war und drollig von seinem früheren Betragen abstach.
Er entkleidete sich jetzt mit Barradas Hilfe; er ließ sich nun pflegen wie ein Kind. Er ließ sich Brust, Achseln und Arme trocknen, frische Kleider anziehen und sich wieder hinlegen, wobei ihm Barrada einen Sack unter den Kopf schob, damit er besser schlafen konnte.
Er dankte und ein gütiges Lächeln veränderte sein ganzes Gesicht. Das war wie immer der Schluß. Sein Herz war weich, er wieder er selbst geworden. Auch hatte es heute nicht sehr lange gedauert.
Es überkam ihn eine unendliche Rührung, indem er an seine Mutter dachte, und ein Verlangen zu weinen; auch stieg ihm wirklich etwas wie eine Träne ins Auge, das gegen solche Schwächen doch abgehärtet war . . . Vielleicht würde man gegen ihn noch etwas nachsichtig sein wegen seines guten Betragens an Bord, wegen seines Mutes in der Gefahr und seiner tüchtigen Arbeit im Unwetter – wenn man über ihn keine zu harte Strafe verhängt, das weiß er genau, so wird er nie wieder rückfällig, und dann wird er alles wieder gutmachen.
Das war diesmal ein großer Entschluß. Wenn er nach der langen Enthaltsamkeit auf dem Meere auch nur ein einziges Glas Branntwein getrunken hätte, so wäre es sofort mit seinem Kopfe vorbei; dann mußte er mehr und immer mehr trinken. Finge er aber gar nicht erst an, ja tränke er gar nichts und unter keiner Bedingung, nun, dann wäre er sicher, ein ordentlicher Kerl zu bleiben.
Seine Reue hatte die Aufrichtigkeit der Reue eines Kindes, und er glaubte wirklich, daß, wenn er diesmal jenem fürchterlichen Gerichte entwischen könnte, das die Matrosen ins Gefängnis führt, dies sein letztes Vergehen gewesen sein würde.
Auch setzte er dabei große Hoffnung auf mich und wünschte überhaupt, mich zu sehen. Und er bat Barrada hinaufzugehen, um mich zu holen.
VIII
Als er diesen neuen Rückfall hatte, waren es sieben Jahre, daß Yves mein Freund war.
Wir waren auf verschiedenen Wegen zur Marine gekommen; er zwei Jahre vor mir, obschon er einige Monate jünger war als ich.
Am Tage meiner Ankunft in Brest, 1867, wohin ich kam, jene erste Marineuniform von grober Leinwand anzulegen, die ich noch vor mir sehe, traf ich zufällig Yves Kermadec bei einem seiner Gönner, einem alten Kommandanten, der seinen Vater gekannt hatte. Yves war damals ein Bursche von sechzehn Jahren. Man sagte mir, daß er im Begriffe stände, Leichtmatrose zu werden, nachdem er zwei Jahre Schiffsjunge gewesen war. Er war eben nach Ablauf eines achttägigen Urlaubs aus seinem Dorfe zurückgekommen. Das Herz schien ihm schwer von dem Abschiede, den er für lange Zeit von seiner Mutter genommen hatte. Dies und unser Alter, das ziemlich dasselbe war, bildete zwischen uns zwei Berührungspunkte.