
Mein geheimes Leben als Monsterjäger – Warum du niemals in einen Gully fallen solltest E-Book
Iris Genenz
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Südpol Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Mein geheimes Leben als Monsterjäger
- Sprache: Deutsch
Wie ich zum Monsterjäger wurde und eine Halbgöttin kennenlernte Ich bin Charly Hartnuss, 13 Jahre alt, und lebe in Dunkelnest, der ödesten Kleinstadt der Welt. Das dachte ich jedenfalls – bis zu diesem Tag: Alles fing mit dem gruseligen Kostüm an, das meine Mum mir zu Halloween genäht hatte, eine Komposition aus nassem Bettvorleger und Mottenfraß. Damit konnte ich mich unmöglich auf der Party blicken lassen. Der Plan war also, im dunklen Hausflur meine normalen Klamotten anzuziehen und mich dann bei meinem Freund Martin ins Vampirkostüm zu schmeißen. Aber dann bekam ich den blöden Reißverschluss einfach nicht auf. So sehr ich mich auch verrenkte, das räudige Werwolfkostüm ließ mich einfach nicht aus seinen Klauen. Hätte ich da bloß geahnt, dass das heute Nacht mein geringstes Problem sein würde … »eine Mischung aus Ghostbusters und Harry Potter, was ich sehr cool finde« Ostseeekind92, Lovelybooks Auftakt zur spannenden Fantasy-Reihe für Kinder ab 10 Jahren Der 13-jährige Charly Hartnuss, Comic- und Fantasyfan, träumt davon Superheldenkräfte zu haben. Doch dann sorgt sein abgewetztes Halloweenkostüm dafür, dass Charly als vermeintlich magische Kreatur von Monsterjägern aus den Anderlanden, einer magischen Parallelwelt, eingefangen wird und bald schon entdeckt er, dass auch in ihm ganz besondere Fähigkeiten schlummern ... - Superwitzig, rasant und mit vielen coolen Monstern: Idealer Lesestoff für Jungs und Mädchen - Mit witzigen Kapitelvignetten: Kurze Kapitel auch für Wenig-Leser geeignet - Mit Monster-Glossar: Kurze Übersicht zu allen vorkommenden Monstern - Lese-Motivation: Zu diesem Buch gibt es ein Quiz bei Antolin Bisher erschienen in der Reihe "Mein geheimes Leben als Monsterjäger": Mein geheimes Leben als Monsterjäger – Warum du niemals in einen Gully fallen solltest Mein geheimes Leben als Monsterjäger – Warum du niemals an einem Riesenwurm hängen solltest Leseprobe: "Was ist das?" "Das? Tja, das ist ein Turnschuh. Eine bequemere und weitaus sportlichere Variante deiner Kampfstiefel. Und auch viel angesagter." Sie musste ja nicht unbedingt wissen, dass meine Schuhe nur aus dem Ausverkauf stammten und nicht gerade die trendigsten Modelle waren. "Nein, du Vollpfosten", knurrte sie jetzt. "Ich meine das da!" Sie deutete auf einen winzigen giftgrünen Sprenkel – mit dem bloßen Auge kaum zu erahnen. "Ach, das!" Ich seufzte bei der Erinnerung an das zweitschlimmste Ereignis dieses Tages. "Das ist Glibberschleim aus der Kanalisation. Ich bin heute in einen Gully gefallen", erklärte ich und bekam rote Ohren. "Wie kann man denn in einen Gully fallen?" Mann, diese Epona hatte den gleichen Blick drauf wie Martins Vater! "Der war nicht abgedeckt, okay?", antwortete ich etwas lauter als nötig. Langsam hatte ich echt die Nase voll davon, immer für alle der Loser zu sein! "Wo war das?", wollte Epona wissen, ohne auf meinen emotionalen Ausnahmezustand einzugehen. »Ich habe selten ein Buch gelesen, welches mit so viel Witz und gleichzeitig mit Spannung auftrumpfen kann, wie dieses (...) einfach vollkommen gelungen« @eine.kissenschlacht »Diese Geschichte ist richtig toll geschrieben. So lustig, spannend und mitreißend. Ich war so im Buch gefangen, dass ich nicht aufhören wollte zu lesen.« Felix @bookbrothers_ol
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Originalcopyright © 2023 Südpol Verlag, Grevenbroich
Autorin: Iris Genenz
Umschlaggestaltung und Illustrationen: Corinna Böckmann
E-Book Umsetzung: Leon H. Böckmann, Bergheim
ISBN: 978-3-96594-245-5
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung,
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Mehr vom Südpol Verlag auf:
www.suedpol-verlag.de
Inhalt
Kapitel 1:Am Höllentor meines Lebens
Kapitel 2:In dem ich mich einschleime
Kapitel 3:In dem ich miefe wie ein Wookiee
Kapitel 4:In dem mir eine Glitzerfee den Stinkefinger zeigt
Kapitel 5: In dem ich sehr an einem Maschendrahtzaun hänge
Kapitel 6:In dem ich zur Ferkeltöle werde
Kapitel 7:In dem ich von Monstern umzingelt bin
Kapitel 8:In dem ich mich wieder in einen Menschen verwandele
Kapitel 9:In dem die Zeit stillzustehen scheint
Kapitel 10:In dem ich einen Fluchtversuch starte
Kapitel 11: In dem ich der Tageszeitung das Leben rette
Kapitel 12:In dem ich die Magie wiederfinde
Kapitel 13:In dem Pilze springen können
Kapitel 14:In dem ich Monster in Schoßhündchen verwandele
Kapitel 15:In dem eine Party zum Monsterbüffet wird
Kapitel 16: In dem der Schreck einen Schreck bekommt
Kapitel 17:In dem Superhelden und Superschurken ihr Unwesen treiben
Kapitel 18:In dem ich einen Aasschlecker melke
Kapitel 19:In dem ich auf dem Dach tanze
Kapitel 20:In dem ich freiwillig in einen Gully steige
Kapitel 21:In dem wir eine Überraschung erlebe
Kapitel 22: In dem sich einiges aufklärt
Kapitel 23:In dem ein wahres Monster entfesselt wird
Kapitel 24: In dem ich eine Teufeltöle reite
Kapitel 25: In dem sich ein Portal schließt und eine Tür öffnet
Kapitel 26:In dem mein Leben ein Upgrade erhält
Auszug aus Prof. Fingerhuts Grundlagenlexikon der Kryptozoologie (Beastbook)
Kapitel 1:
Am Höllentor meines Lebens
Die ersten drei Gedanken, die mir an diesem Morgen durch den Kopf schossen, als ich mich im Spiegel betrachtete:
Ich hasse diese grässlichen riesigen Ohren!
Ich bräuchte viel mehr Brustbehaarung!
Und dieser struppige Schwanz geht gar nicht!
„Das kann ich unmöglich anziehen, Mum!“ Fassungslos drehte ich mich vor dem großen Garderobenspiegel im Flur, wobei mein linker Arm – buchstäblich am seidenen Faden hängend – schlaff hin und her schlenkerte.
„Das sieht nicht aus wie ein Werwolf. Ehrlich! Das sieht aus wie ein dreibeiniger Hund, nachdem ihn ein Werwolf wieder ausgespuckt hat!“ Hilfesuchend schaute ich zu Dad in die Küche.
„Deine Mutter hat eine ganze Woche an diesem Kostüm genäht, da wirst du es ihr zuliebe wohl einen Abend lang tragen können!“ Dad sah nicht einmal von seiner Zeitung auf, während er mir diesen Vortrag hielt. Ganz sicher konnte er den Anblick seines einzigen Sohnes in dieser Komposition aus nassem Bettvorleger und Mottenfraß selbst nicht ertragen und war nur mal wieder zu feige, Mum die Wahrheit zu sagen. Echt! Und so jemand war nun mein männliches Rollenvorbild! Kein Wunder, dass mich nie jemand ernst nahm.
„Mum, bitte!“, flehte ich.
„Ich weiß gar nicht, was du hast, Schätzchen“, sagte Mum ungerührt und zupfte an mir herum. „Du siehst hinreißend aus. Und ganz sicher haben sich die anderen Mütter nicht so viel Mühe gegeben, ihren Kindern eigene Kostüme zu nähen.“
„Genau! Die anderen Mütter haben ihren Kindern Kostüme gekauft. Weil nämlich niemand mit 13 Jahren an Halloween hinreißend aussehen will! Da ist man gruselig und blutverschmiert.“
„Aber, Charly, Schätzchen, das passt doch überhaupt nicht zu deiner Persönlichkeit!“, wandte Mum ein und drückte mir einen Schmatzer auf die Wange. Unglücklich starrte ich auf meine behaarten Füße.
„Schau“, versuchte sie zu retten, was nicht mehr zu retten war, „ich nähe dir den zweiten Arm rasch wieder an und dann bist du der räudigste Werwolf weit und breit.“
Ja! Genau das war mein Problem! Nicht genug, dass ich gesellschaftlich sowieso schon auf der Ersatzbank saß, nun sollte ich mich der Öffentlichkeit obendrein freiwillig zum Fraß vorwerfen!
Würde es eigentlich irgendjemanden interessieren, wenn ich auf der Stelle tot umfiele? Mum und Dad vielleicht schon. Schließlich waren sie zum größten Teil schuld an meinem hoffnungslos verkorksten Leben. Wobei Dad das sicherlich anders sehen würde. „Ich habe mich stets aus dem Leben meines Sohnes herausgehalten. Damit kann ich es ja wohl nicht verpfuscht haben!“, würde er sagen. Und Mum? Die würde behaupten: „Ich habe mein Charly-Spätzchen immer mit Liebe und grünem Gemüse gefüttert. Mehr kann eine Mutter nicht tun!“ Gibt es irgendwo in der Geschichte der Menschheit eine deprimierendere Grabrede?
„Jetzt holen wir dich erst mal aus dem Kostüm und du frühstückst ordentlich. Nachher stopfst du dich sowieso nur noch mit Süßigkeiten voll“, säuselte Mum und bugsierte mich in mein Zimmer. Süßigkeiten! Der einzige Lichtblick an diesem Tag. Wenn ich denn überhaupt welche bekam. In dem Aufzug würde mich wahrscheinlich selbst meine Oma mit einem Besen von der Türschwelle jagen, aus Angst, ich könnte sie mit irgendeiner Krankheit anstecken.
Mich aus diesem Monstrum von einem Kostüm zu schälen dauerte eine gute Viertelstunde. Mum hatte den Reißverschluss so schief eingenäht, dass er sich ständig verhakte. Hätte ich tatsächlich schon Brusthaare, würde jetzt wahrscheinlich ein kahler Streifen längs über meinen Oberkörper verlaufen.
„Das dehnt sich sicher noch ein bisschen aus“, versuchte Mum mich zu beruhigen, während sie den struppigen Pelz von meinem Arm zerrte.
Dad steckte den Kopf zur Tür herein. Wahrscheinlich war er doch etwas beunruhigt, weil es so lange dauerte. Oder er langweilte sich allein in der Küche. Zum ersten Mal an diesem Morgen sah er mich genauer an. „Weißt du, Sohn“, sagte er und versuchte dabei ein Schmunzeln zu unterdrücken. „Du könntest dich auch als tollwütiges Eichhörnchen ausgeben!“
Super! Am Höllentor meines Lebens fand er nun endlich seinen Humor.
„Lass die Scherze, Harald!“, schimpfte Mum, die meinen Blick bemerkte. Dad zuckte nur die Schultern und zog seinen Kopf wieder aus der Tür.
Endlich allein!
Nachdem Mum sich wieder in ihr Nähzimmer zurückgezogen hatte, warf ich mir meine Jacke über, schnappte mir mein Skateboard und machte mich auf den Weg zu meinem besten – und einzigen – Freund Martin. Gemeinsam würden wir vielleicht eine Lösung für meine Halloweenkostüm-Apokalypse finden.
Gemächlich ließ ich mich die Straße zur Innenstadt hinunterrollen. Heute war Feiertag. Das bedeutete, in Dunkelnest war noch weniger los als ohnehin schon. Und das, obwohl es für Ende Oktober erstaunlich warm war.
Nicht einmal das Eiscafé hatte geöffnet. Der einzige Treffpunkt, den man als Teenager hier überhaupt hatte. Manchmal kam ich mir vor wie in einem schlechten Western. So einem, wo die Strohballen durchs Bild gepustet werden, um das ganze Elend der Einsamkeit dramatisch zu unterstreichen.
Ich rollte über den Marktplatz. Dunkelnest war eine typische Kleinstadt. Im Zentrum der Marktplatz mit Brunnen, Rathaus und Kirche. Ringsherum kleine Einkaufsgassen und alte Wohnhäuser. Und am Stadtrand verschiedene Neubausiedlungen mit akkuraten Hecken und kleinkarierten Vorgärten. Wir mit unserer 3-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bildeten hier eher die Ausnahme. Die meisten meiner Mitschüler lebten in großen Stadtvillen oder schicken Doppelhaushälften.
Mein Dad hatte sich vor einigen Jahren mit einem eigenen Briefschlitzunternehmen selbstständig gemacht. Er fertigte also die Schlitze an, durch die die Post durch die Haustüren geschoben wurde. Also solche Dinger, die heutzutage fast niemand mehr brauchte, da es solche Schlitze eigentlich nur noch in alten Haustüren gab. Und das führte dazu, dass wir an chronischem Geldmangel litten.
Martin wohnte in einem der alten vornehmen Häuser in der Innenstadt, seine Familie lebte schon seit Generationen in Dunkelnest und sein Vater war als Bankier einer der einflussreichsten und angesehensten Bürger im Ort. Fast jeder hatte einen Kredit bei ihm. Vielleicht war das der Grund, warum die anderen aus der Schule ihn meistens in Ruhe ließen, obwohl sie ihn genauso mieden wie mich. Keine Ahnung warum, ich fand Martin voll ok. Genau wie mich selbst übrigens. Martin sammelte Superhelden-Comics und stand auf Fantasy, da ging ich voll mit.
Manchmal beneidete ich Martin schon um sein schickes Zuhause. Auch wenn man seinen besten Freund eigentlich nicht beneiden sollte. Aber noch mehr beneidete ich die Superhelden aus unseren Comics. Was würde ich darum geben auch eine coole Superkraft zu haben. Dann würden mich die anderen endlich nicht mehr mobben, sondern mich stattdessen bewundern. Und ich könnte Dalia beeindrucken.
Hach, Dalia! Sie war die Einzige, die neben Martin wirklich nett an unserer Schule war. Und obendrein auch noch hübsch. Doch leider wurde sie immer von einer Traube Freundinnen umringt, sodass sich bisher kaum einmal die Gelegenheit ergeben hatte, dass ich mit ihr alleine war. (Zugegeben, selbst wenn, würde ich es wahrscheinlich nur zu einem hilflosen Grinsen und einer radieschenroten Gesichtsfarbe bringen, aber es wäre immerhin ein Anfang.)
Und noch einen Vorteil hätte es, wenn ich über Superkräfte verfügen würde: Ich könnte Dunkelnest endlich für immer verlassen und irgendwo ein aufregenderes Leben führen.
Plötzlich nahm ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr. Auf der anderen Seite des Platzes drängten sich zwei Schatten aus der Gasse.
Kapitel 2:
In dem ich mich einschleime
„Hey Charly, du Oberloser!“, brüllte mir einer der beiden Schatten entgegen.
Oskar und Paul. Die zwei übelsten Schlägertypen der Schule kamen direkt auf mich zu. Ihre bevorzugten Opfer: 7-Jährige mit gut gefüllten Brotdosen und meine Wenigkeit. Ausgerechnet! Ich hatte keinen Bock auf Stress. Die beiden offensichtlich schon. Verstohlen sahen sie sich um, als wollten sie sich vergewissern, dass die Luft rein war.
„Was machst du hier?“, fragte Oskar mit einem fiesen Grinsen. Die kleinen Schweinsäuglein in seinem überdimensionalen Quadratschädel fixierten mich angriffslustig. „Solltest du nicht zu Hause deiner Mama die Füße massieren?“
„Hähä-hähä“, gluckste Paul.
Gegen diese beiden Typen gab es nur zwei Strategien: Täuschen und Ablenken. Eine direkte Konfrontation sollte man hingegen tunlichst vermeiden. Sonst spielten die beiden mit einem ein Spiel, das sie Piñata-Knacken nannten. So wie diese Figuren aus Pappmaché, die an Kindergeburtstagen mit Süßigkeiten gefüllt wurden und dann mit einem Stock zerschlagen werden mussten. Nur dass die beiden dafür ihre Fäuste benutzten und am Ende nie so was Gutes wie Süßigkeiten dabei herauskam.
„Äh, ich bin gerade für die Schülerzeitung unterwegs und mache eine Umfrage“, stotterte ich.
Die beiden blieben stehen. „Was’n für ’ne Umfrage?“, grunzte Oscar.
„Was’n für ’ne Schülerzeitung?“, fragte Paul.
„Ähm, es geht um die Intelligenz der Schüler“, sagte ich schnell, um den Moment der Verwirrung zu nutzen. „Das passt gerade ganz gut, dass ich euch hier treffe. Ich brauche noch die Meinung von Unbeteiligten zu dem Thema.“ Wie beiläufig ließ ich mich auf meinem Skateboard ein Stück von ihnen wegrollen.
„Was meinste denn mit Unbeteiligten?“, fragte Paul und kratzte sich hinterm Ohr.
Oskar schien schneller zu schalten. Ich konnte regelrecht sehen, wie es in seinem Kopf ratterte.
„Ich glaube“, sagte er langsam, während sein Gehirn den Sinn meines Satzes allmählich zu entschlüsseln schien. „Er will damit sagen, dass wir dumm sind!“ Drohend schlug er sich mit der Faust in die flache Hand. An seinem Kiefer zuckte ein Muskel.
„Wähhh?“, machte Paul und sah mich mit großen Glubschaugen an.
Okay! Ablenkung hatte für einen kurzen Moment funktioniert. Höchste Zeit für den Rückzug. So fest ich konnte, stieß ich mich mit dem Fuß am Boden ab und schnellte los. Oskar und Paul brauchten einige Sekunden, ehe sie sich in Bewegung setzten. Meine Chance! Ich schoss in halsbrecherischer Geschwindigkeit den Bordstein entlang in eine der Gassen. Hinter mir hörte ich das aufgeregte Getrampel meiner Verfolger. Ich legte noch einen Zahn zu und holte mehr Schwung.
Lange konnte ich dieses Tempo allerdings nicht halten. Der Bordstein wurde immer wieder von Straßen aus Kopfsteinpflaster durchbrochen, die meine Flucht deutlich verlangsamten. Ich brauchte dringend ein Versteck! Nur leider hatten ja alle Geschäfte geschlossen. Ein Blick nach hinten verriet mir, dass Oskar und Paul bereits aufgeholt hatten. In meiner Magengrube breitete sich Panik aus wie eine wachsende Seifenblase, die jeden Moment zu platzen drohte.
Doch ehe ich mich weiter mit meiner Angst vor den vier Fäusten meiner Verfolger auseinandersetzten konnte, geschah etwas, mit dem ich nicht in meinen schlimmsten Albträumen gerechnet hätte!
Völlig unerwartet sackte die Spitze meines Skateboards nach unten weg. Das Board geriet in Schieflage und ich rutschte haltlos daran herab, direkt in einen dunklen Abgrund. Um mich herum wurde es schwarz. Ich stürzte in die Tiefe, geradewegs ins Nichts. Und alles, woran ich dabei denken konnte, war: Wenigstens bleibt mir die Blamage mit dem Werwolf-Kostüm erspart, wenn ich jetzt sterbe!
Doch ich starb nicht – nach wenigen Sekunden landete ich mit einem lauten FLATSCH! in einem glibberig-schleimigen Berg aus … Ehrlich! Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was das war. Erkennen konnte ich nichts. Alles lag nach wie vor komplett im Dunkeln. Aber so, wie das Zeug stank, wollte ich gar nicht genau wissen, was das war. Es roch wie Mums Pupse nach Dads Kohlauflauf. Neben mir hörte ich mein Skateboard donnernd aufschlagen und ein Geräusch von splitterndem Holz. Das Ding war wohl hin. Blöder Mist! Ich hing an meinem Skateboard. Wenigstens hatte es mich nach meiner knappen Rettung durch den Schleimberg nicht erschlagen. Wäre auch zu ironisch gewesen, nachdem es mir schon so oft den Hals gerettet hatte.
Ich versuchte mich aufzurappeln. Gar nicht so einfach ohne festen Halt. Über mir vernahm ich plötzlich Stimmen.
„Hey Charly, bist du tot?“ An seinem feixenden Unterton konnte ich deutlich hören, dass Paul dieser Gedanke nicht unbedingt traurig stimmte.
Die Freude wollte ich ihm natürlich gleich wieder vermiesen. „Nö, alles super bei mir“, krächzte ich mühsam.
Ich blinzelte hoch zu dem Lichtkreis, der einige Meter über mir zu schweben schien. Mühsam erkannte ich die Silhouetten zweier Quadratschädel, die zu mir herunterspähten.
„Ach, lass doch den Weichsack!“, höhnte Oskar. „Dem geht’s gut da unten. Is’ doch ’n Fortschritt. In der Kanalisation ist es viel schicker als bei ihm zuhause.“ Er schnüffelte geräuschvoll. „Und es riecht auch besser!“
„Mega!“, kicherte Paul und die beiden gaben sich einen Faustcheck. Bevor sie sich endlich aus dem Staub machten, rief Oskar noch zu mir herunter: „Viel Spaß in deiner neuen Bude!“
Dann herrschte Stille.
Ich wartete einige Minuten, ehe ich einen erneuten Versuch startete, mich aufzurichten. Einerseits, weil ich es Oskar und Paul durchaus zutraute, dass sie außerhalb meines Sichtfelds auf mich warteten. Andererseits, weil meine Knie sich nach dem Schreck anfühlten wie das Zeug, in dem ich gerade saß. Nach einer gefühlten Ewigkeit hatte ich mich aus dem Schleimhaufen befreit und tastete die Wand neben mir ab. Gott sei Dank, es gab eine Leiter hinauf. Ich griff nach der untersten Stufe. Mit wackeligen Beinen machte ich mich an den Aufstieg.
Plötzlich erstarrte ich mitten in der Bewegung. Unter mir ertönte ein hastiges Platschen, als ob jemand durch den Abwasserschacht eilte – PLATSCH, PLATSCH, PLATSCH, PLATSCH. Das konnte doch nicht sein! Rannte hier unten wirklich jemand herum? Voll creepy. Oder war derjenige vielleicht auch in den Gully gefallen und suchte den Ausgang?
„Hallo?“, rief ich mit heiserer Stimme. Augenblicklich verstummten die Geräusche. Der Verursacher des Platschens war anscheinend stehen geblieben und rührte sich nun nicht mehr. Mir schoss ein Zeitungsartikel durch den Kopf, in dem stand, dass ein zwei Meter langer Alligator im Untergrund einer Großstadt gefunden worden war. Angestrengt horchte ich in die undurchdringliche Schwärze hinein. Doch alles, was ich hören konnte, war mein Herz, das in meiner Brust hämmerte wie ein Schlagbohrer. Was, wenn da jetzt etwas auf mich lauerte? Gänsehaut wanderte mir den Nacken hinauf. Ich schüttelte mich, dann hastete ich weiter die Sprossen hoch. Nur raus aus diesem dunklen Loch!
Wenigstens waren Oskar und Paul so nett gewesen und hatten den Gullydeckel nicht wieder über die Öffnung geschoben. Erschöpft ließ ich mich auf den Bordstein sinken. Wer zur Hölle entfernte eine Gullyabdeckung und ließ dann einfach unschuldige Leute hineinplumpsen? Der Typ gehörte hinter Gitter!
Ich startete einen lahmen Versuch, den Gully wieder zu verschließen, scheiterte aber kläglich an dem Gewicht des Deckels. Wahrscheinlich hatten Oskar und Paul deswegen auf den Spaß verzichtet, mich dort unten einzusperren. Manchmal war Faulheit ja auch ein Segen!
Ich atmete tief durch und schlurfte weiter zu Martins Haus. Ein Wunder, dass ich mir nichts gebrochen hatte. Danke an den stinkenden Schleimhaufen, der in Teilen noch immer von meinen Klamotten tropfte. Was zum Henker das auch gewesen war!
Kapitel 3:
In dem ich miefe wie ein Wookiee
„Büäh! Du riechst wie ein nasser Wookiee zwischen den Zehen!“ Martin rümpfte die Nase und schob seine Brille mit dem Zeigefinger ein Stück höher.
„Dann hab ich wenigstens schon mal die passende Duftnote für mein Outfit heute Abend“, antwortete ich matt.
„Komm erst mal rein“, sagte Martin versöhnlich. Unter schwerem Ächzen drückte er die massive Eingangstür weiter auf.
„Großer Gott! Was stinkt hier so?“ Martins Mutter kam in den Flur gestürzt. Mit hochgezogenen Augenbrauen starrte sie mich an. „Was ist denn mit dir passiert?“
„Ich, äh, bin in einen Gully gefallen“, antwortete ich und starrte auf meine Füße. Frau Hirsebein schaffte es wieder mal, dass ich mir wie ein kleines Häuflein Elend vorkam. Mit ihrer schicken Hochsteckfrisur und dem eleganten Kostüm inmitten der piekfeinen Einrichtung fühlte ich mich daneben wie der arme Waisenjunge Oliver Twist, der um ein bisschen Haferschleim bittet.
„So kommst du mir nicht ins Haus, Charles!“, sagte sie streng.
„Mum, er heißt Charly. Nicht Charles. Wie oft soll ich dir das noch sagen?“, korrigierte Martin seine Mutter.
„Du gewöhnst dir erst einmal einen anderen Ton an, junger Mann!“, erwiderte Frau Hirsebein schnippisch. „Und du!“ Nun waren ihre katzenhaften Augen wieder auf mich gerichtet. „Du gehst ins Bad und ziehst diese stinkenden Sachen aus. Ich bringe dir welche von Martin.“ Mit spitzen Fingern wurde ich Richtung Badezimmer navigiert.
Als wir am Wohnzimmer, respektive Salon, vorbeikamen, streckte Herr Hirsebein seinen kahlen Kopf in den Flur. „Was riecht hier so streng? Wurde eine Ladung vergammelter Rüben geliefert?“
„Nein!“, antwortete Frau Hirsebein. Sie klang genervt. „Charles ist in den Gully gefallen.“
„Wie kann man denn in einen Gully fallen? Die sind doch abgedeckt“, fragte Herr Hirsebein und sah mich an, als wäre ich der Trottel vom Dienst.
„Dieser war’s aber nicht“, brummte ich zurück.
„Willst du damit sagen“, Herr Hirsebein schnappte nach Luft, „dass da draußen ein offener Gully auf der Straße ist?“
„Jepp“, antwortete ich knapp.
„Aber das ist doch unverantwortlich! Um nicht zu sagen lebensgefährlich! Da kann ja jemand reinfallen!“
„Wem sagen Sie das“, seufzte ich.
„Erzähl mir sofort, wo das war, Junge!“, bellte Herr Hirsebein. „Ich rufe gleich den Bürgermeister an. So etwas kann ja wohl nicht angehen!“
„Jetzt wird sich der Junge erst einmal waschen und danach kannst du dem Bürgermeister immer noch dabei helfen, die Stadt zu retten“, entschied Frau Hirsebein und schloss einfach die Wohnzimmertür vor seiner Nase.
Nachdem ich den Glibber mehr oder weniger erfolgreich aus meinen Haaren und meiner Kleidung entfernt hatte, schlich ich in einem viel zu weiten Kapuzenshirt und ausgebeulten Jeans erneut am Wohnzimmer vorbei.
Durch die Tür hörte ich die aufgebrachte Stimme von Herrn Hirsebein, der offensichtlich bereits den Sekretär des Bürgermeisters angerufen hatte. „Was soll das heißen, heute ist Feiertag und der Chef ist nicht zu sprechen? Das ist mir egal! Es geht hier um einen unbefugten Eingriff in die Verkehrsordnung. Und noch dazu um Leben und Tod! Sie holen jetzt den Bürgermeister ans Telefon oder Sie hören von meinem Anwalt!“, blaffte er.
Sie hören von meinem Anwalt! war wohl die Erwachsenenversion von Das erzähl ich meiner Mama!
Eilig huschte ich die Treppe hinauf in Martins Zimmer. Herr Hirsebein würde die Angelegenheit auch wunderbar ohne meine Hilfe erledigen. Zur Not eben mit Unterstützung seiner Mama – äh, seines Anwalts.
Gemütlich lümmelte ich mich auf Martins Couch, während er mir sein Kostüm für den Halloweenabend vorführte. Seine Eltern hatten ihm natürlich eins gekauft! Und zwar eine Sonderanfertigung. Geschneidert nach der Vorlage eines Anzugs, den er für einen Superhelden unseres selbst geschriebenen Comics entworfen hatte.
„Krass! Du siehst tatsächlich aus wie Smasher!“ Beim Anblick von Martins Verkleidung blieb mir fast die Spucke weg. Die Schneiderin hatte es tatsächlich geschafft mit dem Kostüm den Eindruck zu erwecken, dass Martin so etwas wie Bauchmuskeln hatte. Dass er eigentlich ein paar Kilo zu viel auf die Waage brachte, war nur noch an seinem rundlichen Gesicht zu erkennen. Seine Augen glänzten.
„Der Wahnsinn, oder? Siehst du, der Schriftzug ist mit LED-Lampen beleuchtet. Und der Berserkerhammer sieht total echt aus!“ Freudestrahlend hielt er einen Plastikhammer in die Höhe, der wirkte, als müsse er mindestens 10 Kilo wiegen.
„Wow!“, seufzte ich. Kohle müsste man haben!
Martin legte den Kopf schief und sah mich an wie ein Dackel, der gerade auf den Teppich gepinkelt hatte. „Ist dein Kostüm wirklich so schlimm?“
„Sagen wir mal so“, begann ich, „hätten die anderen aus der Schule nicht sowieso schon genug Anlass auf mir herumzuhacken, wäre ich spätestens heute Abend auf der Party die Lachnummer des Jahres.“ Düster starrte ich zu Boden.


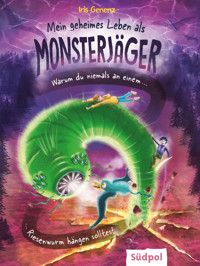













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












