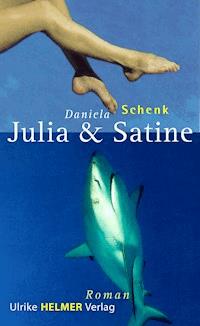Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Krug & Schadenberg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Mein Herz ist wie das Meer" – und aus diesem Grund will Amelie nie wieder eine Beziehung eingehen. Amelie ist bipolar, das heißt, sie schwankt zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. In ihren manischen Hochphasen malt sie wie besessen und schafft großartige Kunst. In ihren depressiven Phasen geht nichts mehr. Und schon gar keine Liebe. Amelies fester Vorsatz, sich von der Liebe fernzuhalten, gerät ins Wanken, als sie auf einer Zugfahrt der zauberhaften Zazou begegnet ... Ein langer Weg steht den beiden bevor, und erst ein großes Unglück bringt eine Kehrtwende. "Mein Herz ist wie das Meer" zeigt, wie sich mit einer bipolaren Störung leben und lieben lässt – ein Buch, das die komplizierte Krankheit nicht beschönigt, aber Hoffnung macht. Und uns manches Mal befreiend lachen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRAUEN IM SINN
Literatur deutschsprachiger und internationalerAutorinnen (zeitgenössische Romane, Kriminalromane,historische Romane, Erzählungen)
Sachbücher und Ratgeber zu allen Themenrund um das lesbische Leben
Bitte besuchen Sie uns: www.krugschadenberg.de
Daniela Schenk
Mein Herz ist wie das Meer
Roman
K+S digital
Für alle, die in der inneren Höllegeschmort haben.
Inhalt
Zug um Zug
Die Nadel im Heuhaufen
Sardinien
Hin und drüber hinweg
Wellenschläge
Hölle auf Erden
Kein Schritt und Tritt
Dem Schicksal in die Speichen greifen
Patentanten
Zug um Zug
Es wäre Zufall,
wenn es Zufälle gäbe.
Mirette Kamal
Zazou
Alle Gegenstände ziehen sich an, egal wie weit sie voneinander entfernt sind. Das hat Newton herausgefunden. Und ich sollte es in den folgenden Jahren verstehen.
Die Anziehungskraft zwischen Gegenständen ist umso stärker, je schwerer die Körper sind und je näher sie sich kommen. Das erfuhr ich an jenem Januarmorgen, als eine schwere Tasche auf meinen Oberschenkel plumpste und mein Leben veränderte. Die Tasche fiel nicht seitwärts oder aufwärts, sondern dank der Gravitationskraft wie immer abwärts. Alles fällt auf die Erde, nur der Mond nicht, der bewegt sich schnell genug, um der irdischen Anziehungskraft zu trotzen, und ist doch groß genug, um die Erde zu beeinflussen: Er zieht das Wasser an wie ein Magnet und bewirkt Ebbe und Flut.
Das überlegte ich mir, als die schwere Tasche auf mir landete. Ich neige dazu, in schwierigen Momenten wissenschaftliche Überlegungen anzustellen, als Ablenkung. Der Oberschenkel schmerzte trotzdem.
»Sakrament, habe ich Sie erschlagen?« Die Attentäterin blickte mich zerknirscht an.
Als ich den Kopf schüttelte, atmete sie sichtlich auf und setzte sich mir gegenüber, sie holte ihren E-Reader aus der Mördertasche und begann zu lesen. Das gefiel mir. Ich vermeide Gespräche mit anderen Fahrgästen, weil ich sonst bei einem nächsten Aufeinandertreffen wieder reden müsste oder abschätzen, ob es drin läge, nur zu grüßen. Ich setzte die Kopfhörer auf und schloss die Augen, während mein Oberschenkel pochte. Kurz vor dem Hauptbahnhof tippte die Frau mir zum Abschied leicht auf die Schulter, lächelte entschuldigend und schleppte ihre Tasche Richtung Ausgang.
Am Abend entdeckte ich auf dem linken Oberschenkel einen großen blauen Fleck. Da kam mir die Tasche in den Sinn – nicht ahnend, dass dies die erste von vielen Spuren war, die diese Frau bei mir hinterlassen sollte.
Am nächsten Morgen setzte ich mich in den vordersten Wagen, was für mich ein großes Opfer bedeutete: Der hinterste kam im Hauptbahnhof an genau der richtigen Stelle zum Stehen, außerdem hasse ich es, Routinen zu ändern. Ich brachte dieses Opfer, weil ich mich vor herunterfallenden Taschen schützen und mit keiner Attentäterin plaudern wollte. An die Scheibe gelehnt schaute ich aus dem Fenster. Der Himmel hatte sich rot verfärbt, vermutlich würde es am Abend regnen. Die Landschaft schlummerte im rötlichen Zwielicht, ich schlummerte mit und ließ mich mit der Musik treiben.
Diese entzückende Idylle fand ihr Ende, als jemand etwas auf meinen Oberschenkel legte. Mit geschlossenen Augen fegte ich den Störenfried weg, dann erst schaute ich auf: vor mir eine gebeugte Gestalt, die sich nun aufrichtete und mich ansah. Eine Hand hielt mir etwas hin. Ich streifte die Kopfhörer ab.
»Wegen gestern«, erklärte die Frau.
»Wie bitte?«
»Weil ich Sie mit meiner Tasche fast erschlagen habe.«
Da erkannte ich sie: die Frau mit der Mordwaffe. Diesmal hatte sie das Haar nach hinten gebunden, ihre Wangen waren gerötet, die Finger von der Kälte rosa gefärbt. Sie setzte sich neben mich.
Unentschlossen schaute ich auf das Ding in meiner Hand. »Das wäre nicht nötig gewesen. Es ist ja nichts geschehen – nur ein blauer Oberschenkel und eine malträtierte Zeitung.«
»Oje! Ich kaufe Ihnen eine neue.«
»Das wird schwierig werden – es war eine Gratiszeitung.«
»Also doch mein Geschenk.« Sie hielt es mir vor die Nase.
»Schokolade. Mag ich leider nicht so.«
»Machen Sie Witze?!« Sie betrachtete einen Moment lang sehnsüchtig die Schokolade, die weit mehr war, nämlich eine pralle Praline, und dann sagte sie: »Na, dann halt nicht« und stopfte sich die Praline in den Mund. Ihre linke Wange sah aus, als wäre sie im neunten Monat schwanger. Als sie fertig gegessen hatte, seufzte sie und fuhr sich wie eine Katze mit der Zunge mehrmals über die Lippen. »Aarauer Brändli Bombe, im Kern Marzipan, drumherum dunkle Schokolade, gefolgt von einer cremigen Schicht, zuäußerst Milchschokolade mit Mandelsplittern durchsetzt.«
»Ziemlich viele Mandeln. Ich bin allergisch gegen Mandeln.«
»Nur ein paar Mandelsplitter.«
»Was ist mit dem Marzipan?«
Verständnisloser Blick.
»Marzipan besteht aus Mandeln.«
»Das wäre mir das Neueste.« Neugierig geworden, zog die Frau das Handy aus der Manteltasche, befragte Siri und las den Wikipedia-Eintrag über Marzipan.
»Da bellt der Kuckuck – Sie haben recht!«
»Ich habe meistens recht.«
»So?« Sie drückte, bis Siri sich wieder in Form eines Strichs meldete, und fragte: »Hat meine Zugnachbarin immer recht?«
Siris Antwort: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
»Lügt meine Zugnachbarin?«
Siri wieder: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
»Wer ist meine Zugnachbarin?«
Und Siri: Interessante Frage, Amelie.
Diese seltsame Frau hieß also Amelie. Laut sagte ich: »Siri ist eben auch nur kein Mensch.«
Amelie nickte. Sie schaute hinaus, die Welt spiegelte sich glitzernd in ihren dunklen Augen. »Ich bin gespannt, ob man heute die Berge sieht: Welches Glückgefühl, wenn sie gestochen scharf dastehen oder eine verträumte Ahnung am Horizont sind. Tagelang halten sie sich verborgen, und plötzlich stehen sie da und tun so, als wären sie nie weggewesen.«
Am Horizont zeigten sich graue Wolken, die Berge waren nicht auszumachen, ein typischer Januarmorgen.
Als wir im Bahnhof einfuhren, stand Amelie auf, die Tasche schon geschultert. »Dir einen schönen Tag, du Pralinenverächterin.« Lächelnd hob sie die Hand zum Gruß und strebte dem Ausgang entgegen, obschon der Zug noch gar nicht hielt. Sie hatte es wohl eilig. Und sie hatte mich geduzt.
Es macht mir nichts aus, nach der Arbeit den Zug zu nehmen, aber es macht mir etwas aus, dass andere das ebenfalls tun. Ich frage mich, warum Menschen nicht harmonisch im Gleichschritt gehen können – vor allem im Gleichschritt mit mir. Warum stoppen sie abrupt vor mir oder trampeln beim Vorbeihasten meine Füße platt? Zombies mit Handy vor der Nase rammen mich oder täten es, wenn ich nicht zur Seite springen würde. Reisende mit Rollkoffern begreifen nicht, dass ihr Wirkungskreis sich durch das Gepäck fast verdoppelt, und schauen mich entrüstet an, wenn sie mir ein Bein stellen. Und warum stehen gesunde Menschen auf Rolltreppen, anstatt zügig voranzugehen? Manchmal höre ich, wie jemand zu seiner Begleitung stöhnt: Ach, die vielen Leute, wie nervig! Offensichtlich zählen sie sich nicht zu den Leuten. Wie schön mussten es unsere Vorfahren gehabt haben, als sie höchstens mit Mammuts oder Bäumen kollidierten – keine Probleme mit Bahnhöfen samt Rollkoffern und -treppen.
An diesem Abend stand ich unruhig auf dem Bahnsteig, weil ich befürchtete, Amelie zu begegnen. Gerade abends bin ich froh um Ruhe. Ich äugte um mich, bereit, mich hinter Säulen, Werbetafeln oder dicken Menschen zu verstecken. Zu meiner Erleichterung tauchte sie nicht auf.
Raffiniert wie ich bin, stieg ich am folgenden Morgen in einen mittleren Wagen ein – Amelie würde mich nicht finden. Amelies Station kam. Ich atmete gerade schon auf, als eine strahlende Amelie vor mir stand. Verflixt! Sie warf die Tasche auf den Boden und nahm mir gegenüber Platz. Keine höfliche Frage, ob der Platz noch frei sei. Durchsuchte Amelie etwa den Zug nach mir? Eine äußerst unangenehme Vorstellung!
Amelie grüßte mich mit einem kleinen Lächeln in den Mundwinkeln. Das schwarze Haar trug sie offen – ein Großteil davon steckte unter einer dunkelblauen Wollmütze mit weißen Tupfen. Sie blickte mich prüfend an. »Was magst du so?«
»Ich verstehe nicht.«
»Was magst du auf die gleiche Weise wie ich Brändli Bomben?«
»Da müsste ich erst wissen, auf welche Weise du sie magst.«
»Wenn sich jemand frühmorgens einen Schokoladenball in den Mund stopft, dann wohl auf gierige Weise. Mein Geschenk war wieder einmal der Beweis: Man schenkt oft das, was einem selber gefällt, nicht unbedingt der anderen. Das ist der Grund, warum viele Geschenke in einer Ecke verstauben, im Küchenschrank vergammeln oder weiterverschenkt werden.«
»Ich schenke nie Dinge, die nicht gefallen.«
»Wie kannst du dir da so sicher sein?«
»Weil die Beschenkten sich freuen.«
»Vielleicht spielen sie dir etwas vor.«
»Niemals.« Ich ließ vor meinem inneren Auge ein paar meiner Geschenke Revue passieren, und auf einmal war ich mir nicht mehr sicher, ob der Roman, den ich so spannend fand, meiner Mutter auch gefiel (sie hatte ihn jedenfalls nie mehr erwähnt) – und was war mit den weißen Orchideen für meine Freundin Annika – hatte sie nicht mal gesagt, dass weiße Blumen sie an Begräbnisse erinnerten?
Ich räusperte mich. »Also, ein Chai wäre nicht schlecht.«
»Keinen Jang Wong Hu Tee?«
»Was soll das sein?«
»Ein chinesischer Schwarztee – würde doch passen.« Amelie lächelte leicht. Ich wusste, worauf sie anspielte, aber ich ging nicht darauf ein. »Einen Chai also, das lässt sich bewerkstelligen.« Sie zog ihren E-Reader aus der Tasche und begann zu lesen. Sie tat das, ohne sich zu erklären – das gefiel mir, es vermittelte mir das Gefühl, dass ich auch tun konnte, wozu immer ich Lust hatte. Ich setzte meine Kopfhörer auf.
Wie letztes Mal schulterte Amelie ihre Tasche, noch während wir in den Bahnhof einfuhren, und winkte mir zum Abschied.
Am nächsten Morgen nahm ich wieder meinen geliebten hintersten Wagen. Falls Amelie zustieg, würde sie mich sowieso finden, und eigentlich war das nicht schlimm. Ich schloss die Augen und merkte erst auf, als jemand sich an meiner Seite des Tischchens zu schaffen machte. Ich öffnete die Augen einen Hauch weit: Ein Becher landete vor mir, eine Hand schwebte auf mein rechtes Auge zu und öffnete es sachte. Wie frech!
»Hier also ein Chai aus der hauseigenen Brauerei«, grinste Amelie, wobei um ihre Augen Lachfältchen entstanden. Der Anzahl und Tiefe nach zu urteilen befand sie sich in meinem Alter, irgendwo in den Dreißigern. Kommentarlos beugte ich mich vor und schnupperte an dem Getränk. Es roch – wie soll ich sagen? – wild. Als wäre Amelie über einen indischen Markt gestreift und hätte von jedem Gewürzhügel eine großzügige Prise genommen. Vorsichtig kostete ich. Der Tee kratzte im Hals – er war staubiger als der Dachboden meiner Oma. Ich schmeckte Safran und Kreuzkümmel, Gewürze, die in eine Paella oder in ein Dhal gepasst hätten, aber nicht in einen Chai. Ich zwang mich zu einem zweiten Schluck – hustete und hechelte (hatte sie Chili reingetan?!).
Amelie schaute besorgt zu. »Nicht gut? Ist zu wenig Zucker drin oder die falsche Teesorte? Ich habe Liptons genommen, etwas anderes hatte ich nicht im Haus. Gell, du erstickst nicht? Wie heißt du eigentlich? Es wäre doch unschön, wenn du sterben würdest und ich wüsste deinen Namen nicht.«
Ein paar Huster später sagte ich mit verwirrtem und erhitztem Mund: »Ich glaube, an der Gewürzauswahl musst du noch arbeiten. Und ich heiße Zazou.«
»Wie das Internet TV?«
»Nein, nicht Zattoo.«
»Jetzt wo du es sagst … Du, es gibt doch eine französische Sängerin, die Zazou heißt.«
»Die heißt Zaz.«
»Aber vielleicht ist Zazou ihr richtiger Name und Zaz die Abkürzung.«
»Möglich, keine Ahnung.«
»Ist ja auch egal. Zazou … kann man wirklich so heißen?« Während sie das fragte, griff sie nach dem Becher und trank. Erwartungsvoll beobachtete ich sie. Zu meinem Erstaunen verkostete sie das Gebräu wie einen exquisiten Wein: »Nicht schlecht. Es müsste aber mehr Zucker rein«, erklärte sie. Entgeistert sah ich zu, wie sie einen zweiten Schluck nahm. War sie irre oder kann man sich über Geschmack einfach nicht streiten? Ich entschied mich für die zweite Möglichkeit. Ich sitze nicht gerne mit einer Irren im Zug.
Amelie deutete hinaus. »Wieder keine Berge, nur Grau.«
»Ich habe keine Ahnung, warum die Sicht manchmal gut ist, dann wieder nicht. Ich weiß nur, dass bei Föhn die Berge gleich hinter dem Münster stehen. Aber warum das so ist? Keinen blassen Dunst.«
Amelie trank den Becher leer – unglaublich! »Unser Geografielehrer war ein Wetterfanatiker. Am Anfang der Stunde erklärte er uns immer, wie das Wetter an diesem Tag zustande kam. Der Föhn ist ein feuchter Südwind aus Italien. Auf dem Weg in den Norden prallt er an die Alpensüdseite. Um weiterzukommen, muss er aufsteigen, dabei entstehen Wolken, die sich auf der Tessiner Seite der Berge abregnen. Der Regen säubert die Luft von Staub- und Schmutzpartikeln, der Wind gelangt frisch gewaschen, sauber und trocken auf die Alpennordseite und schafft damit die ideale Voraussetzung für eine gute Fernsicht. Und ich muss jetzt …« Sie griff nach ihrer Tasche, zwinkerte mir zu und strebte wie immer zu früh dem Ausgang entgegen.
Warum nur diese Eile?
Von meiner Station bis zu Amelies dauert es rund sieben Minuten, neuerdings gefühlt dreißig. Die Zeit hat diese unheimliche Fähigkeit, sich bei der Ewigkeit anzubiedern oder zu Nichts zusammenzufallen und dies gerne im falschen Moment: Die sieben Minuten zu Amelies Station schlugen Wurzeln, dann gesellte sich Amelie zu mir und die restlichen dreiunddreißig Minuten mutierten zu Nanonichts – schon stand Amelie auf, nicht ohne vorher nach den Bergen geschaut zu haben, schulterte ihre Tasche und eilte zum Ausgang. Während sie aufstand und den Mantel oder die Jacke überzog, während sie die Tasche schulterte und mir ein Tschüss zuwarf, gab es keinen Augenblick, in dem sie mir bedeutete, mit ihr gemeinsam auszusteigen. Warum nur?
Mit den Wochen entwickelte sich die Zugfahrt mit Amelie zu einem kleinen Höhepunkt des Tages und wenn Amelie nicht erschien, zu einem Tiefpunkt. Die Begegnung mit Amelie hatte etwas in Gang gesetzt, das mir nicht behagte: Bis dahin hatte ich mich gedankenlos im Zug niedergelassen, hatte gedöst, gelesen oder selbstvergessen Musik gehört. Es war mir einerlei gewesen, wer zustieg, ob ich gut aussah und mich strategisch richtig positioniert hatte oder nicht. Nun war mir diese Unschuld abhandengekommen, nun wartete ich auf Amelie.
Man könnte meinen, dass man Expertin in eigener Sache ist, schließlich lebt man immer mit sich zusammen. Und trotzdem gibt es Situationen, die mich mit Fragezeichen zurücklassen, wie jetzt mit Amelie. Ich hasse Fragezeichen – ich will Punkte: Das sind die Fakten. Punkt. In meinem Leben ist alles an seinem Platz. Punkt. Ich lebe in einer guten Beziehung. Punkt. Ich bin ein vernünftiger Mensch. Punkt. Ich bestimme, wann ich Höhe- und Tiefpunkte habe. Punkt. Keine Frau hat Einfluss auf meine Höhe- und Tiefpunkte. Punkt. Punkt. Punkt.
O ja, ich wusste, dass etwas im Gange war, aber ich ignorierte es. Punkt. Ich hätte die Notbremse ziehen und einen anderen Zug nehmen sollen, doch dieses Vorhaben scheiterte erbärmlich: Ich fand tausend Gründe, warum ich keinen anderen Zug nehmen konnte und fieberte Amelies Station entgegen. Ich wollte, dass Amelie sich zu mir setzte; wollte mit ihr reden, diskutieren, streiten, lachen und eine Menge Gesprächsthemen streifen. Und ich wollte alles über Amelie erfahren.
Doch schon bei der vierten gemeinsamen Fahrt machte Amelie klar, wo ihre Grenzen lagen. Als ich sie fragte, was sie beruflich mache, bedachte sie mich mit einem langen Blick, der gleichermaßen bestimmt und schelmisch war, und sagte: »Halten wir uns an die Regel: keine Koordinaten. Ich möchte nicht über Berufliches reden. Auch nicht über Beziehung und Familie – es gibt genug andere Themen.«
»Und die wären?«
»Bücher, Filme, Essen, Wetter, Leberflecken.«
»Was gibt’s denn über Leberflecken zu sagen?«
»Wo man sie hat, was sie einem bedeuten – Leberflecken sind für mich Abdrücke des Sternenhimmels auf der Haut. Ich finde sie geheimnisvoll und sexy.«
Ich, skeptisch: »Und jetzt willst du wissen, wie viele Leberflecke ich habe und an welcher Stelle?«
»Ich würde nicht wollen sagen – es würde mich interessieren. Falls es dich Wunder nimmt, ich habe sechsundzwanzig. Sie haben alle einen Namen, aber leider vergesse ich entweder den Namen oder welcher zu welchem Flecken gehört.«
»Warum sollte man den Leberflecken einen Namen geben? Das ist sinnlos!«
»Es ist nur dann etwas sinnlos, wenn man es als sinnlos empfindet.«
»Es gibt Dinge, die auch objektiv gesehen sinnlos sind.«
»Zum Beispiel?«
Ich zupfte am Ohrläppchen in der Hoffnung, nützliche Hirnbereiche zu aktivieren, doch bei jeder Idee kam mir gleich ein Gegenargument in den Sinn. Bis mir etwas einfiel: »Es ist sinnlos, etwas zu erwarten oder zu wollen, was man nicht bekommen kann.«
»Finde ich nicht: Unerfülltes Begehren kann sich sehr förderlich auf die Kreativität auswirken. Vieles in der Weltliteratur und Kunst ist entstanden, gerade weil die Kreativen nicht das bekamen, was sie sich ersehnt hatten. Es ist manchmal schöner, etwas zu ersehnen, als es zu bekommen.«
»Ja, sag das mal den Flüchtlingen auf einem überfüllten Boot, das demnächst kentern wird.«
»Deshalb habe ich ja manchmal gesagt, nicht immer. Aber wir können auch mit einem banaleren Thema beginnen: Was ist deine Lieblingsfarbe?«
In diesem Moment setzte sich eine Dame mit toupiertem Haar neben Amelie. Ihr Parfum klatschte die Härchen an meine Nasenwände. »Das ist eine Frage, die sich Kinder stellen«, näselte ich.
»Ach was!« Amelie wandte sich an die Parfumwolke und fragte sie nach ihrer Lieblingsfarbe.
»Lieblingsnarbe? Junge Frau, man fragt fremde Menschen nicht nach Narben!«, kam es von der Dame zurück.
Amelie lächelte. »Lieblingsfarbe – welche Farbe mögen Sie am liebsten?«
»Auch das ist eine seltsame Frage«, erwiderte die Dame. »Aber wenn Sie schon fragen: Apricot gefällt mir. Und was jetzt?«
»Nichts, ich finde es einfach spannend, was Menschen gefällt.« Amelie musterte mich. »Also Zsa Zsa, was ist deine Lieblingsfarbe?«
»Zazou.«
»Zsa Zsa gefällt mir besser.«
»Du kannst nicht nach Gutdünken meinen Namen ändern! Ich heiße Zazou.«
»Aber mich erinnert das an Internet TV. Zsa Zsa ist schöner. Wie die Gabor.«
»Ich höre einfach nicht darauf.«
»Du willst nur von deiner Lieblingsfarbe ablenken.« Sie hielt kurz inne, fügte ein »Zsa Zsa« an und schmunzelte.
»Du willst Kampf? Okay, den kannst du haben, Montmartre.«
Amelies Augenbrauen hoben sich.
»Amélie de Montmartre. Wenn ich Zsa Zsa bin, bist du Montmartre.«
Amelies dunkle Augen wurden eine Nuance dunkler. »Das soll originell sein? Jeder fühlt sich bemüßigt, mich mit diesem verdammten Film in Verbindung zu bringen.«
»Besser damit als mit Conan der Barbar.« Ich grinste breit und auch ein bisschen gemein. Amelie beugte sich vor und boxte mich leicht in den Oberarm.
Das toupierte Haar rauschte. »Fräulein, sie sind mir eine! Man boxt doch nicht, schon gar nicht als Frau eine Frau.«
»Aber als Mann einen Mann schon?«
»Wie soll ich sagen: um Männer ist es weniger schade«, erklärte die Dame.
Montmartre und Zsa Zsa schauten sie verblüfft an und begannen zu lachen.
»Sie retten meinen Tag«, gluckste Amelie.
»Muss der denn um diese Zeit schon gerettet werden?«, fragte ich verwundert.
»So früh ist es für mich nicht«, erwiderte sie in einem Ton, der klar signalisierte: keine weiteren Fragen. Diesen Ton würde ich noch oft hören: Amelie zog Grenzen und das oft an Stellen, die ich nie erwartet hätte.
Als die Dame ausstieg, verließ die Parfumwolke den Wagen, aber ein Rest davon blieb bis zum Hauptbahnhof in der Luft hängen.
»Entzückende Frau«, sagte Amelie.
»Ja, und welch ein Parfum!«
»Rezeptpflichtig – gehört unter das Betäubungsmittelgesetz.« Amelie zwinkerte.
Die Wochen vergingen. Ich erfuhr nichts von Amelie, mal abgesehen davon, dass sie Pralinen und Berge mochte, abscheulichen Chai braute, sechsundzwanzig Leberflecken hatte und eine Menge über das Wetter wusste. Anfangs konnte ich es hinnehmen, dass die Fremde im Zug fremd blieb, ich fand es sogar spannend. Doch allmählich begann mich die Geheimnistuerei zu stören, und je mehr Zeit wir zusammen verbrachten, desto größer wurde meine Neugier. Raffiniert streute ich Fragen nach ihr und ihrem Leben ein, aber sie roch jedes Mal sofort Lunte und antwortete mit Schweigen oder lenkte gekonnt ab.
Nicht dass unsere Gespräche etwas hätten vermissen lassen – sie waren wie eine CD mit Lieblingsliedern, die mich einfach glücklich machte! Aber gerade weil unser Zusammensein beschwingt und reich war, wollte ich mehr über Amelie erfahren und nicht nur Banalitäten wie ihre Lieblingsfarbe (das helle Grün der Birkenblätter im Frühling).
Ich erfuhr nichts. Was nur mochte der Grund sein, dass sie die Koordinaten ihres Lebens hermetisch unter Verschluss hielt? War sie Dompteuse von Salamandern? Fährenfrau? Übersetzerin Suaheli–Deutsch? Besitzerin eines Spielzeugladens? Hatte sie Hobbys? Geschwister? Allergien? Was war der glücklichste Moment in ihrem Leben und welcher der schlimmste? Wünschte sie sich Kinder – hatte sie gar welche? Ich wollte die Eckdaten ihres Lebens erfahren, wollte Schubladen öffnen, wollte einordnen und zuordnen können.
Und es irritierte mich, dass sie sich nicht für mein Leben und für mich als Person interessierte – auch wenn ich es genoss, dass Amelie und ich uns in einem leeren Raum begegneten, unbeschwert von den Geschichten, die wir mit uns herumtrugen und die vielleicht schon lange fertigerzählt waren und jegliche Pointe verloren hatten.
So gesehen waren Amelie und ich auf einem interessanten Weg. Trotzdem hätte ich gern gewusst, ob sie Single war, einen Freund oder Ehemann hatte oder Frauen zugeneigt war. Gefiel ich ihr? Als Mensch, als Frau? Dass ich mich das fragte, sprach Bände – von denen ich aber keinen einzigen aufschlagen wollte, denn sonst hätte ich mir ernsthafte Fragen stellen müssen.
Was ich an Amelie besonders schätzte: Sie war immer für eine Überraschung gut. Einmal saßen wir zu zweit in einem Viererabteil. Amelie holte eine bunte Schachtel hervor. »Spielst du mit?«, fragte sie und hatte die Schachtel schon geöffnet.
»Ich bin keine Spielernatur«, brummte ich. »Was ist das?«
»Memory.«
»Wir sind keine Kinder mehr.«
»Hast du es nicht gern gespielt?«
»Doch, sicher.«
»Eben – deshalb spielen wir Memory.«
Seufzend schaute ich zu, wie Amelie die Kärtchen auf dem freien Sitz neben ihr verteilte. Die Frau und der Mann nebenan sahen uns belustigt zu. Wie war es mir peinlich!
Amelie stieß mich an. »Du darfst anfangen.«
Es blieb mir wohl nichts anderes übrig, als mich in mein Schicksal zu fügen. Von drei Augenpaaren beobachtet, deckte ich zwei Kärtchen auf, darauf Fische, jedoch nicht identische. Bald zeigte sich, dass sich auf allen Karten Fische befanden, mit Ausnahme eines Seepferdchens und eines Seeigels. Für mich sahen die Fische alle gleich aus: mit schillernden Farben, Flossen und Schuppen. Wie sollte ich die auseinanderhalten und mir merken können?
Ich konnte nicht – Amelie jedoch schon: Während ich drei Pärchen rein zufällig fand, graste sie mit schlafwandlerischer Sicherheit ab. Zu allem Übel fühlten der Herr und die Dame sich bemüßigt, mich zu unterstützen. Kaum hatte ich eine Karte umgedreht, bedeuteten sie mir, wo sich die zweite befand, wobei sie nicht auf dieselbe zeigten. Amelie amüsierte sich prächtig. Am Schluss stapelte sie ihre Pärchen und legte meinen Stapel neben ihren. »Dir fehlt die Übung«, erklärte sie gönnerhaft. »Das kommt noch.«
»Das kommt nicht, denn ich habe keine Lust auf eine weitere Geisterfahrt durch diese Meeresunterwelt mit tausend Fischklonen.«
»Aha, eine schlechte Verliererin.«
»Nein, eine, die sich nichts aus Fischen macht.«
Schweigend begann Amelie die Karten einzupacken, schon hing die Tasche über ihrer Schulter, schon sagte sie tschüss und eilte davon.
Ich rief: »Kannst du nicht auf mich warten?« Aber sie hörte mich nicht oder wollte mich nicht hören. Kopfschüttelnd griff ich zu meiner Jacke.
Auf dem Weg zur Bahnstation ging ich einen Block entlang, dessen Treppenhaus nach Weichspüler roch. Manchmal schrubbte eine ältere Dame frühmorgens die Steinplatten vor dem Eingang, sie nahm auch den Schuhrost heraus und putzte die Vertiefung. Eines Morgens im März, ich kannte Amelie schon über zwei Monate, trat ein alter Mann aus diesem Häuserblock und ging vor mir Richtung Bahnstation. Nach ein paar Schritten drehte er sich um, schaute nach oben und lächelte. Er ging weiter, drehte sich wieder um, winkte lächelnd. Bestimmt seine Frau, mit der er schon ein halbes Jahrhundert zusammen war.
Die Szene rührte mich. Ich fragte mich, ob sich in ferner Zukunft jemand auf solch wunderbare Weise auch von mir verabschieden würde. Zweifelhaft.
An diesem Morgen erklärte Amelie, dass sie ein Memory mit einfacheren Bildern für die begriffsstutzige Zsa Zsa auftreiben würde. Ich erwiderte, dass sie aufhören solle, mich Zsa Zsa zu nennen und dass ich nicht auf diesen Namen reagieren würde. Amelie wies darauf hin, dass ich soeben darauf reagiert hätte, deshalb könne sie meine Erklärung nicht ernst nehmen. Bis zur nächsten Station stritten wir darüber; danach erzählte ich ihr von der Abschiedsszene, die ich gesehen und wie sehr sie mich gerührt hatte.
Amelie stützte sich lässig mit dem Ellenbogen auf den schmalen Fenstersims. »Vielleicht war das die Liebhaberin.«
»Aber sicher!«
»Oder der Hund. Oder die Putzfrau, mit der er ein Verhältnis hat.«
»Hör auf, du bist doch nur neidisch.«
»Auf wen genau? Dich, den Hund, den alten Mann oder die Putzfrau?«
»Darauf, dass zwei es auch nach vierzig Ehejahren noch schön miteinander haben.«
»Vielleicht sind sie frisch verheiratet. Oder beide heucheln. Sie denkt beim Winken: Hau bloß ab!, und er: Endlich habe ich ein paar Stunden Ruhe vor der!«
»Ich hätte dir das nicht erzählen sollen – du zerstörst mir das Erlebnis!«
»Das Einzige, was ich in Frage stelle, ist deine Interpretation der Situation, die rein spekulativ war. Fakt ist, dass du nicht weißt, wem er zugewinkt hat, weil du nicht geguckt hast.«
»Es war schön und aufbauend, es so zu sehen.«
»Zum Glück bist du keine Journalistin.«
»Woher willst du das wissen?!«
»Wer so voreilige Schlüsse zieht, eignet sich nicht für den Journalismus.«
»Du weißt aber nicht, ob ich Journalistin bin oder nicht. Du nimmst es bloß an.«
»Ich bin mir sicher.«
»Denk, was du willst – ich werde deine Vermutung weder bestätigen noch berichtigen.«
»Gut.«
Für mich jedoch war nichts gut. Ich hatte Amelies Versteckspiel so satt. »Können wir bitte das Thema wechseln?«
Amelie nickte nur, nahm den E-Reader aus der Tasche und begann zu lesen. So konnte man das Thema auch wechseln.
»Wie billig, zu lesen«, sagte ich.
»Nicht billig, aber billiger als die papierene Version.«
»Sehr lustig!«
»Jetzt sag nicht, dass du sauer bist.«
»Doch.«
»Aber wir haben doch bloß rumgealbert.«
»So nennst du das? Du hast mir ein schönes Erlebnis kaputtgemacht! Unter Herumalbern stelle ich mir was anderes vor.«
»Da gibt jemand einen Kommentar ab und schon ist bei dir alles kaputt? In deinem Universum bist du die Einzige, die etwas kaputtmachen oder kaputtmachen lassen kann. Es steht dir frei.«
»Klar, haut mir einer in die Fresse, entscheide ich, ob mir das wehgetan hat oder nicht. Schießt mir jemand ins Herz, bestimme ich, ob ich sterben will oder nicht.«
Ruhig schaltete Amelie den E-Reader aus. »Warum gleich so krasse Beispiele? Natürlich funktioniert es da etwas anders. Aber es ist trotzdem so: Du hast es in der Hand, ob jemand dir eine Geschichte verderben kann oder nicht. Und du hättest nicht sauer werden müssen, nur weil ich Schrott erzählt habe.«
»Du gibst also zu, dass du Unsinn erzählt hast?«
»Jein.«
»Argh!!« Ich raufte mir die Haare, was Amelie offenbar lustig fand.
»Könnte es sein, dass du mir demnächst den Kopf abreißt?«
»Ja, aber zuerst steche ich dir die Augen aus, schneide dir die Ohren ab und die Zunge in Scheiben.«
»Das hört sich gründlich an – saubere Sache.« Amelie neigte den Kopf zur Seite und blickte mich – wie soll ich sagen? – zärtlich an. Meine Haare auf den Unterarmen stellten sich auf.
Der Zug fuhr über die Brücke, die Häuser waren hier so nah an die Gleise gebaut (oder wohl eher hatte man die Zugbrücke direkt daneben errichtet), dass man in die Wohnungen hätte sehen können, wenn die Fenster nicht die Umgebung gespiegelt hätten. Es gab einen Boxclub, ein Fitnessstudio, einen Lokalradiosender und Wohnungen, in denen mehrheitlich ausländische Familien lebten. Amelie verstaute ihr Handy in einem Außenfach der Tasche und zog Reißverschlüsse zu. Dann schaute sie hinaus und klagte darüber, dass man wieder mal nichts vom Oberland sah. Sie stand auf und zog die Jacke über. Ich wollte sie fragen, warum sie sich immer so früh bereitmachte, aber die Frage blieb mir im Hals stecken – keine Ahnung warum. Ich hob die Hand zum Gruß. Amelie lächelte.
Amelie besaß einiges an Kleidung, und das ist die Untertreibung des Jahres: Sie war Königin über Berge von Klamotten, vermutlich Herrscherin einer Heerschar von Kleiderschränken. Ich hatte sie nie zwei Mal in der gleichen Hose, Bluse oder demselben Pullover gesehen, einzig bei den Jacken gab es Wiederholungen. Ihre Farb- und Musterkombinationen waren oft waghalsig. An diesem Tag trug sie ein schachbrettgemustertes Jackett und darunter eine blau-weiß-lila geblümte Bluse. Und das Verrückteste war: Die unmöglichen Muster- und Farbkombinationen sahen gut aus!
»Was schaust du?«, fragte Amelie.
Errötend beugte ich mich vor und deutete auf den unteren Rand des Jacketts. »Da hängt ein Zettel.«
Amelie schaute an sich hinunter und begann zu lachen. »Schau an, der Preis.« Sie riss am Etikettenfaden, und als der nicht reißen wollte, holte sie eine Streichholzschachtel aus der Tasche. Zuerst verstand ich nicht, was sie damit wollte, aber als sie dann ein Streichholz entzündete und unter den Faden hielt, begriff ich. Der Faden fing Feuer und riss, Amelie reichte mir das Preisetikett. »Wirfst du es bitte in den Abfall? Du sitzt näher dran.«
Ich warf einen Blick auf das Etikett, gespannt, wie viel das Schachbrett gekostet hatte, und staunte nicht schlecht, als da von Hand Fr. 15.- geschrieben stand und über dem Preis in Druckbuchstaben 2ND-BOUTIQUE MARA.
Amelie: »Toller Secondhand-Schuppen – mein Lieblingsladen überhaupt.«
»Ich hasse es, Klamotten zu kaufen. Wenn ich etwas gefunden habe, das mir gefällt, nehme ich es oft in zwei- oder dreifacher Ausführung. Ich verstehe Steve Jobs, der fast nur Blue Jeans und schwarze Pullover trug.«
»Besitzt du auch was anderes als Blue Jeans?«, fragte Amelie lächelnd.
»Ja, schwarze.«
»Wenn du mal keine Jeans trägst, werde ich ein Kreuz an die Decke des Wagens malen.«
»Und ich mache ein Kreuz, wenn du tatsächlich ein Kreuz an die Decke malst«, entgegnete ich augenzwinkernd.
»Wir werden sehen«, sagte Amelie. Dann folgte ein für sie typischer Themenwechsel. »Hast du dir schon mal überlegt, wie viele Stunden, Tage und Wochen du mit Pendeln zugebracht hast und wie viele noch folgen werden?«
»Bewahre nein, das wäre zu deprimierend! Noch schlimmer wäre es zu wissen, wie viele Wochen man auf dem Klo gesessen, Zähne geputzt, gegessen, geschlafen, gewartet, Schuhe gebunden, ferngesehen und gegähnt hat. Bekanntlich macht die Dosis das Gift. Ein paar Minuten pro Tag Zähne putzen ist okay, aber alles Zähneputzen auf einmal – eine Horrorvorstellung.«
»Monatelang Sex wäre aber nicht zu verachten.« Amelie bekam einen genießerisch-verzückten Gesichtsausdruck, und einen Moment lang konnte ich mir nur zu genau vorstellen, wie sie während dieser Monate aussehen würde. »Das würde aber heißen, dass man nach dieser Zeit nie mehr Sex haben könnte, weil man alles auf einmal genossen hätte.«
Amelie nickte ernsthaft, als würden wir über ein reales Problem diskutieren, und fügte hinzu: »Sex ist zwar nicht alles – aber ohne Nichts ist alles sexy. Oder so.«
Wir lachten, dann schwiegen wir einträchtig, bis ich mich überwand und Amelie das fragte, was ich schon lange hatte wissen wollen: »Sag mal, warum brichst du immer so früh auf, ohne auf mich zu warten?«
Verdutzter Blick, leichte Anspannung auf Amelies Gesicht, eine Andeutung nur. Sie sagte gereizt: »Das tut nichts zur Sache.«
»Zu welcher Sache?«
»Dieser hier. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht über Persönliches reden will.«
»Über Kleidung zu reden ist nicht persönlich, über das Verlassen des Zuges schon?«
»Ja.« Demonstrativ schaute sie hinaus. Ebenso demonstrativ zog sie später ihre Jacke über, nahm ihre Tasche und sagte: »Ich frage dich ja auch nicht wegen deiner Augen.« Sie verabschiedete sich und schon war sie verschwunden.
Perplex überlegte ich mir, was an meiner Frage so fürchterlich persönlich gewesen war. Um dann in mich hineinzulächeln: Es gab also Dinge an mir, die sie interessieren würden. Vermutlich aber würde sie sich eher die Zunge abbeißen, als ihr Gesetz zu brechen und mich zu fragen. Beim Aufstehen fiel mein Blick auf die Streichholzschachtel, die Amelie auf dem Tischchen liegengelassen hatte. Ich steckte sie in die Tasche und musste an unsere Ur-Ur-Urahnen denken, für die ein Streichholz nichts weniger als göttlicher Zauber gewesen wäre.
Eines Morgens setzte sich Amelie mir gegenüber und sagte finster: »Fürchte dich nicht.«
»Wie bitte?!«
»Hast du es nicht gesehen? Das blaue Plakat. Auf dem steht: Fürchte dich nicht. Die Bibel.«
»Ach das.« Eine christliche Gemeinde verschwendete seit Jahren Geld für große Plakate mit biblischen Sprüchen.
»Je nachdem, wie ein Lastwagen vor dem Plakat parkt, wäre nur zu lesen: Fürchte dich. Nicht gerade tröstlich. Wenn ich das Wort fürchten lese, erinnere ich mich daran, wie dieses Gefühl sich anfühlt, nämlich Scheiße. Aber vielleicht beabsichtigen sie genau das – wenn ich mich schlecht fühle, brauche ich etwas, das mich davon erlöst, und wer würde sich da besser eignen als der liebe Gott? Warum reicht es den Gläubigen nicht, ihren Glauben zu glauben?«
»Vielleicht wollen sie andere an ihrem Glück teilhaben lassen.«
»Ach was, so selbstlos sind die nicht. Sagen wir mal, ich will mich aus gesundheitlichen Gründen mehr bewegen. Dann habe ich zwei Möglichkeiten: Entweder bewege ich mich mehr oder ich versuche meine Umgebung davon zu überzeugen, dass sie sich mehr bewegt – vielleicht würde mich das motivieren. Anders gesagt: Je weniger ich etwas auf der Reihe habe, desto mehr will ich, dass die anderen es auf der Reihe haben, in der Hoffnung, dass ich es dann auch auf die Reihe kriege.«
»Man will andere bekehren, weil man sich selbst bekehren möchte?«
»Genau.« Amelie rückte näher zu mir und flüsterte: »Siehst du da vorn die junge Frau, die strickt?«
Ich atmete Amelies Körperduft ein. Sie war nicht parfümiert – es war ihr Körper, den ich roch, und ich geriet durcheinander. Ich konnte nicht sagen, ob sie herb roch oder süßlich, sauer, irdisch, bitter. Aber ich konnte die Bilder beschreiben, die Amelies Geruch in mir entstehen ließ: der Hauch von Ferne; das Glitzern der Sonne auf einem See, wenn der Wind mit ihm spielt; der sommerliche Schatten in Griechenland; eine Allee mit blühenden Magnolienbäumen.
»Siehst du, wie sie ins Stricken vertieft ist? Steht sie etwa auf, um andere Leute zum Stricken zu bekehren? Nein, sie hat keine Zeit dafür, sie ist ganz bei der Sache, die ihr sicher viel Spaß bereitet. Sie will niemanden bekehren – sie will den Pulli fertigstellen.«
»Das wird eine Socke.«
»Nein, der Ärmel eines Pullovers.«
»Sie kommt gleich zur Ferse. Ich habe nie kapiert, wie man die macht.«
Amelie machte ihr überhebliches Du-hast-zwar-recht-aber-das-gebe-ich-nicht-zu-Gesicht und fuhr mit ihren Ausführungen fort. »Wenn die Gläubigen und Missionare von ihrer Religion wirklich überzeugt und erfüllt wären, hätten sie keine Zeit für Bekehrungsversuche. Es könnte höchstens sein, dass manche zu ihnen gehen, um von ihnen zu lernen. Das ist dann etwas anderes. Schau dort!« Sie deutete hinaus, wo ein weiteres Plakat stand mit dem Spruch Der Herr gebe dir Frieden. »Ja, Herr, gib mir Frieden, indem du diese Plakate wegnimmst. Amen.«
Amelie hatte sich in die Rede hineingesteigert, ihre Wangen leuchteten mit ihrer roten Lederjacke um die Wette. Sie sah zum Anbeißen süß aus, aber ich würde mich hüten, ihr das zu sagen.
Amelie blickte düster aus dem Fenster. »Der Herr gebe mir Frieden – ha! Man könnte tausend Mal darum bitten und dieser tattrige Greis würde einem nicht ein Quäntchen Frieden schenken.«
Nachdem sie ihre Jacke angezogen und ihre Tasche geschultert hatte, beugte sie sich zu mir – und küsste mich auf die Wange! Sie hob die Hand zum Gruß und rauschte davon. Ihre Wangen hatten sich wieder gerötet.
In meinem Magen blubberte es. Warum hatte sie mich geküsst? Warum heute? Und was plagte sie? Eine Laus schien ihr über die Leber gekrabbelt zu sein – oder vielmehr eine ganze Läusearmee.
Am nächsten Tag schenkte sie mir am Schluss der Fahrt ein Lächeln und gab mir wieder einen Kuss auf die Wange. »Du musst eine Woche ohne mich auskommen«, sagte sie. Mit diesen Worten drehte sie sich um und fort war sie.
Eine Woche ohne Amelie – eine seltsame Vorstellung. Sie war das, worauf ich mich morgens freute; sie war das, was ich ungern ziehen ließ – und sie war das, woran ich beim Zubettgehen dachte. Ob sie Urlaub hatte? Ob sie verreiste? Und wohin? Mit wem? Die letzte Frage provozierte einen dummen Stich ins Herz. Und mein Tag war verdorben.
Es sollte sich zeigen, dass die ganze Woche verdorben war. Zugfahren ohne Amelie war öde, eine ganze Woche auf sie zu verzichten eine Zumutung, aber ich hütete mich, meine Reaktion auf Amelies Fernbleiben innerlich zu kommentieren. Ich hatte ein erfülltes Leben, zumindest ein ausgefülltes – wir waren Zuggefährtinnen, damit hatte es sich. In dieser Woche las ich einen Krimi, am Ende der Woche hatte ich ihn ausgelesen, aber wer der Mörder war und wen er ermordet hatte? Keine Ahnung.
Nach einem nicht enden wollenden Wochenende saß ich am Montag erwartungsvoll im Zug. Bei Amelies Station drückte ich mir die Nase am Fenster platt, und da war sie – Amelie! Sie strahlte mich an, und ich strahlte zurück, unsere Sonne ging auf und flutete durch den Wagen. Ich sagte: »Welcome back!«
Und sie entgegnete: »Yeah, babe.«
»Schön, dass du wieder da bist«, sagte ich. »Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit.«
»Nun, das hängt davon ab, woran man Güte misst«, antwortete sie kryptisch.
»Das ist glücklicherweise jeder freigestellt.«
»Genau, wir sind die Herrscherinnen unseres Kosmos’«, grinste Amelie. »Ist hier etwas Spannendes passiert?«
»Die Strickerin hat einen Schal in Angriff genommen.«
»Gut. Und du?«
»Ich arbeite noch an der Sockenferse.«
Lachend stellte Amelie ihre Tasche auf den Sitz neben sich und sagte: »Zsa Zsa, du bist mir eine.«
»Ich heiße nicht –«
»– Zsa Zsa, ich weiß. Du heißt Zazou. Für mich bleibst du aber Zsa Zsa. Ich kann dich mit Zazou ansprechen, aber innerlich nenne ich dich Zsa Zsa, das kannst du mir nicht verbieten.«
»Hauptsache, du sprichst mich mit Zazou an.«
»Ist das ein asiatischer Name?«
»Nicht dass ich wüsste. Warum?« Ich wusste natürlich, warum sie das fragte.
»Ach egal, Zsa Zsa.« Amelie schlug die Hände vor den Mund und sah mich gespielt erschrocken an. »Ups, sorry!«, rief sie.
»Erstens hast du’s absichtlich gesagt, und zweitens tut es dir nicht leid!«, fauchte ich.
Amelie machte ein zerknirschtes Gesicht.
»Du würdest eine passable Schauspielerin abgeben, falls du nicht eine bist.«
Als Antwort bekam ich einen Schubs und dann einen zweiten. Worauf ich mich mit einem Schlag revanchierte und Amelie aufschrie, als hätte ich ihr mehrere Knochen gebrochen.
»Wer austeilt, muss auch einstecken können, und zwar ohne dabei so erbärmlich zu schreien.«
»Ich habe dir zärtlich über den Arm gestreichelt. Du hingegen hast gnadenlos zugeschlagen.«
»Wenn das zärtlich über den Arm gestreichelt war, bin ich froh, dass ich keine Beziehung mit dir habe – nach zwei Wochen würde ich ins Frauenhaus flüchten.«
Wir erreichten die Eisenbahnbrücke, die Häuserreihe mit dem Box- und Fitnessclub zog an uns vorbei, die Fahne des Lokalradios, die aus dem Fenster hing, flatterte träge im Wind. Amelie schaute selbstvergessen hinaus, bis das Münster sichtbar wurde und dahinter die Berge, die in der Morgensonne leuchteten. Sie begann zu strahlen. »Diese treuen Kerle und Damen, so wunderschön.« Sie schulterte die Tasche, dann hob sie zögernd den Arm und strich mir mit der Hand über die Wange. »Ich kann auch so«, sagte sie verlegen lächelnd und fort war sie.
Ihre Berührung blieb wie ein samtener Abdruck auf meiner Haut, und nun flatterte mein Herz ebenfalls im Wind.
Der April brachte hier und da die Ahnung des Frühlings, um sie dann wieder schadenfreudig mit Schneeregen kaputtzumachen. Seit drei Monaten fuhren Amelie und ich miteinander, und mit jeder gemeinsamen Fahrt wurde ich neugieriger auf sie. Eines Morgens dann nahm ich meinen Mut zusammen und sagte so beiläufig wie möglich: »Du könntest mir deine Nummer geben – man weiß ja nie.«
Ich musste nicht aufschauen, um ihren Blick zu spüren, der halb stechend, halb prüfend und halb wütend war. Ich weiß, das ist eine Hälfte zu viel, aber so war es – eineinhalb Mal intensiver als sonst. Als ich diesem Blick begegnete, wurde mir siedend heiß – es war nur zu deutlich: Ich hatte eine unsichtbare Grenze überschritten.
Sie sagte: »Geht nicht.«
Nochmals den Mut zusammenreißen. »Und warum nicht?«
»Es war unsere Abmachung.«
»Es war deine Bedingung.«
»Der du zugestimmt hast.«
»Ich habe nichts dazu gesagt.«
»Das nennt man schweigende Zustimmung.«
»Es war ja bloß eine Frage.«
»Du hast gegen die Regel verstoßen.«
»Amelie, übertreibst du nicht ein bisschen?«
In ihren Augen flackerte Feuer auf – kein gemütliches Kaminfeuer, sondern ein Buschfeuer, das sich explosionsartig ausbreitete.
»Schon gut, ich habe verstanden.« Ich hatte überhaupt nicht verstanden.
»Dann ist gut.« Und Amelie begann übergangslos von etwas anderem zu reden. Ich ließ mich darauf ein, einmal mehr verwundert, warum ihr das Wahren ihrer Privatsphäre so wichtig war.
Beim Abschied gab Amelie mir nah beim Ohr einen Kuss und sagte: »Bis Montag.«
»Nein, leider nicht bis Montag«, erwiderte ich. »Ich fahre drei Wochen in Urlaub.«
Amelie schaute mich überrascht an, und mir schien, als würde sie zusammenzucken. Sie sagte: »Ach, so«, dann umarmte sie mich ein paar Wagenradumdrehungen lang. Sie murmelte: »Pass auf dich auf«, und wandte sich ab.
Ich ergriff ihre Hand.
Irritiert drehte Amelie sich um.
Ich sagte: »Wenn ich zurück bin, möchte ich dich besser kennenlernen. Ich finde, es ist an der Zeit. Meinst du nicht auch?«
Das zu sagen hatte ich nicht geplant, es sprudelte einfach aus mir heraus – ich wunderte mich über meinen Mut oder meine Unbedachtheit. Erschrocken zog Montmartre ihre Hand zurück. »Ich … Was? Muss jetzt gehen.« Ich sah noch ihren Rücken, dann war sie verschwunden.
Der Urlaub: Alles war so, wie es sein musste: der Himmel himmelblau, der Strand weiß, das Meer erfrischend, die Wanderungen traumhaft und die Abende lauschig – die besten Voraussetzungen, um die Seele baumeln zu lassen. Meine aber ruckelte eingerostet. Vielleicht hatte ich die falsche Lektüre mitgenommen, vielleicht waren die Gespräche mit Jo zu absehbar, vielleicht war alles zu absehbar. Vielleicht aber lag es an etwas anderem – an jemand anderem. Aber nein, so beschloss ich, an Amelie lag es nun wirklich nicht. Was immer es war, es ruinierte meinen Urlaub.
Als ich nach meiner Heimkehr die Wohnungstür hinter mir schloss, schüttelte ich den Kopf. Ich fühlte mich weder aufgetankt noch lebendig noch inspiriert. Im Bett dachte ich an Amelie, und eine riesige Vorfreude überkam mich.
Wie ungeduldig ich darauf wartete, dass wir Amelies Station erreichten! Aufgeregt hielt ich nach ihr Ausschau, als die Reisenden zustiegen. Doch der letzte Fahrgast war hereingekommen, der Zug setzte sich in Bewegung … keine Amelie. Bestimmt erscheint sie morgen, versuchte ich mich zu beruhigen. Ich gab mich der Musik hin – etwa zehn Takte lang, dann stand ich auf und ging den ganzen Zug ab auf der Suche nach ihr. Erfolglos.
Am nächsten Tag wieder keine Amelie.
Weder am Mittwoch, noch am Donnerstag, noch am Freitag.
Nicht in der nächsten Woche.
Oder in der übernächsten.
Ein Monat verstrich, fünf Wochen.
Keine Amelie.
Erst dachte ich, dass sie krank war oder im Urlaub. Dann tippte ich auf eine Weltreise. Oder einen Flug zum Mars. Oder hatte sie die Stelle gewechselt? War sie gar gestorben?! Mied Amelie mich, weil ich sie hatte kennenlernen wollen?
Wo um Himmels willen war sie nur?!
Die Nadel im Heuhaufen
Ich würde dich nicht suchen,
wenn ich dich nicht gefunden hätte.
Tilly Boesche-Zacharow
Amelie
Als ich Zsa Zsa das erste Mal sah, wurde die Welt eine andere. Ich erinnere mich an diese Begegnung, als wäre sie eine Szene aus einem Film: Die Geräusche wurden ausgeblendet, ein Orchester begann mit schmalzigen Geigen, Harfen und einem Chor, der in höchsten Tönen sang; Scheinwerfer wurden auf Zsa Zsa gerichtet, das restliche Licht ging aus; die Zeit nahm die Lupe heraus, es gab nur noch die Schöne und mich, getroffen vom süßen Cupido, wie ihn Julius Kronberg gemalt hatte: ein frecher kleiner geflügelter Bub, der vergnügt zielt und trifft. Ja, Cupido ist ein Kind, denn Verliebtsein ist eine kindische Angelegenheit, jenseits jeglicher Vernunft. Und ja, Verliebtsein ist wunderschön – aber sehr, sehr gefährlich. Vor allem für mich.
Wie hatte es mich erwischt! Und das durfte nicht sein. Ich scheuchte Cupido weg, als hätte das etwas ändern können: Der Pfeil steckte ja schon im Herzen.
Ich hatte an diesem Tag einen Termin mit meinem Bruder – es gab Geschäftliches zu besprechen. Zsa Zsa saß ein Abteil weiter, versunken betrachtete sie die dämmrige Landschaft, ab und zu strich sie sich das Haar hinters Ohr. Sie strahlte anmutige Gelassenheit aus. Und was für ein Gesicht: als hätte der Ferne Osten ihr beim Vorbeigehen Kusshändchen zugeworfen. Sie sah nicht europäisch aus, sie sah nicht asiatisch aus, sie sah aus wie beides zusammen und doch keines davon, und das war wunderschön.
Weißt du, hätte ich mich in meiner Bestform befunden, wäre ich zu ihr gegangen und hätte auf Teufel komm raus mit ihr geflirtet. Glücklicherweise jedoch befand ich mich in einem wohltemperierten Zustand. Ich blieb sitzen, beobachtete, wie sie bei der Ankunft im Hauptbahnhof die Kopfhörer absetzte und in eine Schachtel legte; wie sie die Zeitung glattstrich und bei ihrem Rucksack sorgsam alle Reißverschlüsse zuzog.
Ich habe in meinen Beziehungen verdammt viel Schaden angerichtet, so dass ich mir geschworen habe, nie mehr eine einzugehen. Du findest das übertrieben? Du kennst mich eben nicht: Ich bin oft zu viel des Guten und dann wieder des Guten viel zu wenig und mache die Liebe kaputt. Seit Jahren erlaube ich mir deshalb nur Affären. Diesem Credo würde ich treu bleiben. Und doch nahm ich am nächsten Tag um die gleiche Zeit wieder den Zug, in der Hoffnung, der geheimnisvollen Frau erneut zu begegnen.
Ich hatte vorgehabt, Zsa Zsa nur ein bisschen zu beobachten, aber die durchtriebene Verliebtheit schubste mich in Zsa Zsas Abteil und hieß mich die Tasche auf sie fallenzulassen. Auf meine Frage, ob alles in Ordnung sei, antwortete Zsa Zsa etwas, was ich in meiner Aufregung nicht verstand. Aber ich hörte, wie ihre dunkle Stimme weiche Worte und Sätze formte, die geschmeidig in meine Ohren flossen und mich in Aufruhr versetzten. Wider alle Vernunft fuhr ich von da an täglich diese Strecke. Im Hauptbahnhof angekommen, sputete ich mich, um den Zug zu erwischen, der mich zurück nach Hause brachte.
Was war ich für ein Dummkopf! Ich tat das alles, obschon mein Gesetz unumstößlich blieb: Es würde nichts geschehen. Ich wäre Gift für Zsa Zsa, ich bin Gift für alle – im Moment vielleicht nicht, aber irgendwann bestimmt. Dass ich mich nicht widersprüchlicher hätte verhalten können, war mir bewusst, aber ich versuchte, mich in dieser Widersprüchlichkeit eindeutig zu verhalten. Ungeduldig wartete ich darauf, dass Zsa Zsa etwas tun oder sagen würde, was mein Verliebtsein zerstörte. Ich wartete vergebens.
Erst als Zsa Zsa in den Urlaub fuhr, fielen die Scheuklappen herunter, und ich begriff, was immer klar gewesen war: Es gab nicht nur sie und mich und den Zug – Zsa Zsa führte ein Leben außerhalb, vermutlich war sie in einer Beziehung und würde nun viel Zeit mit ihr verbringen.
Nun, da sie fort war, glücklich mit ihrer Liebe, nun spürte ich einen Klumpen in mir entstehen, der größer wurde und schwer. Er dröhnte: Dummkopf, was hast du dir gedacht – wie konntest du dein Herz vergeben?! Wie töricht von dir, Dummkopf! Jetzt stehst du ohne dein Herz da, Dummkopf, Zsa Zsa turtelt im Urlaub mit ihrer Liebe und denkt keine Sekunde an dich, Dummkopf! Der Klumpen redete pausenlos auf mich ein, schalt mich, warf mir vor, dass ich ein Nichtsnutz sei, wertlos, dumm und nochmals dumm.
Als ich Zsa Zsa Anfang des Jahres kennengelernt hatte, war in meinem Leben kein Eisberg in Sicht gewesen, ich genoss eine ruhige Zeit in warmen Gefilden. Aber das Verliebtsein und mein Verbot, mich zu verlieben – dieser unlösbare Widerspruch – trieben mich allmählich in eisscholliges Gebiet. Meine labile innere Ordnung geriet in Schieflage, bis sie das gleiche Schicksal ereilte wie die Titanic: Ich hörte das Eis knacken und brechen, ich glitt aus, ich brach durch. Und sank …
… sank wie eine Bleikugel, viel zu schnell, viel schneller als sonst. War das so, weil ich unglücklich verliebt war? Weil ich wieder daran erinnert wurde, dass die Liebe für mich ein Minenfeld ist, das ich nicht mehr betreten kann und will? Ich weiß es nicht. Ich wusste nur, dass die Welt sich einmal mehr komplett veränderte …
… in der morgendämmerung mit den unerträglich fröhlichen vögeln wälze ich mich von einer bettseite zur anderen, kaskaden von angst im bauch ..............................
............ich drücke das kissen fest gegen diese angst, der druck auf den bauch gibt mir trost, after eight häppchen großen trost – einen klitzekleinen moment lang und schon wieder vorbei ......
............ich sollte aufstehen ............ nach dieser schlaflosen nacht ............ müde bin ich, geh nicht zur ruh, schließe meine äuglein nicht zu .........
...... das graue licht der morgendämmerung ist so schwarz, als gäbe es kein einziges photon im ganzen kosmos ........ich lebe in einem schwarzen loch, wo die materie abartig dicht ist, kein licht kann mehr abstrahlen, nie mehr, es verschluckt alles, was sich ihm nähert ......
...... bitte, nur ein bisschen schlafen! ich weiß, ich kann nicht, ich sollte aufstehen, kaffee trinken, an etwas schönes denken ............ich finde nichts schönes, stattdessen verletze ich mich an den bruchkanten meines lebens ............ mit gedanken, die kübel grauer farbe organisiert haben und alles übermalen, was sie in die finger kriegen ............
.........ich kann nicht aufstehen, will nicht ............ nur ein kleines bisschen schlaf, bitte! ............ es sind die därme, die mich schließlich aus dem bett treiben, wieder durchfall – woher das zeug kommt, ist mir ein rätsel, wo ich doch kaum mehr etwas hinunterbringe ...............
......... und wenn ich dann am küchentisch sitze ............ starre ......... starre ......... starre ich auf den kaffeelöffel .........
......... der tag uneinnehmbar vor mir ............ spiegelglatte wand ............
......... die gedanken sind an der leine, sie wollen flüchten und erwürgen sich dabei fast.
.........ich habe angst, ich habe solche angst …!
......... und ich weiß nicht wovor ............... und ich weiß nicht wovor nicht ......
........................ allgegenwärtige panik .....................
Spätestens jetzt muss ich mich geschlagen geben, muss anerkennen, was Sache ist: Der Liebeskummer hat mein fragiles chemisches Gleichgewicht im Hirn zerstört. Die Depression hat mich wieder.
Depression … Das Wort ist dir sicher geläufig. Vielleicht hast du auch schon gesagt: Ich bin heute total deprimiert und meintest damit, dass du niedergeschlagen und betrübt warst, schlechte Laune oder keine Freude empfunden hast. Vermutlich ging dieser Zustand bald vorbei, spätestens nach ein paar Tagen. Nun, dieses Deprigefühl meine ich nicht, sondern die Krankheit Depression, der hartnäckige Gast, den man nicht mehr loswird, im Schlepptau Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit, schlechte Laune, Angst und Erschöpfung. Sie raubt dir den Schlaf und die Konzentration, sie benebelt dich mit Furcht, sie zerschmettert dein Selbstvertrauen, bürdet dir Schuldgefühle auf, klaut dir die Lebensfreude, raubt die Farben, zerstört Sinn und jegliche Perspektive.
Das Wort Depression stammt aus dem Lateinischen und bedeutet niederdrücken. Ich finde das zu milde ausgedrückt: Hineinrammen trifft es besser, und zwar ungespitzt in den Boden. Wenn du schon einmal versucht hast, einen Pfosten mit stumpfem Ende in die Erde zu schlagen, weißt du, welche Wucht und Brutalität man dazu braucht – und dass der Pfosten eher splittert, als dass man ihn hineinbringt.
Ja, die Depression schlägt mich in die Erde, ich splittere, schnappe nach Luft und schlucke Dreck. Ein Loch im Bauch öffnet sich, und schreckliche Gefühle kringeln sich darin wie Maden. Angst legt Stein auf Stein, bis sie als bedrohliche Mauer vor mir steht. Das Blut verliert sein leuchtendes Rot und graut die Zellen ein – fifty shades of fucking grey. Immer deutlicher zieht ein Riss durch die Welt, und diesen Riss versuche ich erfolglos zu kitten.
Wie gut ich doch die Anzeichen kenne. Wie stur ich sie nicht anerkenne!
… dafür erkenne ich umso deutlicher, was ich in den sorglosen zeiten vergesse: wir leben in einer illusion – das lebendtote zapft unsere energie an, macht uns glauben, dass wir leben, dabei vegetieren wir nur, es sei denn, wir stoßen zur wahrhaften welt vor.
hätte der wasserstoffkern einen durchmesser von der größe eines menschen, wäre das elektron 0,1 millimeter klein und würde den atomkern in 50 kilometer entfernung umkreisen. 50 km leere – die materie ist nichts! ......... das dasein ein flüchtiges kräuseln auf einem meer von nichts......... nur schaum, der von den gebrochenen wellen übrigbleibt, schon vergangen, schon aufgelöst im nichts.........nichtig und flüchtig – alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, von seiner Plage unter der Sonne? Die Sonne geht auf, und die Sonne geht unter. Der Wind weht nach Süden, er kreist nach Norden, er dreht und dreht und weht und kommt zum Ausgangspunkt zurück. Alle Flüsse fließen ins Meer, und das Meer wird nicht voll.
meine lieblingsstelle in der bibel, kohelet ist mein seelenverwandter.
ich möchte aus meinem kopf fliehen … denn alles, was meine gedanken berühren, verwelkt ......... kaffee kann manchmal kleine, leichte gedanken aus dem hirnsumpf locken – und alles ist einen lichtblitz lang anders ......... dann sinke ich in den alarmierten angstzustand zurück ......... die zeit fließt träge wie wasser in einem ölverseuchten fluss und stinkt.
Als Zsa Zsa aus dem Urlaub zurückkehrte, war ich innerlich so zerstört, dass ich den Zug nicht mehr nehmen konnte, ich schaffte es kaum noch vor die Tür. Kurz war diesmal die Anlaufzeit gewesen, bis die Depression die Diktatur erputschte.
Wie jedes Mal wurden meine Schwestern lästig und baten um Einlass, aber ich verbarrikadierte mich in meiner Wohnung und schickte sie zum Teufel. Da ließen diese Niederträchtigen meine Wohnung vom Hauseigentümer öffnen und brachen rücksichtslos in meine fragile Welt ein. Die Stimmen meiner Schwestern schrillten in meinem Kopf, verzweifelt hielt ich mir die Ohren zu. Delphine und Josephine beschämten mich, indem sie aufräumten, dabei ging mein Abfallhaufen sie einen Dreck an. Ich verweigerte mich ihren Vor- und Ratschlägen – aber ich wäre besser kooperativ gewesen, denn nun entschieden sie, dass ich umfassende Betreuung brauchte.
Meine älteste Schwester Lea blickte mich theatralisch-sorgenvoll an, dabei war es ihr scheiße egal. »Du kannst nicht hierbleiben, und das weißt du. Entweder du kommst mit zu einer von uns oder du musst in die Klinik.« Sie tätschelte meinen Arm. »Du bist fürchterlich abgemagert, und wer weiß, vielleicht willst du dir etwas antun – es wäre nicht das erste Mal. Wenn du nicht freiwillig mitkommst, machen wir es mit Freiheitsentzug. Das möchten wir aber nicht.«
Weinend sank ich aufs Sofa. »Ihr wollt mir das Letzte nehmen, was ich noch habe, ich habe doch nur noch meine Wohnung, ich darf niemanden lieben, schon gar nicht Zsa Zsa.« Ich vergrub mein Gesicht im Kissen.
Lea setzte sich neben mich. »Komm mit zu mir, da bist du gut aufgehoben.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Dann musst du in die Klinik.«
»Ihr wisst, dass ich es dort hasse!«
»Wir haben eine gefunden, die etwas für dich sein könnte: Der Klinik Hofberg ist ein Bauerngut angeschlossen. Dort kannst du mitarbeiten, soweit es dir möglich ist. Sie haben Kühe, Ponys, Ziegen, Schafe, Kaninchen, Katzen, Hühner und so weiter.«
Die Aussicht auf Tiere ließ mich meine Meinung ändern. Ich liebe Tiere, sie geben keine blödsinnigen Ratschläge; Tiere sind wahrhaftig, sie lassen mich so sein, wie ich bin. Sie fordern nicht, sie labern nicht, sie scheißtherapieren nicht.
Weinend gab ich nach.
Zazou
»Was ist los mit dir?« Mutter röntgte mich über ihre Lesebrille hinweg. Sie war dazu übergegangen, die Gläser immer auf der Nase zu tragen; sie scherzte, dass sie sonst einen Brillenarm vom Auf- und Absetzen bekäme. Es war Anfang Juni, wir saßen in ihrem Garten am schmiedeeisernen Tisch, die Frühsommersonne brachte Mutters von Grau durchzogenen krausen Rotschopf zum Glühen.
»Nichts«, erwiderte ich, während ich lustlos in der Teetasse rührte.
»Damit kommst du vielleicht bei anderen durch, aber nicht bei mir.« Sie hatte diese Miene aufgesetzt, die ich nur allzu gut kannte. Sie bedeutete so viel wie: Ich werde nicht nachlassen, bis du mit der Wahrheit herausrückst