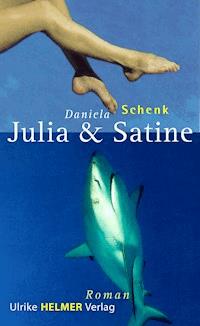Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
BHs hängen an der Stehlampe, gemeinsames Duschen entpuppt sich als Liebeskiller, eine kleine Schwedin stellt den Alltag auf den Kopf, eine Katze liebt Teppiche und Tastaturen, ein Stricknadeltest entlarvt Lesben, der Grill stellt die Gleichberechtigung in Frage, das Gedächtnis lässt nach, suspekte Tampons schwimmen im Fluss, Schnecken erteilen Lektionen fürs Leben und Automaten haben Brüste. Da wird gelöffelt, geduscht, knutschgefleckt, geputzt, gereist, falsch und richtig Geschirr gespült, Rad gefahren, gesaugt, gegrillt, gewartet, auf die Ladentheke geknallt – und immer klafft eine entzückende Lücke zwischen dem was wir gern hätten und dem wie es ist. In den Geschichten steckt eine Prise David Sedaris, eine Messerspitze Ellen DeGeneres und viel Humor à la Schenk. Sowie jede Menge Hopplas und Gestolpere, eine Liebeserklärung an die kleine Schwedin, an Missgeschicke und an die Liebe mit ihren zahlreichen liebenswerten Illusionen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniela Schenk
Das Leben ist ein Witz
Geschichten und Kolumnen über charmante Unmöglichkeiten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Über die Autorin
Willkommen im Lebens-Kino
-- Liebesdichtung & traurige Wahrheit --
Geschirr spülen
Das Löffeln
Warum in die Nähe schweifen, wenn das Ferne so gut?
Gemeinsam duschen
Der Knutschfleck
Zusammen alt werden
-- Die kleine Schwedin & andere nordische Abenteuer --
Die kleine Schwedin und der Gender
Die kleine Schwedin und das Basilikum
Die kleine Schwedin kommt in die Schweiz
Die kleine Schwedin und der Regen
Die kleine Schwedin und die Kunst
Die kleine Schwedin und die Aliens
Mein BH an der Stehlampe
Würstchen im Pyjama
Der Notfallkopf
Die Musikalität von Bügeleisen
-- Frauen --
Die unweigerliche Vergesslichkeit reiferer, aber durchaus attraktiver Damen
Meine tapferen Hausfrauen
Die Tretordnung in der Radwelt
Maria & Josefine
Mit dem Stricknadeltest ins Lesbenglück
Ein Tampon kommt selten allein
Ein Frau ohne Diät ist wie das Paradies ohne Apfel
-- Zuhause --
Heidi, mein Teppich
Katzenvieh und Heidi, mein Teppich
Wie Patricia Highsmith mein Leben veränderte
Ich huste, also bin ich
Im Herzen oder auf der Haut?
Sex ist die natürlichste Sache der Welt
Mein Schreiballtag
Autorin, beleidigt
-- Kuriose Welten --
Hinauf oder hinunter?
Automat mit Brüsten
Einer Gratiszeitung schaut man nicht ins Maul
Muss ich dich siezen oder darf ich Sie duzen?
Mein Gedächtnis ist ein Sack voller Flöhe
Murphy, der Sauhund
Die Grillen der Männer
-- Allerlei --
Ich hoffe, Sie wohlauf sind heute
Lieber reich und gesund als arm und krank
Sie, dem Eisfach entstiegen
Weisse Wolle und andere schwarze Katzen
Weil es so ist, wird es anders
Bananentraum
Danke!
Impressum neobooks
Über die Autorin
Alle ihre Bücher sind Bestseller
(im Paralleluniversum, das dritte von rechts)
Übersetzt in 27,3 Sprachen
u.a. Klingonisch, Miauisch, Lesbinionisch, Satirisch, Basisch, Oktavisch, Ironisch und Niederhochberndeutsch
Nr. 1 Autorin
in der Kategorie:Daniela-Schenk-Romane
Leser- und Medienstimmen:
… ich verstehe kein Wort, aber es ist unglaublich lustig!
…auf jeder Seite Wörter - phantastisch!
… ich habe dank diesem Buch abgenommen – gleich alle zehn Vorhänge …
... einmalig – was Daniela Schenk hier schreibt,
kriegt man nur hier zu lesen.(M. Weich-Rawicki)
… noch nie wurde so prägnant über Heidi Klum und Tampons geschrieben!
… ab Seite 350 steigert sich Schenk noch –
wie ist das möglich?!(die Frankfurter Spezifische)
_______________________________
Erstes Buch, das inholografischer und vierdimensionaler Version erhältlich ist.
__________________________
Daniela Schenk:
Erfinderin des weltberühmten Stricknadeltests,
der in der Lesbenwelt für Furore gesorgt hat
Prämierte Kennerin der kleinen Schwedin™
Schweizermeisterin in Geschirrspülen
(Kategorie:mit verbundenen Augen)
mehr Informationen:
Homepage, selbstgebastelt:
Willkommen im Lebens-Kino
Einmal träumte ich, dass ich verfolgt wurde. Dieser Traum fühlte sich so real an, dass ich zu Tode erschrocken aus dem Bett sprang und flüchtete. Dummerweise waren meine Beine in der Decke verwickelt, ich fiel der Länge nach hin, rappelte mich auf und stürmte in den Schrank (nein, das war nicht die Türe), rannte die Treppe hinunter und riss ein kleines Fenster auf, um zu entfliehen (ziemlich clever von mir, nun gut, die Haustür gleich nebendran wäre auch eine Option gewesen). Erst jetzt erwachte ich und verstand, dass ich von einem Albtraum gejagt worden war. Meine Knie verfärbten sich trotzdem blau.
Menschen mit einem Nahtoderlebnis erzählen, dass ihr Leben wie ein Film vor ihrem inneren Auge abgelaufen sei. Ich hoffe, es gibt bei der Vorführung eine Vorlauftaste, denn ich will nicht zuschauen müssen, wie ich tausendmal duschte, tausende von Kilometern Rad oder Auto fuhr, Tonnen von Essen verschlang, Hektoliter pinkelte, Böden um Böden staubsaugte, mich anzog, umzog, auszog, endlos auf Bildschirme starrte und Tasten traktierte.
Mich interessieren mehr die Glanzlichter meines Lebens: der erste Schultag, die Liebe, eine Medaille im Skirennen, bestandene Prüfungen, die Auftritte als DJane, das Erscheinen meiner Bücher, Geburt und Tod. Nur gibt es solche Ereignisse nicht massenhaft, aneinandergereiht würden sie wenige Tage oder Wochen ergeben.
Wie gut ist es da, gibt es die Momente, die zwar nicht einschneidend sind, an die man sich aber gern erinnert und von denen man noch lieber erzählt. Ich meine diese Augenblicke, als etwas anders als sonst gelaufen ist – was in den meisten Fällen bedeutet: Es istschiefgelaufen. Diese Erlebnisse sind unerwartet, sie verblüffen, verärgern oder überraschen uns, aber bringen uns niemals zum Gähnen. Sie entstehen, wenn Vorstellung und Wirklichkeit auseinanderklaffen, was zu bemerkenswert blauen Knien führen kann – aber einiges zu erzählen gibt.
Dieses Buch enthält Geschichten und Kolumnen, die von diesen charmanten Unmöglichkeiten des Lebens erzählen, wenn wir nicht anders können, als zu rufen (oder lachen, stöhnen, jammern, fluchen): „Uii, manchmal ist das Leben echt ein Witz!“
Beim Einkaufen sagte kürzlich eine junge Frau zu mir, „pardon, Ihnen ist etwas aus der Manteltasche gefallen“, und reichte mir ein kleines, gefaltetes Papier. Ich nahm es gerührt entgegen und bedankte mich zweimal.Ich brachte es nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass ichdiesen Zettel aus einer Zeitschrift gerissen und darin meinen Kaugummi entsorgt hatte.
Eine Woche später saß ich im Flughafen am Gate, den Laptop auf dem Schoss, daneben eine Schachtel mit Lutschpastillen (Spitzwegerich), die ich im Akkord lutschte. In meiner Gier fiel mir eine zu Boden. Ich war zu faul, die Lutschpastille zu suchen, außerdem war vorhin eine Putzfrau mit ihrem Putzwagen vorbeigegangen, die wollte sicher auch etwas zu tun haben. Hinter mir (mit dem Rücken zu mir) saß ein Mann. Ich nahm am Rande wahr, dass er von seinem Platz aufstand und herumhantierte.
Wie war ich erstaunt, als er sich zu mir beugte und voller Ernst sagte: „Sie haben da was verloren“ – in der Hand die entflohene Lutschpastille! Perplex nahm ich sie entgegen und bedankte mich. Wie aufmerksam dieser Mann war, er konnte vielleicht nicht einen Mantelknopf oder gar eine Ecstasy-Pille von einer Lutschpastille unterscheiden, sein Vorhaben jedoch war äußerst edel.
Nach dem Flug saß ich im Zug und korrigierte einen Text, als ich merkte, dass der Deckel des Stiftes verloren gegangen war. Ich suchte im Rucksack, in der Manteltasche, unter dem Sitz – erfolglos. Im Abteil neben mir saß ein junges Paar. Die Frau hatte meine Suche beobachtet und fragte, was ich verloren habe.
„Nur den Deckel eines Stiftes, nichts Wichtiges.“
Schon bückte sich die Frau und guckte unter den Sitzen, auf den Sitzen und dazwischen, sie ging ins nächste Abteil und bückte sich wieder. Die Dame, die dort saß, deutete auf den Boden: „Könnte es das sein? Ich habe gesehen, dass sie (gemeint war ich) etwas sucht.“ Die junge Frau schaute nach, nein. Nun holte der Mann eine Lampe hervor, die wie eine Tafel Schokolade aussah, und leuchtete in dunkle Ecken. Ich sagte: „Wie nett von Ihnen, aber es ist nicht so wichtig.“ Während ich mich mehrmals bedankte, suchte die Frau rege weiter. Vielleicht wurde sie fündig – was sie wohl mit dem Deckel gemacht hatte?
In allen drei Fällen war ich gerührt wie Apfelmus – welch nette Menschen es doch gibt! Ihre Freundlichkeit brachte zwar nichts – trotzdem!
Was mir diese Szenen wohl sagen wollten?
Achte auf die kleinen Dinge?
Benütze den Papierkorb?
Wer verliert, dem wird gefunden?
Das finde ich wohl erst am Ende meiner Tage heraus, wenn ich im jenseitigen Kino sitze und den Film meines Lebens gucke.
-- Liebesdichtung & traurige Wahrheit --
Geschirr spülen
Ich liebe Tove heiß und innig, aber sie hat eine fatale Schwäche: Sie ist Schwedin. Man könnte denken, dass dies keine Schwäche, sondern ein Vorteil ist: Seit den Siebzigerjahren wissen wir, dass Schwedinnen nicht nur blond, sondern auch heiß sind. Die unzähligen Softpornos aus dieser Zeit sind der Beweis – Schwedinnen treiben es in Blockhütten, auf Elchen, unter der Mittsommersonne, auf Seen und während OP-Eingriffen. Sie haben in diesem Bereich also viel zu bieten.
Leider leben wir nicht nur von heißem Sex in kalten Nächten allein, manchmal müssen wir Geschirr spülen. Und hier öffnet sich eine Kluft zwischen Tove und mir, mehr noch: Es entpuppt sich als Kulturkampf zwischen der Schweiz und Schweden.
Ich habe leichtsinnigerweise gedacht, dass sich unsere beiden Länder gut verstehen, schließlich kommen sie im Alphabet hintereinander; schließlich waren beide Länder im Krieg neutral (ha ha!), schließlich leben die ABBA-Frau Anna-Frid und der IKEA-GründerIngvar Kamprad in der Schweiz; schließlich hätten die Schweiz fast den schwedischen Kampfjet Gripen gekauft; und schließlich hat eine Umfrage ergeben, dass die Schweizer am liebsten Schweden als Nachbarland hätten.
Eine ideale Situation für unsere Beziehung also – jedenfalls solange Tove und ich das Bettzeug zerknüllen und auf dem IKEA-Sofa ABBA hören. Trete ich jedoch in Toves Küche, beginnt ein erbarmungsloser Kulturkampf.
Ich ging zu einer Zeit zur Schule, als der Hauswirtschaftsunterricht Pflichtfach war. Dort lernte ich, wie man Geschirr spült: Sehr schmutziges wäscht man vor, dann stapelt man es ordentlich neben der Spüle. Heißes Wasser einlassen, Geschirrspülmittel beigeben, beginnen – zuerst Gläser, Tassen und Besteck, dann Teller, Schüsseln, Töpfe und zuletzt die Pfannen. Das ist von einfacher und praktischer Eleganz, platzsparend und nervenschonend.
In Schweden hingegen findet der Hauswirtschaftsunterricht während der Basketballstunden statt, deshalb werfen sie das Geschirr planlos in das Spülbecken und ersäufen es im heißen Wasser. Wenn Tove gekocht hat, liegt das Geschirr nicht nur in den Abwaschbecken sondern auch daneben, denn sie verbraucht Unmengen an Geschirr – sie spült sogar das Geschirr, das sie nur angeschaut hat.
Nach dem Essen stehe ich vor der Anrichte. Der Geschirrberg würde sich als Installation in der Modern Tate gut machen, abernicht in einer Küche! Seit ich Toves Küchenverbrechen kenne, verstehe ich, warum man so lebensmüde werden kann, dass man sich im Abwaschwasser ertränken möchte, was aber wegen des Geschirrbergs nicht geht.
Tove behauptet, dass ihre Spültechnik ein ausgeklügeltes System sei und dass alle in Schweden es so tun. Bekanntlich kann auch eine ganze Nation in die Irre gehen. Sie faselt, dass im großen Becken das Geschirr im Wasser eingeweicht werde und man im kleineren das eingeweichte sauber bürste. Über das schmutzige Geschirr links und rechts neben der Spüle schweigt sie sich aus.
Natürlich kann man Geschirr so spülen, vorausgesetzt man will sich regelmäßig so richtig elend fühlen. Ich kam auf die Idee, dass der Kauf einer Geschirrspülmaschine das gestörte Klima in unserer Beziehung ins Gleichgewicht bringen könnte, aber seit ich bei Toves Mutter zu Besuch war, meine ich das nicht mehr: Sie besitzt einen Geschirrspüler – plus das schwedische Chaos im Spülbecken und darum herum.
Tove behauptet in ihrer kulturellen Verblendung, dassunserSystem unmöglich sei: Der Schmutz auf dem Geschirr vertrockne, die Stapel seien lästig und überhaupt: Ich könne nicht sauber spülen, das sei wohl schlimmer als ihre (Un-)Ordnung. Ja, vielleicht ist das schlimmer, aber was kann ich dafür, dass ich nicht visuell, sondern auditiv veranlagt bin, und Schmutz nun mal keine Geräusche macht? Ich besitze schon jetzt zwei Brillen, soll ich nun auch noch eine für die Spüldistanz anschaffen?!
Tove und ich haben also ein ernsthaftes Problem, das wir nicht im Bett zurechtknüllen können. Ich möchte die Beziehung jedoch nicht die Spüle hinunterspülen (was bei dem Geschirrberg ohnehin nicht geht), denn ich sammle Flugmeilen und will nicht damit aufhören, bevor ich einen Gratisflug bezogen habe. Es müssen andere Lösungen her: Das Beste wäre, nur Tove würde Geschirr spülen, ich könnte ihr währenddessen etwas aus einer schwedischen Zeitung vorlesen, da hätte sie viel zu lachen. Da die Schweden die Gleichberechtigung erfunden haben (bei ihnen stillen sogar die Männer), wird Tove den Vorschlag nicht akzeptieren. Dann halt gemeinsam fasten, nur wäre das auf Dauer eine knochige Angelegenheit. Oder immer in Restaurants essen und verarmen, oder Plastikgeschirr kaufen, aber leider stehen wir auf Umweltschutz. Oder eine Putzhilfe anstellen, aber da würden wir auch verarmen, und wer weiß, wenn die Frau heiß wäre ...?!
Am besten lernt Tove von mir, richtig Geschirr zu spülen. Ich würde im Gegenzug eine Geschirrspülbrille kaufen und lernen, auf die stummen Schreie des Schmutzes zu hören.
Das Löffeln
Löffeln ist etwas Wunderbares: Die eine legt sich an den Rücken der anderen, so als wären sie wertvolle Silberlöffel, die in der Besteckschublade schön aneinandergereiht werden: Bauch an Kreuz, Brust an Rücken, den Kopf halb aufs Kissen und neben dem Kopf der anderen.
Wenn in Filmen Liebespaar einschläft oder aufwacht, so tun sie das immer gelöffelt: Die Liebenden sind aneinandergeschmiegt eingeschlafen, haben sich – oh Wunder! – in der Nacht nicht ein einziges Mal bewegt und erwachen wie auf Hochglanz polierte Löffel.
Bei mir läuft etwas falsch, wie verliebt ich auch sein mag, wie kopflos und glücklich – Löffeln macht mir ein paar Minuten Spaß, dann …
… schläft der Arm ein.
… wird mir heiß.
… kitzeln mich Haare.
… verkrampft sich mein Nacken.
… werden meine Beine unruhig.
Wenn das geschieht (und es geschieht immer), versuche ich, den Arm sachte in eine neue Position zu bringen; versuche, die Beine nicht zu bewegen; versuche, mit dem Fuß die Decke etwas hinunterzuziehen; drehe den Kopf – nun bin ich die Haare los, dafür ersticke ich im Kissen. Tove zieht die Decke hoch und findet mit dem Po eine ideale Position an meinem Bauch.
Ich überlege mir, wie lange ich gelöffelt liegenbleiben muss, bis ich mich entziehen kann, ohne dass Tove das als Liebesentzug auslegt. Ich entziehe doch keine Liebe, nur meinen tauben Arm!
Tove dreht sich, und die Decke zieht sie mit. Mein Hintern friert in der klirrenden Luft. Vorsichtig mache ich mich daran, die Decke Millimeter um Millimeter zurückzuerobern.
Tove brummt: „Kannst du dich nicht eine Minute stillhalten?!“
Ich kichere nervös und halte eine Minute still.
„Schatz, deine Beine machen mich schon wieder nervös!“
Sie hat diese rührende Angewohnheit, michSchatzzu nennen, wenn sie nicht zufrieden mit mir ist – es ist ihre Versicherung, dass sie mich vergöttert, auch wenn ich anders, besser, netter, schöner oder eleganter sein sollte.
Ich murmle eine Entschuldigung.
„Schon gut.“ Tove nimmt meine Hand, die als einziger Körperteil in Freiheit gelebt hat, und zieht sie zu sich. Sie raunt sinnlich „lass uns schlafen“, küsst meinen Handrücken und legt die Hand an ihre Brüste. Das beruhigt mich nicht. Tove hingegen beginnt hier und da zu zucken, ihr Atem wird tiefer und langsamer – bald schläft sie.
Die Hand bei ihren Brüsten, mein rechtes Bein zwischen ihren Beinen – wie komme ich da weg?! Vorsichtig – vooorsiiichtiiig! – entziehe ich meinen Körper. Der Mond geht auf und zieht gemächlich über den Sternenhimmel, er bescheint matt meine Befreiungsaktion. Endlich habe ich mich fast entlöffelt, da seufzt Tove auf, packt meine Hand und zieht sie – zusammen mit dem Rest von mir – wieder zu sich.
Wie sehr sie mich liebt!
Wie egal es mir im Moment ist, dass sie mich liebt – ich will meinen Körper! Ich will kein Löffel sein, sondern ein Korkenzieher, der allein, aber frei in der Schublade liegt. Ich will den Handstand machen, wenn mir danach ist, ich will Liegestützen machen, wenn mir danach ist, und auf der Matratze hüpfen!
Würde Tove das doch verstehen: Ich eigne mich zur Löffelstellung wie der Elefant zum Klöppeln.
Ewigkeiten später habe ich mich aus dem liebevollen Zangengriff befreit. Ich rücke glücklich zum Bettrand, wackle mit den Füssen, zapple, wälze mich, drapiere das Kissen und befehle meinem inneren Wecker, fünf Minuten vor dem äußeren zu klingeln.
Als es fünf Minuten vorher ist, lege ich mich an Toves Rücken und tue so, als sei ich seit gestern Nacht dort gelegen. Tove öffnet die Augen, streckt und reckt sich und grünzelt zufrieden: „Schatz, schon wieder haben wir die ganze Nacht in der Löffelstellung geschlafen. Das ist sooo romantisch!“ Sie küsst mich.
Ich lächle erschöpft, aber stolz und unterdrücke ein Gähnen.
Manchmal sehne ich mich nach dem Mittelalter zurück, als man mit Fingern und Messern aß und jeder seinen eigenen Holzlöffel besaß, den er an einer Schnur um den Hals trug und in keine Schublade legte. Und wenn doch, hätten die handgeschnitzten Löffel nicht ineinandergepasst, und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass zur Liebe das Löffeln gehört. Tove und ich wären nebeneinander gelegen, hätten den muffigen Duft des Strohsackes eingeatmet und dem gemütlichen Grabbeln der Wanzen gelauscht. Wir hätten uns nach Herzenslust gekratzt, hätten gezappelt und geflucht (die Wanzenstiche) und wären glücklich eingeschlafen.
Wie ich das Mittelalter vermisse.
Warum in die Nähe schweifen, wenn das Ferne so gut?
Ich habe bis vor ein paar Jahren Menschen bemitleidet, die in einer Fernbeziehung leben: Das kann nichts Rechtes sein, habe ich gedacht; so kann man keine echte Beziehung führen, fand ich; die wollen sich nicht wirklich einlassen, wusste ich; so etwas möchte ich nie und nimmer, behauptete ich.
Das Spaßige am Leben ist: Es schert sich einen Deut darum, was wir denken, glauben und wollen, sondern folgt stur seinem eigenen Kurs. So bin ich, die ich weder Fernbeziehung noch Frau mit Kind wollte, mit einer Frau zusammen, die weit weg lebt und eine Tochter hat. Ich bin auch die gewesen, die gesagt hat: In Europa fliegt man nicht, man nimmt den Zug – wegen der Umwelt. Und jetzt bewege ich mich im Flughafen Zürich und Stockholm Arlanda wie in meinem Wohnzimmer.
Wie Tove und ich uns gefunden haben, ist eine schöne und unmögliche Geschichte: Auf diese Art kann man sich nicht finden, zu viele Zufälle müssten da mitmischen. Was sie fröhlich taten.
Am Anfang unserer Beziehung dachten wir, dass wir bald einen Weg zueinander finden würden: Tove wollte in die Schweiz ziehen, verwarf die Idee jedoch wegen der kleinen Schwedin. Ich begann mir Szenarien vorzustellen, wie ich teilweise oder ganz in Schweden leben könnte. Nur leider kann man mich so problemlos verpflanzen wie eine hundertjährige Eiche: Ich habe es bisher nicht geschafft, weiter weg als fünfundzwanzig Kilometer von meinem Geburtsort zu ziehen. In meinen Adern fließt nicht das Blut einer Globetrotterin sondern einer Dorftrottelin.
Mittlerweile reden Tove und ich nur selten darüber, wie wir es anstellen könnten zusammenzuleben, denn wir sehen keinen Weg. Immer mal wieder sage ich zur Beruhigung: Nur weil man keinen Weg sieht, heißt das noch lange nicht, dass es keinen gibt – im Nebel sieht man den Weg auch nicht, und trotzdem existiert er.
Ich finde diese Metapher geistreich, aber davon lichtet sich der Nebel nicht.
Meine Freundin Sieglinde bemerkte kürzlich: „Ich befürchte, eure Beziehung hat keine Zukunft.“ Sie sagte in einem Nebensatz, was für mich sehr hauptsächlich ist. Sie mag Recht damit haben, Tove und ich werden vermutlich lange keinen gemeinsamen Haushalt aufbauen können. Nun gut, wenn ich ans Geschirrspülen denke, bin ich gar nicht so unglücklich darüber.
Aber stimmt es wirklich, dass unsere Beziehung keine Zukunft hat? Ist nicht das einzige, was man mit Bestimmtheit über die Zukunft sagen kann: Man kann nichts mit Bestimmtheit über sie sagen? Nicht mal das Wetter wird verlässlich so, wie es die Meteorologen voraussagen, und die benützen für ihre Prognostik immerhin wissenschaftliche Methoden.
In jungen Jahren war ich einmal bei einer Hellseherin. Sie war blond und drall, so wie man sich die Servicefrauen am Oktoberfest vorstellt, und sie wusste einiges: Dass ich nicht mit nackten Füssen herumgehen solle, weil meine Durchblutung schlecht sei; dass ich im letzten Leben zum Hochadel gehörte, weshalb ich so arrogant sei; dass ich mit dreißig einen spirituellen Mann heiraten und zwei Kinder haben würde. Mit der schlechten Durchblutung hatte sie Recht, aber dazu muss man nicht hellsichtig sein, sondern meine Füße berühren. Soweit mir bekannt ist, habe ich weder geheiratet noch Kinder geboren – das jedoch wegen des Hochadels stimmt, ich war im letzten Leben Marie Antoinette (ich habe kürzlich eine Biografie über sie gelesen, das ist ein Zeichen).
Mein Cousin war auch zu der Oktoberfesthellseherin mitgekommen, ihm sagte sie voraus, dass er mit sechzig in einen Baum fahren und sterben würde. Sie hat seine Lebensdauer nur gerade dreißig Jahren überschätzt.
Man hat bei manchen Menschen den Eindruck, dass sie eine große oder eine schlimme Zukunft vor sich haben. Und liegt daneben. Dazu zwei Beispiele: Ich arbeitete in einem anthroposophischen Heim für geistig Behinderte. Einmal musste ich einen Pensionär in die eurythmische Behandlung begleiten. Im Warteraum saß ein junger, stattlicher Mann, daneben seine Mutter, die mir unter Tränen erzählte, dass ihr Sohn kurz vor der Hochzeit einen Unfall hatte, der ihm das Gehirn zerstörte. In seinem Gesicht konnte man noch den gesunden Menschen ausmachen, der er gewesen war, aber er murmelte Unzusammenhängendes, war weggetreten. Dieser Mann hatte eine strahlende Zukunft vor sich: toller Beruf, baldige Hochzeit – ein paar Minuten ohne Sauerstoff, und die Zukunft änderte sich dramatisch.
Eine Freundin von mir hingegen hatte sich in den Achtzigern mit dem HIV-Virus angesteckt. Sie war schon immer ein kränklicher Mensch, so war klar, dass sie wohl sterben würde. Die Hellseherin meiner kalten Füße sagte ihr den baldigen Tod voraus, und man hätte meinen können, dass sie damit recht haben würde, in den Achtzigern starben ja fast alle, die sich infiziert hatten. Die Freundin lebt immer noch.
Wenn also Sieglinde sagt, dass Toves und meine Beziehung keine Zukunft hat, mag sie Recht haben. Oder nicht. Wir wissen es einfach nicht, wir können nicht wissen.
Ich arbeitete mit einer Engländerin zusammen, die seit zwanzig Jahren mit einem Schweizer verheiratet ist. Während der ersten drei Jahre lebte sie in England und er in der Schweiz – zu einer Zeit, als es weder Skype noch WhatsApp noch tiefe Telefonkosten gab. Sie sagte zu mir: „Denk dran, wenn eine Fernbeziehung zerbricht, zerbricht sie nicht an der Distanz, sondern weil es zwischen den beiden nicht gestimmt hat.“
Natürlich hat eine Fernbeziehung gewisse Nachteile: Ich liege oft allein im Bett; die Flüge gehen ins Geld; wenn ich Grippe habe, muss ich den Tee selber zubereiten; ich komme nur sporadisch zu Sex; kann nicht spontan mit Tove etwas unternehmen; muss die Wochenenden selber gestalten und alleine Ramsch entsorgen.
Es gibt aber auch Vorteile: Ich habe genug Platz beim Schlafen; kann viel reisen und Flugmeilen sammeln; der Sex ist immer noch aufregend; niemand stört mich, wenn ich krank im Bett liege; an den Wochenenden kann ich tun, was ich will, und so viel Ramsch muss ich nun auch nicht entsorgen.
Hat eine Fernbeziehung mehr Nachteile oder Vorteile? Sagen wir es so: je nachdem. Wenn ich mit Tove zusammen bin, sind die Nachteile verschwindend klein. Wenn ich mich von ihr verabschiede, schnellen sie in die Höhe. Wenn ich allein einen gemütlichen Abend verbringe, bin ich mit der Situation zufrieden. Wenn ich ohne Tove etwas Schönes erlebe, finde ich ihre Abwesenheit einfach nur Scheiße.
Was uns hilft, sind die modernen Kommunikationsmittel: Wir schreiben uns viele SMS und über Facebook Nachrichten, wir schicken uns Fotos zu oder skypen miteinander. Manchmal nerven sich meine Freunde, wenn ich Tove SMS schreibe. Da sage ich: „Du kannst deinen Schatz jederzeit sehen, ich nicht, also lass mich meinen Kontakt mit Tove halten.“
In einer Fernbeziehungen lebt man zwei Leben – eines mit sich und eines mit der Liebe, und am Schlimmsten ist die Schnittstelle, dann wenn es um den Abschied geht: Eine muss das Land wechseln und zu Hause wieder ihr Leben aufnehmen; die andere sich in der leeren Wohnung zurechtfinden. Wir schauen uns ein letztes Mal in die Augen, dann reißen wir uns voneinander los, und jedes Mal kommt mir die Liedstrophe von Cole Porter in den Sinn: Ev‘ry time we say goodbye I die a little.