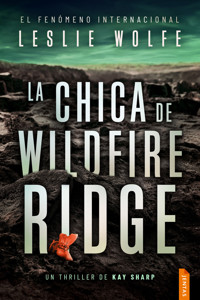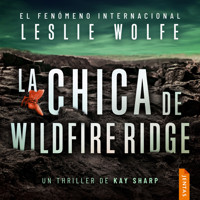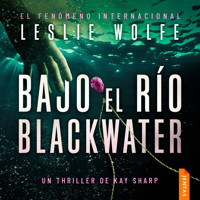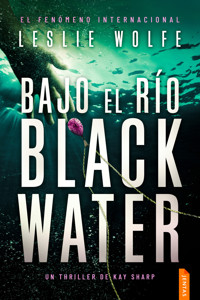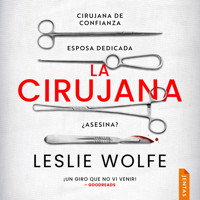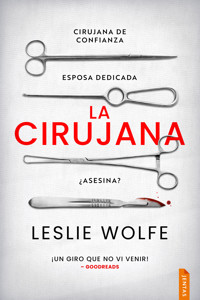5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Tess Winnett FBI-Thriller
- Sprache: Deutsch
Wenn Du ihm gefällst, bist Du so gut wie tot ...
Der Serienkiller "The Family Man" hat mehr als dreißig Familien getötet und wartet im Todestrakt auf seine Hinrichtung. Als die junge FBI-Agentin Tess Winnett den Auftrag bekommt, sich den Fall noch einmal genau anzuschauen, bemerkt sie einige Ungereimtheiten: Drei der Morde fallen aus dem Raster des Killers - gibt es einen Nachahmungstäter, der jahrelang unentdeckt blieb? Tess will diesem Verdacht auf den Grund gehen und kontaktiert Laura Watson, die einzige Überlebende des Massenmörders. Als ihre gesamte Familie abgeschlachtet wurde, war sie gerade einmal fünf Jahre alt. Was geschah in der Mordnacht wirklich? Je mehr Laura sich ihren Erinnerungen stellt, desto näher kommt sie dem wahren Täter ...
Ein spannender Thriller über einen grausamen Psychopathen und eine traumatisierte junge Frau - jetzt als eBook bei beTHRILLED.
"Man kann einfach nicht aufhören zu lesen." Kirkus Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Weitere Titel der Autorin:
Dein ist der Schmerz
Über dieses Buch
Der Serienkiller »The Family Man« hat mehr als dreißig Familien getötet und wartet im Todestrakt auf seine Hinrichtung. Als die junge FBI-Agentin Tess Winnett den Auftrag bekommt, sich den Fall noch einmal genau anzuschauen, bemerkt sie einige Ungereimtheiten: Drei der Morde fallen aus dem Raster des Killers – gibt es einen Nachahmungstäter, der jahrelang unentdeckt blieb? Tess will diesem Verdacht auf den Grund gehen und kontaktiert Laura Watson, die einzige Überlebende des Massenmörders. Als ihre gesamte Familie abgeschlachtet wurde, war sie gerade einmal fünf Jahre alt. Was geschah in der Mordnacht wirklich? Je mehr Laura sich ihren Erinnerungen stellt, desto näher kommt sie dem wahren Täter …
Über die Autorin
Leslie Wolfe ist eine erfolgreiche amerikanische Krimi- und Thrillerautorin, die mit über 400.000 verkauften eBooks regelmäßig in den Amazon-Bestsellerlisten vertreten ist – sie wurde im Februar und März 2018 zur Kindle All-Star Autorin ernannt. In ihren Krimireihen erschafft sie unvergessliche, starke und brillante Ermittlerinnen und begeistert ihre Leser mit rasanten Spannungsplots und einem umfangreichen psychologischen Hintergrundwissen.
LESLIE WOLFE
MEIN ist die ANGST
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Fricke
Deutsche Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2017 by Leslie Wolfe
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Watson Girl«
Originalverlag: Italics Publishing Inc., Gulf Breeze, Forida, USA
Translated and published by Bastei Lübbe AG, with permission from Italics Publishing. This translated work is based on Watson Girl by Leslie Wolfe. © 2017 Leslie Wolfe. All Rights Reserved. Italics Publishing is not affiliated with Bastei Lübbe AG or responsible for the quality of this translated work. Translation arrangement managed RussoRights, LLC on behalf of Leslie Wolfe and Italics Publishing.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Textredaktion: Nadine Buranaseda
Covergestaltung Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: Attitude | Eky Studio | Reinhold Leitner | Bachkova Natalia
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7893-1
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes »Er wird dich jagen« von Alexandra Ivy.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2018 by Debbie Raleigh
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »What are you afraid of?«
Published by Arrangement with KENSINGTON PUBLISHING CORP., 119 West 40th Street, NEW YORK, NY 10018 USA
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. Kaltblütiger Anfang
Vor fünfzehn Jahren
Er klopfte mit dem Lauf seiner Waffe an die Tür und schraubte den Schalldämpfer darauf, während er darauf wartete, dass ihm jemand öffnete. Dabei blickte er sich noch ein letztes Mal um. In der Dämmerung wirkten die Schatten lang, und kaum ein Geräusch störte die vorstädtische Ruhe. Irgendwo in der Nachbarschaft bellte ein Hund, und der Verkehrslärm des Highways, der in einiger Entfernung verlief, war so leise, dass man ihn kaum wahrnahm.
Warmes Licht schien hinter allen Fenstern des zweistöckigen Hauses, das durch die weißen Gardinen hindurchschimmerte, sodass das gewaltige Haus im Colonial-Revival-Stil aussah wie aus einem Märchen. Leise hallten die Geräusche eines Zeichentrickfilms auf die schwach beleuchtete Veranda. Er hörte Daffy Ducks gutturale Stimme heraus.
Nur ein Wagen parkte vor der breiten Garage, in der drei Autos Platz fanden: der silberfarbene Minivan, den Rachel Watson fuhr, wenn sie all das machte, was eine moderne Mutter so tun musste, meist mit mindestens einem ihrer drei Kinder auf dem Rücksitz. Aber Watson stellte seinen Benz stets in die Garage, damit ja kein Staubkorn auf die Sonderlackierung kam, die ihn ein Vermögen gekostet haben musste.
Obwohl er das Fahrzeug nicht sehen konnte, wusste er, dass Watson zu Hause war.
Diese Gewissheit beruhte darauf, dass er nichts dem Zufall überließ. Er hatte geduldig in seinem Wagen gewartet, der unauffällig um die Ecke parkte und dank des üppigen Grüns einer wuchernden Palmettopalme kaum zu sehen war, den Blick auf die Straße gerichtet, beobachtet und seine Zielperson überwacht. Jetzt war er bereit.
Er hörte Schritte, die sich der Tür näherten, und legte die Hand fester um die Waffe, die er hinter seinem Rücken verbarg. Die Tür ging auf, und Allen Watson trat schweigend zur Seite. Er hatte ein zaghaftes Lächeln auf den Lippen, sah aber auch ein wenig verwirrt aus. Er winkte ihn herein, und er kam der Aufforderung nach, wobei er die Waffe in der Hand behielt. Watson schloss die Tür und musterte ihn fragend.
»Was ma…?« Watson stockte, als er die Waffe erblickte, und erstarrte, um dann nach hinten zu wanken, bis er mit dem Rücken an die Wand stieß. Er riss die Augen auf und stierte ihn an, bekam jedoch keinen Ton über die geöffneten Lippen. »Nein … Nein …«, brachte er schließlich hervor. Seine Stimme klang heiser, schwach und gepresst.
Er zögerte und hob die Waffe langsam etwas höher, bis er aus geringer Entfernung auf Allens Brust zielte. Auf einmal war das Geräusch kleiner Schritte zu hören, die über den Holzboden tapsten, gefolgt von einer hohen Stimme, die von oben herabhallte.
»Wer ist das, Daddy?«
Er hob den Kopf und sah zwei von Watsons Kindern in farbenfrohen Schlafanzügen, die sich am Treppengeländer festhaltend, das über dem Wohnzimmer verlief, auf sie herabblickten.
»Nein …«, flüsterte Watson. »Bitte …«
Er konnte es nicht länger hinauszögern.
Nachdem er zweimal den Abzug gedrückt hatte, sackte Watson in sich zusammen, und die entsetzten Schreie der beiden Kinder dröhnten in seinen Ohren. Er hastete die Treppe hinauf, nahm immer drei Stufen auf einmal und lief zu den Schlafzimmern. Nach wenigen Schritten hatte er die beiden schreienden Kinder erreicht. Danach legte sich abermals Schweigen über das Haus, während er jedes Zimmer nach dem dritten Kind durchsuchte.
Er hatte die Suche im oberen Stockwerk beendet und wollte gerade wieder ins Erdgeschoss gehen, als jemand an die Tür klopfte und er mitten in der Bewegung verharrte. Er wich an die Wand zurück und hielt den Atem an. Besorgt wanderte sein Blick erst zu den Fenstern neben der Haustür hinüber, vor denen die Vorhänge nicht ganz zugezogen waren, und danach zu Watsons Leiche, die nicht weit von der Tür entfernt auf dem Boden lag.
Der Besucher würde den Toten problemlos sehen können, wenn er sich nur zur Seite beugte und zwischen den Vorhängen hindurchspähte. Verdammt!
Es klopfte erneut, diesmal lauter und länger, danach klingelte es. Schließlich war eine Männerstimme durch die dicke Tür zu vernehmen.
»Hey, hier ist Ben von nebenan. Sie hatten mir Ihren Akkubohrer geliehen.« Der Mann hielt inne und klopfte mehrmals. »Ich lasse ihn einfach auf der Veranda liegen, okay? Vielen Dank noch mal.«
Der unerwünschte Besucher ging mit schweren, lauten Schritten davon, was jedoch im Getöse des Fernsehers beinahe unterging. Er atmete langsam, ruhig, kontrolliert.
Einen Augenblick später schlich er vorsichtig nach unten und machte sich auf die Suche nach Rachel Watson. Er spitzte die Ohren und konnte über Daffy Ducks Stimme hinweg ein Klappern aus der Küche hören. Mit hochgezogenem Mundwinkel hielt er lautlos und katzengleich darauf zu.
Er wusste nicht, wie lange alles gedauert hatte, aber es war Zeit zu gehen. Der Klang der Sirenen in der Ferne machte ihn unruhig. Er verließ das Haus leise und schnell, nachdem er sich ein weiteres Mal vergewissert hatte, dass draußen nach wie vor alles ruhig und friedlich war, und achtete auf jedes Detail. Im Haus auf der anderen Straßenseite brannte im ganzen Erdgeschoss Licht, und alle Vorhänge waren zurückgezogen, sodass man einen ungehinderten Blick auf das Treiben der Familie darin hatte. Er runzelte die Stirn. Manche Menschen sollten wirklich mehr auf ihre Privatsphäre bedacht sein.
Zur Sicherheit schlich er sich hinter Rachels Minivan, um die Umgebung abermals in Augenschein zu nehmen, bevor er zu seinem Wagen zurückkehrte. Geduckt lief er los und hatte das Fahrzeug mit wenigen Schritten erreicht, ohne es zu berühren. Er blickte zu den Häusern in der Nähe hinüber und lauschte auf Geräusche, die hier nicht hingehörten. Seine Miene verfinsterte sich, als die Polizeisirenen näher kamen, und als er den Kopf hob, erstarrte er plötzlich und hatte das Gefühl, sein Blut würde zu Eis gefrieren.
Am Heckfenster des Minivans klebte eine glückliche Strichmännchenfamilie aus einem Mann, einer Frau, einem Jungen, zwei Mädchen und einer Katze, die alle so breit grinsten, wie es anatomisch überhaupt nicht möglich war.
Er hatte ein Riesenproblem, denn er war sich ziemlich sicher, dass er gerade zwei Jungen und ein Mädchen getötet hatte.
Stöhnend hockte er sich auf den Boden und rieb sich panisch die gerunzelte Stirn, als könnte er sein Problem dadurch lösen oder einen Ausweg finden.
»Denk nach! Denk nach!«, flüsterte er wütend.
Rachel Watson hatte auf gar keinen Fall die falschen Figuren auf ihren Wagen geklebt. Alles andere passte, auch die Katze, die seine Bewegungen vom Küchenschrank aus mit durchbohrenden phosphoreszierenden Augen verfolgt hatte, während er mit Rachel beschäftigt gewesen war. Er hatte das Tier am Leben gelassen. Es war die Kugel nicht wert, da es ja ohnehin nicht sprechen konnte.
Aber das hier? Das ergibt keinen Sinn, dachte er immer wieder und starrte die Klebefiguren an. Dort waren eindeutig zwei gleich große Mädchen zu sehen, denn es handelte sich um die gleiche Figur mit zwei Zöpfen. Der Junge war etwas größer als die Mädchen. Ersetzte Rachel die Sticker etwa jedes Jahr? Vermutlich. Und sie hatte garantiert keinen Fehler gemacht, was das Geschlecht ihrer Kinder betraf.
Aber was ging dann hier vor sich? Er hatte in einem der Schlafzimmer ein Mädchen angetroffen, das ganz allein auf dem Boden mit LEGO-Steinen spielte. Es musste etwa fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Die anderen beiden Kinder waren etwas älter gewesen, vielleicht sieben oder acht, schätzte er.
Beides Jungen.
Etwas war gehörig in die Hose gegangen.
Er spitzte wieder die Ohren und versuchte herauszufinden, wie weit die Streifenwagen noch weg waren. Hatte jemand seinetwegen die Cops gerufen? Er war davon überzeugt, dass die Schüsse nicht laut genug gewesen waren, aber möglicherweise hatte jemand das Mündungsfeuer durchs Fenster gesehen. Vielleicht hatte der Nachbar mit dem Akkubohrer Watsons Leiche auf dem Boden erkennen können. Gut möglich.
Aber es war durchaus denkbar, dass ihm genug Zeit blieb, um die Sache in Ordnung zu bringen.
Er starrte seinen Handrücken eine Sekunde lang an, der im schwachen Dämmerlicht zitterte, und beschloss, zurückzugehen und zu tun, was getan werden musste. Sobald er sich wieder ins Haus geschlichen hatte, zog er leise die Tür hinter sich zu. Dann durchsuchte er ein weiteres Mal jedes Zimmer und hielt die Waffe fest in der schweißnassen Hand.
2. Zurück an die Arbeit
Heute
Special Agent Tess Winnett beugte sich zum Spiegel vor und musterte die Ringe unter ihren Augen mit kritischem, enttäuschtem Blick. Gnadenlos und dunkel zeichneten sich die Objekte ihres Missfallens in ihrem Gesicht ab, verfärbten die Lider und ließen das Blau ihrer Iris trüb und leblos aussehen. Sie wirkte blass und ausgezehrt, und ihre Haut sah gespannt und unter den hohen Wangenknochen beinahe durchsichtig aus.
Etwas Make-up hätte nicht geschadet. Dumm nur, dass sie sich nicht schminkte.
Dies war ihr erster Arbeitstag, nachdem sie sich drei endlose Wochen lang von den im Dienst erlittenen Verletzungen erholt hatte. Eine ausgekugelte Schulter. Gerissene Bänder. Ein paar gebrochene Rippen, die noch immer dafür sorgten, dass ihr bei jedem Atemzug die Seite schmerzte. Aber sie war wieder da und nicht bereit, sich noch einen weiteren Tag zu Tode zu langweilen, die Stunden zu zählen, sinnlos herumzulaufen, durch dreihundert Fernsehsender zu zappen oder sich mit dem Stapel an Büchern zu beschäftigen, für die sie doch nicht genug Geduld aufbringen konnte.
Allerdings vermutete sie, dass nicht etwa die körperlichen Verletzungen der Grund für ihre Blässe waren, sondern das Monster, das in ihrem Inneren lauerte, in den hintersten Winkeln ihres ermatteten Gehirns. Die Erinnerungen, die sie nur zu gern für immer losgeworden wäre, die jedoch nicht verblassen wollten, die grässlichen Erinnerungen an jene furchtbare Nacht vor über zehn Jahren, in der ihr Leben auf einmal zum Albtraum geworden war. In jener Nacht war sie ein machtloses Opfer gewesen und hatte um ihr Leben gekämpft und war nicht wie heute die furchtlose FBI-Agentin.
Diese Wunden schmerzten noch immer und bewirkten, dass sie in einem ständigen Zustand der extremen Wachsamkeit durchs Leben ging, obwohl der Mann ihr inzwischen nichts mehr tun konnte. Sie machten ihr mehr zu schaffen, als es ein paar angeknackste Rippen jemals gekonnt hätten.
Ihr Arzt, der sein Augenmerk auf ihre körperliche Fitness richtete und ihren restlichen Ballast nicht zur Kenntnis zu nehmen schien, hatte sie sechs Wochen krankgeschrieben und ihr für die letzten beiden Wochen tägliche Physiotherapiestunden mit Übungen zum Kraftaufbau und zur Mobilitätssteigerung verschieben. Sie hatte gefleht und gedroht, doch er hatte ihrem Vorgesetzten, FBI Special Agent in Charge oder SAC Pearson, wie sie seinen Titel gerne abkürzte, bereits mitgeteilt, dass sie aus medizinischen Gründen noch nicht wieder dienstfähig sei. Als sie das gehört hatte, war sie ausgeflippt, hatte ihre gesamte irrationale Wut gegen den Arzt gerichtet und ihn mit jedem Schimpfwort bedacht, das ihr nur einfallen wollte, ihm vorgeworfen, die ärztliche Schweigepflicht verletzt zu haben und ein rücksichtsloser, egoistischer Mistkerl zu sein, dem man ihrer Meinung nach nie eine ärztliche Zulassung hätte erteilen dürfen.
Weit war sie damit nicht gekommen. Der Arzt hatte ihre Anschuldigungen abgetan und erwidert, er habe keinesfalls die Schweigepflicht verletzt, sondern SAC Pearson nur mitgeteilt, dass sie die sechswöchige Ruhepause brauchen würde, ohne weitere Details zu nennen. Wundersamerweise stimmte er später an diesem Tag zu, sie nach drei Wochen schon wieder zur Arbeit gehen zu lassen, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie nur leichte Aufgaben übernahm, an einem Schreibtisch saß und sich um den Papierkram kümmerte.
Auf gar keinen Fall!
Aber wenigstens konnte sie das Field Office wieder betreten, weil das FBI ihren Ausweis erneuert hatte. Der Rest lag nun an ihr, nicht wahr? Ein schiefes Grinsen zeichnete sich auf den Lippen ihres Spiegelbilds ab und wurde immer breiter, ließ auch ihre Augen strahlen und die dunklen Ringe fast vollständig verschwinden.
Sie war wieder da. Das war alles, was zählte.
»Willkommen zurück, Winnett«, grüßte eine Frau sie im Vorbeigehen und knallte die Tür der hintersten Toilettenkabine hinter sich zu.
Tess schrak zusammen. Sie hatte gar nicht bemerkt, wie die Frau hereingekommen war. Auf einmal war die Stimme in ihrem Rücken gewesen, so verdammt nah, wo sie doch geglaubt hatte, allein und in Sicherheit zu sein. Ihr Herz raste, und ihre Hände zitterten ein wenig. Sie konzentrierte sich einige Sekunden lang auf ihre Atmung. Einatmen. Ausatmen.
»Danke«, erwiderte sie zögernd, stieß Luft aus und straffte die Schultern.
War sie wirklich schon wieder bereit zu arbeiten? Besser wär’s. Reiß dich zusammen, Winnett!
Sie starrte sich noch ein wenig an und sammelte Mut für die Besprechung mit SAC Pearson. Als sie an diesem Morgen an ihren Schreibtisch gekommen war, hatte sie dort eine Haftnotiz mit der kurzen Nachricht Kommen Sie zuerst zu mir vorgefunden. Die Unterschrift lautete PEARSON, wobei sich die Großbuchstaben in ein kaum noch leserliches Gekritzel verwandelten. Aber sie wusste ohnehin, von dem die Nachricht stammte.
SAC Pearson. Würg. Ihr Boss, der sie schon mehrmals verwarnt hatte und der sich von ihr nichts mehr bieten lassen würde. Ein Mann, der zwölf Jahre als Profiler gearbeitet hatte und mit einer beneidenswerten Aufklärungsquote aufwarten konnte, die nur sie übertroffen hatte. Er lag bei achtundneunzig Prozent, sie bei hundert. Ein winziger Unterschied mit großer Bedeutung. Sie war davon überzeugt, dass ihr Boss diese zwei Prozentpunkte immer im Hinterkopf hatte. Aber vor allem war er ein erfahrener Profiler und müsste nur einen Blick auf die dunklen Ringe unter ihren Augen werfen, um sie für drei weitere Wochen in ihre Wohnung zurückzuschicken, in der sie durchdrehen würde.
Sie schürzte die Lippen, dachte über ihre Optionen nach und räusperte sich leise.
»Hey, Colston, haben Sie zufälligerweise Make-up dabei?«
»Ja, bitte sehr«, erwiderte die Frau und schob ihre Handtasche unter der Kabinentür durch. »Bedienen Sie sich.«
»Danke.«
Tess stellte die Handtasche auf den Waschtisch und zögerte, bevor sie den Reißverschluss aufzog. Es widerstrebte ihr, auf diese Art in die Privatsphäre eines anderen Menschen einzudringen, selbst wenn sie dazu aufgefordert worden war. Wie unterschiedlich die Menschen doch waren. Wie … arglos, vertrauensvoll und offen. Ruhig. Fürsorglich. Bescheiden. Während sie in die Tasche spähte, überkam sie leichter Neid. Sie wünschte sich, ebenso sein zu können wie jeder da draußen, der teilen, vertrauen und hin und wieder unachtsam sein konnte.
Colstons Handtasche enthielt eine ganze Schatztruhe voller Schminkutensilien, und Tess starrte die kleinen Objekte verwirrt an und wusste nicht, was davon sie benutzen sollte.
»Das hier sollten Sie nehmen«, schlug Colston vor und nahm einen Concealer heraus. Dabei tropfte etwas Wasser von ihrer Hand in die offene Tasche, was ihr jedoch nichts auszumachen schien.
Tess stockte der Atem, aber sie schluckte schwer und schaffte es, ihrer Kollegin zu danken. Wieso hatte sie nicht gehört, wie Colston die Toilettenspülung betätigt oder sich die Hände gewaschen hatte? Letzteres war eindeutig passiert, da sich die Frau gerade mit einem Papiertuch abtrocknete. Welche Agentin im Außeneinsatz ließ denn zu, dass sich jemand derart an sie heranschleichen konnte? Sie musste sich wirklich zusammenreißen.
Sie verbarg den in ihr tobenden Aufruhr, trug den Concealer rasch mit den Fingern auf und lächelte dankbar.
»Ich würde auch etwas Rouge auflegen. Sie sind zu blass. Warten Sie, ich helfe Ihnen«, bot Colston an und fuhr mit einem dicken Pinsel über Tess’ Wangen, worauf ihre alabasterfarbene Haut etwas lebendiger wirkte. »Perfekt, das sieht schon viel besser aus.«
Gemeinsam verließen sie die Damentoilette, trennten sich jedoch, da Tess noch bei ihrem Schreibtisch vorbeiging, um ihren Notizblock zu holen, bevor sie Pearsons Büro betrat.
Da saß er an seinem Schreibtisch, hatte den völlig kahlen Kopf gesenkt und las ein Dossier, in dem er ungeduldig und mit zusammengepressten Lippen herumblätterte, woran man seine Verärgerung deutlich erkennen konnte. Er hatte das Sakko ausgezogen und die Hemdsärmel hochgekrempelt, was bedeutete, dass er wenigstens einige Stunden im Büro zu bleiben gedachte.
Tess klopfte an den Türrahmen und wartete schweigend. Er winkte sie herein, ohne den Blick vom Papierkram vor sich abzuwenden. Sie blieb stehen und sah sich die wenigen Objekte an, mit denen Pearson sein Büro geschmückt hatte. Hinter ihm standen in einem Fach in einem halb leeren Bücherregal drei gerahmte Fotos, auf denen seine Familie zu sehen war. Seine leicht übergewichtige Frau schaute herzlich und zugewandt aus und hielt auf dem Familienporträt, auf dem auch die beiden Söhne abgebildet waren, selbstsicher seine Hand.
Bei den anderen beiden Bildern handelte es sich um Fotos von den Abschlussfeiern seiner Söhne, wie man sie von teuren Colleges am Tag der Zeugnisübergabezeremonie erhielt. Beide Jungen hatten die freundlichen Augen ihrer Mutter und waren ansonsten jüngere, abgeschwächte Versionen ihres Vaters. Sie fragte sich, ob die Strenge in Pearsons Zügen genetisch war oder sich im Laufe seines Lebens abgezeichnet hatte, und musterte die beiden vertikalen Linien neben seinen geschürzten Lippen, die permanent gerunzelte hohe Stirn und die angespannte Kiefermuskulatur. Wahrscheinlich war sie angeboren.
Endlich blickte Pearson auf, und seine Miene verfinsterte sich noch mehr. »Setzen Sie sich, Winnett.«
Sie kam der Aufforderung nach.
»Sie sind also wieder da. Früher als geplant.«
»Sir.«
»Willkommen zurück. Sind Sie einsatzbereit?«
»Danke, Sir. Ja, das bin ich.«
Er rieb sich die Stirn und massierte sich die Stelle auf seinem Nasenrücken, auf dem die Brille eine rote Stelle hinterlassen hatte. Dann lehnte er sich nachdenklich auf seinem Stuhl zurück. »Ich habe hier ein paar Sachen für Sie«, sagte er nach einer Weile. Der Klang seiner Stimme ließ nichts Gutes vermuten.
Sie nickte, erwiderte jedoch nichts. Zuerst rutschte sie nervös auf ihrem Stuhl herum, bis sie sich zwang, still sitzen zu bleiben.
»Als Erstes wäre da das Problem mit Ihrem letzten Fall. Es wird eine formelle Untersuchung der gesamten Entwicklung geben, die in zwei Wochen beginnen soll.«
»Eine formelle Untersuchung? Darf ich erfahren, warum?«
»Müssen Sie diese Frage tatsächlich stellen?« Sein Blick schien sie zu durchbohren, bis sie den Kopf senkte und den Boden anstarrte. »Ja, Sie haben den Fall abgeschlossen. Ja, Sie konnten einen weiteren Erfolg für sich verbuchen. Aber die Untersuchungskommission ist sich bewusst geworden, dass einige Ihrer Statistiken nicht ganz so gut sind.«
»Worauf beziehen Sie sich genau?« Sie wusste, dass ihre Aufklärungsquote makellos war, das konnte es also nicht sein. Was dann?
»Sie töten mehr Menschen als jeder andere Agent. Zwar wurden Sie bei jeder Schießerei freigesprochen, aber etwas an Ihrem letzten Fall hat die Aufmerksamkeit der Kommission erregt.«
»Sir, ich …«
»Lassen Sie mich ausreden, Winnett. Ich schlage vor, Sie warten, bis das Komitee die Untersuchung beendet und seine Empfehlung ausgesprochen hat. Sie wurden ja wie gesagt von jeder Schuld freigesprochen, daher dürften Sie auch nichts Schlimmes zu erwarten haben.«
Sie wartete eine ganze Sekunde, bevor sie den Mund aufmachte. »Bei allem nötigen Respekt, Sir, aber das sehe ich anders. Eine formelle Untersuchung kann auch schnell ein Karriereende bedeuten.«
Er stand unvermittelt auf, steckte die Hände in die Hosentaschen und ging auf und ab. »Sie können nichts dagegen unternehmen, Winnett. Niemand kann das. Lassen Sie den Dingen einfach ihren Lauf, und sorgen Sie nicht für Ärger. Es könnte allerdings nicht schaden, wenn Sie zur Abwechslung mal einen Verdächtigen verhaften, anstatt ihn zu erschießen.«
Sie starrte schweigend zu Boden und spürte die Frustration in sich aufsteigen. »Verstanden«, sagte sie schließlich und schaffte es mit Mühe und Not, alles, was mit diesem System nicht stimmte, herunterzuschlucken.
Pearson setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und sah noch unzufriedener aus. »Der zweite Punkt auf der Liste wird Ihnen bei der anstehenden Untersuchung nicht gerade hilfreich sein.« Erst nach kurzem Räuspern sprach er weiter. »Ich möchte, dass Sie für eine Weile mit einem Partner zusammenarbeiten.«
»Wie bitte?« Sie starrte Pearson an und konnte ihre Verärgerung nicht verbergen. Zwar wollte sie keinen Partner, aber sie hatte auch gewusst, dass sie früher oder später einen zugeteilt bekommen würde. Das hatte ihr Pearson klar und deutlich zu verstehen gegeben. Trotzdem war sie sauer. »Es gibt beim FBI keine Vorschrift, dass wir einen Partner haben müssen, daher dachte ich …«
»Zitieren Sie hier nicht die Vorschriften, Winnett. Noch entscheide ich, wer was macht und mit wem. Haben Sie das verstanden?«
»Ja, Sir. Muss ich das so verstehen, dass Sie mir eigentlich einen Aufpasser an die Seite stellen und nicht etwa …?«
»Winnett!«
Sie erstarrte. Ihrem Boss gegenüber durfte sie nicht zu weit gehen, aber sie hatte auch das Gefühl, das nicht verdient zu haben. Wo sollte sie die Grenze ziehen zwischen dem Befolgen von Anweisungen ihres Vorgesetzten und dem Eintreten für das, was sie wollte?
»Vorerst ist niemand verfügbar, der an Ihrer Seite arbeiten könnte«, fuhr er fort und bedachte sie mit einem wütenden Blick, da ihre Erleichterung anscheinend zu offensichtlich war. »Aber ich möchte, dass Sie darüber nachdenken, als nächsten Karriereschritt mit einem Partner zusammenzuarbeiten. Das würde Ihnen guttun und auch die Meinung anderer über Sie verbessern.«
»Was haben die denn für eine Meinung?«
»Dass Sie kein Teamplayer sind. Dass Ihnen die Gefühle anderer egal sind oder was sie zustande bringen. Dass es Ihnen nur darum geht, so schnell und so gut wie möglich einen Fall nach dem anderen zu lösen.«
»Äh … Und was ist falsch daran, Fälle schnell zu lösen? Das ist mein Job!«
»Aber man hat den Eindruck, dass es Sie nicht interessiert, wen Sie dabei verletzen. Sie müssen an Ihrer Außenwirkung arbeiten, Winnett. Das ist unbedingt erforderlich und darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Gewinnen Sie das Vertrauen und den Respekt Ihrer Kollegen zurück, und achten Sie darauf, sich so zu verhalten, als würden Sie zum Team gehören. Hier ist kein Platz für Einzelgänger, Winnett, ungeachtet Ihrer Aufklärungsquote. Wir sind alle ein Team und müssen uns dementsprechend verhalten.«
Wie, in aller Welt, sollte sie das anstellen? Begegnungen wie die auf der Toilette mit Colston waren so selten, dass sie eine Ausnahme darstellten und damit die Regel bestätigten. Sie musste allerdings zugeben, dass sie sie genossen hatte.
»Ich habe gut mit Mike zusammengearbeitet, wie Sie selbst wissen. Aber Mike ist nicht mehr da. Er ist tot.«
»Hören Sie mir jetzt gut zu, Winnett.« Pearson lockerte mit frustriertem Seufzen seine Krawatte. »Ungeachtet dessen, was Sie, ich oder irgendjemand anderes zu tun bereit ist, wird Mike nicht wiederkommen. Auch wenn Sie sich noch so schuldig fühlen oder sich einreden, Sie könnten mit niemand anderem zusammenarbeiten. Es wird Zeit, nach vorne zu blicken, Winnett. Lassen Sie nicht zu, dass diese Sache Ihre Karriere zerstört.« Er schwieg einen Augenblick und vermittelte ihr mit einem vielsagenden Blick das, was er nicht aussprechen konnte.
Sie sah erneut zu Boden und wusste nicht, was sie noch sagen sollte.
»Dann wäre da noch das Problem mit dem Gouverneur«, fügte er hinzu.
Tess seufzte leise und hätte beinahe die Augen verdreht.
»Er hat mich zwei Mal Ihretwegen angerufen, während Sie den letzten Fall bearbeitet haben. Zwei Mal!«
»Die ganzen feinen Leute, denen ich auf die Füße treten muss, rufen ihn an und …«
»Winnett!«, unterbrach er sie erbost. »Denken Sie, ich wüsste nicht, wie der Hase läuft? Aber Sie müssen klüger vorgehen! Sonst ruft er mich irgendwann an und bittet mich offiziell darum, Sie zum Problem eines anderen Gouverneurs zu machen! Kein anderer Agent hier sorgt für derartige Probleme. Sie lösen alle ihre Fälle vielleicht nicht so erfolgreich wie Sie, allerdings mit deutlich weniger Aufsehen und Störungen. Und mit weniger Beschwerden.« Er hielt kurz inne, als wüsste er nicht, was er mit ihr machen sollte. »Seien Sie in dieser Hinsicht klüger, Winnett«, fuhr er schließlich fort. »Lassen Sie nicht zu, dass dieses Team durch Ihr Verhalten in Verruf gerät, weder intern noch extern. Haben Sie verstanden?«
»Ja«, stieß Tess mühsam hervor. Sie würde herausfinden müssen, wie sie andere Menschen dazu brachte, sie zu mögen und zu akzeptieren. Dazu musste sie sich verändern, und das war niemals leicht. Sie musste sich etwas mehr Feinschliff aneignen, dabei jedoch weiterhin in der Lage sein, ihren Job zu machen und auf Zack zu bleiben. Allerdings hatte sie keine Ahnung, wie sie das anstellen oder wo sie anfangen sollte.
»Sie bekommen einen neuen Fall«, wechselte Pearson das Thema.
Sie horchte auf, während sich in ihrem Inneren Vorfreude und Aufregung ausbreiteten und ihre schlechte Laune etwas verbesserten.
»Im Todestrakt in Raiford sitzt ein Serienmörder namens Kenneth Garza.«
»Ah, der Family Man«, stellte sie fest.
»Ganz genau«, bestätigte Pearson. »Der Termin für seine Hinrichtung rückt näher. Sie soll in etwa drei Wochen stattfinden, am zweiundzwanzigsten. Ich möchte, dass Sie sich seine Akte vornehmen und mit ihm reden. Sorgen Sie dafür, dass alles hieb- und stichfest ist und dass wir jedes kleinste Detail beachtet haben, nicht, dass es in letzter Minute noch irgendwelche Überraschungen gibt. Sind Sie mit seinem Fall vertraut?«
»Nein, ich kenne nur seinen Ruf. Das war vor meiner Zeit.«
»Himmel noch mal, Winnett, Sie sind wirklich eine Marke. Vor Winnett und nach Winnett, was? Wie arrogant können Sie eigentlich noch werden?« Pearsons Gereiztheit schwang überdeutlich in seiner sonst so gelassenen Stimme mit.
»Nein, Sir. Ich meinte damit, dass ich mit allen Fällen von Serienmördern vertraut bin, die während meiner Dienstzeit gelöst wurden.«
»Natürlich sind Sie das«, murmelte er, »weil Sie sie gelöst haben!«
»Nein, Sir. Ich bezog mich auf alle Fälle des FBI, unabhängig von dem Agent, der sie gelöst hat, und zwar seit dem Tag, an dem ich vor zehn Jahren dazugestoßen bin.«
Ihm fiel die Kinnlade hinunter, doch er hatte sich rasch wieder unter Kontrolle und machte unbeirrt weiter. Tess hätte beinahe gegrinst, konnte es sich aber gerade noch so verkneifen.
»Gut, dann machen Sie sich mit Garzas Akte vertraut, und reden Sie mit ihm, bevor er auf den Stuhl kommt.«
»Ja, Sir«, erwiderte sie, stand auf und wandte sich zum Gehen.
Er deutete auf einige Kisten, die bereits auf einem Transportwagen in einer Ecke des Büros neben der Tür standen, und sie zog fragend die Augenbrauen hoch.
»Garzas Akte«, erklärte er und las weiter in den Dokumenten, mit denen er sich vor ihrem Eintreffen beschäftigt hatte.
Tess zog am Griff des Wagens und zuckte zusammen, als sich in ihrer Seite ein stechender Schmerz ausbreitete. Rasch wechselte sie die Hand und schaffte es, den Rollwagen auf den Flur zu ziehen, ohne die Wand oder ein Möbelstück damit zu rammen.
Erleichtert konzentrierte sie sich darauf, den schwerfälligen Wagen über den dicken Teppich zu bewegen, und schaute bei jedem Blick hinter sich, um sich zu vergewissern, dass die gestapelten Kisten nicht umfielen. Mit einem Mal prallte sie mit dem Kopf gegen eine muskulöse Brust, die unter einem weißen Oberhemd und einer bunten Krawatte steckte. Sie keuchte auf, als sich der Schmerz in ihrer Schulter wieder bemerkbar machte.
»Passen Sie doch auf, Winnett«, schimpfte Donovan. Er war der beste und klügste Agent in ihrem Analyseteam. Ein Analytiker, kein Außendienstler, trotz seiner zahlreichen Anträge und seines unerschütterlichen Enthusiasmus.
Sie presste die Lippen aufeinander und schluckte den Fluch herunter, der ihr bereits auf der Zunge lag.
»Tut mir leid, Donovan. Ist Ihnen was passiert?« Ihre Stimme klang leicht sarkastisch. Er schüttelte den Kopf.
»Ich mag gar nicht darüber nachdenken, dass Sie von Berufs wegen bewaffnet sind. Hm … Wer das wohl bewilligt hat?«, erwiderte er spitz.
Das tat weh, und einen wütenden Sekundenbruchteil verspürte sie den Drang, Donovan zu sagen, dass das dieselben Menschen gewesen waren, die seine Anträge auf die Versetzung in den Außendienst ablehnten. Aber dann fielen ihr ihre guten Vorsätze und Pearson wieder ein, und sie sprach den Gedanken nicht aus.
»Entschuldigung«, murmelte sie und ging weiter.
Donovan starrte ihr verblüfft hinterher und schien nicht zu wissen, wie er reagieren sollte. Die Tess Winnett, die er und alle anderen kannten, hätte ihn für weitaus weniger in Stücke gerissen. Er stand wie angewurzelt da und beobachtete, wie sie immer wieder zusammenzuckte, während sie sich mit dem schwer beladenen Wagen abmühte.
»Übrigens können Sie den Wagen auch schieben. Das dürfte bei den vielen Kisten deutlich einfacher gehen«, schlug er vor, wandte sich ab und hielt weiter auf die Fahrstühle zu.
Verdammt … Sie schloss kurz die Augen und versuchte, sich einen Ort vorzustellen, an dem sie die wütenden Flüche, die sie Dononvans breiten Schultern hinterherrufen wollte, tatsächlich aussprechen und etwas Druck ablassen konnte. Doch einen solchen Ort gab es nicht.
Sie drehte den Wagen um und schob ihn durch den breiten Flur zu ihrem Schreibtisch, was tatsächlich einfacher ging. Dabei musste sie lächeln und hatte die Untersuchungskommission und die Abertausend Seiten, auf denen die zahlreichen Gräueltaten des Family Man beschrieben wurden, beinahe vergessen.
Immerhin war sie wieder da. Das war alles, was zählte.
3. Ein Brief
Das Rezept für Pasta Primavera kann knifflig sein, wenn man nur selten kocht. Laura Watson hatte gar nicht vor, eine Spitzenköchin zu werden. Sie wollte nur schnell für sich und Adrian etwas zu essen zubereiten, bei dem es sich nicht um die langweiligen, im Tischbackofen gegrillten Sandwiches oder die lange Liste an Mikrowellengerichten handelte, die man vor dem Fernseher herunterschlang.
Sie wohnten in einem Apartment, dem man Lauras gute finanzielle Lage ebenso ansehen konnte wie ihre Berufswahl. Wenigstens doppelt so viele Lampen und Beleuchtungselemente wie üblich zierten die Wohnung, und alle trugen das Logo von WatWel Lightning.
Ein Wandleuchter in Form einer stilisierten Muschel hatte eine ganz besondere Bedeutung. Laura hatte die Lampe mit fünfzehn entworfen, und ihr Adoptivvater/Geschäftspartner hatte den Prototyp gebaut. Ein Jahr später verkauften sie dieses Modell wie geschnitten Brot an Hotels und Resorts an der Ost- und Westküste. Der Prototyp an der Wand ihres Apartments schien zwar nicht so recht zum Rest zu passen, wurde aber nur selten ausgeschaltet. Das sanfte Licht erinnerte Laura stets an ihr Familienerbe, das Unternehmen, das ihr leiblicher Vater zusammen mit ihrem späteren Adoptivvater Bradley Welsh gegründet hatte.
Brad war ihr sehr ans Herz gewachsen. Einen besseren Ziehvater hätte sie sich nicht wünschen können, da er sämtliche Regeln gebrochen und ihr Erbe nicht etwa in einem Treuhandfonds angelegt, sondern sie schon in sehr jungen Jahren an Entscheidungen beteiligt hatte. Er hatte ihr Interesse an der Herstellung von Leuchtkörpern geweckt, sie Führungsqualitäten gelehrt sowie sie an Besprechungen auf höchster Ebene und Verhandlungen mit wichtigen Kunden teilnehmen lassen. Zusammen waren sie zum Liebling der Medien geworden.
An den Wänden ihrer Wohnung hingen auch Fotos von ihnen beiden. Auf dem ältesten war sie sieben oder acht Jahre alt. Er hatte sie zur Einweihung einer neuen Fabrik mitgenommen. Sie hatte das Band eigenhändig durchgeschnitten, sich dabei mit der riesigen Schere abgemüht, ihn jedoch immer an ihrer Seite gewusst. An einem besonderen Platz über dem Kamin hing das einzige Foto ihrer lange verlorenen Familie, darauf fünf glückliche Menschen, die einen von zahlreichen schönen gemeinsamen Augenblicken beim Wandern im Yosemite-Nationalpark festgehalten hatten. An der gegenüberliegenden Wand war ein weiteres Foto zu sehen, das Laura viel bedeutete. Es zeigte ihren Vater und Brad Welsh am Tag der Unternehmensgründung von WatWel Lightning.
Aus diesem Grund war sie der Familientradition gefolgt und hatte ein Elektrotechnikstudium begonnen, um ihrer zukünftigen Rolle in der Firma gerecht werden zu können. Zurzeit lag sie dem Lehrplan sogar weit voraus, und es machte ganz den Anschein, als würde sie ihren Abschluss einige Monate früher als geplant machen. Dennoch stellte sie ein einfaches Nudelrezept vor Probleme.
Stöhnend las Laura die Anweisungen ein weiteres Mal durch. Das Rezept war auf zwei der beliebtesten Online-Rezeptseiten als »leicht« und »für Anfänger« eingestuft worden, doch ihr fehlte die erforderliche Geduld, um alle Schritte auszuführen, die nötig waren, bis man die farbenfrohe Schüssel voller Nudeln erhielt. Mit einem weiteren frustrierten Stöhnen beschloss sie, die Sache abzukürzen und die Punkte, die ihr die größten Probleme bereiteten, zu überspringen. Zucchini? Es waren keine vorhanden, und sie hatte auch nicht vor, das Haus zu verlassen und einkaufen zu gehen. Adrian würde den Unterschied sowieso nicht merken. Die roten Paprikaschoten lagen schon ziemlich lange in ihrem Kühlschrank und waren an einigen Stellen weich geworden, sodass sie eher in die Mülltonne als in ihr wundervolles samstägliches Mittagessen gehörten.
Sie warf einen besorgten Blick auf die Digitaluhr an der Wand des Esszimmers und beschloss, keine Zeit mehr zu vergeuden. Nervös fuhr sie sich mit den Fingern durch das lange, glatte Haar und strich sich einige rebellische Strähnen hinters Ohr. Adrians Workshop musste jeden Augenblick vorbei sein, und sie wollte in der Küche fertig werden. Okay … Dann also die schnelle Variante.
Rasch goss sie die Nudeln ab und murmelte etwas Unverständliches vor sich hin, als einige Farfalle am Seiher vorbei in den Abfallzerkleinerer fielen. Während sie die Nudeln gerade in einen großen Topf gab, summte ihr Handy. Sie warf einen schnellen Blick auf das Display und sah eine Nachricht von Adrian: Bin unterwegs, in zehn Minuten da. Sie öffnete eine kleine Packung gefrorenes Mischgemüse und verteilte es auf den Nudeln, goss Olivenöl über das Ganze, ohne es abzumessen, und schaltete den Herd ein.
Laura mochte technische Spielereien. Das hatte sie möglicherweise von ihrem technisch versierten Vater geerbt, da war sie sich jedoch nicht sicher. In ihrem Apartment gab es eine ganze Sammlung kleiner Geräte und elektronischer Spielzeuge aller Art. Ihre beste Freundin und Adoptivschwester Amanda neckte sie immer damit, dass alles in ihrer Wohnung ein Stromkabel besitzen würde. Für die Aufgabe, die die meisten Menschen ohne nachzudenken ausführten, den Teil des Rezepts, der besagte, »unter ständigem Rühren kochen«, hatte Laura ein neues Gerät, einen automatischen Rührer, den sie auf den Topf setzte und der für sie umrührte. Das war wirklich hilfreich.
Sie räumte schnell den Tisch leer, legte Tischsets darauf, schloss die kleine elektrische Reibe an und legte etwas Parmesankäse hinein. Als sie fast fertig war, hörte sie, wie der Schlüssel im Schloss umgedreht wurde.
»Hey, Baby«, begrüßte Adrian sie lächelnd und gab ihr einen Kuss. »Mmh … Das riecht aber gut!«
Boo, ihr getigerter Kater, schmiegte sich mit aufgestelltem Schwanz, der an ein Banner erinnerte, an seine Beine.
Laura kicherte leise. Die genaue Essenszubereitung würde ihr Geheimnis bleiben, Adrian sollte es nie erfahren. Er war Waise, hatte seine Eltern schon als Kind an Drogen und verschiedene Gefängnisse verloren und war in Straßengangs und Jugendstrafanstalten gelandet, bis ihn jemand bei sich aufgenommen hatte. Ein Fremder … Ein Nachbar, der bereit war, sich mit dem problembelasteten Teenager abzugeben und ihn zur Vernunft zu bringen, bevor er sein Leben vollkommen ruinierte.
Das hatten sie beide gemeinsam, sie hatten beide schon sehr früh ihre Eltern verloren. Laura war jedoch besser dran gewesen. Sie hatte nicht einen Tag auf der Straße, in Armut oder bei einer Pflegefamilie leben müssen. Der Geschäftspartner ihres Vaters und seine Familie waren von dem Augenblick, in dem ihr im Alter von gerade einmal fünf Jahren die Familie genommen worden war, für sie da gewesen. In dieser Hinsicht hatte sie Glück gehabt, denn sie war in einer liebevollen, fürsorglichen Familie aufgewachsen, in der es an nichts mangelte.
Adrian hatte diese Rauheit, die Wildheit eines Menschen, der die Straße überlebt hatte, eines Jungen, der gezwungen gewesen war, über Nacht erwachsen zu werden und auf sich aufzupassen, und das in einem Alter, in dem andere Kinder noch Briefe an den Weihnachtsmann schrieben, dagegen niemals abgelegt. Er hatte das Herz am rechten Fleck, konnte jedoch zuweilen anmaßend werden und seinen Beschützerinstinkt zu sehr ausleben, wenn seine Ängste und inneren Dämonen von all seinen albtraumhaften Erfahrungen befeuert wurden, was Laura jedes Mal in den Wahnsinn trieb.
Aus diesem Grund wandte sie den Blick auch möglichst ab, da sie es einfach nicht schaffte, ihm zu sagen, dass sie schwanger war. Sie hatte früher an diesem Morgen Gewissheit erhalten. Nachdem er zur Uni aufgebrochen war, hatte sie sich einen Schwangerschaftstest im Drugstore geholt und diesen zu Hause durchgeführt. Da ihre Periode erst wenige Tage überfällig war, hatte sie noch Hoffnung gehabt. Sie nahm jeden Morgen ohne Ausnahme die Pille, daher rechnete sie damit, nur eine Linie auf dem Test zu sehen, was ihre Befürchtungen nicht bestätigt hätte.
Doch da waren zwei Linien. Sie wollte es nicht glauben, sie konnte es einfach nicht. Daher wartete sie eine Stunde und machte einen weiteren Test. Doch auch der bestätigte die unerwünschte Wahrheit: Sie war schwanger. Entsetzt rannte sie zu ihrem Laptop und gab genau das ein, was sie empfand. Sie suchte nach »Trotz Pille schwanger. Wie ist das möglich?« und fügte gleich mehrere Fragezeichen an, was jedoch auf keinem rationalen Grund basierte, sondern der Versuch war, nicht aus lauter Verzweiflung etwas zu zertrümmern.
Die Suchergebnisse lieferten mehrere mögliche Ursachen, die alle nicht wirklich auf sie zutrafen, aber der vierte Eintrag der Liste bewirkte, dass es ihr eiskalt den Rücken hinunterlief. Anscheinend konnten Antibiotika die Wirksamkeit der Antibabypille beeinträchtigen. Sofort fielen ihr die Halsentzündung vor drei oder vier Wochen und die Medikamente ein, die sie dagegen genommen hatte. Wieso hatte sie denn niemand gewarnt?
Laura schluckte ihre Tränen hinunter und dachte über ihre Optionen nach. Sie war noch nicht bereit, eine Familie zu gründen, Windeln zu wechseln und all die anderen Dinge zu tun. Zuerst wollte sie ihren Bachelor und ihren Master machen, danach zusammen mit ihrem Adoptivvater das Unternehmen leiten und eine neue Reihe digitaler LED-Leuchten einführen. In ihren Plänen war kein Platz für ein Baby. Und Adrian? Er würde vermutlich auch nicht gerade den besten Vater abgeben. Zwar auch nicht den schlechtesten, aber jemand derart Herrisches konnte ein Kind – und auch seine Mutter – in den Wahnsinn treiben. Eine Abtreibung kam jedoch auch nicht infrage, da sie schon den Gedanken nicht ertragen konnte.
Im Laufe des Vormittags fiel es ihr immer schwerer, die Tränen zurückzuhalten, und irgendwann ließ sie ihnen freien Lauf. Sie weinte bitterlich und beschloss, etwas Besonderes zu kochen, weil sie darauf hoffte, dass Adrian dann möglicherweise nicht bemerkte, dass mit ihr etwas anders war. Es war eine Ablenkung, eine kulinarische Nebelkerze. In Bezug auf ihre Schwangerschaft musste sie erst einmal gründlich nachdenken, bevor sie sich entschied, was sie tun wollte. Sie vermisste ihre Mutter, ihre leibliche, an die sie sich kaum erinnern konnte. Am liebsten wäre sie jetzt zu ihr gelaufen, hätte sie um Rat gebeten und sich in ihren Armen die Augen ausgeheult.
Sie berührte im Vorbeigehen den veralteten Anrufbeantworter im Flur, der noch mit Kassetten funktionierte. Irgendwie hatte sie sich nie davon trennen können, da es sich um eines der wenigen Relikte handelte, die sie noch von ihren Eltern besaß. Sie hatten dieses Gerät berührt, vor fünfzehn Jahren. Nur mit Mühe schluckte sie den Kloß in ihrem Hals herunter und drehte sich zu Adrian um.
»Wie war’s in der Uni?«
Er schnaufte. »Wie immer … Einige sind so verdammt arrogant, dass es kaum auszuhalten ist. Ich habe mir ausgemalt, wie ich ihnen in den Arsch trete.«
Sie schenkte ihm ein schiefes, zärtliches Lächeln. Das war ihr Adrian. Zu zwei Teilen Ingenieur, zu zwei Teilen Teddybär, zu einem Teil Dickkopf und zu einem Teil Straßengauner.
»Wieder Simpson?«, fragte sie und bezog sich damit auf den Professor für elektromagnetische Feldtheorie.
»Hm, hm«, bestätigte er, griff in den Nudeltopf und schnappte sich eine Handvoll Farfalle, die er mit frisch geriebenem Parmesan bestreute. Sie gab ihm einen Klaps auf den Hintern.
In der anderen Hand hielt er mehrere Briefe. Sie bezweifelte, dass er sich überhaupt die Hände gewaschen hatte, bevor er das Essen berührt hatte.
»Autsch!«
»Finger weg«, schimpfte sie. »Das Essen ist noch nicht fertig. Und wasch dir die Hände.«
»Für mich sieht es fertig aus«, meinte er und legte die Post auf den Tisch.
»Nimm das weg, ich habe den Tisch gerade abgeräumt. Ist was Interessantes dabei?«
»Nur das hier«, antwortete er und sortierte die Post über dem Mülleimer, in dem der Großteil der Briefe sofort landete.
Er reichte ihr einen weißen Umschlag, auf dem ihr Name und ihre Adresse in einer geschwungenen Handschrift standen. Sie wischte sich die Hände an der Jeans ab, nahm den Brief entgegen und betrachtete ihn von beiden Seiten. Er war hier in Miami abgestempelt worden. Laura riss den Umschlag auf und zog einen einseitigen getippten Brief heraus.
Nachdem sie die ersten Zeilen gelesen hatte, wallte eine Flut an Gefühlen in ihr auf, und sie musste sich setzen. Sie stützte die Stirn in eine Hand.
»Was ist los?«
»Ähm, der Brief kommt von einer Doktor Austin Jacobs, einer Neurowissenschaftlerin. Sie führt einige Studien durch, um das Gedächtnis zu erforschen … Genauer gesagt geht es um ›kognitive Gedächtniswiederherstellung und Gedächtnisverfälschungen aufgrund von Traumata in der Kindheit‹, und sie würde sich gerne mit mir unterhalten.«
»Warum, in aller Welt, will sie mit dir sprechen?«
»Angeblich sei ich eine gute Kandidatin für ihre Studie. Sie schreibt, sie könne mir dabei helfen, mich zu erinnern. Ich rufe sie gleich Montag an.«
»Den Teufel wirst du tun«, fauchte Adrian und stand abrupt auf. »Das ist vorbei, Baby. Dieser Teil deines Lebens ist abgeschlossen. Lass ihn los.«
Sie mahlte mit dem Kiefer und schluckte ihre bissige Reaktion auf seinen Ausbruch herunter. Es gefiel ihr überhaupt nicht, wenn er versuchte, derart über ihr Leben zu bestimmen.
»Ich rufe sie Montag an, Adrian. Das ist vielleicht meine einzige Chance, mich zu erinnern. Und ich möchte mich erinnern … Ich will es.«
Sie schwiegen beide, da sie zu sehr mit ihrem inneren Aufruhr beschäftigt und zu aufgewühlt waren. Das Schweigen lastete schwer auf ihnen und wirkte fast wie eine ungute Vorahnung.
Laura faltete den Brief zusammen, steckte ihn in die Gesäßtasche, stand auf und stellte die Schüssel mit den Nudeln auf den Tisch. Danach holte sie Teller, Besteck und Gläser.
»Ich habe keinen Hunger mehr«, sagte Adrian schmollend.
Manchmal benahm er sich wie ein verwöhntes Kind.
»Jetzt sei nicht albern«, sagte sie ruhig, aber entschieden. »Ob du nun etwas isst oder nicht, macht keinen Unterschied, da ich Doktor Jacobs Montagfrüh so oder so anrufen werde.«
4. Überlegungen: Erster Mord
Ich erinnere mich an die Nacht, in der ich zum ersten Mal gemordet habe, als wäre es gestern gewesen. Ich weiß noch genau, wie ich mich präzise darauf vorbereitet habe, wie ich mich dafür bereit gemacht habe, sowohl vom taktischen als auch emotionalen Standpunkt aus gesehen. Angeblich ist das Töten schwer und kann einen Mann brechen. Es kann ihn für immer zerstören.
Mich hat es befreit.
Aber greifen wir meiner Geschichte nicht voraus. Als Erstes war da das Bedürfnis zu töten. Sie müssen wissen, dass es bei mir kein Drang war, jedenfalls nicht am Anfang. Möglicherweise war es auch so, dass ich den Drang zu töten auch schon früher verspürte, jedoch nicht begriff, wie ich mir ehrlich eingestehen muss. Mich überkam eine Unruhe, eine erstickende Wut ohne präzises, genau definiertes Ziel, sodass ich nicht entsprechend handeln konnte, weil mir schlichtweg schleierhaft war, was ich tun musste. Nicht bis zum ersten Mord.
Ja, ich hatte also den Drang, Allen Watson zu töten. Gründe dafür gab es mehr als genug. Sie waren zahlreich und sind doch irrelevant im Vergleich zu dem, was ich Ihnen mitteilen möchte. Aber bitte glauben Sie mir, wenn ich Ihnen versichere, dass ich alles versucht habe, um ihn nicht töten zu müssen. Er hat mir keine andere Wahl gelassen. Ich wurde in eine Ecke gedrängt und sah keine andere Alternative, als das armselige Leben dieses Mistkerls zu beenden.
Sobald mir bewusst geworden war, dass mir nichts anderes übrig blieb, fing ich an, mir zu überlegen, wie ich es tun sollte. Sie müssen verstehen, dass es für mich nie eine Option war – oder ist –, im Gefängnis zu landen. Ich überlegte hin und her und suchte nach einer Lösung, die mich nicht hinter Gitter bringen würde. Während ich mich Nacht für Nacht hin und her wälzte und versuchte, den perfekten Mord zu ersinnen, geschah etwas. Das Schicksal griff ein und eröffnete mir eine Möglichkeit.
Ein Serienmörder, dem die Medien den lächerlichen Namen The Family Man verpasst hatten, hatte nur wenige Kilometer vom Haus der Watsons entfernt eine vierköpfige Familie ermordet. Ich erfuhr in den Nachrichten davon und sah, wie die Leute im Fernsehen wegen der Morde außer sich waren und sie als schreckliche Wiederholung einiger andere Morde bezeichneten, die auf die gleiche Weise und in der gleichen Gegend begangen worden und mir irgendwie entgangen waren.
Was für eine Gelegenheit!
Ich weiß noch genau, dass ich den Rest der Nacht tief und fest geschlafen habe. Am nächsten Morgen wachte ich ausgeruht auf und beschaffte mir sämtliche Informationen, die es über diesen Serienkiller gab. Dabei achtete ich darauf, keine Spuren zu hinterlassen. Dafür sind Büchereien gut, denn dort kann man anonym recherchieren, getarnt mit einem Hoodie, einer dickrandigen Brille und einer derart finsteren Miene, dass mich meine eigene Mutter nicht wiedererkannt hätte. Wenn ich wüsste, wer den Hoodie erfunden hat, würde ich demjenigen einen Scheck schicken. Vielleicht aber auch nicht … Denn so würde ich Spuren hinterlassen, und das wäre ein großer Fehler. Bargeld wäre weitaus klüger.
Schon bald wusste ich dank der Medien und des Internets alles, was es über den Family Man zu wissen gab. Die Polizei hatte wahrscheinlich noch mehr Informationen, hielt diese jedoch aus Angst vor Nachahmungstätern zurück, was mir jedoch egal war. Den Family Man nachzuahmen, schien mir der beste Weg zu sein. Ich sah mir seine Morde genau an, betrachtete alle Faktoren und nahm sie unter die Lupe: wie er seine Opfer tötete, wie er sich Zutritt zu ihren Häusern verschaffte, welche Waffe er benutzte, welches Kaliber und welche Marke, wie er die Tat beging. Jede Kleinigkeit zählte.
Es gab nur ein Problem dabei, den Family Man nachzuahmen: Ich würde Allen Watsons ganze Familie umbringen müssen. Na gut … Das war seine Schuld, nicht meine. Er hatte mich ja erst zu dieser Tat getrieben.
Die Beschaffung der richtigen Waffe war nicht einfach. Ich musste mir eine Beretta neun Millimeter kaufen, natürlich nicht registriert, und dafür einen verlässlichen Straßenhändler finden. Zur richtigen Straßenecke in der Nähe des Liberty Square zu gelangen, erwies sich als schwieriger als der eigentliche Waffenkauf. Ich konnte nicht mit meinem Wagen hinfahren. In Taxis gibt es heutzutage Kameras im Innenraum, und so nutzte ich zum ersten Mal seit Jahren den öffentlichen Nahverkehr, schaltete das Handy aus und setzte trotz der verfrühten Hitzewelle die Kapuze meines Hoodies auf. Ich verbarg mein Gesicht die ganze Zeit hinter einer Zeitung, und sobald ich das Viertel erreicht hatte, legte ich den letzten Teil der Strecke zu Fuß zurück.
Die erste Person, die ich nach einer Waffe fragte, schickte mich zum Teufel. Es war ein gut gebauter Schwarzer, der meine Frage persönlich nahm und sofort davon ausging, ich würde aufgrund seiner Hautfarbe davon ausgehen, dass er illegale Waffen verkaufte. Damit lag er, ehrlich gesagt, richtig, was ich ihm gegenüber jedoch nicht zugab. Ich entschuldigte mich nur und hörte erst auf, als er »Vergiss es, Mann«, murmelte und weiterging. Ich hatte meine Lektion gelernt.
Danach lief ich noch eine Weile über den Liberty Square und näherte mich schließlich einem anderen jungen Mann, diesmal einem Weißen, jedenfalls musste die Haut unter seinen vielen Tattoos irgendwann einmal weiß gewesen sein. Er machte diese schnellen, ruckartigen Bewegungen mit dem ganzen Körper und war vermutlich methsüchtig. Aber er kannte jemanden und sagte, er könnte mir für einen Zwanziger sagen, wo ich denjenigen finde.
Das tat er, und eine Minute später trat ein dritter Mann auf uns zu und führte mich zu einem Wagen, in dessen Kofferraum eine Vielzahl von Schusswaffen lag. Er hatte genau die Pistole, die ich gesucht hatte, und schwor, sie sei zuvor für keine Straftat verwendet worden. Als hätte ich ihm das abgekauft … Vielleicht hat er aber auch die Wahrheit gesagt, wer weiß?
Er verlangte zweihundert Dollar. Da ich die Straßenpreise für illegale Waffen nicht kannte, hatte ich mich darauf eingestellt, zweitausend zu bezahlen, und so stand ich nun da und versuchte, die beiden Hunderter hervorzuziehen, ohne dass sie merkten, wie dick mein Geldscheinbündel tatsächlich war. Erfreut darüber, dass ich nicht zu handeln versuchte, bot er mir noch zwei Schachteln mit Neun-Millimeter-Munition an, und ich nahm mir vor, die Fingerabdrücke von jeder einzelnen Patrone zu wischen. Man kann nie vorsichtig genug sein.
Ich war bereit und konnte die Sache nicht länger hinauszögern. Allen Watson würde nicht verschwinden oder lernen, den Mund zu halten, er wurde zu einem zu großen Risiko für mich. Ich fuhr los und parkte in der Straße, die parallel zu der Sackgasse verlief, in der er wohnte, hinter einem Busch. Dann wartete ich geduldig, bis er von der Arbeit nach Hause kam, und wartete danach noch etwas länger, bis es dämmerte. Erst dann schlug ich zu.
Er ließ mich wie erwartet rein, und ich gab ihm nicht einmal die Gelegenheit, seine Frage ganz auszusprechen. Das war auch völlig unnötig. Die Zeit für Gespräche war verstrichen. Ich drückte zweimal den Abzug und sah zu, wie er gegen die Wand sackte und einen dicken Blutfleck auf der karamellfarbenen Holzverkleidung hinterließ.
Die Aufregung des Tötens erfasste mich, als hätte ich mir Heroin gespritzt, schoss mir direkt ins Gehirn und ließ jede Zelle meines Körpers vibrieren. Wow! Was für ein Rausch! Ich erinnere mich noch genau, wie mir der metallische Geruch des frischen Bluts in die flatternden, aufgeblähten Nasenflügel stieg und wie mich das Hochgefühl durch den Adrenalinrausch in etwas anderes verwandelte – in einen Übermenschen, ein Raubtier, das Blut gewittert hatte. Sie sehen, dass ich damit gerechnet hatte, mir würde nach dem Mord an Watson übel werden, denn ich hatte gehört, dass es anderen so ergangen sei. Ich hatte sogar eine Plastiktüte dabei, in die ich mich notfalls übergeben konnte. Aber nein, das war überhaupt nicht nötig.
Ich hörte die Kinder kreischen und wollte nicht, dass Rachel Watson hereinstürmte und die Sache unschön wurde. Daher rannte ich die Stufen hinauf und holte sie schnell wieder ein. Es machte mir nichts aus, die drei Kinder zu töten, war jedoch auch keine Freude. Vielmehr empfand ich – rein gar nichts. Aber mir blieb nun mal keine Wahl, wo der Family Man doch ganze Familien und nicht nur die Erwachsenen ermordet hatte.
Das Beste hatte ich mir bis zum Schluss aufgehoben, und so machte ich mich auf die Suche nach Rachel. Ein Nachbar kam vorbei und hat mich ganz schön erschreckt. Ich hasste diese Furcht, die mir die Kehle zuschnürte und mich zu ersticken drohte. Echte Raubtiere kennen keine Furcht, warum fürchtete ich mich dann? Aber ich schüttelte sie ab und suchte Rachel Watson, wobei ein vergessenes, aber vertrautes Gefühl in mir aufstieg und mich anstachelte.
Als sie mich sah, ließ sie einige Teller fallen und wich schreiend zurück, bis sie gegen den Küchenschrank stieß, um mich anzuflehen.
»Nein, nicht«, kreischte sie immer wieder, genau wie ihr Mann es in seinen letzten Augenblicken getan hatte.
Doch ich konnte den Abzug nicht drücken, irgendetwas verhinderte es. Ich wollte es. Ich wollte sie tot sehen, und sie musste sterben. Aber nicht so … Es schien mir Vergeudung zu sein, eine schreckliche Verschwendung von etwas, das zu einem berauschenden Erlebnis werden konnte, einer herrlichen Erinnerung, die ich noch jahrelang auskosten würde.
Ich legte die Waffe auf die Arbeitsplatte, zog ein großes Messer aus dem hölzernen Messerblock und machte einen Schritt auf sie zu. Sie hatte die Augen vor Angst weit aufgerissen und starrte die lange Klinge an.
Dann keuchte sie auf und schrie lauter und immer lauter: »Nein, nicht!«