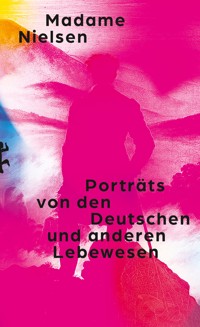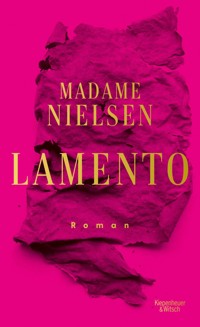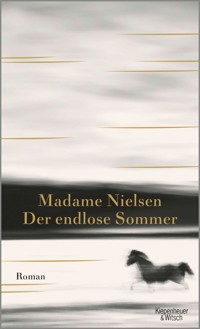19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vor langer Zeit, als Madame Nielsen vielleicht noch ein junger Mann war, kommt er aus der Provinz nach Kopenhagen, um Künstler zu werden und den großen Autorinnen und Autoren seines Landes zu begegnen. Doch aus der Nähe zeigen auch die Großen ihre allzu menschlichen Seiten ... Dieser Roman mit seiner unnachahmlichen Mischung aus Hans Christian Andersen, Samuel Beckett und Buster Keaton zementierte Madame Nielsens Ruf als eine der bedeutendsten dänischen Autorinnen der Gegenwart und war für den wichtigsten gesamtskandinavischen Literaturpreis nominiert. Im Lauf von zwölf skurrilen, peinlichen, ergreifenden, ganz und gar unmöglichen und hinreißend zärtlichen Begegnungen formt sich allmählich das Bild eines dreizehnten Schriftstellers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Madame Nielsen
Mein Leben unter den Großen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Madame Nielsen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Madame Nielsen
Madame Nielsen, Autorin, Sängerin, Künstlerin, weltweite Performerin. Ihre Romane wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, und sie war mehrfach für den Nordic-Council-Preis nominiert. Ihr Roman »Der endlose Sommer« erschien 2017 auf Deutsch und wurde ein großer Erfolg. Die Autorin spricht fließend Deutsch.
Hannes Langendörfer, geboren 1975 in Heidelberg, studierte in Freiburg und Uppsala Skandinavistik und Germanistik. Er lebt als Übersetzer aus dem Dänischen, Schwedischen und Englischen in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Dieses Buch erzählt von zwölf unvergesslich peinlichen Begegnungen mit großen Schriftstellerinnen und Schriftstellern und vom gescheiterten Versuch, Peter Høeg zu sein und alles zu können: fließend Suaheli sprechen, fechten, Ballett tanzen, Ski fahren, Berge besteigen, Romane schreiben, die sieben Weltmeere befahren (und zwar alles gleichzeitig).
Als Madame Nielsen noch Claus Beck Nielsen war, kam dieser Claus eines Tages aus der Provinz nach Kopenhagen, um seine Träume zu verwirklichen und wahrhaft großen und namhaften Menschen zu begegnen. Doch auch die Großen waren nur so klein wie er, und die Begegnungen mit ihnen wurden zwar unvergesslich, aber vor allem eins: quälend. Aus der Spiegelung mit den Großen entsteht eine ganz eigene Geschichte.
Dieser frühe Roman, eine Mischung aus Hans Christian Andersen und Buster Keaton, begründete Madame Nielsens Ruhm als geniale Autorin, die sich nicht um Schreibkonventionen schert.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Mine møder med De Danske Forfattere
Copyright © 2013 by Madame Nielsen. Translated from the Danish language: Mine møder med De Danske Forfattere, First published by Gyldendal A/S 2013
Aus dem Dänischen von Hannes Langendörfer
© 2024, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Reilika Landen/plainpicture
ISBN978-3-462-31181-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Die Geschichte unserer Zeit
Das Brot & der Körper
An der Schwelle zum Nobelpreis
Die universale Großmutter
Der Schriftsteller höchstpersönlich
Die innerste Zone
Der geborene Hund
So nah, dass es schmerzt
Wir Engel sind nicht immer lieb
Ein Ja auf Probe
Die schicksalhafte Begegnung
Die zwei Körper des alten Königs
Für meine Tochter
Die Geschichte unserer Zeit
Als ich mit neunzehn zum ersten Mal nach Kopenhagen kam, war ich noch nie im Leben einem berühmten Menschen begegnet. Am ehesten noch, als der westdeutsche Handball-Gott Hansi Schmidt mir Mitte der Siebziger nach einem Kampf gegen die Lokalhelden vom HC Stjernen ein Autogramm in mein Turnierheft kritzelte, kurz den Kopf hob und mich sogar sah, ehe ich von der Menge der Fans verschluckt und fortgespült wurde. Menschen, die etwas Außergewöhnliches waren, kannte ich nur aus der Zeitung, den Illustrierten und dem Fernsehen. Nie hatte ich jemand Berühmtes auf der Straße oder zufällig in der Stadt im Kaufhaus gesehen, und dass ich jemals mit einem bedeutenden Menschen reden würde, konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Mit sechsundzwanzig zog ich nach Kopenhagen. Ein paar Wochen vor dem Umzug hatte meine erste und bis dahin einzige Freundin mit mir Schluss gemacht, und ich war allein in einem Sommerhaus an der Nordsee. Es war März, die Landschaft farblos und verlassen, und ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, also schaltete ich den Fernseher ein. Ich landete mitten in einer Sendung. Schauplatz war die Storebælt-Fähre, die damals noch zwischen Nyborg und Korsør verkehrte. In drei unförmigen, aufblasbaren Sitzsäcken aus durchsichtig blauem Plastik hockten drei Männer und unterhielten sich. Zwei von ihnen waren Künstler, der dritte Schriftsteller. Zu der Zeit hatte ich weder von Kunst noch von Künstlern groß eine Ahnung, ich kannte nur, was ich in meiner Kindheit und frühen Jugend gesehen hatte, wenn meine Eltern auf der Hin- oder Rückfahrt vom Sommerhaus mal einen Zwischenstopp eingelegt und mit meinen beiden Schwestern und mir eine Galerie oder ein Museum besucht hatten. Die großen Autoren unsres Landes kannte ich praktisch nur vom Bücherregal meiner Eltern, wo ihre Namen auf jedem dritten oder fünften Buchrücken standen, alles Bücher aus dem Gyldendal Buchclub. Ein paar von ihnen hatte ich in die Hand genommen und auf der Jagd nach erregenden Stellen durchgeblättert, die mir eine mickrige, schamhaarlose Erektion bescheren konnten. Bei der Abschlussprüfung am Ende der Neunten war ich mit einem Gedicht von Morten Nielsen drangekommen, aber worum es darin ging, wusste ich damals so wenig wie heute. Mit siebenundzwanzig hatte ich fast nur Jungsbücher gelesen, Detektiv Kim, die Jan- und die Flemming-Bücher, dann Fünf Freunde, »Geheimnis um …«, Die schwarze Sieben, Alfred Hitchcock und die drei Fragezeichen und später Alistair McLean, Der Herr der Ringe, Unten am Fluss, Das Mädchen in der Schaukel, Ayla und der Clan des Bären und, als einzigen großen Autoren unsres Landes, dessen Namen ich mir gemerkt habe: den Weltumsegler Troels Kløvedal. Einmal hatte Lola Baidel, eine der größten Dichterinnen der Zeit, an meiner Schule aus ihren Gedichten gelesen, aber ausgerechnet an dem Tag lag ich schwitzend und schlotternd mit Grippe zu Hause in meinem Schubkastenbett mit den zwei grün karierten Schaumstoffmatratzen und bekam kein Wort davon mit. Worüber die drei Männer auf den aufblasbaren, durchsichtig blauen Plastiksitzsäcken redeten, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich am nächsten Morgen die sechs Kilometer vom Sommerhaus in die nächste kleine Stadt und in die dortige Schule ging, wo es damals noch eine gemeinsame Schul- und Stadtbibliothek gab. Im Regal mit der Aufschrift »Lyrik« stand ein einzelnes Buch von demjenigen der drei Männer auf den aufblasbaren blauen Plastiksitzsäcken, der laut Einblendung am Bildrand Schriftsteller war. Das Buch war verblüffend dünn, kaum dicker als ein Micky-Maus-Heft. Aber noch enttäuschender war sein Titel. Die Geschichte unserer Zeit. Ich hatte mich nie für Geschichte interessiert, in der Schule gab’s so was wie »Geschichte« überhaupt nicht, in meiner ganzen Kindheit und frühen Jugend drehte sich alles nur um Sport, drinnen in der Halle oder draußen auf den Bolzplätzen, samstags vorm Fernseher, wenn Fußballtoto kam, und jeden Nachmittag mindestens eine halbe Stunde auf dem Klo mit der Sportbeilage vom Montag oder dem Tischtennis-Monatsmagazin. Ich konnte die Namen aller Spieler von sämtlichen sechzehn Nationalmannschaften bei der Fußball-WM in Westdeutschland auswendig, aber »die dänische Thronfolge« kannte ich nur aus den Geschichten, die mein Vater über seine Schulzeit in Fredericia und Tønder erzählte. Ich weiß auch nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Jedenfalls nicht ein Buch über Die Geschichte unserer Zeit. Andererseits: Etwas Neues musste passieren, irgendwas, ich war sechs Kilometer bis zu dieser Kleinstadt gelaufen, gleich würde ich dieselben sechs Kilometer wieder zurücklaufen und dazu noch bei steifem Gegenwind aus West, ich musste unbedingt als ein anderer zurückkehren, oder wenigstens mit dem Ansatz zu einem völlig neuen Leben, also griff ich mir zuletzt doch Die Geschichte unserer Zeit, ließ sie von der Schulbibliothekarin stempeln und ging auf der Schotterstraße zurück zum Sommerhaus. Den Rest des Tages und die Nacht durch und den Tag und die Nacht darauf las ich Die Geschichte unserer Zeit. Ich las langsam und gründlich und laut vor mich hin und verstand rein gar nichts. Die Geschichte, von der das Buch laut Titel angeblich handelte, wurde mit keinem Wort erwähnt, und auch das Buch selbst war keine Geschichte. Trotzdem machte es auf mich einen großen Eindruck. Die Stelle, an der die Hauptperson, die keinen Namen hat, sondern nur ich heißt, wie du und ich, im Zug aus dem Fenster schaut, und die Landschaft »vorbeiwirbelt«, und wenige Zeilen später ist »das Universum nicht größer als ein Stecknadelkopf«, »eine Glut«, die aufflammt und erlischt. Im Lauf der nächsten Tage oder Wochen schrieb ich fünf Gedichte und beschloss, nach Kopenhagen zu fahren. Ich zog in eine Wohngemeinschaft im dritten Stock, ich hatte von allen am wenigsten Geld, aber da ich auch keine Möbel besaß, bloß eine Matratze und einen Rucksack mit Klamotten, Zahnbürste und den fünf Gedichten, und mit meinen knapp sechzig Kilo auch selbst nicht viel Platz wegnahm, konnte ich problemlos in dem hintersten Kämmerchen hausen, einem viereckigen Raum mit Petroleumofen und winzig kleinem Dachfenster, durch das immer zur vollen Stunde das Glockenläuten der drei umliegenden Kirchen dröhnte, ohrenbetäubend und ganz außer Takt. Ich setzte meinen Rucksack ab, ging zur Post und schickte meine fünf Gedichte an die einzige Literaturzeitschrift, von der ich je gehört hatte, ging in die Bibliothek und lieh eine dicke Anthologie mit dänischen Gedichten aus den letzten Jahrhunderten aus, nicht bloß Die Geschichte unserer Zeit, nein, die ganze, große Geschichte. Auf dem Rückweg kaufte ich einen Kanister Petroleum und fand einen kleinen Tisch und einen Stuhl in einem Müllcontainer. Ich schleppte den ganzen Kram hoch in mein Kämmerchen im dritten Stock, lieh mir von einem meiner Mitbewohner einen Stapel Papier und ein paar Bleistifte, legte den Stapel neben das Buch mit den dänischen Gedichten der letzten Jahrhunderte auf den Tisch, setzte mich hin, schlug es auf und fing an zu lesen. Die nächsten Wochen oder Monate saß ich an dem Tisch, las in dem Buch und schrieb einzelne Wörter und manchmal sogar ganze Zeilen auf die Blätter, die sich im Lauf der Tage und Nächte auf dem Tisch stapelten, auf den Boden segelten, herumflogen und zu kleinen Haufen sammelten wie das Laub eines kubistischen Albinobaums. Jede Stunde, rund um die Uhr, schmetterten die Kirchenglocken durch das winzige Dachfenster und dröhnten in meinem Schädel, der sich immer leerer und mehr oder weniger inspiriert anfühlte, während der Frühling Sommer wurde, schwerer Regen gegen die Scheibe schlug und tief unten im Hof auf den Boden klatschte. Nur ein Mal alle drei oder fünf Stunden stand ich auf, um kurz in der Küche mein Wasserglas zu füllen und vielleicht, wenn ich zufällig gerade allein war, eine dünne Scheibe von dem Brot eines der anderen abzuschneiden und ein klein bisschen Butter eines Dritten draufzuschmieren, vielleicht auch einen Hauch Gutsleberwurst. Auf dem Weg zurück ließ ich Wasser. Das war alles. Ein paar Wochen später kam die Absage von dem Redakteur der Zeitschrift, einem der großen, alten Dichter des Landes. Er hatte meine fünf Gedichte gelesen und wollte keins davon drucken, ermunterte mich aber dennoch, ihm mehr Gedichte zu schicken, nicht gleich, versteht sich, in einem halben Jahr oder so, wenn ich mich etwas weiterentwickelt hatte. Gegen Ende des folgenden Winters schickte ich dem Redakteur der Zeitschrift weitere neun Gedichte. Meine fünf Erstlinge, dachte ich, waren vielleicht nicht künstlerisch genug gewesen, auch der Schriftsteller hatte ja nicht allein auf seinem aufblasbaren blauen Plastiksitzsack gehockt, sondern in Gesellschaft zweier richtiger Künstler. Meine Gedichte mussten unbedingt auch einen Bezug zur Kunst haben, also ging ich in die Küche, und da ich zufällig gerade allein war, stibitzte ich eine Rote Bete aus dem Kühlschrankfach eines Mitbewohners, schnitt sie mittendurch, zog alle meine Sachen aus, verteilte neun Blatt weißes Papier auf dem Boden, rieb eine Rote-Bete-Hälfte gegen mein Knie, presste das Knie auf eins der Blätter und wiederholte danach die Prozedur mit acht anderen Körperteilen, presste erst die Hand, dann eine Wange, dann die Stirn, eine Pobacke, den Mund, den linken Fuß, die rechte Schulter und zu guter Letzt meinen Penis auf je eins der neun weißen Blätter. Ich zog mich wieder an, las die neun »Rote-Bete-Drucke« vom Boden auf und ging in die Bibliothek, wo ich eine Schreibmaschine lieh und jedes der neun handgeschriebenen Gedichte auf je einem Kunstwerk ins Reine tippte, ging quer über den Platz zur Post und schickte meine neun nunmehr poetischen Rote-Bete-Drucke an den Zeitschriftenredakteur. Drei Monate später erschien die nächste Nummer der Zeitschrift, darin unter anderen zwei Gedichte von Anders Claudius Westh, allerdings ohne Rote-Bete-Drucke. Das war der erste, letzte und einzige Auftritt Anders Claudius Wesths in der dänischen Literaturgeschichte. Mehr braucht’s in diesem Land aber auch nicht. Fast nichts und doch genug, dass ich plötzlich ein Teil der »Geschichte unserer Zeit« war, von Dutzenden, Hunderten, vielleicht Tausenden jungen und weniger jungen, schon ziemlich gescheiterten älteren Männern und Frauen, die es irgendwann mal mit einem Gedicht, einer Novelle, vielleicht sogar einem Romanfragment in eine Zeitschrift oder eine Anthologie geschafft haben und alle miteinander das ausmachen, was man »die dänischen Schriftsteller« nennt. Genug, um mich eine Zeit lang in ihren Kreisen bewegen zu können, mehr oder weniger unbemerkt, die meisten sahen nur sich selbst, und sie zu betrachten. Und genug, dass ich sie jetzt, knapp zehn oder mehr als zwanzig Jahre später, schreiben kann, die Geschichte meiner Begegnungen mit den großen Autoren unsres Landes.
Das Brot & der Körper
Mehrere Jahrzehnte war Poul Borum alleinherrschender Herausgeber der wichtigsten Zeitschrift für moderne dänische Lyrik, ebenjener Zeitschrift, die ganz unten auf Seite 38 in einer ihrer Hunderten Nummern zwei Gedichte von Anders Claudius Westh abdruckte. Außerdem war Borum Rezensent bei einem Morgenblatt und entschied dort, oft mit nur wenigen Zeilen, ein für alle Mal, wer ein echter Schriftsteller und wer von nun an als talentloser Trottel zu betrachten war und dazu verdammt, in Dunkelheit zu versinken. In seiner so gut wie nicht vorhandenen Freizeit schrieb er selbst Gedichte, keine echten Gedichte, das konnte jeder echte Dichter sehen, doch da sie allesamt ja bloß kraft seines Urteils echte Dichter waren, sagte oder schrieb es keiner, bis er eines Tages plötzlich tot war. Auch ich hatte einige seiner Gedichte gelesen, in der Anthologie der großen Lyriker unseres Landes, die nun schon seit über einem Jahr in meinem Kämmerchen auf dem Tisch lag und die ich einmal im Monat zum Verlängern in die Bibliothek trug, und auch ich konnte sehen, dass es keine echten Gedichte waren, nur warum genau, wusste ich nicht zu sagen. Das Einzige, was mir wirklich haften blieb, war der »Körper«. Gleich mehrere Gedichte handelten vom »Körper«. Der »Körper« war anscheinend von zentraler Bedeutung für die Poesie und jeden, der ein echter Dichter sein wollte. Das wunderte mich, denn ich hatte Poul Borum einmal in einem literarischen Salon ein paar dieser Gedichte lesen hören, und soweit ich sehen konnte, kümmerte er sich nicht im mindesten um den »Körper«, jedenfalls nicht seinen eigenen, ja, es sah sogar so aus, als wüsste er überhaupt nicht, dass er einen hatte. Und recht besehen war das, was man unter dem orangefarbenen oder pissgelben, blauen oder lila Strubbelhaar, der Lederhose und den Nietengürteln, mit denen er alles zusammenhielt, erahnen konnte, auch bloß ein unförmiger, recht schlaffer Sack aus alter Haut und nahezu nutzlosen Knochenresten und Fett. In der Zwischenzeit war ich in meine eigene kleine Wohnung mit Schranktoilette und Blick auf Christiania gezogen. Ich hatte die Matratze, den Tisch und den Stuhl, die zusammengekratzten Haufen Papier, das blaue Exemplar der Zeitschrift mit Anders Claudius Wesths zwei Gedichten und die Anthologie der großen Lyriker unseres Landes mit hoch in die Wohnung genommen und hockte jetzt jeden Tag und bis tief in die Nacht am Tisch und las in der Anthologie und schrieb meine mehr oder weniger echten und jedenfalls nie wirklich gedruckten Gedichte. Kurz vor Morgengrauen ging ich runter nach Christiania, sammelte Pfandflaschen für die Miete und schnorrte in der Pusher Street ein halbes, mehrere Tage altes und größtenteils sogar rissiges Honig-Salz-Brot in der Sunshine Bakery, die wie ein kleines Stück New York in der Provinz rund um die Uhr geöffnet hatte, sogar an Heiligabend. An den Tresen draußen vor der Bäckerei gelehnt aß ich eine Scheibe von dem Brot und beobachtete die Haschdealer, die im Feuerschein um eine Öltonne standen, redeten und sich die Hände wärmten, während ihre riesigen Hunde wie Schatten im Dunkel umherstreiften, und ging dann wieder hoch in meine Wohnung. Aber einmal in der Woche ging ich weiter über die Brücke in die Stadt, in der Hoffnung, zufällig einem der dänischen Autoren über den Weg zu laufen, zu denen ich jetzt gehörte. Das war nicht sonderlich schwer, die dänischen Autoren waren überall, vor allem abends und nachts. Sie versammelten sich zu Lesungen oder in den Cafés und Kneipen der Stadt oder standen im Dunkeln vor einer solchen und zitierten schwankend Lorca, aber vor allem sich selbst. Und an so einem Abend, als ich unbemerkt in einer kleinen Gruppe von Schriftstellern hinter einem Kulturhaus in der Innenstadt stand, geschah es, dass der große Poul Borum auf uns zukam und zu seinem 58. Geburtstag einlud. Zwei der drei anderen dänischen Schriftsteller waren seine Protegés, sie kamen täglich und besonders nachts zu ihm in die Wohnung und aßen und tranken und gingen hoch auf die Dachterrasse und rauchten Hasch und torkelten runter und schliefen in einem seiner vielen kleinen Zimmer oder einfach auf einer Matratze zwischen den Regalen seiner kolossalen Bibliothek ihren Rausch aus. Die dritte war die Freundin eines vierten. Protegés. Und ich? Ich bezweifele, ob er überhaupt wusste, wer ich war. Ich jedenfalls wusste es nicht. Aber da Poul Borum nicht bloß ein gnadenloser Kritiker und ein schlechter Dichter, sondern auch ein großzügiger Mensch war, und da ich zufällig in der kleinen Schar dänischer Schriftsteller stand, lud er auch mich zu seinem Geburtstagsabendessen ein. Oder so verstand ich es zumindest. Er sagte zwar nicht meinen Namen, er sah mich noch nicht mal an, aber er sagte »ihr«: – Habt ihr nicht Lust, am Dienstag zu meinem achtundfünfzigsten Geburtstag zu kommen, nichts Großes, nur ein kleines, intimes Abendessen. – Wann, fragte einer der beiden Protegés. – Acht Uhr, sagte Poul Borum. – Danke, sagte ich. Was keiner hörte. Ich hatte, wie bereits zart angedeutet, kein Geld, ich lebte von Flaschensammeln und altem Brot, ich konnte es mir nicht leisten, ein echtes Geschenk zu kaufen, eine Platte, ein Buch, eine Flasche Wein oder einen der Nietengürtel, mit denen er seinen unförmigen Mangel an »Körper« zusammenhielt. Ich überlegte, ihm ein signiertes Exemplar der Zeitschrift mit meinen zwei Gedichten zu schenken, aber sie war – abgesehen von dem Tisch, dem Stuhl und der Matratze – das einzig wirklich Private, was ich besaß, ohne sie war ich wieder ein Niemand, und das wollte ich nicht. In der Nacht darauf ging ich also in Christiania Flaschen sammeln, und als es Morgen wurde, kaufte ich im Supermarkt ein Kilo Mehl und ein Päckchen Hefe. Auf dem Weg hinauf in die Wohnung schnorrte ich ein bisschen Salz von dem Nachbarn unter mir, Wasser hatte ich selbst aus dem einzigen Wasserhahn der Wohnung. Daneben stand ein kleiner Ofen, kaum größer als die Anthologie dänischer Dichter, aber groß genug, dass ich in der folgenden Nacht, als ich noch ein nicht ganz echtes Gedicht geschrieben hatte, ein Brot in ihm backen konnte. Warum ich mich ausgerechnet entschied, dem großen Kritiker ein Brot zu backen und zu schenken, weiß ich nicht. Vielleicht hatte es etwas mit dem »täglichen Brot« zu tun und der Verbindung vom »Körper« als dem zentralen Element für die Dichtkunst und dem, der ein echter Schriftsteller sein will. Vielleicht war es bloß, weil ich kein Geld hatte und selbst von Wasser und Brot lebte und abgesehen von den großen Autoren unseres Landes an nichts anderes dachte als Brot. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, das Brot allein wäre vielleicht nicht genug. Es musste irgendwie meine ganz persönliche Signatur tragen. Als dänischer Schriftsteller. Ich hatte gerade den Durchbruch geschafft und mir mit zwei der neun poetischen Rote-Bete-Gedichte, die jeweils den Abdruck eines Teils meines ganz persönlichen »Körpers« trugen, einen Namen als dänischer Schriftsteller gemacht. Das wusste zwar außer ihm und mir keiner, und letztlich hatte er nur zwei der neun Gedichte in seiner Zeitschrift gebracht, und ganz ohne Rote-Bete-Druck. Aber ich bildete mir ein, oder hoffte, dass es ausschließlich daran lag, weil eine grafische Wiedergabe der neun Rote-Bete-Drucke für die Zeitschrift eine zu kostspielige Angelegenheit war, und er deswegen beschlossen hatte, ihren Abdruck auf einen späteren Zeitpunkt der Literaturgeschichte zu verschieben. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, diese Spur weiterverfolgen zu müssen. Und so formte ich den Teig mit meinen eigenen Händen zu einer Zahl, ehe ich ihn in den Ofen schob. Die Zahl war 58. Es war zum einen das allerbasalste, das tägliche Brot, und gleichzeitig mit meinen bloßen Händen, sozusagen meiner eigenen körperlichen Signatur, zu einem Zeichen transformiert, der Zahl 58, die genau das Alter seiner Person, seines Körpers zum Ausdruck brachte, wodurch sein und mein Körper, meine Signatur und seine kritische Lesart, indem der Ofen den weichen Teig zu einer endgültigen, festen goldbraunen Form buk, in einer höheren, künstlerischen Einheit aufgingen. Am nächsten Abend trug ich das Brot über die Brücke und die Havnegade entlang und klingelte an der Nummer 37. Er öffnete selbst die Tür. Einen Moment stand er bloß da und starrte mich leer und ausdruckslos an, als hätte er mich noch nie im Leben gesehen. Er hält mich für einen Pizzaboten, dachte ich. – Herzlichen Glückwunsch!, sagte ich und überreichte ihm das Brot, – und danke für die Einladung. –Komm rein, murmelte er mit seiner tiefen, zischligen Stimme und ging vor mir durch einen Flur und links an einer endlosen Reihe dicht stehender, vollgepackter Regale vorbei, durch ein kleines Wohnzimmer mit dem größten Fernseher, den ich in meinem ganzen Leben gesehen hatte, und einer kleinen Sofagruppe aus schwarzem Leder, auf der drei, vier der dänischen Schriftsteller saßen und laut durcheinanderredeten und plötzlich verstummten und wortlos, verblüfft zusahen, wie er das Brot an ihnen vorbei in die Küche trug, wo er es neben der Spüle abstellte und vor mir zurück ins Wohnzimmer ging. Das war das Letzte, was ich von dem Brot sah. Es wurde mit keinem einzigen Wort erwähnt, weder während des anschließenden Abendessens noch später bei einem der ansonsten zahlreichen Versuche, die endgültige und allumfassende Geschichte der dänischen Literatur und der großen Autoren unseres Landes zu schreiben. Als sich das Abendessen dem Ende zuneigte und sowohl das Geburtstagskind als auch seine jungen Protegés und die Freundin des anderen Schützlings sich dank der fünf Gramm Hasch, die der eine Protegé in aller Heimlichkeit, als Überraschung, in den Rinderbraten getan hatte, von einer lautstarken Schar mehr oder weniger großer Autoren in eine Ansammlung zusammengesackter, verwaschen murmelnder Wesen verwandelt hatte, stand ich unbemerkt auf und ging durch sämtliche der vielen Zimmer und Winkel der großen Wohnung, bis in die Dienstmädchenkammer, die auf halber Treppe hinter der Küche lag, kam ich, aber ohne Erfolg. Sofern er sich nicht aus Sicherheitsgründen entschieden hatte, die neun poetischen Rote-Bete-Drucke in einem Bankschließfach aufzubewahren, waren auch sie spurlos aus der dänischen Literaturgeschichte verschwunden.
Ein paar Monate oder Jahre später begegnete ich Poul Borum wieder, im Foyer des Planetariums nach der Premiere einer avantgardistischen Kammeroper für zwei Stimmen, für die eine Freundin einer seiner Protegés das Libretto geschrieben hatte. Er saß auf einer Bank neben einem anderen jungen Protegé, der ihm half, eine Art Atemmaschine zu halten, eine künstliche Lunge, beinahe ein ganzer kleiner Zeppelin mit einem Haufen dünner Plastikschläuche, die Borums »Körper« mit den restlichen Vehikeln des Planetariums und Vorstellungen von Raumreisen und fernen Galaxien und Welten weit jenseits von dieser verbanden. Die Maschine atmete für ihn, ein langgezogenes, zähes Heulen, das in ihn überging und ein zischendes Blubbern wurde. Er sah benebelt, leidend aus. Wie eine unendlich ferne Galaxis, ein sterbender Sternennebel. Als hätte er endlich verstanden, dass auch er einen echten Körper außerhalb der Sprache hatte. 58. Das klingt vielleicht nicht nach viel. Aber wenn man wie Borum seinen echten Körper der Poesie geopfert hat, bleibt zum Leben nicht mehr viel übrig. –Danke für neulich, sagte ich. Er hob noch nicht mal den Kopf. Kein einziges Wort. Was hätte er auch sagen sollen? Er hätte mich zu seiner Beerdigung einladen können. Aber er tat es nicht.
An der Schwelle zum Nobelpreis
Während ich mit meiner ersten und bislang einzigen Freundin auf einer Boxspringmatratze in einem Zimmer in der Provinz lag und Ayla und der Clan des Bären vorlas, schrieb sich der beinah gleichaltrige Jens Christian Grøndahl in die dänische Literaturgeschichte ein, indem er sie einerseits völlig verwarf und gleichzeitig in einer Reihe sogenannter schriftbewusster, wild experimentierender Romane aus dem blanken Papier wiederauferstehen ließ. Das begriff ich natürlich nicht, als ich ein paar Jahre später in meiner Dienstmädchenkammer im dritten Stock in der WG hockte und die Romane las. Ich las sie bloß, langsam und verblüfft aufmerksam, in der Hoffnung, im Blitzgewitter von Grøndahls Genie selbst einen kleinen Funken sprühen zu spüren, bescheiden, aber groß genug für ein Gedicht oder vielleicht sogar einen Roman. Ich wusste, dass Jens Christian Grøndahl der seltene Fall eines geborenen Schriftstellers war, und schon ab dem ersten Roman, ja, sogar dem ersten, einzigartigen Satz ein zukünftiger Nobelpreisträger. Fasziniert und stundenlang starrte ich auf das Schriftstellerfoto. Er war bloß vier Jahre älter als ich, sah aber aus, als könnte er mein Vater sein. Er strahlte einen großen, beinah unmenschlichen Ernst aus. Wenn ich mich doch bloß auch so ernst nehmen könnte!
Aber es war zu spät. Als ich endlich Ayla und der Clan des Bären zuklappte, war Jens Christian Grøndahl schon längst Redakteur der tonangebenden Zeitschrift des Landes. Zusammen mit seinem Mitherausgeber verwarf er alles Bisherige und ernannte sich zum Nachfolger von nichts und niemand. Und hier komme ich: Gegen Abend, wenn wir uns endlich von der Boxspringmatratze aufrafften, gingen meine erste und fraglos vollbusigste Freundin und ich in das örtliche Kino, das zu einem Café gehörte. Weil wir kein Geld hatten, sahen wir nie die ersten fünf Minuten der Filme. Wir mussten schön warten, bis der Kartenkontrolleur, der zugleich Barkeeper war, alle zahlenden Gäste ins Saaldunkel gelassen und den Film gestartet hatte und wieder an der Bar stand, ehe wir uns reinschleichen konnten. Wir sahen viele der damals wichtigsten Filme, darunter 9½ Wochen mit Kim Basinger und Mickey Rourke. Kann sein, dass wir nicht den tieferen Sinn des Films begriffen, wir fanden ihn einfach toll, gut sahen sie aus, der Mann und die Frau, und die Erdbeeren in ihren Drinks in den fantastischen Close-ups waren fast überwirklich. Ich glaube, es war dieselbe Faszination, die ich verspürte, als ich an einem späten Winterabend in meinem Kämmerchen in der WG