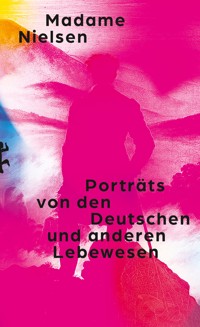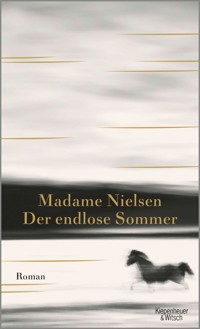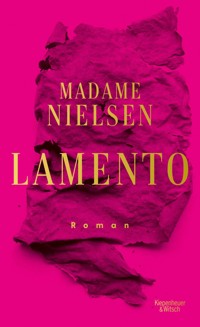
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie wird aus Verliebtheit Liebe? Und wann erlischt das Feuer? Ein Künstlerroman und ein Liebesroman oder besser: ein Klagelied über die Unmöglichkeit, den Zauber der Verliebtheit mit dem Alltag in Einklang zu bringen. »Lamento« beginnt mit einem Brand, das Feuer durchzieht den ganzen Roman. Die Erzählerin, eine Schriftstellerin, lernt als ganz junge Frau bei der Premiere eines ihrer Stücke einen ebenfalls sehr jungen Dramatiker und Theatermacher kennen. Sie verlieben sich schlagartig und verbringen fortan jede Minute miteinander, völlig unberührt von der Außenwelt. Doch als sie schließlich heiraten, ein Kind bekommen und der Alltag die Leidenschaft erstickt, schlägt die Liebe ins Destruktive um. Die Frau kämpft um jede Minute, die sie schreiben kann, während der Mann sich immer mehr seiner Kunst zuwendet und dem Familienalltag den Rücken zukehrt. Letztlich zerbricht alles, und die Frage bleibt: Wie wird aus Liebe Hass? Madame Nielsen schafft in diesem kurzen Roman das Kunststück, ganz konkret und mitreißend lebendig über eine leidenschaftliche und am Ende schmerzhafte Liebe zu schreiben und somit über die Liebe an sich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Madame Nielsen
Lamento
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Madame Nielsen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Madame Nielsen
Madame Nielsen, geboren 1963, Autorin, Sängerin, Künstlerin, Performerin. Ihre Romane wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, und sie war mehrfach für den Nordic-Council-Preis nominiert. Performances u.a. in Berlin und Wien. Ihr Roman »Der endlose Sommer« erschien 2017 auf Deutsch und wurde ein großer Erfolg. Die Autorin spricht fließend Deutsch. Sie war 2019/2020 Gast des Berliner Künstlerprogramm des DAAD.
Hannes Langendörfer, geboren 1975 in Heidelberg, studierte in Freiburg und Uppsala Skandinavistik und Germanistik. Er lebt als Übersetzer aus dem Dänischen, Schwedischen und Englischen in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein Künstlerroman und ein Liebesroman oder besser: ein Klagelied über die Unmöglichkeit, den Zauber der Verliebtheit mit dem Alltag in Einklang zu bringen.
»Lamento« beginnt mit einem Brand, das Feuer durchzieht den ganzen Roman. Die Erzählerin, eine Schriftstellerin, lernt als ganz junge Frau bei der Premiere eines ihrer Stücke einen ebenfalls sehr jungen Dramatiker und Theatermacher kennen. Sie verlieben sich schlagartig und verbringen fortan jede Minute miteinander, völlig unberührt von der Außenwelt. Doch als sie schließlich heiraten, ein Kind bekommen und der Alltag die Leidenschaft erstickt, schlägt die Liebe ins Destruktive um. Die Frau kämpft um jede Minute, die sie schreiben kann, während der Mann sich immer mehr seiner Kunst zuwendet und dem Familienalltag den Rücken zukehrt. Letztlich zerbricht alles, und die Frage bleibt: Wie wird aus Liebe Hass? Madame Nielsen schafft in diesem kurzen Roman das Kunststück, ganz konkret und mitreißend lebendig über eine leidenschaftliche und am Ende schmerzhafte Liebe zu schreiben und somit über die Liebe an sich.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Lamento
© Madame Nielsen & Grif, 2020
All rights reserved
Aus dem Dänischen von Hannes Langendörfer
© 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture / Stephen Sheperd
ISBN978-3-462-30294-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
When we are laid, are laid in earth, may our wrongs create
no trouble, no trouble in thy breast;
remember us, remember us, but ah! forget our fate.
Remember us, but ah! forget our fate.
I
»Il n’y a pas d’amour
Il n’y a pas d’amour«
ruft der Kunde dem Dealer zu oder
vielleicht eher dem Nichts
dem Schrecken dem Dunkel
in tiefster Nacht dort draußen
in der Einsamkeit der Baumwollfelder
»Es gibt keine Liebe
Es gibt keine Liebe«
ich hörte ihn, den Grand maître der Schwulen
und des Fleisches
Patrice Chéreau, er wusste, wovon
er sprach, was er wusste
was er nicht wusste, darüber musste er schweigen.
»Il n’y a pas d’amour
Il n’y a pas d’amour«
ich hörte es, tierisch, dort unten
aus dem gedämpften Scheinwerferlicht auf der Bühne
die keine Bühne war
sondern der Boden einer großen alten Fabrikhalle
mit Sand bestreut
eine innere Wüste
ich hörte es und sah sie synchron tanzen wie
brennende Puppen an Fäden
und ich hielt den Atem an und tue es immer noch
hier, mehr als zwanzig Jahre später, weiß ich
es gibt eine Liebe, die essen Seele auf
es gibt eine Liebe
ruhig und maulwurfgemächlich
die nie das Licht des Tages erblickt
und erst zur Welt kommt lange nachdem
das Feuer, das mancher Liebe nennt,
aber bloß Besessenheit ist,
Wahnsinn, Orgasmus der Seele
erloschen ist
es gibt eine Liebe, die es nicht gibt
außer als Vorstellung, Sehnsucht, Hoffnung
es gibt eine Liebe, die es erst gibt
wenn man zusammen durchs Feuer
des Verliebtseins gegangen ist
und die Wüste danach
und danach den Hass, der Jahre
manchmal Jahrzehnte währt
und auf der anderen Seite herausgekommen ist
in der Resignation
wenn du nicht länger hoffst, glaubst oder weißt, dann
erst dann
kannst du lieben
»Il n’y a pas d’amour
Il n’y a pas d’amour«
Wir saßen auf den großen Felsblöcken im Schatten am Fuß der Mauern um das römische Theater in Orange, vielleicht waren wir auch drin gewesen, in dem Fall hab ich es vergessen, es ist über zwanzig Jahre her, die Glocken der großen grauen Feldsteinkathedrale hatten eben eins oder zwei geschlagen, die Stadt lag im Hitzeschlaf, auf den Straßen war fast niemand zu sehen, die Fensterläden der Häuser in den schmalen Gassen waren zugeklappt, die schweren Metalljalousien an den Geschäften runtergelassen, im Schatten vor dem Café lag ein schlafender Hund. Bei Sonnenaufgang um fünf oder halb sechs hatten wir das Haus in dem kleinen Dorf verlassen, das an der Bergflanke hing wie ein Schwalbennest, fensterlos und scheinbar ärmlich, wenigstens von der Schattenseite zu dem schmalen, abweisenden Weg hin betrachtet, der im steilen Bogen aus dem Tal aufstieg und sich durch einen bewaldeten Gürtel höher in die beinahe kahlen Berge zog; doch zur anderen Seite, nach Südosten zur Ebene hin, die sich flach und fruchtbar – hier und da ragt eine Felsenklippe mit einem Dorf und zuoberst eine Kirchturmspitze auf wie aus einem versteinerten grünen Meer – vierzig Kilometer bis ganz an den Fuß des Mont Ventoux erstreckt, öffneten sich die von Norden gesehen so bescheidenen grauen Steinhäuser wie vierstöckige Paläste mit Terrassen und hängenden Gärten, Kaskaden gelber Forsythien, die wie Schaum die Bergflanke hinabfielen.
Das Haus, in dem wir wohnten, zählte zu den größten im Dorf, grau, düster, vier Etagen Feldstein und eigentlich viel zu groß für uns, wir benutzten nur das Schlafzimmer, das mir auch als Arbeitszimmer diente und ganz oben eine zusätzliche fünfte Etage bildete, mit Glasflügeltüren und Aussicht aufs Tal, und den Speisesaal ganz unten, der beinahe eine Grotte war, selbst mitten am Tag kalt und düster, dort hockte er tief im Halbdunkel am Ende des großen, dunkel lackierten Tischs auf einem weißen Plastikstuhl und starrte über seine Papiere hinweg und weiter über die Terrasse und den Abgrund. Es war als Hochzeitsreise gedacht, das Haus gehörte einem älteren reichen Arzt aus Basel, wo keiner von uns je gewesen war und nie hinkommen würde, doch in den drei Wochen, die wir in dem Haus zubrachten, glitten wir mit der Geschwindigkeit des Lichts, des Gedankens oder vielmehr der Unachtsamkeit auseinander. Ein Mal nur begegneten wir uns, tief in der Nacht, der letzten, als das ganze Tal, die Ebene und »der geschälte Berg«, Petrarcas Mont Ventoux, von magnesiumweiß blendenden Blitzen erhellt wurde und der Donner über die Ebene rollte und der Regen mit jener zerstörerischen Gewalt runterprasselte, Himmelsschleusen, die sich öffnen und Felsblöcke losreißen und Bäume entwurzeln, Niederschläge, die nur der Süden kennt und sich nur jedes siebte Jahr ereignen, wenn die Erde am trockensten ist und Tiere – Vögel, Ziegen, Rinder, Katzen, Hunde, sogar Pferde – wie Kadaver über die Landschaft verstreut liegen, mit Rippen und Knochen, die durch die steife Haut vorstehn wie Dornen – da zeugten wir dich.
»Es gibt keine Liebe
Es gibt keine Liebe«
Gegen Nachmittag rissen wir uns los von unserem Dösen auf den Felsblöcken, oder vielleicht war es bloß eine Bank im Schatten unter der Theatermauer, und gingen durch die langsam erwachende Stadt zum Bahnhof und nahmen den Zug nach Paris, Gare de Lyon, und von dort den RER-Zug nach Houilles, wo eine Jugendfreundin von ihm lebte. Die Freundin, Sabine, arbeitete bei TF1 in der Technik und lebte alleine in einer kleinen Wohnung in einem Neubau; uns zuliebe, als eine Art Hochzeitsgeschenk, hatte sie sich im Wohnzimmer eine Matratze hergerichtet und uns das Schlafzimmer überlassen. Wir setzten unsere Rucksäcke ab und duschten, als er aus dem Bad kam, warf er sein Handtuch – es war weiß, erinnere ich mich – über eine Stehlampe, die neben dem Bett in der Ecke stand, die Lampe war eingeschaltet, es war fast Mitternacht, wir waren den ganzen Tag unterwegs gewesen und hatten Hunger, wir gingen ins Wohnzimmer, wo es auch eine kleine Kochnische gab, in der er Töpfe auf die Platte stellte und zu rühren begann, und währenddessen redeten sie und er miteinander Französisch, ich verstand nur einzelne Wörter, sie redeten von den Freunden von damals, von Frank und Jean-Marie, die ich nächsten Abend kennenlernen sollte, aber dann nie kennenlernte. Plötzlich roch es verbrannt, aber es war nicht das Essen. Als ich die Tür zum Schlafzimmer öffnete, stand es in Flammen, die anderen kamen dazu und standen schweigend, starrend hinter mir, berauscht auf jene Art, mit der Feuer und Zerstörung berauschen. Komm, sagte er und nahm zum letzten Mal meine Hand, öffnete die Wohnungstür und zog mich rücklings ins Treppenhaus. Wir krochen zusammen ein paar Stufen tiefer und lagen dort und sahen durch die offenen Türen ins Feuer, das brüllte wie ein großes Tier und unsere Gesichter versengte und die Augäpfel austrocknete, und sie, Sabine, eine noch junge Frau, sie war erst Anfang dreißig, die jammernd (es klang nach Wiegenlied, nach Gebet) wie in Trance mit vorgereckten Händen in den Flammen verschwand und versuchte, Erbstücke zu retten, einen großen schweren Sekretär und die Kommode ihrer Groß- oder Urgroßeltern aus der Normandie, bald war sie nur ein schmächtiger, in den Flammen umherirrender Schatten, eine schwache Stimme, jetzt nur ein Wimmern, dann war sie weg.
– Ich liebe dich, flüsterte er
aber da war es zu spät.
Du ähnelst ihm. Ich verstehe euch nicht. Ihr seid Nachttiere, und so schnell, ohne Übergang bist du schon weit voraus, schwerelos, nervös, wie ein Reh oder eine kleine Flamme, die durch die Welt huscht, ein Silberfischchen, ich kann dir nicht folgen, wenn ich blinzle, bist du schon woanders, oh, ich verstehe nicht, dass man jemand so heftig lieben kann, es ist, als hätte ich dich noch nicht geboren, noch sind wir ein Fleisch, aber sieben Sinne, und ich nur einer davon, du bist eine Welt, zu der ich keinen Zugang habe, die Nacht, ich sehe sie nie, aber sie ist, wo du lebst, was treibst du? Ich wache auf mit dem Licht, ich habe so eine Lust auf den Tag, die Dämmerung, den langsamen Übergang, den Anfang aller Dinge, aber ihr ertragt ihn nicht, es ist, als ob ihr bei Licht zerspringt. Ich will dir gern helfen, dich befreien, dir verzeihen, was? Du bist doch die Unschuld, wir, er und ich, sind die, die die ganze Schuld tragen sollten. Ich habe immer gedacht, dass es die Nacht am Tag nicht gibt, sie ist gar nicht möglich, nur in uns, wir können uns die Nacht vorstellen, am helllichten Tag; an dem Morgen, als ich dich geboren hatte und er dich zu mir hochhob und ich dich das erste Mal in meinen Händen hielt wie etwas völlig Fremdes, das immer noch ich war, und in deine Augen sah, die noch nichts gesehen hatten, da sah ich sie, die Nacht, all das Dunkel der Welt: Wenn das Licht anbricht, ziehen sich die Nacht, die Trauer, die ganze Geschichte und alles Entsetzliche, das wir getan haben, in dir zusammen.
Plötzlich ist um uns die Feuerwehr, und ihre Mutter und ihr Vater, der Hitzedruck hat die Scheiben rausgesprengt, es knirscht unter unseren Füßen, wie wir da in der Frühsommernacht unten auf der Straße stehen und hochschauen, während das gelbe rotierende Licht des Rettungswagens über die Gesichter fegt. Und weg, der Rettungswagen ist fort, aber wir stehen hier noch neben den Eltern, wildfremde Menschen, sie haben keine Ahnung, wer wir sind, wo wir herkommen, sie haben uns nie vorher gesehen, mich jedenfalls, wir wissen nicht, was wir sagen sollen oder wohin mit unseren geröteten Pergamentgesichtern und halb geschmolzenen Rucksäcken. Die Feuerwehr ist immer noch zugange, obwohl das Feuer anscheinend gelöscht ist, oben auf Höhe des dritten Stocks gähnen in der roten Mauer zwei rußschwarze Grotten, aus denen es immer noch lotrecht qualmt wie aus Rauchermündern; nicht bloß das Schlafzimmer, auch das Wohnzimmer, alles, ihr ganzes Leben hat es rausgeblasen, die Frühsommernacht riecht säuerlich nach nasser Brandstelle. Was sagen wir bloß? Sie sollten uns verfluchen, ins Gesicht schreien, niederstrecken wie Tiere, aber sie sagen nichts, stehen einfach nur neben uns, ein nettes älteres Pariser Bürgerpaar aus Maisons-Laffitte, sie im geblümten Nachthemd mit langem, dunkelblauem Mantel drüber und Korksandalen an den nackten Füßen, er komplett angezogen, als ginge er gleich ins Büro, Hemd, Jackett, Hose und glänzend polierte Schuhe. Und dann tun sie das Schlimmstvorstellbare, das ich ihnen nie verzeihen kann. Sie sagen, er sagt, wir sollen mit zu ihnen nach Hause. Kommen Sie, sagt er und macht die Autotür auf, und wir setzen uns auf die Rückbank, zwei große Kinder mit unseren Rucksäcken, die nach geschmolzenem Plastik riechen, auf dem Schoß. Und sie steigen vorne ein, als wären sie unsere Eltern, Vater am Steuer, Mutter neben ihm, und fahren uns nach Hause.
Warum sind sie nicht im Krankenwagen mitgefahren, zumindest einer von ihnen? Warum fuhr er uns nach Hause und parkte unter den Fliederbüschen vor einer großen alten Villa, wo in der Küche, im Flur und einem Zimmer im ersten Stock noch Licht brannte, und ließ uns rein und zeigte uns, still, freundlich, einen Platz für unsere Rucksäcke und das Zimmer mit dem Bett, in dem wir schlafen konnten (schlafen, wie sollten wir je wieder Schlaf finden), das Bad, den Kühlschrank, »falls Sie der Hunger packt« (als wüsste er, dass wir nie dazu gekommen waren, den Gemüsereis zu essen, in dem er rumgerührt hatte und der sicher erst zischend am Topfboden anbrannte, ehe der Topf auf dem Herd schmolz, der explodiert und zusammen mit dem Rest ihres Lebens in die Dunkelheit hinausgepustet worden war), während die Mutter ein Taxi rief, eine kleine Tasche packte und ins Krankenhaus fuhr. Alleine. Das verzeihe ich ihnen nie.
An manchen Morgen stehe ich schon um vier auf, genau bevor das Dunkel zu leuchten beginnt, um ihn ganz mitzubekommen, den Anfang der Dinge. Ich ziehe mir den Bademantel über, schlüpfe in die Sandalen, schleiche in die Küche und setze Kaffeewasser auf. Ich gieße den Kaffee in die orangefarbene Thermoskanne, sie hat mich all die Jahre und zwei Ehen lang und hinein ins Offene begleitet, greife mit der anderen Hand den Becher, trage ihn rein und setze mich hin. Noch denke ich nichts, ich bin reine Aufmerksamkeit, ich lausche dem Licht, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber nach ein paar Stunden bin ich plötzlich unsagbar müde und schwerelos. Und dann, wenn ich Glück habe, steht er da, ein kleiner Absatz nur, ein Wurf, eine wundersam lebendige Bewegung, die zwar noch nicht ganz ihre Form gefunden hat, da gibt’s noch zu feilen und zu schleifen, bis sich alles zurechtruckelt, aber das ist nur eine schöne Dreingabe, auf die ich mich freue, jedenfalls ist sie jetzt da, die Bewegung, der Wurf, was auch immer, noch eine kleine Wendung in der großen Erzählung von uns, und damit ist gut, ich kann aufstehen und in den Tag gehen. Und egal, was er bringen mag, ich kann es tragen, selbst dein Dunkel, solange du mich nur lässt.
In den Nächten im Zimmer bei ihren Eltern, in dem Bett, in dem sie sicher geschlafen hatte, als sie Kind war und noch zu Hause lebte, lagen wir wach, mit brennenden Gesichtern und Augen, die trocken und rau waren wie Glaskugeln, unfähig zu weinen oder zu lieben oder sie einfach zu schließen, es war, als hafteten die Lider fest an den rauen Kugeln, wir lagen nebeneinander und sahen an die Decke und horchten auf die Stille, diesen unbarmherzigen Frieden in der Welt, wenn das Fürchterlichste passiert ist. An die Tage erinnere ich mich nicht, nur an die Abendmahlzeit, le dîner, um einen runden Tisch in der Mitte des Speisezimmers, vier Menschen, stumm in je ihrer Himmelsrichtung, das weiße Tischtuch, das weiße Geschirr und darauf nicht eine an der nächsten Tankstelle besorgte oder an die Tür gelieferte Pizza, sondern Hase in Aspik, selbst zubereitet, den die Mutter aus dem Kühlschrank genommen und dazu Frühkartoffeln gekocht hatte, und vor dem Hasen einen grünen Salat, tranken wir Wein dazu? bestimmt, es ist unverzeihlich, aber wir taten es, Weißwein, kühl (aber ohne anzustoßen, ohne ein Wort), wir mussten einfach, um nicht zu schreien.
Das ging nur ein paar Tage und Nächte, aber es ist wie ein ganzes Leben, eine weitere Kindheit, in der wir nicht bloß Liebende waren, sondern auch Bruder und Schwester, wie in einem Märchen, die große Villa, die stillen Nächte, der Duft von lila und weißem und rosa Flieder durch das offene Fenster, wie durch das Feuer in eine andere Welt getreten, verzaubert, ich verstand nicht, was die Menschen um mich miteinander redeten, die Eltern und auch er, mein Bruder, der dein Vater werden sollte, er sprach Französisch mit ihnen und mit der großen Schwester, die uns schon am nächsten Morgen mit ihrem Mann besuchen kam, als wäre unsere Anwesenheit in der Villa ihrer Eltern eine Selbstverständlichkeit, völlig gang und gäbe, dass man (nicht aus christlicher Nächstenliebe, sondern nach guter bürgerlicher französischer Sitte und ohne geringstes Zögern) die Menschen, die einem gerade das Leben ruiniert hatten, zu sich nach Hause nahm, ihnen Essen und ein Bett gab, ihre schmutzige Kleidung wusch und – bis auf Weiteres – mit ihnen zusammenlebte. Sie behandelte mich wie eine kleine Schwester, kalt, aber vertraut, ihre Art, wie sie mir in die Augen sah, als sie mir die Hand gab, als wüsste sie exakt, wie es mir ging, als hätten wir etwas gemeinsam, ein Geheimnis, das die Eltern, die Alten, nicht verstünden.
Dann und wann, wenn ich aufstehe und in die Küche gehe, sehe ich durch die halb geöffnete Tür einen Hauch von dir, wie du bist, wenn dich keiner sieht, und du einfach nur sein darfst, in deinem Zimmer auf dem Bett sitzen mit nackten gekreuzten Beinen, krummem Rücken, in einem blauen T-Shirt und mit dem Computer auf dem Schoß, und ich erkenne mich selbst wieder, die Zehen, die Hände, das Kinn und die Augen, doch der Blick, mit dem du plötzlich aufschaust, wenn ich es mir nicht verkneifen kann, stehen zu bleiben, ist seiner, das Chaos und Dunkel, diese rasend verzweifelte Intelligenz, die die Welt erleuchtet und euch verzehrt.
Da ist ein Augenblick, den ich vergessen habe, aber nie vergessen kann, ganz tief in den Flammen, der Hölle, er lässt meine Hand los und kriecht, erst wie ein Hund, dann legt er sich flach hin und gleitet wie eine Schlange vorwärts, Zentimeter für Zentimeter, über die Schwelle, durch den Flur, noch eine Schwelle, sie sieht ihn nicht kommen, sie nimmt nichts wahr als das Feuer und die Dinge darin, ihr ganzes verfluchtes Zeug, was sollen wir damit, es ist, als wären die Dinge wir, sie besitzen uns, ohne sie sind wir NIEMAND, jetzt ist er bei ihren Füßen, unter dem Feuer, es reicht noch nicht ganz hinunter, es ist direkt über seinem Haar in den Dingen, verzehrt sie, verprasst sie, die Bettdecke, die Tapeten, die Kommode, den Sekretär, die Lampe steht ganz hinten rechts hinterm Bett wie eine Fackel, sie nimmt ihn nicht wahr, sie hat die Hände voll Flammen, sie schlagen von ihrem Rücken aus wie Flügel, tanzend, es ist ein Fest, er streckt die Hand über ihren Fuß, mit den äußersten Fingerspitzen kriegt er den Rucksack zu fassen und zieht ihn zwischen ihren Füßen über den Teppich wie einen toten Fisch, einen Kadaver, unschön und schäbig, wie nur Menschendinge es sein können, Zentimeter um Zentimeter, immer noch kriechend, rückwärts jetzt, geschmeidig, als wäre das der Augenblick, die heroische Handlung, für die er geboren ist, durch den Flur, und dann plötzlich mit einem Ruck fährt er hoch und auf allen vieren über die zweite Schwelle raus ins Treppenhaus und die ersten zwei Stufen runter zu mir und lässt ihn an uns vorbeirollen und noch ein paar Stufen tiefer auf den Absatz, sodass die Flammen ausgehen und er sofort, zitternd – wovor? Hitzeschock? Schrecken? Gespannter Erwartung? Ist es Freude? – die Hand reinsteckt, rumwühlt und einen kleinen Stoß Papier rauszieht, nicht mehr glatt und weiß, sondern gelblich gewellt wie Pergament, und mit Asche, die von den Rändern auf die Schrift krümelt, das Manuskript, an dem er jeden Tag da unten am Tisch in seiner eiskalten Grotte geschrieben hat und das er um nichts in der Welt verlieren will.
Ich will nicht, aber ich sehe ihn immer vor mir, diesen Mensch, neben mir auf der Treppe zusammengekrümmt über einen Haufen halb verkohltes Papier, das er aus den Flammen gerettet hat, in denen sie, jetzt bloß ein schmächtiger, wimmernder Schatten, umherirrt, während sein Blick über die Papiere flackert, völlig gebannt von dem, was er geschrieben hat,
»Man tötet nur, wen man liebt,
alle anderen sind gleichgültig
Warum sollte man sie sonst töten?«
Ist das ein Mensch, denke ich, ja, das ist der Mensch, den ich liebe oder zu lieben glaubte, aber in den ich bloß bis zum Wahnsinn verliebt war, das ist der Mensch, er nimmt niemand anderen wahr, nicht mich, nicht sie, seine französische Freundin, die noch lebendig ist, hier, hier drinnen im Feuer, das grollt und brüllt und alles andere überdröhnt und nun auch ihre Stimme, sie ist ohne Ton.
Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle, das ist die Art Sachen, die niemand wissen braucht, und erst recht nicht ein Kind, was sollen wir bloß mit diesem Wissen, es ist so schon schwer genug, Mensch zu sein.
An einem Vormittag, es muss der zweite oder dritte gewesen sein, fuhren wir mit der Schwester und ihrem Mann in ihrem Auto, wieder auf dem Rücksitz sitzend wie zwei Kinder, aber diesmal mit der Schwester am Steuer, zum Krankenhaus in einer Vorstadt weit draußen auf der anderen Seite der Millionenstadt und sahen sie zum letzten Mal. Hinter Glas. Durch eine Scheibe von einem kleinen dreieckigen Raum aus, ohne Möbel oder Fenster nach draußen, nur die Tür, durch die wir hinein sind und die jemand jetzt hinter uns geschlossen hat, zwei weiße Wände und die Scheibe. Näher kamen wir nicht, weder wir noch ihre Eltern. Der Raum, in dem sie lag, war luftdicht, steril. Sie war ganz hinten auf eine hohe Liege gebettet, Beine und Rumpf mit einem weißen Laken zugedeckt und Hände, Arme und Kopf in Gaze gewickelt. Wie eine Mumie. Das Einzige, was man durch zwei schwarze Aussparungen sehen konnte, waren die Augen. Sie waren geöffnet.
Wir standen da wie Salzsäulen, stumm. Der Schwager ertrug es nicht, man merkte, wie es in ihm arbeitete und zuckte, er schielte zu uns rüber, er räusperte sich. Schließlich sagte er etwas, ich verstand nicht, was, nur dass es keine Rede war oder ein Gebet oder etwas, worüber er nachgedacht hatte, es war eine Gedankenlosigkeit, irgendein Scherz. Wir reagierten nicht, weder ich noch die Schwester. Dann versuchte er es mit deinem Vater, er war noch so jung, Herrgott, Männer, sich prügeln, trinken, die Welt erobern und beherrschen, das können sie, aber das Entsetzliche verkraften sie nicht. Vielleicht wollte er dem Schwager gegenüber bloß höflich sein, er lächelte ein wenig verwirrt, der Schwager machte noch einen Spruch, und dann nannte er den Namen der Schwester. Sie rührte sich nicht, aber ich merkte, wie sie erstarrte, in diesem Augenblick hasste sie ihren Mann, eiskalt, hart, mit einem Hass, von dem ich damals nicht ahnte, dass man seinen Nächsten mit ihm hassen kann. Plötzlich ging drinnen hinter der Scheibe eine Tür auf und eine Krankenschwester kam herein, ganz in Weiß und mit einer blassgrünen Vliesmaske vor dem Gesicht. Sie stellte sich ans Kopfende, hinter die Mumie, und sah hinaus zu uns. Wie ein Zeichen. »Sind Sie bereit.« Wir standen ganz still, selbst der Schwager hielt auf einmal die Klappe. Dann beugte sie sich vor, fasste vorsichtig den rechten Arm und hob ihn hoch. Die Mumie winkte uns zu. Und wie vier Automaten oder völlig hilflose, gottverlassene Menschen hoben wir die Arme und winkten zurück.
Einmal fuhren wir mit der Metro nach Paris rein, nur er und ich, streiften durch die Straßen um den Boulevard Saint-Germain, setzten uns in Sartres und de Beauvoirs Café, es war trübes Wetter, kalt, der Wind zerrte an den Platanenwipfeln, aber wir konnten einfach nicht drinnen sitzen, wir saßen alleine draußen unter der Markise auf diesen typischen klapprigen, dunkel lackierten Pariser Caféstühlen mit der Patina der Dreißigerjahre, Decken um den Leib und jeder mit seinem Buch im Schoß und sahen ins Leere. Ganz spät am Nachmittag fing es an zu regnen und wir gingen ins Kino, ein winziger Saal, nicht größer als ein Wohnzimmer, und saßen dort mit einer Handvoll anderer Fremder und sahen einen Film, an den ich mich nicht mehr erinnere.