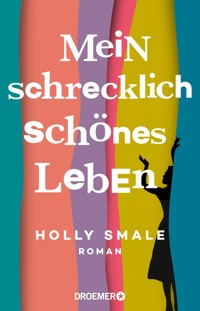
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was würdest du tun, wenn du deine Vergangenheit ändern könntest? »Mein schrecklich schönes Leben« ist ein ebenso einfühlsamer wie mitreißender Roman um Selbstliebe und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Cassandra Penelope Dankworth hat selten richtig gute Tage, aber heute läuft es besonders schlecht: Am Morgen trennt sich ihr Freund Will von ihr, und noch vor dem Mittagessen verliert sie ihren Job, weil sie angeblich Kunden ebenso vergrault wie ihre Kolleg*innen. Am Abend jedoch taucht Will auf, um sie zum Essen auszuführen, als sei nichts gewesen. Cassandra ist so erleichtert, dass ihre bisher längste Beziehung (immerhin vier Monate!) doch noch nicht vorbei ist, dass sie keine Fragen stellt. Allerdings fühlt sich der ganze Abend an wie ein einziges Déjà-vu – und am nächsten Morgen macht Will wieder Schluss, mit den exakt gleichen Worten wie am Tag zuvor. So unwahrscheinlich es auch sein mag, Cassandra muss einsehen, dass sie in einer Zeitschleife feststeckt. Es scheint, als hätte sie endlich die Möglichkeit, alles richtig zu machen – aber was genau ist eigentlich »richtig«? Die 31-jährige Cassandra ist eine herrlich unperfekte Heldin, deren selbstironischer Erzählton uns immer wieder schmunzeln lässt. Mit leichter Hand erzählt Holly Smales Roman von Familie, Liebe und Schuld, vom Erwachsenwerden, von Selbstfindung und Mental Health.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Holly Smale
Mein schrecklich schönes Leben
Roman
Aus dem Englischen von Jana Wahrendorff
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Cassandra Penelope Dankworth hat selten richtig gute Tage, aber heute läuft es besonders schlecht: Am Morgen trennt sich ihr Freund Will von ihr, und noch vor dem Mittagessen verliert sie ihren Job, weil sie angeblich Kunden ebenso vergrault wie ihre Kolleg*innen.
Am Abend jedoch taucht Will auf, um sie zum Essen auszuführen, als sei nichts gewesen. Cassandra ist so erleichtert, dass ihre bisher längste Beziehung (immerhin vier Monate!) doch noch nicht vorbei ist, dass sie keine Fragen stellt. Allerdings fühlt sich der ganze Abend an wie ein einziges Déjà-vu – und am nächsten Morgen macht Will wieder Schluss, mit den exakt gleichen Worten wie am Tag zuvor.
So unwahrscheinlich es auch sein mag, Cassandra muss einsehen, dass sie in einer Zeitschleife feststeckt. Es scheint, als hätte sie endlich die Möglichkeit, alles richtig zu machen – aber was genau ist eigentlich »richtig«?
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Danksagung
Für meine Schwester Tara.
Wir zwei gegen den Rest der Welt.
O dieses Menschenleben! – Wenn es glücklich ist, ein Schatten stört es; ist es kummervoll, so tilgt ein feuchter Schwamm dies Bild.
– Aischylos
1
Wo fängt eine Geschichte an?
Sie ist eine Lüge, die erste Seite eines Buches, denn sie gibt sich bloß als Anfang aus. Sie tut, als wäre sie tatsächlich der Moment, in dem etwas losgeht, dabei bekommt man bloß eine willkürliche Zeile aus einem Meer an Wörtern. Diese Geschichte beginnt hier. Wählt eine zufällige Situation aus. Vergesst, was vorher passiert ist oder danach kommt. Tut so, als würde die Welt aufhören, zu existieren, wenn ihr das Buch zuklappt. Als wäre eine Entscheidung nicht bloß ein weiterer beliebiger Punkt auf einer festgelegten Zeitlinie.
Aber so funktioniert das Leben nicht, also belügen Bücher uns wohl.
Vielleicht lieben wir sie deshalb so sehr.
Genau solche bescheuerten Aussagen führen dazu, dass ich beim Buchclub auf der Fentiman Road vor die Tür gesetzt werde.
Hier eine Liste, wo man mich überall gebeten hat, nicht mehr aufzutauchen:
bei der Lesegruppe auf der Blenheim Road
in der großen WG in Walthamstow, in der ich kurz gewohnt habe
in meiner letzten Beziehung
in meinem aktuellen Job
Das mit den letzten beiden Punkten ist ziemlich schnell hintereinander passiert. Heute Morgen hat Will – mit dem ich seit vier Monaten zusammen bin – mich geküsst, völlig unvermittelt meine Vorzüge aufgezählt und die Motivationsrede damit beendet, mit mir Schluss zu machen.
Das mit dem Job war vor etwa achtzig Sekunden.
Dem angespannten Kiefer und den bebenden Nasenflügeln meines Chefs nach zu urteilen steht meine Reaktion auf diese Information noch aus. Irgendwie sieht er verschwommen aus und klingt gedämpft, so als befände er sich hinter einer dicken Scheibe aus Milchglas. Außerdem hat er getrockneten Haferbrei am Kragen, aber jetzt scheint mir nicht der richtige Zeitpunkt, ihn darauf hinzuweisen. Er ist verheiratet. Soll seine Frau das später machen.
»Cassie«, wiederholt er lauter. »Hast du mich verstanden?«
Natürlich habe ich ihn verstanden, ansonsten würde ich wohl immer noch detailliert vom Kundenmeeting berichten. Denn genau damit war ich beschäftigt, als er mich eben gefeuert hat.
»Es geht gar nicht so sehr um deine Leistung«, fährt er fort. »Wobei jemand, der so ungern telefoniert wie du, wohl Gott weiß besser nicht im PR-Bereich arbeiten sollte.«
Ich nicke. Damit hat er nicht ganz unrecht.
»Aber dein grundsätzliches Auftreten passt einfach nicht zu uns. Du bist unhöflich. Aufmüpfig. Und ehrlich gesagt ziemlich arrogant. Du bist kein Teamplayer. Dabei weißt du eigentlich, was wir hier im Büro brauchen, oder?«
»Eine bessere Kaffeemaschine.«
»Genau so eine Scheiße meine ich.«
Ich würde euch ja verraten, wie mein Chef heißt und aussieht, aber es scheint so, als würde er in dieser Geschichte nicht länger eine tragende Rolle spielen.
»Wir haben schon oft darüber gesprochen. Cassandra, sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Unser bester Kunde ist uns gerade wegen deines – Zitat – ›sturen, nervtötenden Verhaltens‹ abgesprungen. Du bist unsympathisch. Das war genau das Wort, das sie benutzt haben. Unsympathisch. PR-Arbeit ist ein Job für Menschen, die gut mit Menschen können.«
Moment mal.
»Das stimmt nicht«, werfe ich ein und versuche, ihm direkt in die Pupillen zu gucken. »Soweit ich weiß, heißt es in meiner Jobbeschreibung nicht, dass sympathisch sein Voraussetzung ist. In meinem Arbeitsvertrag steht es auf keinen Fall, das hab ich überprüft.«
Jetzt blähen sich seine Nasenflügel zu regelrechten Nüstern auf.
Ich kann nur selten nachvollziehen, was andere Leute denken, aber manchmal fühle ich es: Dann strömt eine Welle an Emotionen aus ihnen heraus und in mich hinein, als würde man Tee aus einer Kanne in eine Tasse gießen. Während ich volllaufe, muss ich herausfinden, was zur Hölle das bedeuten soll. Wo das alles herkommt, und was ich tun muss, damit die Gefühle nicht überall verschüttet werden.
Jetzt pulsiert mir eine Wut durch die Adern, die sich nicht nach meiner eigenen anfühlt. Sie ist dunkellila und rot.
Seine Farben überfallen mich, und das gefällt mir gar nicht.
»Sieh mal«, sagt mein Chef und stößt ein vermeintlich geduldiges Seufzen aus, das so gar nicht zu der Emotion passt, die aus ihm herausfließt. »Das funktioniert einfach nicht. Auf irgendeiner Ebene musst du das doch auch spüren. Vielleicht suchst du dir was, das besser zu deinen … besonderen Fähigkeiten passt.«
Im Prinzip hat genau das Gleiche auch Will heute Morgen zu mir gesagt. Keine Ahnung, warum die beiden meinen, ich hätte das Ende kommen sehen müssen. Das habe ich absolut nicht.
»Bei uns geht es um das Zwischenmenschliche«, erklärt mein Chef erneut. »Ich schlage vor, du suchst dir einen Job, bei dem das nicht so relevant ist?«
Mit einem Räuspern stehe ich auf und sehe auf die Uhr. Zeit, Bilanz zu ziehen. Es ist Mittwoch, aber noch nicht mal Mittag.
Beziehung: aus.
Job: vorbei.
»Tja«, sage ich ruhig. »Scheiße.«
Meine Geschichte fängt also hier an.
Sie hätte aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt losgehen können. Ich musste bloß einen wählen. Es hätte heute Morgen sein können, als ich vom Geschrei meiner Mitbewohner*innen aufgewacht bin. Oder als ich mein Frühstück gegessen habe (Porridge mit Banane – wie immer). Oder als ich ein schönes Geschenk für Will zu unserem Jahrestag ausgesucht habe (ein wenig verfrüht, wie sich gezeigt hat).
Es hätte auch der Moment sein können, kurz bevor ich ihn das erste Mal getroffen habe, ein durchaus positiverer Start. Oder der Tag, an dem meine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind, das wäre deutlich negativer gewesen.
Entschieden habe ich mich aber für irgendwas in der Mitte.
Der Anfang meiner ganz persönlichen Geschichte liegt damit schon etwa einunddreißig Jahre zurück, das dramatische Ende der Geschichte meiner Eltern nicht ganz so lange. Da bin ich also und packe meine Sachen in einen Karton. Wie es aussieht, ist der einzige Gegenstand auf meinem Schreibtisch, der nicht der Firma gehört, eine Tasse mit einem Cartoon-Hirsch darauf, die ich mal geschenkt bekommen habe. Sie landet im Karton. Man kann zwar nie wirklich wissen, was als Nächstes passiert, aber ich schätze, Koffein wird es weiterhin geben.
»O nein!« Meine Kollegin Sophie beugt sich über den Schreibtisch, als ich mir gerade eine welke Pflanze unter den Arm klemme, nur damit es nicht so aussieht, als würde ich ein weiteres Jahr meines Lebens hinter mir lassen, ohne etwas daraus mitzunehmen. »Die haben dich doch nicht gefeuert, oder? Das ist ja furchtbar! Wir werden dich alle ganz schrecklich vermissen.«
Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob sie das ernst meint. Wenn ja, kommt das unerwartet. Wir sitzen uns zwar gegenüber, seit ich hier angefangen habe, trotzdem weiß ich praktisch nichts über sie. Bloß dass sie zweiundzwanzig ist und Thunfischsandwiches mag, dass sie sehr aggressiv in die Tasten haut und in der Nase popelt, als würde niemand von uns über die Fähigkeit zum peripheren Sehen verfügen.
»Wirklich?«, frage ich ehrlich neugierig. »Wieso?«
Sophie öffnet den Mund, schließt ihn aber wieder und widmet sich erneut ihrer Tastatur, als wollte sie mit den Fingern Hau den Maulwurf spielen.
»Cassandra!« Gerade als ich meine eigene Tastatur mit einem kleinen Desinfektionstuch abwischen will, taucht mein Chef im Türrahmen auf. »Was zum Geier machst du da? Du sollst nicht jetzt sofort verschwinden. Ich glaub, es hakt, was stimmt denn nicht mit dir? Würdest du wohl noch weiterarbeiten, bis die Kündigungsfrist abgelaufen ist?«
»Oh.« Ich schaue auf meinen Karton und die Pflanze hinab. Jetzt habe ich ja schon gepackt. »Nein, danke.«
Der Schreibtisch ist sauber, ich hänge mir meine Tasche über die Schulter und den Mantel über den Arm, drücke mir den Karton vor den Bauch und klemme mir noch irgendwie die Pflanze zwischen Ellbogen und Karton. Dann versuche ich, die Agenturtür zu öffnen. Mit dem Knie halte ich sie auf und werfe einen Blick zurück, obwohl ich – genau wie Orpheus an der Schwelle zwischen Unter- und Oberwelt – weiß, dass ich das nicht tun sollte.
In der Agentur ist es noch nie so still gewesen.
Alle haben die Köpfe abgewandt, als würde mein Anblick sie plötzlich blenden. Das leise Klappern der Tastaturen ist zu hören – fast wie Taubengetrappel auf dem Dach – und wird nur von Sophies brutalen Todesstößen unterbrochen. Der Heizkörper am Fenster gurgelt, der goldene Empfangstisch blendet mich, und der Wasserspender tropft. Wenn ich aus dem heutigen Tag etwas Gutes mitnehmen soll – und ich denke, das sollte ich –, dann wohl, dass ich das nicht mehr jede Sekunde meines restlichen Arbeitslebens ertragen muss.
Sie sollten öfter Leute wegen grundlegender Persönlichkeitsschwächen feuern. Das steigert die Produktivität.
Als die Tür hinter mir zufällt, zucke ich zusammen, obwohl ich sie selbst habe zufallen lassen. Dann piept mein Handy, und ich balanciere vorsichtig all meine Sachen auf einem Knie, während ich es herausziehe. Ich versuche immer, alle Nachrichten sofort zu lesen. Sonst liegt das Handy so schwer in der Tasche.
Dankworth, bitte räum deinen Scheiß auf.
Ich runzele die Stirn und antworte:
Welchen Scheiß genau?
Wieder piept es.
Sehr lustig. Räum die Küche auf, das ist ein GEMEINSCHAFTSRAUM.
Vor ein paar Wochen hatte ich nicht den Eindruck, dass die Küche für die Allgemeinheit gedacht ist, als ich mitten in der Nacht ein Glas Wasser holen wollte und Sal und Derek gegen den Kühlschrank gelehnt Sex hatten.
Aber vielleicht kommt es auf die Definition von Gemeinschaft an.
Immer noch verwirrt drücke ich auf den Knopf vom Aufzug und laufe in Gedanken durch die Wohnung, um herauszufinden, was ich dieses Mal falsch gemacht habe. Ich habe vergessen, meine Porridgeschüssel und den Löffel abzuwaschen. Außerdem liegt mein gelber Lieblingsschal auf dem Boden, und ein violetter Pullover hängt über der Sofalehne. Das ist meine sechste WG in zehn Jahren, und langsam fühle ich mich wie eine Schnecke: Immer muss ich all mein Hab und Gut zusammenhalten, um bloß keine Spuren zu hinterlassen.
Ich antworte:
O. k.
Meine Eingeweide verflüssigen sich, meine Wangen fangen an zu brennen, und ich spüre, wie ein grellpinker Ausschlag sich über meiner Brust ausbreitet. Ein dumpfer Schmerz legt sich mir um den Hals, als würde jemand einen Schal zuziehen.
Faszinierend, wie Emotionen sich durch das Leben ziehen.
In der einen Minute bist du zwölf, stehst auf dem Spielplatz und hörst zu, wie die anderen sich darum streiten, wer dich in sein Team aufnehmen muss. Und in der nächsten Minute bist du in den Dreißigern, Single und wartest auf den Aufzug vor der Agentur, aus der du gerade geworfen wurdest, weil niemand mit dir zusammenarbeiten will. Gleiches Gefühl, anderer Körper. Das meine ich wörtlich: Meine Zellen haben sich in der Zwischenzeit mindestens zweimal selbst erneuert.
Die Agenturtür schwingt auf. »Cassandra?«
Seit Ronald vor ein paar Monaten hier angefangen hat, hatte er jeden Tag dasselbe an – einen marineblauen Kaschmirpullover. Da er immer angenehm riecht, vermute ich, dass er mehrere von der Sorte besitzt.
Er kommt auf mich zu, und ich breche augenblicklich in Panik aus. Ab und zu habe ich ihn erwischt, wie er mich vom Nachbarschreibtisch aus mit einem seltsamen Ausdruck im Gesicht beobachtet hat, und ich habe keine Ahnung, was dieser Ausdruck bedeuten sollte. Anziehung? Abneigung? Traut er sich nicht, mich zu fragen, wo der nächste gute Waschsalon ist? Für den ersten Fall habe ich mir schon vor einem Monat eine Antwort zurechtgelegt. Nur zur Sicherheit.
Dein romantisches und/oder sexuelles Interesse schmeichelt mir, vor allem da wir uns bisher nur flüchtig kennen, doch ich habe seit Langem einen Freund, in den ich mich gerade langsam, aber sicher verliebe.
Tja, das stimmt jetzt wohl nicht mehr, was?
Ronald räuspert sich und fährt sich mit seiner riesigen Hand über das raspelkurze Haar. »Die gehört mir.«
»Wer?« Diese ungewöhnliche Wortwahl irritiert mich. »Ich?«
»Die Pflanze.« Er deutet auf den Topf, der unter meiner verschwitzten Achselhöhle klemmt. »Die gehört mir, und ich möchte sie gerne behalten.«
Ah, jetzt erreicht der schwindelerregende Rausch der Demütigung endlich seinen Höhepunkt.
»Klar«, erwidere ich steif. »Tut mir leid.«
Ronald blinzelt und streckt die Hand aus. Ich löse hastig die Finger vom Topf, damit er mich nicht berührt, und lasse ihn dabei beinahe fallen. Den gleichen lustigen Tanz führe ich auch an der Kasse im Supermarkt auf, wenn ich bar bezahlen muss.
Ich steige in den Aufzug und drücke auf den Knopf nach unten. Ronald mustert mich so prüfend, wie man eine halb reife Avocado begutachtet, und ich starre zu Boden, bis er zu einem Entschluss kommt.
»Tschüss«, meint er schließlich.
»Tschüss.« Die Aufzugtüren gleiten zu.
Und so fängt meine Geschichte an.
Mit einer Spruchtasse in einem Karton, der Auslöschung eines kompletten Charakters und der Erkenntnis, dass ich in diesem Gebäude wohl weniger vermisst werde als eine halb tote Zimmerpflanze.
2
Es ist nicht alles schlecht.
Wenigstens muss ich morgen nicht in einer Agentur mit einem Empfangstisch sitzen, der aussieht, als hätte König Midas daran geleckt. Ich muss nicht Leuten beim Kauen zuhören, die mich nicht mögen, während ich hoffe, dass niemand ein Kreativgewitter einberuft. Ich muss nicht mehr so tun, als würde ich mir nicht am liebsten mit den Fingernägeln die Haut vom Körper schälen, während ich dafür bezahlt werde, einen Haufen Lügen zu erzählen.
Morgen wird ein guter Tag.
Klar, übermorgen sitze ich dann im Büro meines Bankberaters, atme in eine Papiertüte und flehe ihn an, meinen Dispo zu erhöhen. Ich sollte also wohl das Beste draus machen.
»Miss Dankworth?«
Mit einem Pling gleiten die Aufzugtüren auf, und ich stürme Richtung Ausgang. Den Karton presse ich mir wie eine Art trojanischen Schild schützend vor die Brust.
»Miss Cassandra Dankworth?« Das muss man der Rezeptionistin lassen, sie ist nur schwer zu ignorieren. »Einen Moment bitte. Ich habe hier Mr Caplan in der Leitung. Er sagt, Sie müssen Ihre Karte abgeben, bevor Sie gehen.«
Cassandra Penelope Dankworth, so heiße ich. Dank meiner (toten) Eltern trage ich den Namen einer tragischen Seherin aus der griechischen Antike, der niemand glauben wollte, und den der treuen Ehefrau, die zwanzig einsame Jahre auf ihren Mann Odysseus gewartet hat.
»Kann nicht«, presse ich hervor. »Autopilot ist an.«
Mein Herz rast, Adern und Pupillen weiten sich, die Lungen dehnen sich aus, und Sauerstoff wird in mein Hirn gepumpt, um mich auf das vorzubereiten, was mein Körper als drohende Gefahr einstuft. Superpraktisch, wenn man vor einem wütenden Wollhaarmammut flüchten muss. Nicht so praktisch, wenn man nur versucht, ein Bürogebäude mitten in London zu verlassen, ohne sich auf die Schuhe zu kotzen.
Panisch werfe ich mich immer wieder gegen die Tür, bis die Rezeptionistin Mitleid hat und den Knopf drückt, um mich rauszulassen.
Frische Luft schlägt mir entgegen wie eine kräftige Ohrfeige.
Mit geschlossenen Augen bleibe ich einen Moment lang auf dem Gehweg stehen und versuche, mich neu zu kalibrieren. Hinter meinen Lidern flackert es – kleine Notsignale unzähliger sinkender Schiffe –, und wenn ich mich nicht bald beruhige, wird es passieren. Dabei will das nun wirklich niemand. Nicht hier, nicht auf dem Bürgersteig, mitten in Soho, umgeben von Menschen, die Flusskrebsbaguettes in sich hineinstopfen.
Will meint, ich soll es mal mit Yoga versuchen. Allerdings fühle ich mich unwohl, wenn so viele Hintern gleichzeitig in die Luft gestreckt werden.
»Entschuldigung.« Eine Frau in einer verboten orange leuchtenden Bomberjacke tippt mir sanft auf die Schulter, und ich zucke zusammen, als hätte sie mir einen Stromschlag verpasst. »Irgendwie blockieren Sie den Ei… Alles in Ordnung?«
Ich blinzele. »Bananenmuffin.«
»Wie bitte?«
Eine Welle der Erleichterung überrollt mich. »Ich brauche einen Bananenmuffin.«
Schnell klemme ich mir den Karton unter den Arm und haste auf das kleine Café an der Ecke zu. Bananenmuffins sind tröstlich. Bananenmuffins sind beruhigend und vertraut. Bananenmuffins wachen nicht morgens auf und sagen, dass du ihnen zwar viel bedeutest, sie aber keine Zukunft mehr mit dir sehen.
Die kleine blaue Türglocke vom Café bimmelt über meinem Kopf, und kurz muss ich an das Läuten des Weihnachtsglöckchens in Ist das Leben nicht schön? denken, einem wunderschönen Film über einen beliebten Mann, der einen positiven Einfluss auf die Welt hat und mit dem ich mich daher nicht sonderlich gut identifizieren kann.
»Hallo, junge Frau! Herrje, ist es etwa schon ein Uhr? Oder sind Sie heute früher dran?«
Ich starre auf die Stelle, an der die Bananenmuffins stehen sollten.
»Oh.« Der Cafébesitzer lächelt, als würde nicht gerade die ganze Welt unter meinen Füßen zerbrechen. »Es gab heute Morgen leider ein Missverständnis mit den Lieferanten, und sie hatten die mit Banane nicht, die Sie so mögen. Dafür haben wir aber diese köstlichen Schokomuffins und welche mit Salzkaramell, die ich persönlich sehr empfehlen kann. Sie sind wirk…«
»Banane«, beharre ich in plötzlicher Verzweiflung.
»Heute leider nicht«, erklärt er geduldig. »Kommen Sie doch morgen zu Ihrer gewohnten Zeit wieder, dann stelle ich ein paar zur Seite, in Ordnung?«
»Aber …« Die Verzweiflung droht, mich zu überwältigen. »Morgen komme ich nicht.«
»Warum setzen Sie sich dann nicht für einen Moment, und ich schaue mal, ob ich nicht was anderes für Sie finde?«
Der alte Herr zeigt besorgt auf die grünen Samtsessel, und sofort blitzt eine Erinnerung in mir auf: Will, wie er Cappuccino trinkt und mich mit einem Milchschaumschnurrbart verschmitzt angrinst.
»Nicht weinen, Schätzchen«, ruft der Cafébesitzer leicht panisch. »Wie wäre es, wenn ich morgen ein paar Extra-Bananenmuffins zur Seite lege, damit Sie sie abholen und einfrieren können?«
Ich werde Will nie wiedersehen, nicht wahr?
So sind doch die Regeln, oder? Sie sagen, dass ihr in Kontakt bleibt, immer Teil des Lebens sein werdet, bloß ist das nur leeres Gerede. Eine wohlwollende Lüge, die ihr durchschauen sollt, aber ihr glaubt sie, bis ihr irgendwann keine Antworten mehr auf eure Nachrichten und Katzen-GIFs bekommt, und dann seht ihr sie mit einer anderen Frau bei Pizza Hut. Und sie tun so, als ob sie euch nicht bemerken, obwohl ihr wie wild winkt.
Ich hätte bloß nie gedacht, dass das auch mit Will passiert. Alles ist so gut gelaufen. Ich hatte noch nicht mal die Chance, eine gute Ausstiegsstrategie zu entwickeln, mir eine vernünftige Reaktion auf sein Schlussmachen zurechtzulegen oder mal im Kopf durchzuspielen, wie sich dieser Liebeskummer wohl anfühlen wird.
Ich war nicht vorbereitet.
»Hey«, ruft eine Frau mit einem großen grauen Hut, als ich wieder durch die Tür aus dem Café stolpere. »Warte ku…«
Alles ist viel zu weit weg und gleichzeitig viel zu nah, zu laut und zu leise. Eine gelbe Tür, eine orangefarbene Blechdose, ein blauer Streifen am Himmel, ein einzelner blauer Handschuh auf dem Boden, der rote Kreis auf dem Verkehrsschild. Wie ein sich drehendes Kaleidoskop.
Eine Taube flattert hektisch an mir vorbei, ich presse mir die Hände vor das Gesicht.
Es kommt.
Es kommt, und ohne meinen Bananenmuffin kann ich nichts tun, um es aufzuhalten.
Ich muss nach Hause, jetzt sofort.
Völlig außer Atem taumle ich um die Ecke und gegen eine Wand aus Lärm, so rau und schmerzhaft, dass ich einen Moment brauche, ehe ich verstehe, dass der Lärm nicht aus mir selbst kommt.
»Pelz ist Folter! Nerz bringt Schmerz! Pelz ist Folter! Nerz bringt Schmerz!«
»Mode geht auch ohne Tode!« Eine Frau mit lilafarbenem Topfschnitt hält mir eine Broschüre entgegen. »Jedes Jahr werden wegen ihres Pelzes hundert Millionen Tiere gezüchtet und getötet! Sie fristen ihr Leben in winzigen Käfigen, bis sie irgendwann grausam abgeschlachtet werden, damit Menschen ihre Häute tragen können!«
Bläuliches Violett, Zwiebel-Käse-Atem. Eine Woge heißen Ekels rauscht mir durch den Kopf. Ich zucke zusammen, als ich gegen die klebrige, nackte Haut eines Mannes ohne Oberteil gepresst werde.
»Nerze sind semiaquatische Tiere!«, schreit er, während ich auf seine Nippel starre. »Sie halten instinktiv die Luft an, deshalb leiden sie bei der Vergasung ganz fürchterlich!«
»Ich …«, stammle ich und stolpere über ein Banner. Jetzt werde ich die Regent Street entlanggeschwemmt wie ein gelähmter Delfin in einem Schwarm bunter, kreischender Fische mit Megafonen und Trillerpfeifen.
»PELZ IST MORD!«
»Pelz ist Mord!«
»PELZ IST MORD!«
Trommelschläge, Wolken aus lilafarbenem Rauch, schrilles Hupen, Kindergeschrei, Hundegebell. Der Schwall an Geräuschen überwältigt mich, und alle Zellen meines Körpers scheinen zu vibrieren, so wie Glas kurz vor dem Springen.
»Tod durch Elektroschocks!« Eine ältere Frau taucht genau vor meinem Gesicht auf, mit orangeroten Poren und neongelben Emotionen. »Füchse bekommen die Elektroden in den Arsch gesteckt. Klingt das für dich nach Spaß?«
Ich folge ihrem Blick zu dem Fuchsschwanzanhänger, der an meiner Tasche baumelt. Will hat mich oft damit aufgezogen, wie »kindisch« er den findet. Aber ich klammere mich gerne daran fest, wenn ich in einem vollen Zug stehe oder mir jemand in der Postschlange zu nah kommt. Außerdem ist es offensichtlich Kunstfell: Der Anhänger ist knallgrün, verdammt.
Was ich ihr gerade höflich erklären will, als mich eine klebrige Flüssigkeit im Gesicht trifft. Sie riecht sauer, schmeckt nach Tinte und verfaulten Gummibärchen.
Ich greife mir mit der Hand an die Wange. Meine Finger werden ganz rot.
Irgendjemand fängt an, ohrenbetäubend zu schreien.
Erst als ich mir mit den Ellbogen verzweifelt einen Weg aus der Menschenmasse kämpfe, stelle ich fest, dass dieses grausige, schrille Geräusch aus mir selbst kommt.
Es ist hier.
Es ist hier, und ich bin voller (Blut? Farbe? Maissirup?), und hinter meinen Augenlidern explodieren Feuerwerkskörper, und ich bin »unsympathisch« und »stur« und »nervtötend« und schon wieder arbeitslos, und eine Sirene geht los, und eine Alarmanlage heult mir durch den Kopf, und Will liebt mich nicht, konnte mich nicht lieben, vielleicht gibt es da nichts zu lieben, und nirgendwo gibt es Scheiß-Bananenmuffins.
Jetzt schluchze ich hemmungslos und tue das Einzige, was mir noch einfällt. Ich suche mir den nächsten leeren Hauseingang und rolle mich auf dem Boden zu einem kleinen Ball zusammen, die Arme fest um den Kopf geschlungen.
(»Cassandra muss sich abgewöhnen, auf Stress zu reagieren wie ein Igel.«)
Und ich warte auf die Dunkelheit.
3
Komische Reaktion, ich weiß.
Meine Mitmenschen unterstellen mir schon mein Leben lang, dass ich seltsam bin. Und immer hat sie meine Seltsamkeit verärgert oder irritiert. Über die Jahre hinweg habe ich für meine »kleinen Anfälle« schon viele Diagnosen erhalten:
viktorianische Hysterie (»Holt das Riechsalz!«)
ein dramatisches Naturell
die verzweifelte Gier nach Aufmerksamkeit
ein pathologischer Drang, Partys zu ruinieren
Ich weiß nur eins: Wenn ich mir einen dunkeln, ruhigen Ort suche, sobald sich einer ankündigt, verflüchtigen sich meine »Ausbrüche« meistens kurz vor dem Höhepunkt, wie Nieser oder Orgasmen.
Und wenn nicht …
Sagen wir mal so, ich verbringe den Großteil meines Lebens in ständiger Angst davor, dass der nächste Anfall mitten in einem Kundenmeeting kommt, oder samstagnachmittags bei Zara oder auf der Hochzeit von irgendwem. (»Cassandra muss aufhören, so zu tun, als würde sich alles immer nur um sie drehen.«) In meiner Theorie arbeitet mein Hirn wie eine faule IT-Abteilung, und jedes Mal, wenn es irgendein Problem gibt, zieht es erst mal den Hauptstecker.
Einmal aus- und wieder anschalten, vielleicht hilft das ja.
Das hier muss ein besonders schlimmer Aussetzer gewesen sein. Als ich endlich wieder auftauche, sind meine Glieder übersät mit Kratzern, mein ganzer Körper fühlt sich irgendwie aufgedunsen an – wie ein Ballon voller Wasser. Die Straße ist dunkel und wieder ruhig. Die Demo ist verschwunden.
Genau wie meine Uhr, wie ich feststelle, als ich bibbernd auf mein Handgelenk schaue.
Ich blicke mich weiter um. Und der Karton mit der Tasse ist auch weg.
Ganz toll. Danke, London.
Unter Schmerzen versuche ich taumelnd, mich zu erheben wie Aphrodite, nur dass ich im Gegensatz zu der griechischen Göttin der Liebe und Schönheit eine schleimverschmierte, arbeitslose Frau Anfang dreißig bin. Und statt voller Anmut aus einer Muschel emporzusteigen, hänge ich schwitzend am Türknauf einer Bar mit dem seltsamen Namen Humbug, und versuche, dem verurteilenden Blick eines Müllmannes zu entkommen.
Das Gute ist, dass ich jetzt unendlich viel ruhiger bin.
Man kann über mein Hirn sagen, was man will – und sehr viele Leute hatten dazu schon eine Meinung –, aber es weiß definitiv, wie es die Werkseinstellungen wiederherstellt.
»HALLO? WER IST DA?«
Ich wünschte wirklich, meine Mitbewohner*innen würden aufhören, das jedes Mal zu brüllen, wenn ich durch die Tür komme. So viele Menschen wohnen jetzt auch wieder nicht bei uns.
»Cassandra«, melde ich mich und schließe die Tür hinter mir.
Nach reichlicher Überlegung habe ich mir ein Uber nach Hause gegönnt, statt mich wie üblich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln herumzuschlagen. Vermutlich ist jetzt nicht der richtige Moment, Geld aus dem Fenster zu werfen, aber es ist definitiv der falsche Moment, um ewig lange mit einem Hirn in der U-Bahn zu hocken, das sich anfühlt wie zu flüssig geratener Kartoffelbrei.
»Oh.« Sal taucht in der Küchentür auf. Sie trägt sehr kurze knallpinke Shorts und stützt lässig einen Fuß gegen ihr anderes gebräuntes Bein, als wäre sie ein lächerlich schöner Flamingo. »Du bist’s.«
»WER?«, schreit Derek schon wieder aus dem Wohnzimmer.
»Cassandra«, ruft Sal offensichtlich enttäuscht zurück, während sie mich mustert, als wäre ich ein Einbrecher. »Wir warten auf den Lieferdienst.«
»Hat der denn jetzt auch schon einen Schlüssel?« Ich lege meine Tasche ab und ziehe mir die Schuhe aus.
»Ha. Witzig wie immer.«
Salini Malhotra ist einen Ticken kleiner als ich – »Ganz schön groß für eine Frau« (was gewöhnlich nur kleine Männer feststellen) –, hat strahlende Haut, volle Lippen und die Art Wangenknochen, die wohl niemand anders als Zeus höchstpersönlich gemeißelt haben kann. Derek Miller ist ihr Freund und ähnlich attraktiv, wenn man Männer mag, die ihre benutzten Bleachingstreifen und Bartstoppeln überall im Bad rumliegen lassen, was ich nicht tue.
Ich wohne seit ungefähr einem halben Jahr hier, und Sal sieht mich immer noch so eindringlich an, als fürchte sie, mein Gesicht irgendwann einem Phantombildzeichner beschreiben zu müssen.
»Oh!« Plötzlich fällt mir das Fake-Blut von der Demo wieder ein. Ich muss aussehen, als wäre ich in einen Fleischwolf geraten. »Mir geht’s gut, mach dir keine Sorgen.«
»Mach ich nicht.« Sal seufzt erschöpft und dreht sich weg, um in den Küchenschränken nach einem Glas zu suchen. »Du wirkst, als könntest du dich sehr gut um dich selbst kümmern.«
Ein paar Sekunden lang beobachtete ich sie. Die Farbe, die aus ihr herausströmt, sieht nicht wirklich aus wie Ärger, aber sie gehört ganz sicher in dieselbe Familie: ein bläuliches Rot, wie dieser teure Designerlippenstift, den ich angeblich nicht tragen kann, weil er sich mit meinen Haaren beißt. Ihre intensiven Gefühle kribbeln mir auf der Haut, suchen einen Weg hinein. Nicht wirklich Ärger, mehr als Unmut, zu hell für Abscheu …
»Derek«, ruft sie ins Wohnzimmer. »Deine andere Freundin ist da. Willst du nicht Hallo sagen?«
Was immer es ist, Sal hat mir ganz offensichtlich noch nicht vergeben. Da kommen auch ein paar Funken Kotzgelb aus ihr heraus, bloß ergibt das keinen Sinn. Aber ich bin müde, vielleicht deute ich es auch falsch.
»Sei nett, Babe.« Derek kommt mit einem Zahnpastalächeln in die Küche geschlendert und starrt ihr auf den Hintern. »Sie hat Mist gebaut. Das passiert uns allen mal. Versuch doch, drüber hinwegzusehen, solange wir hier noch zusammenwohnen, okay?«
Langsam schlingt er seinen langen Arm um sie und zieht sie für einen Kuss an sich. Die Geste erinnert mich an einen Elefanten, der sich Erdnüsse in den Mund schaufelt.
»Na gut«, schnaubt Sal und starrt mich über die Schulter hinweg an, als wäre ich eine Gasflasche, die neben einem offenen Feuer steht und keine Sekunde aus den Augen gelassen werden darf, weil sonst das ganze Haus in die Luft geht. »Tut mir leid. Ich denke einfach, es wäre leichter für uns alle, wenn wir beide die Wohnung wieder für uns hätten. Eigentlich ist sie eh nicht groß genug für drei. Außerdem ist sie schon über dreißig. Da sollte man doch nicht mehr in WGs wohnen, oder?«
Es ist ja nicht so, als würde eine wunderschöne Wohnung in Primrose Hill auf mich warten, und ich hätte mich trotzdem für die winzige Abstellkammer in Brixton entschieden, weil ich den beiden so gerne beim Fummeln zugucke.
»Ihr seid beide neunundzwanzig«, bemerke ich knapp.
»Jeder weiß, dass dreißig die magische Grenze ist, ab der es nur noch armselig ist, mit jemandem zusammenzuwohnen, mit dem man nichts hat.« Sal löst sich von Derek und schielt mit zusammengekniffenen Augen in meine Richtung, als müsste sie überlegen, in welche seltsam geformte Tupperdose ich passe. »Warum ziehst du nicht zu dem Anwalt, den du datest? Das hilft dir vielleicht aus dem Loch, in dem du dich offensichtlich gerade befindest.«
Mein Magen verkrampft sich, als hätte mir jemand einen Basketball hineingepfeffert. Das Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr, aber es hat sich in mein Muskelgedächtnis eingebrannt.
Gerade kann mir gar nichts helfen.
»Will ist kein Anwalt«, sage ich. »Er ist Tierfilmer.«
Fast hätte ich noch stolz erzählt, dass wir gar nicht mehr zusammen sind. Aber das ist wohl nicht der clevere Konter, nach dem ich suche.
»Lass gut sein«, sagt Derek mit Nachdruck und schnippt Sal liebevoll gegen die Nase. »Ich mein’s ernst. Wir wollten Cassie so viel Zeit wie nötig geben, um eine neue Bleibe zu finden. Und das machen wir auch. Wir sind keine Arschlöcher.«
»Ich suche schon. Ehrlich.«
Und damit meine ich, dass ich zweimal im Internet nach Wohnungen geguckt habe, die ich mir leisten kann, um dann einzusehen, dass es in meiner vertrauten Hölle wenigstens heißes Wasser gibt und die Duschkabine nicht direkt neben dem Bett steht. Da habe ich den Laptop schnell wieder zugeklappt. Wenn ich mich lang genug in meinem Zimmer verstecke, vergessen sie das Drama von vor ein paar Monaten vielleicht, und alles kann wieder normal werden.
»Normal« bedeutet in unserem Fall, dass wir uns gegenseitig ignorieren und ich mir hin und wieder ein paar passiv-aggressive Kommentare über meine Kleiderwahl anhören muss.
Immer noch besser, als was auch immer das hier ist.
»Ich werde noch intensiver suchen«, murmele ich und sehe mich stirnrunzelnd um. Irgendwas fühlt sich falsch an. Es riecht … anders. Gestern gab es bei den beiden Fish and Chips, und normalerweise verpestet der Geruch von Tod im Bierteig noch tagelang die Luft. Doch er ist schon fast verflogen. Der gelbe Schal hängt wieder an der Garderobe, und als ich mich zum Sofa drehe, ist auch der violette Pullover verschwunden.
Mist. Bei all dem Spaß heute habe ich die Nachrichten vergessen, die Sal mir geschickt hat.
»Tut mir leid, dass ich meine Porridgeschüssel heute Morgen vergessen habe«, sage ich förmlich und drehe mich zum Waschbecken. »Ich spüle sie schnell.«
Aber auch sie ist verschwunden.
»Haben wir jetzt eine Spülmaschine?« Meine Igelschüssel steht wieder ordentlich verstaut in meinem winzigen Schränkchen (dem einzigen Platz, den die beiden mir zugestanden haben, und den ich täglich wie bei Tetris neu sortieren muss, damit nichts rausfällt). »Ich glaube nämlich nicht, dass ich da im Moment was zu beisteuern kann.«
»Was?« Sal stellt den laut dröhnenden Fernseher an.
»Nichts«, seufze ich. Ich würde euch ja erzählen, was ich getan habe, um wieder mal eine Wohnsituation gegen die Wand zu fahren, aber die Demütigung war schon beim ersten Durchleben schlimm genug. Es reicht, wenn ihr wisst, dass es ein Missverständnis war. Keiner meiner herausragenden Momente, und ich mache Sal keinen Vorwurf daraus, dass sie mich behandelt wie eine neue Tapete, die auf den ersten Blick gut zu passen schien, jetzt aber ungewöhnlich schwer wieder zu entfernen ist.
»Ach!«, ruft sie, als ich gerade die Treppe zu meinem winzigen Zimmer hochlaufe. »Du hast schon wieder einen blöden Brief bekommen! Ich hab ihn dir vor die Tür gelegt. Wäre schön, wenn du auch mal den Briefkasten leeren könntest. Ich bin nämlich nicht deine verdammte Sekretärin.«
Blinzelnd greife ich nach dem Umschlag, der an meiner Tür lehnt wie ein betrunkener Mann mittleren Alters an einer Bar. Da steht mein Name – Cass – in einer sehr vertrauten Handschrift, und ein mulmiges Gefühl breitet sich in mir aus. Schnell kneife ich die Augen zu, bis es wieder vorbei ist.
Gestern habe ich auch einen Brief bekommen. Das gerät langsam außer Kontrolle.
Ich reiße diesen hier in der Mitte durch, öffne die Tür und werfe ihn in den Papierkorb. Ich will ihn weder lesen noch beantworten. Leise schließe ich die Zimmertür, lasse mich nach hinten auf mein Bett fallen und starre ausdruckslos an die Decke. Ich mag mein kleines Zimmer wirklich und will noch nicht wieder ausziehen, wenn es sich vermeiden lässt. Okay, es war mal ein Badezimmer und ist so winzig, dass ich all meine Sachen in offenen Regalen und auf Kleiderstangen neben dem lädierten Waschbecken lagern muss. Selbst wenn ich sie nach Farbe und Textur sortiere (was ich selbstverständlich tue), stresst mich der Anblick.
Aber das Zimmer ist sauber, günstig und absolut symmetrisch, ein seltener Fund in London. Hier gibt es keine sichtbaren Schimmel- oder Blutflecken, dafür ein richtiges Fenster, was es besser macht als fünf der acht Alternativen, die ich mir angeguckt habe. Die Sonne scheint morgens vor der Arbeit hinein, und wenn man in einem bestimmten Winkel einschläft, wird man von einem warmen, glücklichen gelben Streifen über den Augen geweckt.
Gelegentlich fällt dieser Winkel genau auf Wills Brust. Wenn ich mich also richtig positioniere, kann ich mit der Sonne und Wills Herzschlag aufwachen.
Konnte, Vergangenheitsform, nicht länger zutreffend.
Mist.
Schnell schnappe ich mir mein Handy und verfasse eine Nachricht, bevor Stolz und Selbstachtung mich davon abhalten können:
Sind wir uns absolut sicher, dass das die richtige Entscheidung war?
Mir gefällt mein Gebrauch vom »wir«, als hätten wir beide denselben Beitrag zu dieser Situation geleistet, obwohl wir das definitiv nicht haben.
Ich drücke auf SENDEN und halte die Luft an, versuche, nicht mitzuzählen.
Achtundvierzig Sekunden später:
Klar! Das wird super. Wirst schon sehen!
Irritiert starre ich auf das Display.
Ähm.
»Super« ist nicht das Wort, das ich dafür benutzen würde, Will.
Es piept erneut.
Du und dein Thesaurus-Hirn ;-)
Sensationell. Bombastisch. Lebensverändernd.
Beste Entscheidung ever. Besser?
Eigentlich nicht, nein. Immer wollen die Leute wissen, was mit mir nicht stimmt, aber manchmal frage ich mich, ob wirklich ich das Problem bin. Das ist der unpassendste Zwinkersmiley, den ich je gesehen habe.
Zähneknirschend antworte ich:
Schön, dass du dich so freust.
Ich pfeffere das Handy ans Fußende meines Bettes.
Vier Monate.
Ich habe vier Monate meines Lebens mit einem Mann verbracht, der jetzt offenbar das Ende unserer Beziehung feiert wie das WM-Finale. Und ich hätte es kommen sehen müssen, das ist ja gerade das Peinliche daran. Will ist ein gut aussehender vierunddreißigjähriger Mann, der schon eine Beziehung hinter sich hat, die fast in einer Ehe geendet hätte. Ich dagegen sammle immer noch unsere Kinokarten und zähle unsere Dates. Das gestern war Nummer sechsundzwanzig, und das verdient doch ein bisschen mehr Respekt als »Beste Entscheidung ever«, vielen Dank auch.
Um das klarzustellen: Ich bin nicht immer diejenige, die verlassen wird. Auch wenn ihr das vielleicht denkt, aber ich hatte bisher etwa dreiundzwanzig Lebensabschnittsgefährten, und bei ungefähr fünfundfünfzig bis sechzig Prozent war ich diejenige, die es beendet hat. Dates und Beziehungen sind total anstrengend, auch wenn die andere Person es wirklich will. Was auf Will – wie er mir gerade unmissverständlich klargemacht hat – offenbar nicht zutrifft.
Plötzlich bin ich furchtbar erschöpft, also schlüpfe ich schnell unter die Decke und ziehe sie mir über den Kopf wie eine kleine Festung. Meine blonden Haare knistern vor statischer Ladung, bauschen sich auf wie eine Pusteblume und kleben mir sofort im Gesicht. Mit einem Gähnen streiche ich sie beiseite und schließe die Augen. Das geht mir immer so. Zu viele Gefühle auf einmal treiben mein Hirn in eine Leistungsspitze. Dann schickt es mich schlafen, um Energie zu sparen. Etwas unpraktisch, wenn man zum Beispiel auf der Beerdigung der eigenen Eltern ist. Aber wenn man schon im Bett liegt und es nicht mehr viel gibt, für das es sich wach zu bleiben lohnt …
Ich bin fast völlig weggedriftet, als es an der Wohnungstür klingelt.
Hinter meinen Augenlidern blitzt ein helles Neonblau auf.
»Endlich. Das wurde ja … CASSANDRA! FÜR DICH. Wo zum Teufel bleibt das Essen? Müssen die das erst noch fangen? Ich kollaboriere gleich, verdammt.«
Verwirrt quäle ich mich aus dem Bett (noch zu verschlafen, um zu begreifen, ob Sal meint, dass sie vor Hunger gleich zusammenklappt oder sich mit Derek zusammentut, um mich zur Tür zu schleifen) und werfe mir meinen alten gelben Bademantel über die Arbeitsklamotten. Es war ein langer Tag, und mir tut alles weh. Ich kann jedes bisschen Extraflausch gebrauchen, das ich kriegen kann.
Als ich mir die Kapuze auf den Kopf ziehe, knistern meine Haare wieder. Ich gehe in den Flur.
»Hey, Küken.« Will grinst mich an.
4
Okay, damit habe ich nicht gerechnet.
»Kapiert?«, fragt Will, nachdem ich ihn sechs Sekunden lang schweigend angestarrt habe. »Weil du so flauschig aussiehst wie ein Küken. Außerdem bist du eine Frau, und es sollte ein Scherz sein, weil ich so einen altmodischen und frauenfeindlichen Kosenamen niemals ernsthaft benutzen würde.«
Ich öffne den Mund.
Zugegeben, ich hatte bisher noch nie eine Langzeitbeziehung – mit vier Monaten ist Will meine persönliche Bestleistung –, aber ist es üblich, dass man am Abend der Trennung bei der Ex auftaucht und sich über ihr Outfit lustig macht?
»Hat es bei der Arbeit länger gedauert?« Will holt sein Handy heraus und schielt auf die Uhrzeit. »Bist du da drunter angezogen? Wir müssen nämlich los, wenn wir pünktlich sein wollen.«
Wie unter Schock schäle ich mich aus meinem Bademantel und präsentiere einen marineblauen Jumpsuit, als wäre ich die unattraktivste Geflügelstripperin der Welt. Noch mehr Verwirrung durchzuckt mich: Mittwochs trage ich eigentlich den schwarzen Jumpsuit. Die Trennung heute Morgen hat mich wohl so aufgewühlt, dass ich den falschen angezogen habe.
»Du siehst umwerfend aus.« Will grinst mich an. »Hol deine Schuhe.«
Ich weiß, an diesem Punkt sollte ich wohl ein paar zweckdienliche Fragen stellen – oder überhaupt Fragen –, aber Will hat gerade gesagt, dass ich umwerfend aussehe, und das tat gut. Also nicke ich nur und ziehe artig meine Schuhe an.
Vielleicht ist er für eine Nachbesprechung hier.
Statt die Beziehung eines Morgens einfach mit einem Kuss zu beenden und dann nie wieder miteinander zu reden, kommt man nachher noch mal zu einem Abschlussmeeting vorbei. Um alles ausführlich zu besprechen und eine Übersicht zu erstellen, auf der haarklein steht, was so schiefgelaufen ist. Denn wenn ich ehrlich bin: Ich habe mir den ganzen Tag den Kopf darüber zerbrochen und trotzdem absolut keine Ahnung.
»Hi.« Will lächelt mich an, als ich die Eingangstür hinter uns zuziehe, und lehnt sich vor, um mich sanft auf die Wange zu küssen.
Ich starre ihn bloß an. »Hi.«
Auch das fühlt sich unpassend an. Hat er nicht heute Morgen das Recht verwirkt, beiläufig seine Lippen auf meine Haut zu drücken? Eine Duftwolke von starkem schwarzem Kaffee hüllt mich ein – ich vermisse ihn schon, dabei berührt er mich gerade –, und Will läuft die Straße entlang. Ich folge ihm, lasse ihn nicht aus den Augen. Sein Gang war eins der ersten Dinge, die mir an ihm aufgefallen sind, als wir uns kennengelernt haben. Er ist gleichzeitig kühn und schwungvoll. So stelle ich mir Odysseus auf seinem Schiff vor. Will hat generell etwas Robustes, Unerschrockenes an sich – er ist ein Mann wie ein Baum –, und das wirkt sehr anziehend auf Frauen wie mich, die sich neunzig Prozent der Zeit über schwach und eingeschüchtert fühlen.
Was zum Teufel ist hier los? Na ja, ich habe heute den ganzen Tag noch nicht meine Mails gecheckt. Vielleicht hängt die fehlende, kontextuelle Information noch in meinem Posteingang.
Außerdem versuche ich verzweifelt, irgendwelche Farben oder Emotionen zu identifizieren, aber da sind keine. Was auch immer Will fühlt, entweder es ist nicht sonderlich stark, oder er verbirgt es hervorragend. Das kann er wirklich, wirklich gut. Deshalb kam die Trennung für mich ja auch aus dem Nichts. Erst in letzter Minute habe ich etwas wahrgenommen.
»Wohin gehen wir noch mal?«, frage ich.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Vielleicht ist er doch nicht für das Beziehungsabschlussgespräch hier. Vielleicht geht es um konstruktive Kritik, und wir werden gemeinsam analysieren, aufarbeiten und überlegen, wie wir die Situation verbessern können. Vielleicht kann ich mich ihm, trotz seiner Zweifel, doch noch mal aufdrängen, wie ein hartnäckiger Mobilfunkhändler.
Will zieht die Augenbrauen hoch. »Ins Barock Me Darling.«
»Was?« Abrupt bleibe ich stehen. »Wieso?«
»Weil es ein ausgezeichneter Wortwitz ist. Und ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis. Es sind zu Fuß nur drei Minuten von hier, und ich verhungere. Außerdem habe ich den Tisch schon vor Wochen reserviert. Steht im Kalender.«
Will reist wegen seines Jobs oft durch die ganze Welt. Deshalb versuchen wir, was uns an Work-Life-Balance fehlt, durch einen sehr klar strukturierten Wochenplan und detaillierte Veranstaltungsprogramme auszugleichen, die ich ihm jeden Sonntagabend schicke.
»Okay, aber …« Ich verziehe das Gesicht. »Ach, egal.«
Das alles kommt mir ein wenig grausam vor. Normalerweise ist Will so rücksichtsvoll und sensibel … Oder ist das Teil eines Plans? Eine romantische Geste, um den Bruch wieder zu kitten, damit wir nahtlos mit Date siebenundzwanzig weitermachen können?
Ehrlich gesagt brauche ich sofort eine Antwort.
Ich setze mich nicht in ein Pop-up-Restaurant zum Thema 18. Jahrhundert, gebe vor, eine Karte zu studieren, die ich bereits auswendig kenne, und setze ein falsches Lächeln für die Kellnerin mit Lippenstiftfleck am Kragen auf, nur um herauszufinden, ob ich Single bin oder nicht.
»Will«, setze ich an, greife unbeholfen nach seiner Hand, erwische aber nur die Fingerspitzen. »Wegen heute Morgen …«
»Ach, Mist.« Eine Farbe flackert auf, aber zu blass und zu kurz, um sie zu deuten. »Das hab ich total vergessen. Ich war nur angespannt, weil ich auf die Freigabe für den nächsten Auftrag warte. In letzter Zeit waren die Jobs ein bisschen rar. Tut mir leid, Cassie. Manchmal bin ich echt ein mürrischer Arsch.«
Da ist es: alles, was ich seit etwa zehn nach acht heute Morgen hören wollte.
Meine Freude bricht durch die Oberfläche, wie ein Küken aus einem Ei.
Es war gar keine Trennung, bloß ein Missverständnis – unterschiedliche Meinungen, völlig normal in einer gesunden Beziehung! –, und ich habe maßlos überreagiert. (»Cassandra hat die unschöne Angewohnheit, immer direkt den Teufel an die Wand zu malen.«) Die Tatsache, dass ich immer noch nicht verstehe, was passiert ist, kommt mir auf einmal absolut irrelevant vor, solange alles wieder gut ist.
»Du musst dich nicht entschuldigen«, trällere ich und drücke seine Hand. »Ich hab bestimmt auch dazu beigetragen. Vergeben und vergessen. Lass uns nicht mehr drüber reden.«
Ich quelle so über vor Glück, dass ich nicht weiß, was ich als Nächstes tun soll. Einerseits ist das hier eine epische romantische Wiedervereinigung, die sicherlich hemmungsloser und leidenschaftlicher Zuneigungsbekundungen bedarf. Andererseits stehen wir mitten auf der Straße, und ein weißer Van hupt uns an. Ich lehne mich vor, um Will auf den Mund zu küssen. Er stößt mit dem Kopf auf mich zu wie ein Truthahn, zieht mich dann aber von der Straße.
»Am besten lassen wir uns heute nicht überfahren.« Er klingt heiter und steif zugleich, wie ein schwimmender Holzstamm. »Ich möchte wirklich unbedingt das Hühnerfrikassee mit Stachelbeeren und Innereien probieren. Deshalb bin ich auch froh, dass du den gelben Flauschmantel ausgezogen hast. Sonst hätte ich dich noch mit einer der Zutaten verwechselt.«
Abends ist es in Brixton laut und voll, aber es herrscht eine ansprechend dionysische Atmosphäre. Die Farben sind kräftig, die Luft dick. Wie rohes Fleisch und Weihrauch und Chiffon und feuchter Müll und Lila und Zimt und Lamm und Zigaretten. Meistens erstickt mich das, doch heute Abend – so voller Glück und mit Wills Hand in meiner – hüllt es mich in wohlige Wärme, als hätte man mich in köstliche Marinade eingelegt.
»Schon wieder?« Ganz behutsam drehe ich unsere verwobenen Finger, sodass meine Hand oben liegt. »War es beim ersten Mal nicht eklig genug? Warum will man überhaupt Innereien essen?«
Wir reihen uns hinter einem anderen Pärchen vor einem Frachtcontainer aus Metall ein. Eine Frau in einem langen roten Samtrock und einer Brokatschürze hakt Namen auf einem Klemmbrett ab. (Den Rock haben vor drei Jahren alle zur Weihnachtszeit getragen.)
»Keine Ahnung«, antwortet Will. »Ich hab sie noch nie probiert.«
»Willkommen im Barock Me Darling!« Die Frau lächelt uns mit knallroten Lippen entgegen und trägt dieselbe Bluse wie gestern: Da ist der kleine Lippenstiftfleck am Kragen. Was sie wohl sonst noch nicht sauber macht? »Hoffentlich können wir Ihnen heute Abend ein unvergessliches Esslebnis bereiten. Name?«
»Cassandra Dankworth.«
»Baker«, antwortet Will im selben Moment.
»Oh.« Ich stoße ein leises Schnauben aus. »Sie meinen für die Reservierung. Ich dachte, Sie wollten einfach wissen, wie ich heiße.«
Zum Glück hört mir niemand zu. Will starrt auf sein Handy, und die Kellnerin in dem historisch inkorrekten Kostüm führt uns schon durch die sechs Meter lange Kiste zu unseren runden Mahagonihockern an der langen Theke, die es hier statt Tischen gibt. Wellblech und Samttapete, falsche Entenköpfe an den Wänden und geschnitzte Goldsessel sind eine mutige – manche würden sogar sagen, unglückliche – Kombination.
Aber Will gefällt es, also bin ich zufrieden.
Außerdem hört man nicht oft an zwei Abenden in Folge den Begriff »Esslebnis«.
»Hattest du das Frikassee nicht gestern schon?« Wie die Hühner auf der Stange sitzen wir vor der Wand und werfen einen Blick in die Karte. »Weißt du nicht mehr? Wir haben doch auch über Nüsse gesprochen. Weil sie einerseits Früchte sind, aber auch ein Stück aus der Keule von Rindern, Kälbern oder Schweinen sein können. Außerdem heißt bei Armbrüsten die Halterung von Pfeil und Sehne Nuss, und Steckschlüsselaufsätze sind auch Nüsse. Und wir haben festgestellt, dass man die letzten beiden Varianten lieber nicht auf seinem Teller finden möchte.«
Zugegeben, den Großteil dieser Unterhaltung habe ich allein gestemmt.
Will nickt abwesend und starrt weiter auf sein Handy, also lasse ich den Blick durch das Restaurant schweifen, bis seine Aufmerksamkeit wieder bei uns ist. Was hier in dem Container wohl ursprünglich verschifft wurde? Getreide? Seife? Bücher? Wenn es Bücher waren, dann war die Umwandlung in das Restaurant definitiv eine Verschlechterung.
»Was meinst du damit?« Endlich sieht mein Freund mich an. »Wir waren gestern nicht hier.«
»Ähm.« Verwirrt blinzle ich. »Doch, waren wir.«
»Nein, waren wir nicht.« Er schüttet mir netterweise Wasser aus dem Krug in mein Glas, bevor ich ihn wie gestern wieder umwerfen kann. »Gestern war ich den ganzen Abend im Studio und habe panisch einen Film geschnitten.«
»Falsch.« Ich sehe mich um und strecke den Finger aus. »Wir haben genau da gesessen. Du hast das Frikassee mit Stachelbeeren bestellt und ich die Rote Bete Pfann Kuchen – vier Wörter –, und später habe ich mich aufgeregt, weil du deinen Löffel in meinen Pudding gesteckt hast.«
»Nope.« Will lacht. »Obwohl das sehr nach etwas klingt, das du machen würdest.«
»Du hast ihn angeleckt! Du hast meinen Pudding mit deinem Speichel kontaminiert!«
»Cassie, wir schlafen miteinander.« Er grinst und schaut in die Karte. »Ich stecke regelmäßig meinen Löffel in deinen Pu…«
»Will«, unterbreche ich ihn hastig, bevor die Kellnerin uns hört und schlussfolgert, dass das zwischen uns was Lockeres und Nicht-auf-Dauer-Angelegtes ist. Denn das ist es nicht. »Das sind zwei vollkommen verschiedene Situationen. Wir küssen uns auch, aber das heißt doch nicht, dass ich dir im Schlaf in den Mund spucken darf.«
Wieder lacht er. »Spuckst du mir denn im Schlaf in den Mund?«
»Nein«, erwidere ich hitzig. »Dabei geht es nämlich um Konsens.«
Tatsächlich habe ich im Vorfeld die Karte intensiv studiert und mir alle Fotos auf Google eingeprägt und im Restaurant angerufen, um nach den vegetarischen Optionen zu fragen, und bin auf dem Weg zur Arbeit hier vorbeigelaufen und habe durch die Fenster gespäht. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass ich mir ein paar falsche Erinnerungen anrecherchiert habe.
Außerdem streiten wir uns oft wegen Wills abstoßender Tischmanieren: Beim Essen kann er einfach keine Grenzen akzeptieren.
»Na gut«, lenke ich ein und greife mir ein Stück »Waisbrot«, auch wenn ich sicher bin, dass das selbst im 18. Jahrhundert nicht so geschrieben wurde. »Hast ja recht. Wahrscheinlich bin ich einfach nur müde. Heute war wirklich ein … verwirrender Tag.«
Unter der Theke legt Will mir sanft die Hand auf den Oberschenkel. Nicht aus den sexy Gründen, die ihr jetzt vielleicht vermutet. Ich trete mit dem rechten Fuß immer wieder so fest gegen das Wellblech, als wäre es eine Blechtrommel, und unsere Sitznachbar*innen werfen uns schon genervte Blicke zu.
Angestrengt knete ich mir die Hände und konzentriere mich auf den Druck von Wills Berührung.
In seinem Blick liegt etwas Sanftes. Etwas zu Sanftes. »Was ist passiert?«
Hitze steigt mir ins Gesicht, und ich wende mich schnell ab. »Na ja …«
»Hallo, geliebte Gäste!« Die Lippenstiftfleckfrau ist wieder da. »Bereit für ein bisschen Barock ’n’ Roll? Was wollt ihr trinken? Ich empfehle den Puss & Mew.«
»Einfach normalen Rotwein, bitte«, erwidert Will mit einer Autorität, die einem aus der tiefsten Seele emporsteigt, wie Zwiebeln aus der hausgemachten Suppe. »Für mich das Frikassee, und … du wolltest die Rote-Bete-Pfannkuchen, oder?«
»Ich hab nicht gesagt, dass ich sie will«, murmle ich und stopfe mir weiter Brot in den Mund. Auf einmal fällt mir ein, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe. »Es ist nur das einzige Gericht auf der Karte ohne Innereien.«
»Du bist witzig!« Die Kellnerin kritzelt etwas auf ihren Block. Hat sie sich das notiert wie eine Therapeutin? »Hattet ihr bisher einen schönen Tag?«
Und weg sind die beiden: Sie plaudern über das Wetter. Das führt offenbar unausweichlich zu der Frage, wie lang das Restaurant geöffnet hat, wie viel Umsatz man hier macht und ob sie darüber nachdenken, sich irgendwo dauerhaft niederzulassen. Währenddessen studiere ich die Karte, als wäre sie die Ilias. Wie machen Leute das? Wie können zwei völlig Fremde sich so in eine Unterhaltung verstricken, ohne sich darin zu verheddern? Woher wissen sie, was sie als Nächstes sagen sollen? Und, vor allem, warum? Es ist wie bei Musicals, bei denen plötzlich alle denselben Tanz aufführen, ohne vorher zu proben: absolut unerklärlich.
Endlich verlässt die Kellnerin uns mit unserer Bestellung im Schlepptau, und ich spüre, dass Will mich mustert.
»Cassie«, sagt er leise.
Ich sehe zu ihm auf. »Ja?«
»Du weißt, dass wir uns nur unterhalten haben, oder?«
Jetzt bin ich wirklich verwirrt. »Ja.«
»Was ist das dann für ein Gesicht?«
»Wieso, was ist mit meinem Gesicht?« Hastig schnappe ich mir ein Messer und halte es hoch, doch es ist zu angelaufen, um etwas in der Klinge zu erkennen. O nein! Das Fake-Blut von der Demo. Hektisch beginne ich, mir über die Wangen zu rubbeln. »Will, warum hast du denn nichts gesagt?«
»Wozu denn?« Wieder legt er mir die Hand auf das wippende Bein. »Was ist los? Sprich mit mir. Du wirkst heute total durcheinander.«
Langsam atme ich aus. Oh, es ist nicht viel los. Ich habe mir bloß unsere Trennung eingeredet, die Trauerphase eingeläutet, bin gefeuert worden, habe eine Pflanze gestohlen, sie mir wieder wegnehmen lassen, wegen eines Muffins geheult, wurde mit Blut besudelt und bin dann im Hauseingang einer Bar zusammengebrochen. Klingt alles nicht nach einer Frau, mit der man viel Zeit verbringen will, oder? Dabei habe ich dich doch gerade erst wieder.
»Alles gut.« Ich lächle ihn breit an. »Danke, dass du fragst. Wie geht es dir denn?«
»Super.« Er blickt auf, als unser Essen gebracht wird, das – um meine Verwirrung auf die Spitze zu treiben – exakt so aussieht, wie ich es erwartet habe. Und das ohne Beweisfotos in der Karte. »Sogar blendend. Ich hab tolle Neuigkeiten.«
Will schaut auf sein Essen, dann zu mir und wieder aufs Essen. Und mit einem Mal spüre ich eine regelrechte Sturzflut an Farben, eine seltsame Mischung, die ich nicht entwirren kann, wie ein Knäuel verschiedenfarbiger Wollfäden. In seinen Augen blitzt irgendetwas Neues auf, aus dem ich allerdings auch nicht schlau werde.
Dann spricht Will weiter: »Mir wurde ein Auftrag in Indien angeboten.« Er greift nach seinem Weinglas und nimmt einen übertrieben großen Schluck. »Ich soll eine Dokumentation über Schuppentiere filmen. Samstag fliege ich und bleibe einen Monat.«
Was zum kontinuierlichen Erzählfluss noch mal ist hier los?
»Ja.« Mit gerunzelter Stirn lege ich meine Gabel beiseite. »Ich weiß.«
5
Wissenschaftler können sich das Phänomen des Déjà-vus nicht genau erklären.
Ist es eine Erinnerung, die sich so schnell formt, dass wir uns an den Augenblick erinnern, noch während wir ihn erleben? Eine Fehlfunktion, bei der der Gegenwarts- und der Vergangenheitsteil des Gehirns gleichzeitig beansprucht werden? Eine Nervenbahn, die übersprungen wird? Ein Wurmloch, eine religiöse Erfahrung, ein Fehler in der Matrix? Es ist unklar, doch als Will zu einem Vortrag ansetzt, den ich schon gehört habe, ein Gericht isst, das er schon gegessen hat, Wein trinkt, den er schon getrunken hat, und das alles in einem Restaurant, in dem wir – da bin ich mir inzwischen ganz sicher – schon gestern waren, stellen sich mir die Nackenhaare auf.
»Cassie.«
Hinter der kleinen Bar zerspringt eine Flasche auf dem Boden. Ein Handy klingelt mit der vertrauten Melodie eines Filmsoundtracks.
»Cassie.«
Die Eingangstür knallt zu, und der Wasserkrug …
»Cassandra, kannst du nicht mal für eine Minute dein Handy weglegen? Ich versuche, mit dir zu reden.«
Verwirrt blicke ich vom Wikipedia-Eintrag über Déjà-vus auf.
»Guck mich an.« Will nimmt mir sanft das Handy aus der Hand und legt es auf den Tisch. »Ich weiß, das kommt jetzt etwas überraschend, aber es ist wirklich ein tolles Projekt. Und ich war ja schon öfter wegen der Arbeit weg, das heißt also nicht, dass wir nicht …«
»Wann hast davon erfahren? Seit wann weißt du das?«
Will runzelt die Stirn. »Gegen fünf, wieso?«
Ich fixiere meine unberührten Pfannkuchen. Wir haben nicht mehr miteinander gesprochen, seit ich heute Morgen zur Arbeit gegangen bin. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten: Entweder ich werde hier gerade zum Opfer in einem Musterfall von Gaslighting, oder die Synapsen in meinem Hirn haben einen Kurzschluss. Schnell schaue ich auf und mustere Wills Gesicht. Es sieht nicht aus und fühlt sich auch nicht so an, als würde er lügen, aber ich bin zu durcheinander, um einzuschätzen, ob die Emotionen, die ich spüre, meine oder seine sind.
Einer von uns beiden ist verrückt geworden. Angesichts meines heutigen Tages wohl ich.
»Mir geht es nicht so gut.« Abrupt springe ich von meinem Hocker auf und stoße den verdammten Wasserkrug um. »Ich glaube, ich möchte jetzt nach Hause, bitte.«
Das Wasser tropft mir vom Schoß, und ich torkele von unserem Platz weg. Egal was hier los ist, ich kann nicht noch einen Zusammenbruch riskieren. Nicht hier, nicht jetzt, nicht in Gegenwart des tollsten Mannes, mit dem ich je zusammen war. Zwei an einem Tag hat es bisher noch nie gegeben, aber vielleicht habe ich mir ja den Kopf gestoßen. Vielleicht habe ich eine Art zeitverzögerte Gehirnerschütterung. Vielleicht sind all meine sorgfältig sortierten Neuronen durcheinandergeraten, wie die Steine in einem Scrabblebeutel.
»Wirklich?« Will nimmt sich ein paar triefend nasse Servietten, guckt sehnsüchtig auf seinen Teller und dann zu mir, offensichtlich hin- und hergerissen. »Jetzt sofort? Können wir das nicht beim Essen besprechen?«
Die rothaarige Frau hinter mir stößt ein schrilles Lachen aus. Ich erinnere mich an dieses Lachen. Wirklich. Zumindest fühlt es sich so an.
»Ich gehe«, wiederhole ich mit Nachdruck. »Jetzt.«
»Dann komme ich mit.« Er schnappt sich noch ein Stück Brot und steht auf. »Ich hab nicht damit gerechnet, dass du so reagierst. Sonst hätte ich dich besser darauf vorbereitet. Das ist eine tolle Chance, und ich dachte, du freust dich für mich.«
Ziemlich sicher habe ich das beim letzten Mal auch getan. Ich habe ihm auf meinem Handy eine interaktive Karte von Indien gezeigt und ganz aufgeregt und mit vollem Mund einen Vortrag über Schuppentiere gehalten. Ich habe nachgemacht, wie sie ganz unterwürfig ihre Pfötchen zusammenhalten wie unterbezahlte Butler, und Will hat so lange gelacht, bis ihm der Kaffee nach dem Dessert aus der Nase lief.
Nur dass das anscheinend nie passiert ist. Was bedeutet, dass irgendwas in meinem Gehirn zu schnell oder zu langsam läuft, und das ist ein Riesenproblem. Ganz plötzlich fühlt sich der Frachtcontainer überladen an. Ich halte die Luft an und schwanke durch die Tür nach draußen, bleibe mit geschlossenen Augen auf der belebten Straße stehen und klammere mich fest an meine Daumen, um nicht allzu sehr in Panik zu verfallen.
Atme, Cassandra. Atme.
Aber nicht zu schnell, sonst wirst du wieder ohnmächtig.
»Cassie?« Will kommt ein paar Minuten nach mir aus dem Container. »Ich hab noch bezahlt, aber sie wollten uns das Essen nicht einpacken. Anscheinend gab es im 18. Jahrhundert noch kein Essen to go. Was ist hier eigentlich los? Du benimmst dich ganz schön exzentrisch, selbst für deine Verhältnisse.«
Atmen, atmen, atmen …
Vorsichtig öffne ich ein Auge nach dem anderen.
Es ist weg. So schnell, wie das Déjà-vu aufgetaucht ist, ist es wieder verschwunden. Alles ist wieder normal, meine Synapsen haben die Arbeit wieder aufgenommen, die Realität ist nicht länger verzerrt, und ich werde so tun, als hätte ich Wills letzten Satz nicht gehört.
»Allergische Reaktion?«, schlage ich vor.
»Du hast doch gar nichts gegessen.« Mein Freund klingt erschöpft, als wäre ein Essen mit mir so anstrengend wie das Erklimmen eines Berges ohne passendes Schuhwerk. »Aber lass uns einfach zurück zu dir gehen und dann drüber reden.«
Wir schweigen uns den ganzen Weg über an, und mit jedem Schritt fühlt sich der Fehler in der Matrix surrealer an, wie ein Traum, der einem langsam entgleitet, sobald man die Augen öffnet. Immer wieder schiele ich zu Will, doch er sieht mich nicht an. Sein Kiefer wirkt angespannt. Wir halten Händchen, doch seine Hand fühlt sich hölzern an. Unecht. Eine Fake-Hand. Als hätte ich ein Date mit Pinocchio.
Den ganzen Weg über trieft etwas Lindgrünes aus ihm heraus. Ich weiß, die meisten denken, Grün stünde für Eifersucht, aber das stimmt nicht. Zumindest nicht dieses Mal.
Es fühlt sich eher an, als würde Will eine Entscheidung treffen.
»Tut mir ehrlich leid«, sage ich zum fünften Mal, als wir endlich in meinem Zimmer sind, ziehe meinen marineblauen Jumpsuit aus und hänge ihn ordentlich weg, bevor mir einfällt, dass ich ihn genauso gut auf den Boden oder in einen Brennofen werfen könnte. Nächste Woche brauche ich ihn sowieso nicht mehr. »Keine Ahnung, warum ich mich so benommen hab.«
»Schon gut.« Will streift seine Jeans ab und steigt in mein Bett. »Wirklich.«
So was sagen Leute nur, wenn sie euch wissen lassen wollen, dass sie lügen. Sehr behutsam, als wäre Will ein Raubtier, klettere ich zu ihm unter die Decke und schaue ihn an. Haben wir heute Abend Sex? Schwer einzuschätzen. Einerseits würde es vermutlich die Anspannung lösen. Aber andererseits bin ich nicht sicher, ob die richtige Stimmung herrscht.
Nach ein paar Sekunden zieht Will ein Buch aus seiner Tasche – irgendeine Biografie über David Attenborough, was auch sonst –, also folge ich brav seinem Beispiel und schnappe mir mein eigenes Buch (DiePenelopiade). Den BH kann ich nachher immer noch ausziehen, vielleicht hebt das die Stimmung ein wenig.
»Weißt du …« Nach ein paar Momenten Stille legt Will sein Buch weg. »Wenn dich irgendetwas ärgert, kannst du es mir sagen. Ich muss es wissen. Renn nicht einfach ohne Erklärung mitten im Essen weg. So funktionieren erwachsene Beziehungen nicht.«
Ich verziehe das Gesicht. »Okay.«
»Es geht hier um meinen Job. Ich nehme die Aufträge, die ich kriege. Ich kann mir nicht aussuchen, wann ich wohin muss.«





























