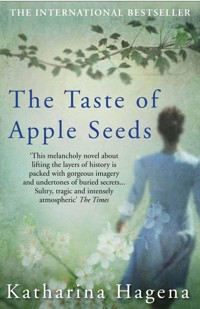Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Seit ihre Mutter ihr das Schwimmen beigebracht hat, fährt Katharina Hagena fast jeden Sommer mit ihrer Familie nach Spiekeroog. Mit geschlossenen Augen kann sie noch immer die verschiedenen Wege zum Strand am Duft erkennen. Hagena erzählt vom Baden bei Meeresleuchten, vom Zeltplatzkiosk als Ort der Verheißung und von einem Sand, der beim Darübergehen aufschreit. Sie berichtet von vergeblichen Bernsteinsuchen, der Heilkraft von Strandkörben bei gebrochenem Herzen, von Schiffsunglücken, Seenebel und dem Verschwinden der Wellhornschnecke. Hagenas Erinnerungen und Gedanken schärfen die Sinne für die Zerbrechlichkeit der einzigartigen Insel und sind zugleich ein Nachdenken über Sprache, über das In-Worte-Fassen dessen, was nicht bleibt, seien es eine Sandbank, der Geruch von Strandwermut oder das möwenfarbene Haar ihrer Mutter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KATHARINA HAGENA
Mein Spiekeroog
© 2020 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann, mareverlag
Coverabbildung ilbusca/istockphoto.com
Abbildung Karte © akg-images/historic-maps
Abbildung Garnele © Oleg7799/shutterstock.com
Typografie (Hardcover) mareverlag, Hamburg
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-382-8
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-611-9
www.mare.de
In Erinnerung an Anke
Inhalt
I. ÜBERFAHRT
Vorwort
Fürwort
Schwimmen, verschwommen
Überfahrt
II. REIZKLIMA
Frische Luft
Wind
Frisches Wasser
III. DER STRAND
Sand
Schwimmen 2
Schlumpfburg
Strandkorb
Strandsport
IV. DAS DORF
Jeder darf machen, was er will
Das Old Laramie
Die Hermann-Lietz-Schule
Der Zeltplatzkiosk
Die Ulme
Schwimmen 3
Der Bahnhof
V. DIE DÜNEN
Dünensingen
Gipsbein
Der Lesepavillon
Bankgeheimnis
VI. DAS MEER
Schwimmen 4
Meeressprache
Über das Finden
Muscheln
Bernstein
Seesterne und Quallen
Krebsgetier
Meeresleuchten
VII. ÜBERRESTE
Der Drinkeldodenkarkhof
Moltke
Verona
Exkurs:Vom Abschweifen und Fortfahren
VIII. DAS WATT
Salzwiesen
Strandwermut
Der gelbe Turm
Schwimmen 5
Wattwandern
IX. DAS KÖRPERGEDÄCHTNIS
Literatur
Danksagung
I. ÜBERFAHRT
Vorwort
Ein Buch über Spiekeroog zu schreiben, heißt, eine Parallel-Insel zu erschaffen, die zwischen zwei Buchdeckel passt, ein schwarzes Buchstaben-Eiland im weißen Seitenmeer, Sprachinsel aus Inselsprache.
Das Wort Spiekeroog trägt sein Inselsein im Namen, -oog, das bedeutet in der niederdeutschen Sprache Ostfrieslands »Insel«, kommt aber immer nur als Teil eines Wortes vor, Oog allein gibt es nicht. Woher Spieker kommt, weiß man nicht genau, es könnte Speicher heißen, aber besonders viel zu speichern gab es auf der Insel nie. Die ersten Insulaner lebten vor allem vom Fischfang. Spieker kann auch Nagel heißen, vielleicht, weil die Insel eine längliche Form hat? Allerdings haben die meisten der Ostfriesischen Inseln eine längliche Form. Und durch die starke Strömung werden sie auf der östlichen Seite auch immer länger.
Spiekeroog ist nicht dadurch entstanden, dass Teile des Festlands abbrachen – die Insel ist vom Meer angeschwemmt und vom Wind herbeigeweht worden. Der Sockel der Insel stammt aus der Eiszeit und liegt heute tief unter der Oberfläche. Spiekeroog ist ungefähr zehn Kilometer lang und nur zwei Kilometer breit. Erwähnt wird die Insel zum ersten Mal 1398, da heißt sie »Spickerooch«, und laut einer Quelle aus dem Jahre 1561 wird die Insel nur als Ort mit »schlechten Dünen« bezeichnet.
Erst 1448 beklagt sich der ostfriesische Häuptling Ulrich Cirksena darüber, dass »mynen undersaten uppe Spikeroch hundert shap genomen« worden seien – seinen Untertanen wurden hundert Schafe geklaut. Doch das sollte nicht das letzte Ungemach bleiben, das den Spiekeroogern widerfuhr. Nicht selten wurden sie von Piraten überfallen, die mitnahmen, was ihnen gefiel. Und schließlich legten sich die Insulaner auch noch mit ihrem Oberherrn an, Balthasar von Esens. Raub und Plünderungen ihres Dorfes waren die Folgen. Im Jahre 1806 wurde Spiekeroog dem holländischen Königreich zugeteilt und war damit Teil des napoleonischen Frankreichs. Nach der Auflösung des französischen Kaiserreichs fiel Ostfriesland an Hannover und damit an den englischen König, ehe es 1866 wieder preußisch wurde.
Die Inselsprache blieb jedoch die ganze Zeit über Plattdeutsch.
Als die Franzosen weg waren, kamen die ersten Badegäste nach Spiekeroog, aber erst später und spärlicher als auf manchen anderen Ostfriesischen Inseln. So begann der Badebetrieb auf Norderney schon fast dreißig Jahre früher. Auch heute ist auf Spiekeroog oft nicht ganz so viel los wie auf den meisten der sechs anderen Inseln, aber jetzt ist das einer der Gründe, warum die Leute überhaupt dorthin fahren.
Als Kind waren wir, mein Bruder und ich, mit unseren Eltern jedes Jahr in den großen Ferien auf Spiekeroog, mit achtzehn hatte ich meinen letzten Teenager-Sommer auf der Insel, als Studentin fuhr ich nur noch im Winter hin. Dann kam ich eine Zeit lang gar nicht mehr, bis ich selbst Kinder hatte. Mit ihnen war ich wieder jeden Sommer da. Inzwischen gehen sie aber mehr und mehr ihre eigenen Wege, entdecken ihre eigenen Inseln, und vielleicht finden sie irgendwann ihr eigenes Spiekeroog.
Mein Spiekeroog besteht aus Treibgut.
Erinnertes, Gelesenes, Gehörtes oder Geträumtes – alle Baustoffe dieses Buches sind angeschwemmt. Ich ziehe mir einzelne Stücke heraus und setze sie so zusammen, wie es mir passt, das meine ich ganz wörtlich: so, dass ich hineinpasse – ähnlich wie bei jenen durchlässigen Piratenverschlägen, die früher an den Randdünen des Oststrands standen. Inzwischen sind sie wahrscheinlich fortgespült oder weggeweht. Doch ich stelle mir vor, sie stehen immer noch dort, nur sind sie im Laufe der Zeit mehr und mehr versandet, bis nichts mehr von ihnen zu sehen war. Strandhafer und Silberdisteln haben sich auf ihnen niedergelassen, und längst sind sie zu einem Teil der Landschaft geworden.
Fürwort
Das besitzanzeigende Fürwort »mein« vor einem geografischen Begriff ist heikel. Es klingt nach Aneignung und Ermächtigung – ein besitzergreifendes Widerwort.
In Wahrheit liegen die Besitzverhältnisse zwischen Spiekeroog und mir genau andersherum: Diese Insel ist weniger die meine, als ich die ihre bin. Doch vielleicht möchte dieses »mein« gar keinen Besitz ergreifen, sondern ist vielmehr ein Ausdruck von Zärtlichkeit? So wie in dem Wiegenlied »Kindlein mein«, wo es nachgestellt ist. Insel mein.
»Dû bist mîn, ich bin dîn«, heißt es in jenem mittelhochdeutschen Liebesgedicht, das zwar »mein« sagt, aber erst, nachdem es »du« gesagt hat, und um im selben Atemzug zu erklären, dass es »dein« ist. Vielleicht ist es nur möglich, »mein« zu sagen, wenn man sich selbst schon verschenkt hat? Wenn mein und dein ineinander wohnen wie ein Herz im Herzen, dann kann »mein Spiekeroog« nicht nur meine Insel sein.
»Mein Spiekeroog« bedeutet also weniger Eigentum als eigentümliche Verbundenheit, hat weniger mit meiner inneren Haltung zu tun als vielmehr mit meinen Innereien. Bevor ich das Buch Mein Spiekeroog schreiben kann, hat sich Spiekeroog schon in mich eingeschrieben. Längst ist die Insel Teil meines Körpers geworden:
Da ist die zwei Zentimeter lange Narbe am Fuß aus jenem Sommer, in dem ich in die scharfe Eisenkante des fast – aber eben nur fast – vollständig von Sand bedeckten Wracks der Verona getreten bin. Als ich das letzte Mal dort war, ragte es hoch aus dem Sand, drauftreten konnte man nicht mehr, dafür aber hineinschauen in das schwarze Innere, vor dem mir graut.
Trotz meines geradezu religiösen Eifers beim Einschmieren mit Sonnenschutzfaktor fünfzig hat die Sonne eine Handvoll Muttermale in meine Haut gebrannt, einen kleinen rauen Fleck auf den Nasenrücken gestanzt, Linien von den Augenwinkeln in die Schläfen gezogen.
Nach Sandstürmen, Salzwasser und billigen Sonnenbrillen sind ein paar geplatzte Blutgefäße in den Augäpfeln zurückgeblieben.
Einer meiner linken Mittelfußknochen weist Zeichen des Verschleißes auf – vom ständigen Barfußlaufen nach Osten und nach Westen.
Noch immer sind da winzige Narben in den Kniekehlen und Handinnenflächen von den Abertausenden Knie, Sitz- und Bauchwellen, Aufschwüngen, Unterschwüngen, Todessprüngen, die wir an den blauen Reckstangen übten.
Beim Volleyballspielen am Strand habe ich mir die Finger verstaucht und die Knöchel verknackst. Die Hämatome an Unterarmen und Oberschenkeln sahen aus wie bunte Inseln auf einer Seekarte, ein unbekannter Archipel, der sich langsam verschob, verformte und schließlich verblasste.
Irgendwo in meiner Speiseröhre muss es eine Narbe geben, die an jene Gräte erinnert, die ich als Kind in einem Spiekerooger Restaurant verschluckt habe. Nachdem ich sie mit Brot und Tränen schließlich heruntergewürgt hatte, konnte ich die Stelle noch tagelang hinter dem Brustbein spüren.
Meine Füße wurden punktiert von Splittern, die sich beim Gang auf den Holzplanken hinauf zur Strandhalle in die nackten Sohlen gebohrt haben. Fügte man sie alle zusammen, würden sie wieder eine ganze Planke ergeben.
Und nicht zuletzt gibt es all die kleinen Narben und Blessuren, die ich mir beim Bewegen und Verstellen des Strandkorbs zugezogen habe: gequetschte Finger vom Einstellen der Haube, Rückenschmerzen beim Drehen des Strandkorbs, blaue Zehen, die ich mir bei einer zu eng genommenen Kurve am ausgezogenen Fußteil verstauchte, eingerissene Fingernägel vom Aufschließen des versandeten Schlosses, eine rechtwinklige Narbe auf dem Spann, als beim Verschieben des Korbs mein Fuß kurz unter den des Strandkorbs geriet. Und natürlich die vielen Schürfwunden vom Stolpern über das Holzgitter, das immer jemand aus der Familie in den Sand neben den Korb wirft.
Je länger die Liste wird, desto unvollständiger wird sie.
Spiekeroog hat sich unter meiner Haut abgesetzt wie eine Tätowierung, hat sich eingeritzt, eingebrannt, eingezeichnet. »Meine« Insel zu sagen, ist also durchaus eine Einverleibung, aber nicht meinerseits, sondern inselseits.
Schwimmen, verschwommen
Als mein Bruder und ich sicher schwimmen konnten und nicht mehr, wie noch beim Ablegen unserer Frei- und Fahrtenschwimmer, mit dem Körper vollkommen senkrecht, den Kopf im Nacken und der Nase als höchstem Punkt, blind durchs Wasser pflügten, beschloss meine Mutter, dass es Zeit war, an die Nordsee zu fahren. Sie fand, wir wären nun bereit für Spiekeroog.
Sie hatte uns das Schwimmen selbst beigebracht, Freiundfahrten hatte ich mit vier Jahren zusammen mit meinem Bruder, der ein Jahr älter ist, in einem Ostseebad abgelegt. Das war sehr früh, aber meine Mutter war ungeduldig. Sie wollte endlich wieder selbst schwimmen.
Zu Hause am Baggersee hatte sie mit uns geübt, bis wir müde waren und mit blauen Lippen auf die Decke taumelten. In Handtücher gehüllt, aßen wir danach sonnengewärmte Kuchenstücke und Pfirsiche. Sobald wir saßen und uns – wegen der Handtücher – nicht mehr bewegen konnten, sagte sie beiläufig, dass sie »mal eben rüberschwimmen« wolle, und schon machte sie einen flachen Köpfer ins Wasser, tauchte weiter draußen wieder auf und schwamm, Brust und Kraul im Wechsel, hinüber auf die andere Seite des Sees. Wir konnten sie die ganze Zeit sehen. Am anderen Ufer, es war ungefähr einen halben Kilometer entfernt, winkte sie uns kurz und schwamm wieder zurück. Wenn sie aus dem Wasser schritt, klebte ihr nasses Haar dunkel an Stirn und Schläfen, und sie lächelte fröhlich, wenngleich auch etwas verlegen. Die anderen Mütter schwammen meistens zu zweit oder zu dritt parallel zum Ufer, man konnte sie lachen und reden hören, und wenn sie herauskamen, hatten sie immer trockene Haare.
Solange man uns also noch mit Handtüchern und Sandkuchen am Ufer festhalten musste, verbrachten wir die Sommerurlaube an der Ostsee. Die Ostsee ist ein kleines Meer, kleine Kinder konnten gut darin stehen, es gab keine hohen Wellen, und wenn man aus dem Schlauchboot fiel, konnte man meistens allein wieder hineinkrabbeln. Man konnte mit dem Auto und dem Fahrrad bis an den Strand fahren, es gab eine Strandpromenade mit Läden, Fischbuden und einer Milchbar, wo mein Vater »Joghurt Spezial« bestellte, einen Traum aus gezuckertem weißem Joghurt mit einem Berg Obstsalat aus der Dose obendrauf.
Das alles gab es auf Spiekeroog nicht.
Und doch war meinem Bruder und mir klar, dass diese ostfriesische Nordseeinsel die nächste Ebene darstellte. Alles, was vorher gewesen war, war nur zur Übung. Für Nichtschwimmer war das nichts.
An meine erste Überfahrt kann ich mich nicht genau erinnern. Auch nicht an meine erste Reise mit der Inselbahn. Der erste Blick von oben auf den Strand. Meine erste Wattwiese. Alle meine Kindheitsinselsommer streben danach, in meiner Erinnerung zu einem großen Meerbild zu verschwimmen, und nur anhand von Kleidungsstücken, Fotos und den Erinnerungen anderer kann ich mühsam rekonstruieren, was wann gewesen sein könnte.
Schwimmend, verschwimmend, sich verschwimmend – das ist vielleicht die angemessene Art der Annäherung an diese Nordseeinsel, auf der meine Kindheit in jedem Wortsinne aufgehoben ist. »Die nächste Flut verwischt den Weg im Watt«, heißt es zu Beginn von Rilkes Nordseeinselgedicht, das ich noch immer vor mich hin flüstere, wenn ich auf Spiekeroog bin. »Und alles wird auf allen Seiten gleich.« Aus der nächsten Flut jedoch steigen die Erinnerungen herauf wie Inseln, die mal schärfer, mal verschwommener zu sehen sind. Mal legen sich im Laufe der Jahre Sandbänke um die Erinnerungsinseln, sie werden größer und verändern ihren Umriss, mal schrumpfen sie, gehen unter, werden abgetragen oder bewegen sich wie Wanderdünen langsam, Sandkorn für Sandkorn, an verschiedene Stellen des Gedächtnisses.
Überfahrt
Das erste Mal sind wir Mitte der Siebziger nach Spiekeroog gefahren, das weiß ich sicher. Vielleicht war es aber auch schon Anfang der Siebziger. Ich weiß nicht, ob wir auf der Fähre draußen oder drinnen saßen, ich schätze aber, draußen, denn meiner Mutter wurde drinnen immer schlecht. Ihr wurde auch draußen schlecht, aber da konnte man den Horizont besser im Auge behalten, es gab frischere Luft, und falls es zum Äußersten kommen sollte, zog sie die Reling dem Schiffsklo vor. Ja, wir werden also draußen gesessen haben, wahrscheinlich werden wir gefroren haben, wie wir es immer taten, wenn wir uns oben aufs Deck setzten. Es dauerte Jahrzehnte, bis ich begriff, dass man auch in einer Dreiviertelstunde bei Sonne trotz winddichten Anoraks vollkommen durchfrieren konnte.
Ein Ort wird erst dann zur Insel, wenn man sich ihm über den Seeweg nähert. Zwar gibt es Inseln, auf die man mit dem Auto oder dem Zug gelangt. Mir aber gefällt an Spiekeroog besonders, dass das nicht geht. Autos gibt es auf dieser Insel nicht, nur Lösch- und Krankenwagen, außerdem ist sie die einzige der sieben Ostfriesischen Inseln, die keinen Flugplatz hat, oder nicht mehr.
In der Nazizeit gab es einen Flugplatz. Auf den Salzwiesen im Westen, wo jetzt die Islandpferde grasen und Falken rütteln, landeten zwischen 1934 und 1945 Kriegsflugzeuge und Bombenflieger. Davon zeugt heute nichts mehr. Einmal, da hatte ich aber schon selbst Kinder, musste ich ein widerspenstiges Islandpony durch die Wiesen führen und bildete mir ein, unter meinen Füßen würde bisweilen ein gerader Weg aufschimmern, aber vielleicht war das auch nur ein Teil der alten Inselbahntrasse, oder ein besonders akkurater Trampelpfad. Ich konnte jedoch nicht anhalten und es näher untersuchen, weil das Pony dringend nach Hause wollte.
Wenn man heute mit dem Schiff am Hafen anlegt, hat das immer etwas Festliches. Menschen stehen am Rand und singen und winken, und meistens sieht man Leute, die man kennt, weil sie auch schon immer herkommen. Die Insulaner winken natürlich nicht. Wenn ich vom Shopping nach Hause komme, winkt meine Familie ja auch nicht von Weitem, selbst wenn sie mich abholen würden, um meine Taschen zu tragen.
Früher, als das Schiff noch am Anleger im Südwesten festmachte, war das anders. Da gab es weniger Platz, es war hektisch und für kleine Kinder auch recht unübersichtlich. Wir mussten sofort in die bereitstehende Bahn steigen, möglichst in denselben Wagen wie unsere Eltern. Drinnen roch es ein bisschen nach abgestandener Eisenbahn, aber die Bänke waren nicht aus staubigem Plüsch oder klebrigem Kunstleder, sondern aus Holz, was ich hübsch fand. Trotzdem wollten mein Bruder und ich lieber draußen fahren. Jeder Waggon hatte einen kleinen Austritt, eine Art fahrenden Balkon. Man konnte sich also an die Balustrade dieses Austritts stellen und sowohl hinüber zum nächsten Wagen schauen als auch geradewegs nach unten. Denn dort, gleich unter der gewaltigen schwarzen Kupplung, lag das Meer!
Bei Flut fuhren wir ganz dicht über die unruhige Wasseroberfläche. Die Gleise standen auf Holzpfählen in der See, und nur wenige Zentimeter davon entfernt schwappten braungrüne Wellen, die bei stärkerem Wind durch die Gleise gedrückt wurden und manchmal sogar bis in den Wagen hinaufspritzten. Das war herrlich und beängstigend zugleich, selbst wenn es nur wenige Minuten dauerte, bis erst Sand und Muscheln und schließlich Queller und Gräser zwischen den Schienen sichtbar wurden.
Einmal, meine Eltern waren drinnen bei den Taschen geblieben, kamen wir von unserem Außenbalkon in den Wagen hinein und bemerkten, dass eine feine alte Dame mit weißem Haar und schwarzen Kleidern auf der Holzbank gegenüber meiner Mutter Platz genommen hatte. Sie trug eine Sonnenbrille und saß sehr aufrecht. Meine Mutter guckte ein bisschen komisch – zugleich aufgeregt und verlegen. Sie flüsterte uns zu, dass dort die Witwe von Gustav Heinemann sitze. Ich wusste nicht, wer Gustav Heinemann war, schaute mir die feine Dame trotzdem gut an, jedenfalls kann ich mich noch genau an sie erinnern – besonders aber an die Bewunderung und Anspannung meiner Mutter, die ich nicht ganz verstand, jedenfalls fanden mein Bruder und ich die Bahnfahrt durchs Meer viel spektakulärer.
Die Fahrt mit der Witwe des Altbundespräsidenten war nicht unsere erste Ankunft auf Spiekeroog. Ich weiß jedoch, dass mich auf meiner ersten Rückfahrt ein sich unentwegt küssendes Pärchen – sie waren höchstens dreizehn – die gesamte Seereise über in Bann hielt. Ich fand es aufregend, ahnte, dass das alles irgendwie verboten war, sowohl die Zungenküsse als auch das Zugucken. Der Junge war sehr blass und hatte dunkles Haar, das Mädchen war wunderhübsch. Sie lächelten sich nicht zu, sie sprachen nicht miteinander, sondern waren mit verzweifelter Hingabe – es war schließlich die Rückfahrt – ineinander vertieft.
Ich habe also keine Seehunde beobachtet, nicht die Insel, wie sie langsam verschwand, nicht die Möwen, die das Schiff begleiteten. Natürlich habe ich weder den blassen Jungen noch das Mädchen je wiedergesehen. Wahrscheinlich haben sie nicht einmal einander wiedergesehen. Sie waren damals mit einer großen Gruppe von Kindern und Jugendlichen auf dem Boot, gehörten zu jenen ferienverschickten Erholungsheimkindern, die am Strand immer unter sich blieben, als lebten sie auf einer Insel auf der Insel.
Oder sie haben sich zwar nie wieder gesehen, aber immer geschrieben, und noch heute schicken sie sich ab und zu eine Weihnachtskarte. Oder sie sind beide gestorben, er an einer Krankheit, sie bei einem tragischen Unfall, und, was aber niemandem je auffallen wird, beide am selben Tag. Oder sie leben noch heute, treffen sich jeden Sommer heimlich auf Schiffen und küssen sich durch die sieben Weltmeere.
II. REIZKLIMA
Frische Luft
Das Küssen – ich komme später noch einmal darauf zurück – ist nur eine Spielart der mannigfaltigen physischen und metaphysischen Reize Spiekeroogs. Meine Mutter erklärte uns, auf der Insel herrsche ein sogenanntes Reizklima, und noch immer kommt es mir vor, als wären hier alle Sinne immerzu in einem Zustand der besonderen Geschärftheit, würden unentwegt und alle auf einmal gereizt. Als würde das Klima unbekannte Rezeptoren freilegen, Synapsen neu verschalten, spezielle Transmitterstoffe ausschütten.
Würde man mich mit verbundenen Augen und Ohrstöpseln über Spiekeroog mit einem Fallschirm aus dem Hubschrauber werfen, könnte ich, so bilde ich mir zumindest ein, am Geruch erkennen, wo ich mich befinde: Jeder Weg auf Spiekeroog riecht anders. Der eine mehr nach Krähenbeeren, der andere mehr nach Heide, einer nach Heckenrosen, einer nach Jelängerjelieber, einer nach Pommes frites, einer nach Seetang, einer nach Schlick, einer riecht nach Harz und Nadeln, einer nach Moos und Laub, einer nach Butterzimtwaffel, einer nach Chlor, einer riecht nach modrigem Tümpel, einer nach Meer, einer nach gebratenem Fisch, einer riecht nach Strandwermut, einer riecht nach Pferd, einer nach Sonnencreme, einer nach Buttermilch und wieder ein anderer nach Schaf.
Aber auch der Soundtrack der Insel ist unverwechselbar: Am Strand ist es eine Mischung aus Möwen, Meer, Kinderstimmen, Volleyballaufschlägen, Schlagballpfiffen, Austernfischerrufen und Seeschwalbengeschrei, durchbrochen von Pferdegalopp und dem Gebimmel der Badezeitenglocke.
Am Hafen besteht er aus Möwenschreien, Schafeblöken, Elektromotorengesurr, klirrenden Segelbootmasten und, wenn ein Schiff kommt, Schiffshupen, Rufen, Abschiedsliedern, Containergerumpel.
Im Dorf wiederum hört man Möwengeschrei, Taubengurren, Menschenstimmen, Bollerwagen, Radiomusik, Spatzen und Stare. Im Watt sind es Möwen und andere Wasservögel, und wenn es still und neblig ist, dann kann man vernehmen, wie das Watt schlürft und schmatzt, wie sich Muscheln knackend schließen, wie kleine Luftblasen platzen, weil im Schlick irgendetwas atmet oder verwest.
Im Osten hört man das Windrad, im Westen den Wind.
Das Reizklima besteht wie jedes Klima zu einem nicht geringen Anteil aus Wetter.
Alle Urlauber stehen früher oder später bangend vor den Aushängen mit der Drei-Tage-Wettervorhersage und seufzen oder jauchzen. Nicht dass es hier besonders kalt oder besonders heiß würde, aber das Wetter ist ein wichtiger, nie enden wollender Gesprächsstoff, nicht zuletzt, weil dein Haus mindestens einen Kilometer vom Strand entfernt liegt und du es dir sehr gut überlegen musst, ob du beim Anblick einer dunklen Wolke packst und heimrennst oder lieber den Strandkorb in eine wasserdichte Festung umbaust und sitzen bleibst.
Meistens verzocke ich mich dabei.
Wenn sich der Himmel verdunkelt, bleibe ich zunächst ruhig im Strandkorb und blicke mitleidig auf die Schar der geduckten Kurgäste, die eilig ihre Bollerwagen den Holzweg hinaufzerren. »Anfänger«, denke ich selbstzufrieden, oder »Tagesgäste«. Mit lässiger Gebärde lege ich ein paar imprägnierte Decken über unsere Rucksäcke. Doch sobald die ersten Sturmböen am Strandkorb rütteln, stelle ich mir vor, jetzt für Stunden hier unten festzusitzen, statt zu Hause Tee zu trinken und Kekse zu essen, und plötzlich kann ich mir nichts Schöneres denken als Tee und Kekse, also packe ich panisch alles zusammen, rufe die Kinder und zwinge sie, sofort aufzubrechen. »Warum sind wir denn nicht schon vor einer Viertelstunde losgegangen, dann hätten wir jetzt nicht diese Hektik?«, fragen sie genervt. Ich versuche, etwas möglichst Passiv-Aggressives zu erwidern, das bei ihnen maximale Schuldgefühle auslöst und sie zum Verstummen bringt, und schreite sodann beherzt voran. Doch kaum sind wir an der Strandhalle vorbei, wo wir uns noch hätten unterstellen können, gibt es einen Wolkenbruch.
Nirgends bin ich so oft so klatschnass geworden wie auf Spiekeroog. Ich war hier schon so nass, dass der Regen in meinen Schuhen nicht mehr bloß schmatzende, sondern tatsächlich gluckernde Geräusche machte. Ich habe beim Auswringen von durchgeregneter Wäsche schon Waschbecken gefüllt. Und weil der Regen selten ohne Wind und der Wind selten ohne Salzwasser daherkommt, werden die Sachen auch nie wieder trocken.
Wenn die Regenwolken sich auf dem Festland oder über dem Meer abregnen, bilden sich dunkle Schleier als Verbindungsströme zwischen Himmel und Meer. Tatsächlich kommt es mir manchmal so vor, als wäre die Grenze zwischen dem Wasser oben und dem Wasser unten verwischt. Manchmal fällt der Regen so dicht, dass zwischen den Tropfen keine Luft mehr zu sein scheint. Regenbogen tauchen unvermittelt auf, oft doppelte, dreifache, und verschwinden schnell wieder. Von den Bäumen regnet es noch eine ganze Weile, nachdem der Himmel wieder klar ist. Und obwohl der Sand am Tag schnell trocknet, hängt der Nachttau noch lange in den Dünen.
Als Kinder waren wir dem Wetter besonders ausgeliefert, erstens, weil es keine Regen-App gab, und zweitens, weil meine Mutter es wichtig fand, dass wir uns viel an der frischen Luft aufhielten. Dabei litt sie von uns allen am meisten unter den Elementen: Nur auf Spiekeroog haben die Hände meiner Mutter vor Kälte so gezittert, dass ihr rosa Kirschjoghurt links und rechts über den Becherrand in den Strandkorb schwappte. Und auch mir war bei minus vierzig Grad in Kanada deutlich wärmer als bei null Grad am Hafen von Spiekeroog, wo wir vor ein paar Jahren im Januar zwei Stunden auf die Fähre warteten, die sich den Weg durch das angefrorene Wasser bahnen musste.
Doch wenn es warm ist auf der Insel, dann möchte man nirgendwo anders sein als eben genau hier. (Wenn es kalt ist, aber eigentlich auch nicht. Bloß bei Eissturm muss man vielleicht nicht unbedingt am Hafen stehen.)
Ist es sehr heiß, kann der Weg zum Strand mit dem ganzen Gepäck mühsam sein. Dort angekommen, verkriechen sich alle in den Schatten hinterm Strandkorb. Sitzt man aber zu lange im Schatten, wird einem wieder kalt: »Guckt, mir sterben die Finger ab«, sagte meine Mutter mehrmals in der Woche, hielt ihre großen Hände hoch, und wir sahen, dass die Finger von den Kuppen her weiß geworden waren. Meine Mutter sagte »s-terben« mit einem stimmlosen s vorne, weil sie aus Norddeutschland kam. Wir fanden ihre abgestorbenen Finger erschreckend, fürchteten, dass, sobald das Weiße ihr Herz berührte, sie auf der Stelle tot umfallen würde. Aber meine Mutter lachte und sagte, sie müsse sich nur ein bisschen bewegen. Sie erhob sich langsam, schlenderte ein paar Meter vom Strandkorb weg und rannte davon. Sie rannte oft. Mal nach Westen, mal nach Osten. Wenn sie zurückkam, war sie wieder warm, legte sich in die Sonne und las ihr Buch. Nach Hause gehen stand nicht zur Wahl.
Wind
Auf Spiekeroog weht immer Wind, selbst bei Windstille. Spätestens unten am Strand wird es frisch, meistens kühlt mir aber schon hinter der vorletzten Düne auf dem Weg dorthin die erste Brise die Stirn. Wenn es nicht windstill ist, sieht man Möwen, die fliegen, ohne von der Stelle zu kommen. Die Seevögel sammeln sich auf den Sandbänken und stellen sich mit dem Gesicht in die Windrichtung. Vielleicht auch, weil sich ihre Federn sonst mit einem Knacks, den ich mir genau vorstellen kann, umstülpen würden, wegknicken wie die Speichen eines Regenschirms, den man auf der Insel genau aus diesem Grund nur selten benutzt. Bei Sturm heult der Wind um die Ecken der Häuser, rüttelt an den Masten der Segelschiffe im Hafen, sodass ihr aufgeregtes Klirren bis ins Dorf getragen wird.
Als wir klein waren, konnten wir uns schon bei starkem Wind, der aber noch kein Sturm war, kaum aufrecht halten. Mit ausgebreiteten Armen legten wir uns in den Gegenwind und wurden getragen. So mussten sich Vögel fühlen, kurz vor dem Losfliegen. Doch Wind kommt leider in Böen, und so fielen wir immer wieder zurück auf die Erde.
In den letzten Jahren habe ich ab und zu Windhosen und Wasserhosen auf dem Meer gesehen, Staubteufel über den Dünen und andere tornadoartige Lufterscheinungen. Doch jedes Mal lösten sie sich rasch wieder auf. Manchmal kam es mir vor, als hätte ich sie nur geträumt, aber sie waren wirklich da. Der Wind auf Spiekeroog bläst Volleybälle ins Meer und Kaffeebecher in den Sand. Er wirft Strandkörbe durch die Gegend. Er bricht Vögeln den Hals, schubst Häuser ins Meer, lässt Dünen wandern.
Und auf dem Zeltplatz fliegen Zelte mit schlafenden Kindern durch die Luft. Wahre Geschichte.
Den Film Vom Winde verweht sah ich bezeichnenderweise auf Spiekeroog zum ersten Mal. Meine Mutter, die Filme liebte, aber manchmal ein schlechtes Gewissen hatte, wenn sie allein ins Kino ging, überredete mich, mit ihr diesen alten Film anzuschauen. Sie schwärmte so sehr davon, dass ich es kaum erwarten konnte. Damals war die Sporthalle noch nicht abgebrannt. An zwei oder drei Abenden pro Woche wurde sie mit Stühlen versehen und zum Kino umfunktioniert. Bevor es die Turnhalle gab, ging man zum Filmegucken in den Kursaal, und nach dem Brand auch. Aber meine Spiekerooger Kinozeit fand vor allem in der Turnhalle statt. Die Filme kamen in großen Rollen mit dem Schiff, und manchmal entdeckten wir sie in ihrem Behälter, sodass wir schon auf der Fähre lesen konnten, welche Filme gezeigt werden würden. Meine Mutter fand, mit dreizehn sei ich bereit für die großen Gefühle von Doktor Schiwago und Vom Winde verweht