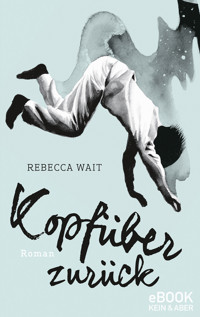19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder und psychologisch packender Roman über komplexe Familienverhältnisse und die Tücken von Geschwisterbeziehungen. Als Erwachsene müssen die Schwestern Alice und Hanna mit vielem fertigwerden – nicht nur mit Enttäuschungen in der Arbeit und in der Liebe, sondern auch mit immer komplizierteren Spannungen und Unausgesprochenem in der Familie. Ihr Leben sieht dem, das sie sich immer vorgestellt hatten, erschreckend unähnlich. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, ihre zerrüttete Beziehung zueinander zu reparieren und einen Weg zu finden, mit ihrer dominanten Mutter umzugehen. Sie müssen herausfinden, ob das Leben wirklich mehr ist als eine Tragödie mit ein paar lustigen Momenten – wie Hanna es ausdrücken würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Rebecca Wait, 1988 geboren, verbrachte als Kind viel Zeit in den schottischen Highlands und auf den Hebriden. 2010 schloss sie ihr Englischstudium an der Oxford University ab, heute ist sie Lehrerin in London. Sie hat zahlreiche Preise für ihre Kurzgeschichten und Theaterstücke gewonnen. Ihre Romane Kopfüber zurück und Das Vermächtnis unsrer Väter erschienen bei Kein & Aber.
ÜBER DAS BUCH
Für Alice und Hanna, Heilige und Sünderin, ist das Erwachsenwerden eine Prüfung. Zumal sie sich auch nicht gegenseitig beistehen, denn die Zwillingsschwestern könnten unterschiedlicher nicht sein. Die viel zu dominante Mutter, der meist abwesende Vater und der älterer Bruder Michael, mit dessen Missbilligung man stets rechnen muss, machen die Sache auch nicht einfacher. Und dann ist da noch die Katastrophe in der Familiengeschichte, über die nie gesprochen wird, die aber vieles geprägt hat. Als etwas Unerwartetes mit Hanna geschieht und alte Wunden aufbrechen, müssen die beiden Schwestern nach einem Weg suchen, ihre eigene zerrüttete Beziehung zu verbessern - und vielleicht sogar je ihr eigenes Glück zu finden?
Ein fesselnder, witziger und psychologisch packender Roman über komplexe Familienverhältnisse, die Tücken von Geschwisterbeziehungen und weibliche Gefühlswelten.
Für Chris und Iris
1
2018
Alles in allem gehen sie 2018gern auf Beerdigungen. Michael hat einen Sinn fürs Zeremonielle, Hanna erfreut sich am Drama, und Alice mag es, wenn Menschen dafür zusammenkommen. Ihrer Mutter geben Beerdigungen ein Gefühl des Triumphes.
Heute ist Alice früh dran und wartet am Eingang des Krematoriums auf die Gäste. Das ist ihre Rolle im Leben – früh dran sein, genauso wie es Hannas ist, zu spät zu kommen (oder gar nicht erst aufzutauchen, oder genau dann, wenn sie nicht sollte).
»Es wäre netter, wenn du draußen warten würdest«, sagt ihre Mutter.
»Aber es regnet.«
»Wir sind hier bei einer Beerdigung, Alice«, erwidert ihre Mutter, als müsste sie sich deswegen nass regnen lassen.
Aber da ihre Mutter keine Anstalten gemacht hat, mit ihr im Regen zu warten, und außerdem sowieso verschwunden ist, bleibt Alice im überheizten Eingangsbereich stehen, in dem es nach Desinfektionsmittel und feuchter Wolle und etwas anderem, unbestimmt Durchdringlichem riecht. Alice hofft inständig, dass es nicht der Geruch des Todes ist.
Sie hat ihrer Mutter bei den Vorbereitungen geholfen, so lautet zumindest die offizielle Version. In Wirklichkeit hat sie das meiste allein erledigt, Bestattungsunternehmen kontaktiert, gemeinsam mit dem Redner den Ablauf der Trauerfeier geplant (komisch, dass man unter diesen Umständen von einer Feier spricht, denkt Alice) und die Räumlichkeiten des nahe gelegenen Working Men’s Clubs für den anschließenden Trauerkaffee reserviert. Die Auswahl des Büfetts hat ihr am meisten Kopfzerbrechen bereitet, da sie nicht einschätzen konnte, wie viele Gäste kommen würden. Vor ein paar Wochen hatte sie einen ganzen Samstag lang im alten Haus die Unterlagen ihrer Tante durchgesehen und ein paar Adressen gefunden (manche davon ohne Namen), an die sie Trauerkarten verschickte. Außerdem entdeckte sie einige Telefonnummern und hinterließ Nachrichten, unterhielt sich mit einem sehr netten Mann, der behauptete, ihrer Tante nie begegnet zu sein, und einer weniger netten Frau, die sie erst anraunzte und dann abrupt auflegte. Ein paar Nachbarn ihrer Tante haben zugesagt, ältere Herrschaften, die schon lange vor dem Tod ihrer Großeltern in der Straße wohnten.
Der Sarg ihrer Tante steht bereits vorne in der Kapelle. Alices Mutter war dagegen, ihn feierlich hereintragen zu lassen. »Das ist ein unnötiger Aufriss«, meinte sie. »Was ist, wenn sie den Sarg fallen lassen?«
»Sie lassen ihn bestimmt nicht fallen«, erwiderte Alice.
»Sei dir da mal nicht so sicher. Richtig leicht war deine Tante nicht.«
Alice, immer bemüht, ihre Tante zu lieben, geht nicht weiter auf den Kommentar ein.
Die ersten Autos rollen auf den Parkplatz. Durch das regennasse Türfenster beobachtet Alice die Leute beim Aussteigen und spürt, wie ihr stellvertretend das Herz in die Hose rutscht – ihr altes Ankunftsproblem. Wenn sie als Kind zum Spielen (oder noch schlimmer, zu einer Feier) zu einer Freundin oder zu ihren Großeltern gebracht wurde, wuchs die Nervosität jedes Mal kribbelnd und unerbittlich an, und wenn der Motor abgestellt wurde, sackte ihr der Magen in die Kniekehlen (Hanna dagegen schritt munter voran und drehte sich kein einziges Mal um). Die Verabredung an sich verlief dann meistens problemlos, machte manchmal sogar Spaß. Die Kluft zwischen Abwesenheit und Anwesenheit bei einer sozialen Verpflichtung ist Alice schon immer massiv erschienen, muss jedoch irgendwie innerhalb weniger Sekunden überwunden werden.
Alice entdeckt unter den Ankömmlingen keine Spur von Hanna. Sie zieht die schwere Holztür auf und begrüßt zwei ältere Damen, Nachbarinnen ihrer Tante. Mrs Linden und Mrs Jackson, die Namen fallen ihr gerade noch rechtzeitig ein. Sie tauschen sich kurz über das schlechte Wetter aus, dann wendet sich Alice dem Mann zu, der nach den beiden hereingekommen ist. Er ist sehr dünn, hat sich das schüttere Haar über den Kopf gekämmt und trägt eine hellbraune, mit Regentropfen gesprenkelte Wildlederweste.
»Ich war ein naher Freund von ihr«, sagt er und schüttelt Alice die Hand. Er betont das Wort »nah« auf leicht verstörende Weise.
»Wie schön«, erwidert sie. »Woher kannten Sie sich?«
Er schaut sich kurz um, als könnte sie jemand belauschen. »Von hier und dort.«
Diese Antwort scheint nicht auf Nachfragen ausgelegt. »Kannten Sie sich lange?«, versucht es Alice stattdessen.
»Na ja. Wie man es nimmt.«
Die Unterhaltung fällt Alice zunehmend schwer, doch zu ihrer Erleichterung tritt eine ihr unbekannte, ausladende Frau in einem dunkelblauen Glitzerblazer durch die Tür und ergreift ihre Hand. »Grüß dich, meine Liebe!«
»Hallo. Danke, dass Sie gekommen sind.«
»Aber natürlich. Schön, dich nach so langer Zeit endlich mal wiederzusehen.«
Das bereitet Alice Sorgen, da ihr die Frau nicht bekannt vorkommt. Sie starrt sie allerdings derart erwartungsvoll an, dass Alice sie nicht enttäuschen möchte, also erwidert sie schwach: »Ja, und wie. So nett, dass wir uns mal wiedersehen.«
»Wenn auch aus einem traurigen Anlass«, sagt die Frau.
Alice stimmt zu. Mrs Linden und Mrs Jackson sind inzwischen ein Stück weitergegangen, doch der nahe Freund steht immer noch neben ihr. Hoffentlich möchte er nicht vorgestellt werden. Plötzlich wird ihr klar, dass sie auch seinen Namen nicht kennt.
Sie wagt sich auf der Suche nach hilfreichen Informationen noch einmal an die Frau heran. »Wie war die Anreise?«
»Sehr leicht, Liebes«, antwortet die Frau. »Du weißt doch, dass wir direkt um die Ecke wohnen.« Eine Nachbarin, denkt Alice triumphierend.
Dann lächelt die Frau. »Schon komisch, wie ähnlich du ihm siehst. Ach, er wird uns wirklich fehlen.«
Langsam dämmert es Alice, dass hier ein Missverständnis vorliegt, doch sie weiß nicht, wie sie es am besten ansprechen soll.
»Fast schon unheimlich.« Die Frau mustert sie genauer. »Als stünde er vor mir. Du hast seine Augen. Und seine berühmte Nase! Sogar den gleichen Unterkiefer.«
Der Vergleich kommt Alice nicht gerade schmeichelhaft vor, und sie setzt an: »Wissen Sie, ich glaube –«
Doch die Frau unterbricht sie. »Ich gehe dann mal lieber Marjorie suchen. Sie hat mir geschrieben, dass sie mir einen Platz freihält, und du kennst sie ja.«
Alice bleibt mit dem westentragenden Freund ihrer Tante zurück. Die Demütigung ist umso schmerzhafter, da sie vor Zeugen geschah, und sie sucht nach einem beiläufig amüsierten Kommentar, mit dem sie die Situation abtun kann, doch der Mann kommt ihr zuvor. »Nette Dame. Wenn Sie nichts dagegen haben, suche ich mir dann auch mal einen Platz.«
Alice sieht ihm hinterher. Sie ist in eine Spirale aus Selbstvorwürfen gestürzt und verbringt die nächsten Minuten damit, das Gespräch mit der Dame im Blazer geistig zu rekonstruieren, um zu bestimmen, was sie anders hätte machen sollen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die peinliche Begegnung sie in Zukunft nachts heimsuchen wird.
Sie spürt jetzt, dass ihr zu warm ist, Schweiß sammelt sich in ihren Achselhöhlen und verdunkelt den dichten Stoff ihres Kleides. Das Kleid war ein Fehlkauf, Folge einer panischen Onlineaktion vor ein paar Tagen. Auf der Webseite hatte es elegant gewirkt, aber als Alice sich am Morgen im Spiegel betrachtete, sah es aus, als wäre sie in einen dunklen Sack gehüllt, eine Art mittelalterliches Büßergewand. Gleichzeitig ist der voluminöse Stoff unter den Armen zu eng, saugt ihren Schweiß auf und schränkt gleichzeitig den Bewegungsradius ihrer Arme ein.
Diese Anhäufung kleinerer Katastrophen nimmt sie derart in Anspruch, dass sie überhaupt nicht bemerkt, wie Hanna plötzlich hinter ihr auftaucht.
»Ich bin durch die andere Tür gekommen«, sagt Hanna, als Alice sich umdreht und sie entdeckt. »Wusstest du, dass da hinten noch eine Kapelle ist? Ich wäre beinahe auf der falschen Beerdigung gelandet.« Sie senkt die Stimme. »Und? Wo ist sie?«
»Vorne im Sarg. Wurde schon reingebracht.«
Hanna lacht auf. »Ich meinte unsere Mutter. Mach mir mal keine falschen Hoffnungen.«
»Weiß ich nicht. Wir sind zusammen gekommen, aber seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen.«
»Wie ist sie heute drauf?«
»Ziemlich fröhlich.«
»Na toll.«
Alice steckt die Hände in die Taschen und umklammert die am Morgen strategisch platzierten Taschentücher. »War deine Anreise in Ordnung?«
»Ja. Lang eben.«
Beide schweigen.
Dann sagt Hanna: »Wusstest du, dass das hier unsere neunte Beerdigung ist? Für unsere Familie, meine ich.«
»Unmöglich.«
»Doch. Hör zu. Zwei Paar Großeltern. Großtante May. Die alte Mrs Mulligan von gegenüber, die uns nicht leiden konnte. Im Jahr darauf dann Mr Mulligan, weil wir auf der Beerdigung seiner Frau so gut ankamen.«
Alice nennt die letzte, damit Hanna es nicht tun muss. »Dad.«
»Siehst du?«, meint Hanna. »Ganz schön beachtlich. Bald kommen die Leute noch auf Ideen.«
Da entdeckt sie ihre Mutter, die gerade aus den Toiletten kommt.
»Bis später.« Sie verschwindet den Flur hinab.
»Bis dann«, sagt Alice.
Das war ihr erstes Gespräch seit vier Jahren.
Michael trifft als Letzter ein und tritt mit der Gravität eines Mannes durch den Haupteingang, der bedauerlicherweise durch wichtige Dinge aufgehalten wurde. Die meisten Gäste sitzen bereits in der Kapelle, nur Alice wartet noch auf Nachzügler. Insgesamt sind vier ältere Gäste aus der Nachbarschaft von Alices Tante aufgetaucht, die sie schon als Kind kannten, und vier aus ihrem Freundeskreis. Ein weiterer Mann und zwei Frauen (abzüglich der Dame im Blazer, die vermutlich den Weg in die richtige Kapelle gefunden hat). Sie scheinen einander nicht zu kennen. Wenn man Alice, ihre Mutter, Michael und Hanna mitzählt, kommt man insgesamt auf zwölf Trauergäste, und Alice wird klar, dass sie auf reichlich Sandwiches sitzen bleiben wird. Auch mit dem Wein hat sie es übertrieben; sie selbst trinkt nur selten und konnte schwer einschätzen, wie viel die anderen Gäste trinken würden. Außerdem hatte sie eine Riesenangst davor, jemand müsste auf dem Trockenen sitzen.
»Hanna ist da«, sagt sie, als Michael ihr einen Kuss auf die Wange gibt. In seinem dunklen Anzug wirkt er sehr elegant. Er ist zwar erst sechsunddreißig, ergraut aber schon an den Schläfen. Steht ihm gut, findet Alice.
»Ja.« Michael zuckt mit den Schultern. »Hat sie ja auch angekündigt.« Offensichtlich möchte er ihrer Schwester keine Zugeständnisse machen.
Anscheinend ist er allein gekommen, aber Alice hütet sich davor, ihn darauf anzusprechen. Wahrscheinlich ist es sowieso besser, dass seine Frau nicht dabei ist; am Ende würde sie sich noch wehklagend ins Grab werfen, ganz egal, ob sie die Verstorbene gekannt hatte oder nicht. Wobei es heute natürlich kein Grab gibt. Ob wohl schon mal jemand versucht hat, sich bei einer Einäscherung in den Ofen zu stürzen? Das würde sich wahrscheinlich eher schwierig gestalten, da man erst mal durch den Metalltunnel kriechen müsste. Sie unterbricht den Gedankengang, da er ihrer Schwägerin gegenüber unhöflich und gleichzeitig unpassend für eine Trauerfeier ist.
»Acht Leute sind da«, sagt sie zu Michael, um das Schweigen zu beenden. »Außer uns. Schön, dass so viele kommen wollten, oder?«
»Auch wenn ich nicht verstehe, weshalb.«
»Aber ich fürchte, ich habe zu viel Wein besorgt.«
»Wie viel hast du denn?«
»Vierundzwanzig Flaschen.«
»Um Gottes willen, Alice. Das hier ist eine Einäscherung, keine Orgie.«
»Ich weiß«, erwidert Alice kleinlaut. Michael hält sie schon lange für leichtsinnig, dabei kann sie sich diesen Ruf nicht im Ansatz erklären. Eigentlich gilt sie eher als zu ernst. Oft befürchtet sie, sie könnte eine Langweilerin sein.
»Wo ist Mum?«
»Erste Reihe. Wirkte ganz gut gelaunt.«
»Das wage ich zu bezweifeln«, erwidert Michael. »Immerhin sind wir bei einer Einäscherung.«
»Klar«, sagt Alice. »In Anbetracht der Umstände, meinte ich.« Sie hofft, sie klingt angemessen ernst. »Deine Anwesenheit ist ihr sicher ein großer Trost.«
Michael nickt. »Ich geh besser mal rein.« Er schaut auf die Uhr. »In sieben Minuten geht es los. Du kommst doch rechtzeitig dazu, oder?«
»Ich komme mit dir.«
»Gut.« Er schaut sie kurz an. »Ist das Kleid neu?«
»Ja«, antwortet Alice trotzig.
»Sieht schön aus. Ich bin ja kein Fan von diesem modernen Trend, auf Beerdigungen kein Schwarz zu tragen.«
Alice stimmt ihm zu, streicht sich über das Sackkleid und erfreut sich innerlich an seinem positiven Urteil.
Da kommt die Dame im dunkelblauen Blazer aus den Toiletten. Sie winkt Alice zu. »Bis gleich, Jeanie.«
»Alice?«, fragt Michael streng. »Hast du dir etwa einen neuen Spitznamen zugelegt?«
Nach der Trauerfeier ergießen sie sich in den schwachen Sonnenschein, dem der Regen Platz gemacht hat, und Alice sieht sich nach Hanna um, die während der Feier nicht bei ihnen, sondern in einer hinteren Reihe gesessen hat. Soweit Alice das überblicken kann, hat sie bislang weder mit ihrer Mutter noch mit Michael gesprochen. Jetzt macht Alice sich – womöglich unbegründete – Sorgen, dass ihre Schwester sich bereits davongemacht, sich ihnen erneut entzogen hat. Doch da entdeckt sie Hanna abseits der verstreuten Grüppchen. Alice wischt sich rasch über das Gesicht, um die Tränenspuren zu beseitigen.
Sie berührt Hanna am Arm. Sagt schüchtern: »Hallo.«
»Hi.« Hanna dreht sich zu ihr und verschränkt die Arme vor der Brust. »Nette Trauerfeier, oder?«
»Ja.«
»Hätte ihr bestimmt gefallen.« Dann korrigiert sie sich. »Wobei, ich habe keine Ahnung, was ihr gefallen hätte.«
Still denken sie an ihre Tante.
»Weißt du noch, als sie dich mit einem Messer bedroht hat?«, fragt Hanna.
»Ja«, erwidert Alice. »Ich kann mich lebhaft daran erinnern.«
»Ich war immer neidisch, dass das nicht mir passiert ist.«
»Bist du mit dem Auto da, oder sollen wir dich mitnehmen? Mum und ich fahren gleich vor, um alles fertig zu machen.«
»Danke, ich fahr bei Michael mit.«
Das macht Alice traurig. Wenn es eine tröstliche Konstante in ihrem Leben gegeben hatte, dann das Wissen, dass Hanna sie Michael vorzog, wenn auch nur geringfügig. Aber sie musste ja alles kaputt machen.
»Du bist in Jeans aufgekreuzt?«, hört sie Michael fragen.
Woraufhin Hanna erwidert: »Der Schein trügt. Ich trage ganz offensichtlich eine zeremonielle schwarze Robe. Kannst du mich zum Schmaus mitnehmen?«
Alice geht ihre Mutter suchen.
Ihre Mutter hält das Lenkrad fest umklammert. »Natürlich konnte deine Schwester mich nicht begrüßen. Natürlich wäre das zu viel verlangt.«
Alice betrachtet den Vorort, der grau am Fenster vorbeizieht. Zum Glück dauert die Fahrt zum Working Men’s Club nicht lange. Das Auto kommt ihr eng und stickig vor, obwohl sie nur zu zweit sind. »Ist vielleicht nicht ganz so einfach auf einer Beerdigung, oder? Sie war sich wahrscheinlich unsicher.« Sie versucht, sich Hanna als unsicher vorzustellen. Unmöglich.
»Tut gerade so, als würde sie mich nicht kennen. Setzt sich in die letzte Reihe wie eine Fremde.«
Alice merkt, dass ihre Mutter sich in Rage redet. »Wahrscheinlich braucht sie einfach noch ein bisschen Zeit«, sagt sie zaghaft.
»Zeit? Sie hatte doch schon genug Zeit. Das ist mal wieder typisch.«
War es wirklich typisch? Alice ist sich nicht sicher. Ihr scheint, sie kennen sich in ihrer Familie nicht richtig gut. Jahrelang haben sie zusammen in einem Haus gewohnt und sich trotzdem nie kennengelernt. Stattdessen haben sie die Geschichten, die sie voneinander erzählen.
Im Working Men’s Club angekommen, inspiziert ihre Mutter den Veranstaltungsraum, während Alice in die Küche geht, wo der Caterer gerade alles vorbereitet.
»Ah«, sagt er wie zu einer alten Freundin. Sie haben zwei Mal miteinander telefoniert. »Sie sind bestimmt Alice.«
Alice lächelt ihn dankbar an. »Sieht lecker aus.« Sie deutet auf die Sandwichplatten.
»Das sind bloß ganz einfache Sandwiches, Liebes. Kaffee und Tee habe ich schon nebenan aufgebaut.«
Für einen Trauerkaffee ist er seltsam vergnügt, was Alice ihm hoch anrechnet. Auf der Webseite ist sein Name als James angegeben, doch sie soll ihn Jimmy nennen, das findet sie rührend, macht sie aber gleichzeitig so befangen, dass sie ihn gar nicht erst mit Namen anredet.
Sie beschäftigt sich, indem sie mehrmals zum Auto geht, um Wein und Orangensaft hereinzuholen, während Jimmy die Platten zusammen mit Gläsern, Geschirr und Servietten in den Veranstaltungsraum bringt.
Ihre Mutter betritt die Küche. Sie mustert die Weinkisten auf der Arbeitsfläche. »Warum um alles in der Welt hast du so viel Wein gekauft?«
»Ich habe mich verschätzt.«
»Stell das bloß nicht alles raus.« Sie verschwindet wieder.
Jimmy, der das Ende dieses Austauschs gerade noch mitbekommen hat, zwinkert ihr zu. »Alkohol kann man nie genug haben«, sagt er. »Merken Sie sich das fürs Leben. Brauchen Sie sonst noch etwas?«
»Nein, vielen Dank«, erwidert Alice. »Sie waren eine Riesenhilfe.«
»Alles klar. Na dann, viel Glück.«
Er huscht geschäftig davon, und Alice kommt sich leicht beraubt vor, als hätte sie ihren einzigen Komplizen verloren.
Aber wo sind Hanna und Michael?
Die anderen Gäste treffen nach und nach ein, und Alice begrüßt sie am Eingang und weist den Weg zum Veranstaltungsraum, wo ihre Mutter mit monarchinnenhafter Feierlichkeit auf sie wartet. Die Nachbarinnen und Nachbarn kommen paarweise an, die vier Freundinnen und Freunde ihrer Tante separat in kurzer Folge, wobei sie leicht verstohlen wirken. Doch von Hanna oder Michael ist keine Spur, und langsam wird Alice nervös. Sie bleibt noch kurz an der Tür stehen, dann kehrt sie ebenfalls in den Veranstaltungsraum zurück.
Die Gäste haben kleine Grüppchen gebildet. Der nahe Freund in der Weste unterhält sich mit einer anderen Freundin ihrer Tante, einer Frau mit rotem Lippenstift, die sich als Nicky vorgestellt hat. Der andere Freund ihrer Tante, Harry oder Henry (beide Namen waren unter den Trauerkartenempfängern gewesen, und obwohl er sich ihr vorgestellt hat, kann sie sich nicht mehr genau erinnern), ist nirgends zu sehen, und die letzte Freundin steht allein mit einem Glas Weißwein in einer Ecke, also gesellt Alice sich zu ihr.
Bei der Begrüßung am Krematorium hatte sie ihren Namen nicht genannt, und Alice kam nicht dazu, sich danach zu erkundigen. Sie ist ungefähr so alt wie ihre Mutter, Anfang sechzig vielleicht. Sie hat ein ziemlich strenges Gesicht, aber dafür kann sie ja nichts.
»Wie kommen Sie zurecht?«, fragt Alice.
»Womit?«, fragt die Frau ungeduldig.
Alice kommt sich dämlich vor. »Mit der Beerdigung.«
»Hab schon schlimmere gesehen.«
Die Frau nippt in der darauffolgenden Stille an ihrem Wein, und Alice wünscht ganz entgegen ihrer Natur, sie hätte selbst ein Glas in der Hand.
»Woher kannten Sie meine Tante?«, versucht sie es.
»Figürliches Zeichnen.«
»Ach ja?«, sagt Alice. »Wie interessant. Ich wusste gar nicht, dass meine Tante einen Zeichenkurs belegt hat.«
»Sie hat Modell gestanden.«
»Oh.«
»Sie werden da doch jetzt nicht prüde, oder?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Ist ein netter Nebenverdienst.«
»Glaube ich gern.«
»Ist ja wohl keine Sexarbeit, oder?«
»Nein«, erwidert Alice. »Natürlich nicht.« Und dann, um nicht als prüde abgestempelt zu werden, fügt sie hinzu: »Nicht, dass Sexarbeit verwerflich wäre.«
Darauf folgt eine längere Stille. Alice kann sich nicht erklären, wie sie innerhalb von einer Minute an diesen Punkt gelangt sind.
»Haben Sie Kinder?«, fragt die Frau plötzlich.
Alice schüttelt den Kopf. »Nein.«
»Verheiratet?«
»Nein.«
»Wie alt sind Sie denn?«
»Zweiunddreißig.« Alice kommt sich vor wie bei einem Verhör.
»Zweiunddreißig? Mein Gott, was würde ich nicht geben, um noch mal zweiunddreißig zu sein.« Sie betrachtet Alice. »Na dann. Genießen Sie es, solange Sie noch können.«
Sie klingt schwermütig, und Alice würde ihr am liebsten erklären, dass sie keiner von diesen Menschen ist, die denken, sie würden nie altern. Alice kann sich das bestens vorstellen. Neben dem Kind, das in ihr wohnt, verängstigt und verloren, lebt dort ihr älteres Ich und dringt mit jedem Tag ein bisschen näher an die Oberfläche. Jedenfalls ist es nicht so, als hätte sie einen Nutzen von ihrer Jugend. Ob dieses Wissen für die Frau wohl tröstlich wäre?
»Warten Sie trotzdem lieber nicht, bis es zu spät ist«, rät sie nun. »Ihre Generation denkt immer, sie könnte alles haben, aber dann wachen Sie eines Tages auf und sind alt, und es ist zu spät.«
Alice nickt. Sie wird immer nervöser wegen Hanna, und erneut wirft sie einen Blick in die Runde.
»Was ist, langweile ich Sie etwa?«
»Nein.« Alice ist von ihrem feindseligen Ton erschrocken. »Nein, ich suche bloß nach meiner Schwester. Sie sollte eigentlich hier sein, aber anscheinend hat sie es noch nicht geschafft.«
»Hat sich aus dem Staub gemacht, wie?« Der Frau scheint diese Idee zu gefallen.
»Hoffentlich nicht.« Ihr kommt ein neuer Gedanke: Hatten Hanna und Michael womöglich einen Autounfall?
In der Nähe bricht lautes Gelächter aus, und Alice und die Frau sehen sich reflexartig danach um: Es stammt vom Westenmann, der sich anscheinend bestens mit der Frau namens Nicky versteht. Er füllt ihnen am Getränketisch die Weingläser.
»Flirten auf einer Beerdigung«, bemerkt Alices Gesprächspartnerin. »Peinlicher geht es nicht mehr.«
Alice entdeckt den fehlenden zweiten Mann, Harry-oder-Henry, wie er gerade von den Toiletten zurückkommt, und fängt ihn einigermaßen verzweifelt ab.
»Kennen Sie sich?«, fragt sie. »Ich glaube, Sie waren beide mit meiner Tante befreundet.«
»Lydia«, stellt die Frau sich vor, ohne die Hand anzubieten.
»Hugh«, erwidert er.
Hugh ist Ende sechzig, wirkt sanft und schüchtern. Alice lässt die beiden mit schlechtem Gewissen allein. Wahrscheinlich ist er Lydia nicht gewachsen, aber lange kann sie sich darüber nicht sorgen, denn sie entdeckt Michael, der am anderen Ende des Raums mit ihrer Mutter spricht. Hanna ist nicht dabei.
Alice geht auf sie zu, doch bevor sie sich nach Hanna erkundigen kann, sagt Michael: »Alice, wusstest du, dass die vegetarischen Sandwiches auf der gleichen Platte liegen wie die mit Fleisch?«
»Oje«, sagt Alice. »Na ja, solange die Leute darauf achten, was sie sich in den Mund stecken, sollte es kein Problem sein.«
»Und wusstest du nicht, dass alles nach Ei schmeckt, wenn man die Eiersandwiches direkt neben die anderen legt?«
»Aber du magst Eiersandwiches doch«, entgegnet Alice. »Du hast eins in der Hand.«
»Darum geht es nicht. Schinkensandwiches mag ich auch gerne, aber nur, wenn sie nach Schinken schmecken und nicht nach Ei.«
»Vielleicht lege ich die mit Ei dann einfach auf eine andere Platte.«
»Dafür ist es jetzt auch zu spät.«
»Wo ist Hanna?«
»Woher soll ich das wissen?«, gibt er genervt zurück. »Bin ich etwa ihr Babysitter?«
»Ihr seid doch zusammen hergefahren, oder?«, fragt Alice nervös.
»Ach so, ja. Aber sie wollte erst noch ›ihren Kopf auslüften‹, seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen.«
In seinem trockenen Tonfall klingt es, als wollte er Hanna irgendwelche Schandtaten unterstellen.
»Mir geht es übrigens gut«, schaltet sich ihre Mutter ein. »Danke der Nachfrage.«
»Tut mir leid, Mum«, sagt Alice. »Ich bin nicht ganz bei der Sache. Ist alles in Ordnung?«
»Geht so. Der Tag war nicht einfach. Und jetzt kommt auch noch Hanna mit ihrem Geltungsdrang dazu.«
»Das stimmt doch gar nicht«, erwidert Alice. Genau das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Hanna ist so sehr in den Hintergrund getreten, dass sie komplett verschwunden ist.
Erneut schallendes Gelächter des Westenmanns. Alice dreht sich um und sieht, dass er mit Nicky im Schlepptau auf sie zukommt.
»Wunderschöne Feier.« Er hebt das Glas.
»Ja, das war ein richtig schöner Abschied.« An Nickys Schneidezähnen klebt Lippenstift. Die beiden wirken ein wenig neben der Spur.
Alice wirft einen Blick zum Getränketisch und muss zu ihrem Schreck feststellen, dass sechs der acht bereitgestellten Flaschen schon leer sind. Vermutlich ist das nicht allein den beiden geschuldet. Sie schaut sich um, und zum Glück haben noch andere Leute Weingläser in der Hand.
Zu niemand Bestimmten sagt Alices Mutter: »Die Sandwiches sind leider etwas trocken geraten.«
»Überhaupt nicht«, widerspricht der Westenmann. »Im Gegenteil, sie sind köstlich. Hervorragend.«
»Hoffentlich hat der Caterer sie nicht zu lange offen stehen gelassen«, fährt ihre Mutter fort. »Er wirkte recht unbekümmert.«
»Mir kam er sehr professionell vor«, entgegnet Alice.
»Ach, Alice, dir kommt doch jeder professionell vor.«
»Ich hole noch ein paar Flaschen«, weicht Alice aus. In Wirklichkeit will sie nach Hanna suchen.
Endlich findet sie ihre Schwester in der Küche. Sie sitzt mit baumelnden Beinen auf der Arbeitsfläche und trinkt ein Glas Wein.
»Hallo!« Alice klingt überschwänglicher als geplant.
»Nach der Fahrt musste ich erst mal was trinken«, sagt Hanna. »Michael ist mit den Jahren auch nicht erträglicher geworden.«
»Heute ist er ganz schön nervig«, stimmt Alice treulos zu. Hanna lächelt kurz, was den Betrug rechtfertigt. Alice geht zu den Weinkisten. Ob sie sich wohl in London treffen könnten, bevor sie wieder abreist? Ob sie sich auf einen Kaffee oder einen Drink einlassen würde, damit sie endlich alles klären könnten? An schlechten Tagen hat sie furchtbare Angst davor, Hanna würde ihr nie verzeihen und sie müsste ihr Leben ohne sie verbringen.
»Wie lange bleibst du?«, fragt sie bemüht beiläufig.
»Was meinst du?«
»Wann fliegst du wieder zurück?«
Ohne ihr in die Augen zu schauen, erwidert Hanna: »Gar nicht.« Als Alice nicht darauf antwortet, fügt sie hinzu: »Meintest du wirklich, ich wäre nur hierfür zurückgekommen?«
Alice schüttelt den Kopf, dabei war sie tatsächlich davon ausgegangen.
Hanna lacht. »Ich reise doch keine sechstausend Meilen für jemanden, den ich kaum kannte. Also wirklich, Alice. Das wäre doch eher dein Ding.«
Das mag sein, bloß kann Alice sich nicht vorstellen, wie sie es überhaupt in sechstausend Meilen Entfernung verschlagen sollte. »Du bist wieder zu Hause? Für immer?«
»In England«, berichtigt Hanna sie sanft. »Fürs Erste.«
»Und was ist mit deiner Arbeit?«
»Ich habe eine Stelle beim Außenministerium in London bekommen.«
»Wie toll«, sagt Alice. »Was für wunderbare Neuigkeiten. Und wo wohnst du dann?«
»Weiß ich noch nicht. Ich muss mir eine Wohnung –«
»Wenn du willst, kannst du bei mir unterkommen«, fällt Alice ihr ins Wort. »Meine Mitbewohnerinnen haben bestimmt nichts dagegen. Du könntest auf dem Sofa schlafen. Oder in meinem Bett, und ich gehe aufs Sofa. Ich wohne in Clapham, weißt du noch? Super Anschluss. Du könntest mit der Northern Line bis nach Embankment oder Waterloo fahren und von dort zu Fuß gehen.«
»Danke«, erwidert Hanna knapp. »Ich komme schon klar.«
Alice schweigt. Sie wollte zu viel, zu schnell, und sie weiß es.
Hanna gleitet anmutig von der Arbeitsfläche, ohne ihren Wein zu vergießen. »Ich gehe dann mal zu Mum. Kann es wahrscheinlich nicht ewig aufschieben.«
»Sie ist heute ein bisschen …«
»Ein bisschen wie immer. Da muss ich durch.«
»Wenn du dir da mal nicht dein eigenes Grab schaufelst«, scherzt Alice.
Hanna verschwindet, und Alice wartet kurz, um sich zu sammeln. Dann bringt sie die Weinkiste in den Veranstaltungsraum, stellt frische Flaschen auf den Getränketisch und räumt die leeren zurück in die Kiste.
Hanna steht bei ihrer Mutter, Nicky und dem Westenmann. Die alte Mrs Linden gesellt sich eben dazu. Schlau von Hanna, sich ihrer Mutter hier zu stellen. Vor Zeugen.
»Jetzt mach mal halblang.« Michael ist wie aus dem Nichts neben ihr aufgetaucht. »Brauchen wir wirklich noch mal sechs Flaschen? Der Kerl da drüben hat jedenfalls schon genug intus.«
Alice folgt Michaels Blick. Der Westenmann redet auf Hanna ein und gestikuliert dabei mit seinem Weinglas. Hanna nickt und scheint sich ein Lachen zu verkneifen. Beim Anblick ihrer Schwester schwillt Alice vor Glück die Brust.
»Ist doch schön, dass die Leute so entspannt sind«, sagt sie zu Michael. Hanna ist wieder zu Hause, würde sie am liebsten verkünden. Hanna ist endlich wieder da. Doch die Information ist noch zu neu, zu wertvoll, um sie zur Diskussion zu stellen.
»Auf mich wirkt er ein bisschen zu entspannt«, meint Michael.
»Ach, so daneben ist er doch gar nicht.«
»Eben meinte er zu mir, ich sähe aus wie ein Anwalt.«
»Na ja, du bist ja auch einer.«
»Es war nicht als Kompliment gemeint.«
Alice bringt die Kiste wieder in die Küche und holt eine Platte mit Schokokeksen. Es sind zwar noch reichlich Sandwiches da, aber die Gäste könnten jetzt sicher etwas Süßes vertragen.
Sie dreht eine Runde durch den Raum, um sicherzugehen, dass alle versorgt sind, insbesondere die älteren Herrschaften. Die reizbare Frau namens Lydia unterhält sich immer noch mit dem sanftmütigen Hugh.
Alice gesellt sich zu den Nachbarinnen Mrs Jackson und Mr Blight, die zusammen Tee trinken und sich leise unterhalten.
»Vielen Dank, dass Sie gekommen sind«, sagt sie.
»Aber natürlich, Liebes«, erwidert Mrs Jackson. »Früher war sie mal ein wirklich reizendes Kind.«
Das kann Alice sich nur schwer vorstellen, und das macht sie traurig.
»Tragische Geschichte«, stimmt Mr Blight zu. »Für die ganze Familie.«
Alice nickt. Vor ihrem inneren Auge sieht sie ihre nervösen, verblassten Großeltern. Die kalte, unbewegliche Miene ihrer Mutter. Dann denkt sie an Hanna, deren Leben schwieriger war, als es hätte sein sollen.
»Hanna ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten«, fährt Mrs Jackson fort. »Die schönen blonden Haare. Katy war in ihrer Jugend unglaublich hübsch, das hat Hanna von ihr geerbt.«
»Aber merkwürdig«, meint Mr Blight. »Ihr zwei seht euch überhaupt nicht ähnlich, obwohl ihr Zwillinge seid. Du bist viel dunkler.«
»Hanna ist wunderschön, genau wie Katy damals«, sagt Mrs Jackson.
»Du siehst ihr gar nicht ähnlich«, wiederholt Mr Blight. »Im Grunde das genaue Gegenteil.«
Kein guter Tag für ihr Selbstwertgefühl. »Kann ich Ihnen noch irgendetwas anbieten?«, fragt sie. »Noch ein Sandwich vielleicht, oder ein paar Kekse?«
Nachdem sie ihnen jeweils mehrere Schokokekse auf einem Teller gebracht hat, fühlt sie sich endlich Hanna und ihrer Mutter gewachsen. Mrs Linden und der Westenmann stehen immer noch bei ihnen, nur Nicky ist weitergezogen.
»Gerade habe ich zu Ihrer Mutter gesagt, was es für ein Geschenk ist, an so einem Tag von seinen Kindern umgeben zu sein«, sagt der Westenmann zu Alice. Der Gedanke scheint ihm Tränen in die Augen zu treiben.
Alice nickt lächelnd. Ihre Mutter scheint es nicht eilig zu haben, ihm beizupflichten. Kurz trifft Hannas Blick auf ihren. Hanna schaut schnell wieder weg, doch Alice hat ihr die Belustigung angesehen. Es versetzt ihr einen Kitzel, dass sie ausnahmsweise einer Meinung sind.
»Ich selbst habe ja keine Kinder«, verkündet der Westenmann.
»Ach ja?«, fragt Mrs Linden. »Wie schade.«
»Das muss man auch wollen«, meint Alices Mutter.
»Ich konnte keine bekommen.«
»Oh, das tut mir leid«, sagt Alice. Sie ist nicht ganz bei der Sache, da sich Hanna murmelnd entschuldigt und von der Gruppe entfernt hat. Wo will sie hin?
»Es hat nicht sollen sein«, erwidert der Westenmann.
»Ja, manchmal ist das eben so«, stimmt Alice zu. Sie will nicht unhöflich sein und zwingt sich, ihm aufmerksam zuzuhören. Er wirkt deutlich betrunken und fängt langsam an zu lallen.
»Ist ja nicht so, als hätte ich es nicht versucht«, sagt er.
»Oje«, sagt Alice. »Das tut mir leid.«
»Das kommt öfter vor«, meint Mrs Linden. »Wirklich schade.«
Der Mann seufzt. »Der Geist war willig.«
Niemandem fällt eine passende Antwort ein.
»Es lag am Fleisch.« Er beugt sich vertraulich zu Alice, in der er das meiste Mitgefühl vermutet. »Das Fleisch war schwach.«
Alice spürt, wie ihr die Hitze ins Gesicht steigt. Sie meidet die Blicke ihrer Mutter und Mrs Lindens. »Das tut mir sehr leid.«
Er trinkt einen großen Schluck. »So ist das eben. Man tut, was man kann.«
»Richtig.«
Eine Stille entsteht, und Alice ist erleichtert, dass er das Thema anscheinend abgehakt hat, doch dann fährt er fort: »Manchmal reicht es einfach nicht. Das ist das Problem. Wenn es darauf ankommt, ist man der Situation nicht gewachsen.«
Alice ist wie erstarrt, ihr fehlen die Worte.
»Alice«, sagt ihre Mutter scharf. »Erzähl Mrs Linden doch mal von dem Sponsorenlauf, den ihr auf der Arbeit gemacht habt.«
»Wir haben an einem Sponsorenlauf –«, setzt Alice an.
»Die verstehen einfach nicht, wie nervös sie einen machen, das ist das Problem«, fällt der Mann ihr ins Wort. »Dieser Blick, den sie aufsetzen.« Er leert sein Glas und starrt ins Nichts. »Für die ist es ja einfach. Müssen ja bloß daliegen.«
»Möchten Sie vielleicht einen Tee?«, platzt es aus Alice.
Erschrocken schaut er sie an. Er scheint kurz zu überlegen, dann sagt er: »Ja, das wäre sehr nett. Danke.« Gehorsam wie ein Kind folgt er ihr ans Büfett und wartet geduldig, während sie ihm vorsichtig sein Weinglas abnimmt und ihm stattdessen einen Tee mit Milch reicht.
»Bitte sehr«, sagt sie.
Er trinkt langsam davon.
»Nehmen Sie sich einen Keks.« Alice hält ihm die Platte hin.
Michael steht am anderen Ende des Büfetts und kaut schlecht gelaunt auf einem Schinkensandwich herum. Er mustert den Westenmann, dann wirft er Alice einen missbilligenden Blick zu, er hat es ihr doch gesagt.
»Ich gehe mal an die frische Luft.« Mit der Teetasse in der Hand schwankt der Mann zur Tür.
Michael kommt zu ihr. »Wieso hast du ihn so viel trinken lassen?«
»Dafür kann ich doch nichts. Außerdem ist er gar nicht so betrunken.«
»Er kann kaum noch geradeaus laufen.« Michael sieht dem Mann hinterher. Erneut beißt er in sein Sandwich, kaut, schüttelt den Kopf. Eher traurig als wütend stellt er fest: »Schmeckt nach Ei.«
»So schön, dass Hanna hier ist«, sagt Alice. »Findest du nicht? Ich habe ja erst geglaubt, dass sie wirklich kommt, als ich sie gesehen habe.«
Michael zuckt mit den Schultern. »Hanna macht, was sie will. War schon immer so.«
»Und sie ist wieder zu Hause.« Alice kann nicht länger an sich halten. »Sie zieht wieder her.«
»Dann können wir sie wenigstens ordentlich im Blick behalten. Aufpassen, dass sie nicht entgleist.«
»Macht sie schon nicht«, erwidert Alice genervt.
Er wirkt nicht überzeugt.
»Hauptsache, wir sind alle wieder zusammen«, sagt Alice. »Endlich.«
»Bis auf Dad«, bemerkt Michael trocken. »Der ist tot.« Diese Tatsache verkündet er völlig emotionslos, und Alice, die im Zweifel immer tröstlich reagiert, weiß nicht, wie sie reagieren soll.
Sie werden von einer Gabel unterbrochen, die an ein Weinglas schlägt. Das Gemurmel verstummt, und Alice sieht sich nach dem Verursacher des Geräuschs um. Entsetzt stellt sie fest, dass es sich dabei um den Westenmann handelt, der es anscheinend nicht an die frische Luft geschafft hat und stattdessen auf einen Stuhl mitten im Raum gestiegen ist. Sein Weinglas ist voll.
»Zeit für ein paar Worte«, erklärt er mit der übertrieben deutlichen Aussprache der Sturzbetrunkenen. »Im Gedenken an die Verstorbene.«
»Was macht er da?«, zischt Michael.
»Er hält eine Rede«, flüstert sie.
»Das sehe ich selbst, Alice.«
Jetzt, da sämtliche Blicke auf ihn gerichtet sind, scheint der Mann verunsichert. Alice sieht, wie ihm ein panischer Schatten über das Gesicht huscht. Hoffentlich wird er sich auf ein paar tröstliche Plattitüden beschränken, ihre Tante habe ein erfülltes Leben gehabt, werde schmerzlich vermisst und so weiter, und die Ansprache damit beenden. Dann müsste sich wenigstens keiner unnötig lange schämen.
Leider entscheidet der Mann sich im Griff des Lampenfiebers für einen anderen Weg. »Mitbürger! Freunde! Römer! Hört mich an.« Diese Eröffnung scheint ihm Mut zu verleihen. »Begraben will ich Cäsarn, nicht ihn preisen.« Er schwankt leicht auf dem Stuhl.
»Alice, halt ihn auf«, raunt Michael.
»Aber wie?« Alice schaut sich verstohlen um. Die meisten Gäste wirken verwirrt, nur ihre Mutter sieht angespannt aus.
Michael schreitet selbst zur Tat und räuspert sich. »Danke, aber wir haben keine Ansprachen vorgesehen.«
Der Westenmann will ihn mit einer Geste zum Schweigen bringen. »Was Menschen Übles tun, das überlebt sie.«
»Das hier ist wirklich nicht der passende Rahmen«, sagt Michael. Er schaut zu ihrer Mutter.
»Das Gute wird mit ihnen oft begraben.«
»Das reicht.«
»So sei es auch mit Cäsarn!« Der Mann schwingt den Arm in einer ausladenden Geste, wobei er Hugh, der dummerweise in der Nähe steht, seinen Wein übergießt.
»Gut.« Michael tritt einen Schritt näher. »Jetzt reicht es. Bitte kommen Sie da runter.«
Alice fragt sich kurz, ob er ihn wohl festnehmen will.
Der Westenmann sieht ihn an. »Sie, mein Herr, sind ein furchtbar unhöflicher Kerl. Zwischenrufer werden hier nicht toleriert. Bitte schweigen Sie, sonst lasse ich Sie an den Ohren rausschleifen.«
»Verdammt noch mal«, schimpft Michael, ist allerdings verunsichert und rührt sich nicht von der Stelle. Anscheinend will er den Mann nicht mit körperlicher Gewalt von seinem Podest zerren. Sie weiß, dass sie ihm helfen sollte – Zornesröte ist ihm ins Gesicht gestiegen –, doch sie ist wie gelähmt. Sonst scheint auch niemand eingreifen zu wollen. Die Gäste schauen sämtlich betreten zu Boden, bis auf Lydia, die den Redner mit sichtlicher Freude betrachtet. Alices Mutter starrt aus dem Fenster, als hätte sie nichts mit dieser lächerlichen Situation zu tun. Sie scheint sich in Nachsicht zu üben, doch Alice kennt sie schon zu lange, um dem Braten zu trauen.
Der Westenmann schaut leicht benommen von Michael zu seinem restlichen Publikum. »Wo war ich stehen geblieben?«
»So sei es auch mit Cäsarn«, hilft Lydia ihm aus.
»Ach, genau. So sei es auch mit Cäsarn.«
Er hält inne, und kurz hofft Alice, damit wäre er fertig, doch er holt lediglich tief Luft.
»Der edle Brutus hat euch gesagt, dass er voll Herrschsucht war!« Erneut schwenkt er den Arm, und diesmal rutscht ihm das Weinglas aus der Hand, verfehlt Hugh nur knapp und zerspringt auf dem Boden. Der Westenmann hält überrascht inne.
Alice entdeckt Hanna im Flur zur Küche. Wie so oft ist ihre Miene undurchdringlich, doch als sie Alices Blick bemerkt, zwinkert sie ihr zu. Alice weiß nicht, wie sie das deuten soll.
Der Westenmann schüttelt vorwurfsvoll den Kopf in Richtung Hugh, als wäre dieser für das Wurfgeschoss verantwortlich, dann fährt er fort: »Und war er das, so wars ein schwer Vergehen, und schwer hat Cäsar auch dafür gebüßt. Hier, mit des Brutus Willen und der andern …« Er legt eine bedeutungsschwangere Pause ein. »Denn Brutus ist ein ehrenwerter Mann.« Er bedenkt Michael mit einem spitzen Blick.
»Das ist alles deine Schuld, Alice«, murmelt Michael.
»Das sind sie alle, alle ehrenwert.« Mit einer spöttischen Handbewegung bezeichnet er die versammelten Gäste. Mit fortschreitender Rede scheint sich seine Laune verschlechtert zu haben, vielleicht wegen Michaels Unterbrechung. Nach einer weiteren effekthascherischen Pause flüstert er deutlich hörbar: »Komm ich, bei Cäsars Leichenzug zu reden.«
Um Gottes willen, denkt Alice. War das etwa nur die Eröffnung?
»Sie machen sich und uns alle lächerlich.« Michael hat sich anscheinend wieder gefangen. »Kommen Sie bitte sofort da runter.«
»Ich lasse mir nicht den Mund verbieten!«, blafft er Michael an. Offenbar ist er jetzt in Fahrt geraten. »Sie, mein Herr, sind ein ehrloser Mann. Das Erste, was wir tun müssen, ist, dass wir alle Rechtsgelahrte umbringen. Ha! Nehmen Sie sich vor dem in Acht, meine Damen und Herren.« Er scheint sich in Rage zu reden. »Er bringt sie lebenslang hinter Gitter, der Richter frisst ihm aus der Hand. Richtig gehört! Er ist Richter, Geschworener und Henker in einem.«
»Ich praktiziere kein Strafrecht«, erklärt Michael würdevoll. »Ich bin Steuerrechtler im Unternehmensbereich.«
Leider gibt dieses Geständnis dem Redner den Rest. »Der Gipfel der Ehrlosigkeit!«, ruft er. »Die reinste Lasterhöhle ist das hier! Da kommt man rein und denkt, man wäre in Sicherheit, und im nächsten Moment wimmelt es von Steueranwälten! Ich wette, die ganze Sippe besteht aus Steueranwälten, und ihre Kumpanei noch dazu. Selbst die Dame da drüben« – er deutet auf die alte Mrs Linden – »ist wahrscheinlich Steueranwältin. Im Ruhestand, vielleicht«, räumt er ein. »Aber das macht es auch nicht besser. Dieser Herr ebenfalls.« (Er zeigt auf Mr Blight, der fassungslos den Kopf schüttelt.) Dann sieht er sich auf der Suche nach Inspiration im Raum um. »Dieser Mann«, erklärt er mit Blick auf Hugh, »ist vielleicht kein Steueranwalt. Vielleicht aber auch doch. Schwer zu sagen. Könnte sogar ein Buchhalter sein.«
Hugh starrt in sein Weinglas, als würde er sich am liebsten darin verkriechen.
»Und die da …« Der Westenmann zeigt auf Alice, die in Panikstarre verfällt. Doch der Mann bricht ab. »Nein, die ist in Ordnung. Hat mir einen Keks gegeben. Ist der einzige Lichtblick.«
Alice fühlt sich wider besseres Wissen geschmeichelt.
»Nein, an so einem Ort dürfen wir nicht achtlos werden«, sagt der Mann. »Wir sitzen in einem Schlangennest. Und eins noch!« Er wankt bedrohlich. »Hüten Sie sich vor den Sandwiches. Vorhin habe ich zwar das Gegenteil behauptet, aber die Dinger sind staubtrocken.« Er legt eine dramatische Pause ein. »Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mal, ob das Brot wirklich von heute ist.«
Er will gerade fortfahren, da bricht Hanna in stürmischen Applaus aus. »Bravo!«, ruft sie. »Wunderbar.«
Sie tritt auf den Mann zu und reicht ihm die Hand. »Was für ein Auftritt«, sagt sie. »Der reinste Genuss.«
Der Mann zögert benommen, dann ergreift er ihre Hand. Hanna hebt sie in die Höhe, und sie verbeugen sich gemeinsam. Dann hilft sie ihm vom Stuhl.
»Dann wollen wir Ihnen mal ein Glas Wasser holen«, sagt sie. »Die Stimmbänder ein bisschen beruhigen.« Die beiden verschwinden in der Küche.
Im Raum herrscht Schweigen.
Schließlich meldet sich Mrs Jackson zu Wort. »Ich fürchte, der Arme hat wohl ein bisschen zu viel getrunken.«
»Ich fand es eigentlich ganz gut«, sagt Lydia.
Danach löst sich die Versammlung rasch auf. Die älteren Herrschaften schauen auf die Uhr und verabschieden sich. Hugh und Nicky verlassen das Gebäude gemeinsam, und der Westenmann wird von Lydia zu einem Taxi geführt. An Alice gewandt sagt sie: »Ich passe auf, dass er nach Hause kommt.« Sie zögert kurz, dann fügt sie hinzu: »Ich bin mir nicht mal sicher, ob er Ihre Tante überhaupt kannte. Ich habe ihn gefragt, wie sie hieß, und er meinte, es wäre ihm vorübergehend entfallen, aber womöglich hätte ihr Name mit M angefangen.«
»Ach du je.« Gleich bricht sie noch in Tränen aus.
»Machen Sie sich nichts draus«, sagt Lydia. »Solche Sachen passieren auf Beerdigungen ständig.«
Tatsächlich?, denkt Alice.
Nachdem sich alle Gäste verabschiedet haben, überlässt Alice das Aufräumen im Veranstaltungsraum ihrer Mutter und Michael und macht sich auf die Suche nach Hanna. Sie wird in der Küche fündig, wo ihre Schwester Gläser spült.
»Wollte mich nützlich machen«, sagt sie.
»Lass nur. Ich kann das gerne machen.«
Ohne Einwand zuckt Hanna mit den Schultern und streift die Spülhandschuhe ab.
»Tolle Beerdigung hast du da organisiert«, sagt sie. »Hat echt Spaß gemacht.«
»Dieser Mann …«, setzt Alice verzweifelt an.
»Das war der absolute Höhepunkt. Kannst du den bitte auch für meine Beerdigung anheuern?«
»Sollen wir dich mit zurück nach London nehmen?«, fragt Alice. »Mum und ich sind in zwanzig Minuten fertig.«
»Schon gut, ich fahre mit Michael.«
»Der liegt dir dann die ganze Fahrt über mit den Vorteilen einer eigenen Immobilie in den Ohren.«
»Ich setz meine Kopfhörer auf.«
Sie schauen sich an. Alice will gerade noch etwas sagen, doch Hanna kommt ihr zuvor. »Na, dann gehe ich mal bei Mum meinen Kragen riskieren. Drück mir die Daumen.« Sie geht zur Tür. »Bis die Tage.« Und über die Schulter hinweg fügt sie noch hinzu: »Falls ich es überlebe, meine ich.«
»Viel Glück«, sagt Alice, aber Hanna ist schon verschwunden.
Alice und ihre Mutter räumen den Rest schweigend auf. Alice ist mit den Nuancen im Schweigen ihrer Mutter vertraut und weiß genau, welches man besser nicht bricht.
»Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt«, sagt ihre Mutter schließlich. »Das kommt davon, wenn man anderen Alkohol aufdrängt.«
»Ich habe doch niemandem etwas aufgedrängt«, entgegnet Alice.
»Was für ein Reinfall.«
»Tut mir leid«, sagt Alice. »Das war keine Absicht.«
»Bei dir ist auch nie irgendwas Absicht«, gibt ihre Mutter zurück. »Alles passiert einfach so.«
Alice denkt darüber nach. Die Aussage fasst ihr Leben niederschlagend trefflich zusammen.
»Die Trauerfeier hat den Gästen gefallen«, erwidert sie. »Und das Büfett kam auch gut an, abgesehen vom Wein.«
Ihre Mutter seufzt.
»Und die Trauerfeier ist doch das Wichtigste, oder?«
»Mag sein.«
»Und Hanna war da. Hanna ist wieder zu Hause.«
Darauf gibt ihre Mutter keine Antwort.
Nachdem die letzten Sandwiches eingepackt und Tassen und Gläser weggeräumt sind, schließt Alice ab und wirft den Schlüssel in den Briefkasten.
Im Auto sitzen sie schweigsam nebeneinander. Alice spürt, wie sich die Last des Tages auf ihren Schultern ablegt.
»Das hätten wir geschafft«, sagt ihre Mutter. Das sagte sie auch immer am Weihnachtsmorgen, oft schon am frühen Nachmittag. Das hätten wir geschafft. Nächstes Jahr dann wieder. Alice erinnert sich noch genau daran, wie traurig sie das jedes Mal machte.
Alice schaut zu ihrer Mutter, die immer noch starr geradeaus blickt. Ihre Mutter trauert, ermahnt sie sich, auch wenn das nicht offensichtlich ist. Sie war schon immer schwer zu trösten.
»Ich glaube, ihr hätte es gefallen«, sagt Alice. »Das hoffe ich zumindest.« In den letzten Stunden hat sie kaum an ihre Tante gedacht, es ist einfach zu viel los gewesen. Jetzt gibt sie sich besonders viel Mühe dabei. »Was für eine traurige Geschichte«, bemerkt sie schließlich.
»Was?«
»Alles. Wie es für sie gelaufen ist.«
»So ist das im Leben«, erwidert ihre Mutter kurz angebunden.
»Aber vielleicht hatte sie nicht das Leben, das sie verdient hätte.«
»Kann schon sein.« Ihre Mutter lässt den Wagen an. »Aber wer hat das schon?«
2
Fahl und unscheinbar. Da ist Celia im Alter von acht Jahren, ungeliebt und unansehnlich. Sie hat eine Höckernase, und ihre Augen liegen einen Hauch zu tief, nur ihre Farbe – ein leuchtend klares Grün – sticht hervor. Ihr Teint ist ungesund gelblich. Manche Leute müssen erst in ihr Äußeres hineinwachsen, erklärt ihre Mutter, was Celia verwirrt, da sie mit acht noch nicht begriffen hat, dass sie nicht hübsch ist.
Ständig bekommt sie zu Ohren, wie schön ihre große Schwester Katy sei, nur zu Celias Aussehen herrscht Schweigen. Doch aus irgendeinem Grund hat Celia daraus noch keine Schlüsse gezogen. Es schadet natürlich nicht, dass Katy auf sehr offensichtliche Weise hübsch ist, goldblondes Haar und blaue Augen, goldschimmernde Haut wie eine Göttinnenstatue. Die Leute sind nicht besonders fantasievoll, hat Celia festgestellt, und sehen fast immer nur das Offensichtliche, nicht das Interessante.
Celia ist ein stilles, wachsames Kind und macht ihre Lehrer nervös. Sie lacht nur selten.
»Sie neigt zu Extremen«, schreibt ihre Klassenlehrerin ins Zeugnis.
Celia hält das für ein Kompliment.
Selbst als sie auf dem Spielplatz die Berufe ihrer zukünftigen Ehemänner diskutieren, fällt der Groschen nicht. Celia erklärt, ihrer werde Arzt sein, und ein anderes Mädchen erwidert: »Du findest bestimmt keinen Mann«, woraufhin alle kichern.
Celia hält das für eine Anspielung auf ihren Intellekt. »Macht euch keine Sorgen«, beruhigt sie die anderen. »Die meisten Männer heutzutage wollen keine albernen Frauen.« Das hat Celia von ihrer Mutter gelernt, die sich sehr für gesellschaftlichen Wandel interessiert. Immerhin befinden sie sich in den Sechzigern: Die Welt verändert sich.
Doch die anderen kichern immer noch, und Celia ist genervt. Sie kann dieses Gackern nicht ertragen. Als die anderen davongehen wollen, folgt sie ihnen trotzdem.
Die elfjährige Katy überbringt Celia die Nachricht schließlich kurz vor ihrem neunten Geburtstag.
»Du bist hässlich«, sagt sie unverblümt. »Weiß doch jeder. Ich habe gehört, wie Mummy das zu Daddy gesagt hat. Bloß hat sie nicht ›hässlich‹, sondern ›reizlos‹ gesagt. Im Wörterbuch steht, das heißt ›hässlich‹.«
Katy scheint das nicht böse zu meinen, sie erklärt es mit der für sie typischen ausdruckslosen Art. Falls sie Celia damit hätte ärgern wollen, hätte diese es sich vielleicht nicht so zu Herzen genommen.
In ihrem Zimmer mustert sie ihr tränenüberströmtes Gesicht. Reizlos. Ja, jetzt sieht sie es auch.
Celias Mutter scheint vieles zu ermüden, insbesondere Celia. »Jetzt nicht«, sagt sie oft, wenn Celia sie etwas fragen oder ihr etwas erzählen will.
Ihre Mutter stickt gern, aber immer das gleiche Motiv: Narzissen auf weißem Hintergrund. Celia findet sie nicht selten bei der Arbeit im Wohnzimmer. Die Hand mit der Nadel bewegt sich gleichmäßig, ihr Blick ist auf das Fenster gerichtet, obwohl es dort draußen außer einem kleinen, gepflegten Rasenstück nicht viel zu sehen gibt.
Über dem Kamin hängt für den Großteil von Celias Kindheit eine Narzissenstickerei. Unzählige Stunden lang mustert sie das Bild prüfend, um herauszufinden, ob es sich stets um ein und dasselbe Exemplar handelt oder ob es wechselt. Sie hütet sich jedoch davor, ihre Mutter darauf anzusprechen. Sie betrachtet die Stickerei heimlich, aber jedes Mal, wenn sie glaubt, sie hätte einen Unterschied ausgemacht, kommen ihr sofort Zweifel. Ist die gelbe Nebenkrone der mittleren Narzisse vielleicht mal einen Hauch dunkler gewesen? Hatte dieses Blatt schon immer einen zusätzlichen Stich an der Kante?
Als Celia noch klein ist, durchlebt sie eine eigene Narzissenkunstphase. Katy darf schon sticken, aber Celia ist noch zu jung und muss sich mit Filzstiften und Wasserfarben begnügen. Sie hat kein besonderes Interesse an Narzissen, sondern hält sie einfach für den festgelegten Gegenstand jedweder künstlerischen Bemühung.
Als ihr Vater nach Hause kommt, streckt sie ihm ihr neuestes Narzissenbild hin. Ihr Vater betrachtet es auf der Türschwelle zum Wohnzimmer. Dann wandert sein Blick zu den Narzissen über dem Kamin und von dort zum Sofa, wo Celias Mutter und Katy nebeneinander über ihre Narzissenstickereien gebeugt sitzen. Schließlich richtet er den Blick wieder auf Celias Bild. Ihm scheinen die Worte zu fehlen.
Dann sagt er: »Ich brauche erst mal einen Schluck«, und geht davon, ohne sich zu Celias Bild zu äußern.
Eines Tages fragt sie ihre Mutter, weshalb sie so viel stickt, und ihre Mutter erwidert: »Ich mag es lieber, wenn meine Hände beschäftigt sind.«
»Und warum Narzissen?« Celia ist jetzt älter und weiß, dass man auch andere Blumen sticken kann.
»Das Muster ist so leicht, da muss ich mich nicht konzentrieren«, sagt ihre Mutter.
Celia ist mit dieser Antwort nicht zufrieden, doch sie kann nicht genau sagen, woran das liegt.
Celias Vater dagegen hat eine Schwäche für Scherzfragen, was Celia nicht im Geringsten nachvollziehen kann.
»He, ihr zwei«, sagt er etwa schelmisch am Abendbrottisch. »Was steigt hoch, kommt aber nicht wieder herunter?«
Celia denkt gründlich darüber nach. Die Aussage trifft auf vieles zu, einen Heliumballon etwa, wenn man die Schnur loslässt und er in den Himmel steigt, bis er nur noch ein winziger Punkt ist und dann ganz verschwindet. Eine Rakete, die ins Weltall fliegt. Ein Ball, der in einem Baum hängen bleibt.
»Und?«, fragt ihr Vater. »Was steigt hoch, kommt aber nicht wieder herunter?«
Celia hat die Qual der Wahl und entscheidet sich schließlich für: »Ein Bergsteiger, der auf den Mount Everest klettert und auf dem Gipfel stirbt.«
Eine Pause entsteht. Ihr Vater wirkt beunruhigt. »Wie bitte?«, fragt er. »Nein, leider falsch.«
»Das Alter«, löst Katy ruhig auf.
Er scheint sich wieder zu entspannen. »Ja, mein Schatz, ganz genau. Das Alter.«
»Aber warum ist das die richtige Antwort?«, will Celia wissen.
»Ist eben so.«
»Und was ist mit allen anderen möglichen Antworten?«
»Die sind falsch«, sagt ihr Vater.
»Aber wer bestimmt, welche Antwort richtig ist?«
»Das reicht jetzt, Celia.« Ihr Vater sieht abgespannt aus.
»Du verstehst das nicht richtig«, erklärt Katy. »Bei solchen Fragen geht es um Wörter, nicht um Tatsachen.«
Celia versucht, sich das zu merken, bleibt jedoch argwöhnisch gegenüber dem Überlegenheitsanspruch von Scherzfragen, die einen doch nur bloßstellen wollen.
Celia sehnt sich nach Freunden, merkt jedoch nicht, wie abstoßend sie auf die anderen Kinder wirkt. Sie ist zu forsch, verlangt anderen zu viel ab. Sie verdirbt ihnen den Spaß, weil sie bestimmen will, und weint, wenn niemand auf sie hört, wenn die anderen Quatsch machen oder die Regeln abändern, sie nicht beachten oder sie auslachen. Sie wenden sich instinktiv von ihr ab, von ihren zahllosen Bedürfnissen, ihrer Ernsthaftigkeit.
Während ihres letzten Grundschuljahres kommt kurzzeitig Hoffnung auf, als eine neue Mitschülerin dazustößt. Mary ist klein und schüchtern, und Celia reißt sie sich unter den Nagel. Mary lässt es zu, ist vielleicht dankbar, so schnell eine neue Freundin gefunden zu haben. Den Großteil des Schuljahres sind sie beste Freundinnen. Celia wacht eifersüchtig über sie. Sie sitzen in jedem Fach nebeneinander und spielen in den Pausen zusammen. Celia besteht außerdem darauf, dass ihre Karokleider die gleiche Farbe haben (die Mädchen dürfen zwischen Grün, Rosa und Blau wählen, und Celia entscheidet, dass sie und Mary immer Grün tragen). Mary darf nicht mit anderen Mädchen spielen, und als sie es einmal wagt, in der Pause mit den anderen Hüpfseil zu springen, straft Celia sie zwei Tage lang mit Schweigen, bis Mary sie unter Tränen anbettelt, wieder ihre Freundin zu sein. Sie besuchen sich gegenseitig und teilen sich ein gemeinsames Tagebuch, ein ledergebundenes Notizbuch, das Mary zu Weihnachten bekommen hat. Doch dann, nach den Osterferien, tritt die Katastrophe ein. Celia fängt sich ein gemeines Virus ein und muss eine Woche lang zu Hause bleiben. Anschließend weicht Mary ihr aus, tuschelt in der Ecke mit Helen Wilson und rennt mit ihr davon, wenn Celia sich nähert. Wenn Celia während des Unterrichts mit Mary reden will, sagt Mary zu Helen: »Hörst du dieses Summen auch? Ist hier irgendwo eine Fliege im Zimmer?« Celia schreit wütend auf und schlägt nach Mary, die rechtzeitig ausweicht. Mary und Helen starren Celia entsetzt an.
»Mary war schon länger nicht mehr hier«, bemerkt ihre Mutter ein paar Wochen später. »Habt ihr euch zerstritten?«
Celia spürt, wie heiße Tränen in ihr aufsteigen, und zuckt mit den Schultern. »Ich hasse sie.«
»Das ist aber nicht nett von dir«, meint ihre Mutter.
Da kommt ihr Vater herein und sagt: »Du, Cee, je mehr er hat, desto weniger wiegt er. Was ist das?«
Celia flüchtet auf ihr Zimmer.
Katy ist ebenfalls einsam, bemüht sich jedoch ihm Gegensatz zur verzweifelten Celia nicht, etwas daran zu ändern. In der Schule ist sie schüchtern und meidet ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, verbringt die Pausen in der Bibliothek oder manchmal sogar auf den Toiletten. Hin und wieder gesellt Celia sich in der Mittagspause zu ihr, aber Katy schickt sie fort oder ignoriert sie gleich ganz. Celia hat gehört, Schwestern seien oft beste Freundinnen. Sie ist sich zwar nicht sicher, glaubt allerdings nicht, dass sie und Katy beste Freundinnen sind. Zu Hause hat sie schon öfter versucht, mit Katy zu spielen, aber Katy spielt lieber allein und ist meist in ihrer eigenen Welt versunken. Sie ist ganz vernarrt in ihren Kater Rhabarber, mit dem sie sich oft unterhält und ihn ausgiebig krault. Obwohl sie so merkwürdig ist, wirkt sie gleichzeitig zart, und da sie auch noch hübsch ist, nimmt das die Leute für sie ein.
»Unsere kleine Tagträumerin«, sagt ihr Vater liebevoll. »Immer im Wolkenkuckucksheim.«
Celia lernt dadurch schon früh, dass attraktive Mädchen mit mehr davonkommen.
Da Katy die Hübsche ist, wäre es ja nur gerecht, wenn Celia die Schlaue wäre. Allerdings ist das Leben nicht gerecht, wie sie ebenfalls rasch lernt. Bis zur Sekundarschule hält sie sich für eine Intellektuelle. Seit Jahren sammelt sie lateinische Ausdrücke und bringt sie im Alltag unter. »Es liegt ja nicht am Brokkoli per se«, erklärt sie am Abendbrottisch, »sondern daran, dass er so matschig ist. De facto müsste er das ja gar nicht.«
»Gott, bist du bescheuert«, sagt Katy.
Celia und Katy landen auf dem Gymnasium, doch keine von beiden bekleckert sich dort mit Ruhm. Sie schaffen es in keinem Fach ins obere Klassendrittel und bewegen sich in mehreren Fächern am unteren Rand.
Obwohl ihre Zeugnisse ähnlich durchschnittlich ausfallen, wird nur Celia von ihrer Mutter auf ein Studium angesprochen.
»Du könntest einen Universitätsabschluss machen«, sagt sie. »Das machen heutzutage viele Mädchen. Damit könntest du dann Lehrerin an einer netten Mädchenschule werden.«
Celia, mittlerweile dreizehn Jahre alt, ist misstrauisch. Mädchenschulen sind ihrer Erfahrung nach nicht sonderlich nett. »Geht Katy auch studieren?«, fragt sie. Katy lernt gerade halbherzig für ihre O-Levels.
Ihre Mutter weicht ihr aus. »Vielleicht, kann sein. Mal sehen.«
Für Katy spielt es keine Rolle, ob sie studiert oder nicht, erkennt Celia. Denn Katy wird heiraten.
Sie hatte schon mehrere feste Freunde, aber keiner hat es lange durchgehalten. Katy beschuldigt einen nach dem anderen der Untreue, als wären die schlaksigen Halbwüchsigen unwiderstehliche Schwerenöter, denen sich die Frauen reihenweise an den Hals werfen.
»Denen darf man nicht vertrauen«, warnt sie Celia. »Keinem einzigen.«
Celia nickt, so wie immer, doch von da an betrachtet sie Katy mit anderen Augen.
Mit sechzehn ist die einst so fügsame Katy streitsüchtig und wütend geworden. Wo sie früher fast unsichtbar durch die Räume glitt, macht sie ihre Anwesenheit jetzt durch knallende Türen spürbar. Sie beschuldigt ihre Eltern, sie zu ärgern, wenn sie sie bitten, das Geschirr zu spülen oder ihr Zimmer aufzuräumen. »Lasst mich in Ruhe! Immer müsst ihr auf mir rumhacken und mich ärgern!« Irgendwann geben sie auf und bitten sie kaum noch um etwas. (Celia muss nach wie vor abspülen, egal, ob es sie ärgert oder nicht.)
Celia ist Katy der größte Dorn im Auge. »Immer glotzt du mich so blöd an«, beschwert sich Katy. »Schau woanders hin, du Ekelfetzen.«
Es stimmt, Celia mustert andere Leute oft sehr intensiv. Aber sie kann nichts dagegen tun. Katy ist ein interessantes Studienobjekt.
»Alle seid ihr gegen mich«, behauptet Katy eines Tages am Frühstück. »Celia war schon immer neidisch auf mich, und ihr habt sie auch noch angestachelt.«
»Schatz, das stimmt doch gar nicht«, beschwichtigt ihre Mutter.
»Immer habt ihr ihren komischen Launen nachgegeben.«
»Welchen Launen denn?«, fragt Celia, aber niemand beachtet sie.
»Wir haben ihr nie nachgegeben«, erwidert ihre Mutter.
»Immer seid ihr auf ihrer Seite«, beharrt Katy. »Habt ihren Neid angefacht.«
»Wir waren nie auf irgendeiner Seite.«
»Aber ich bin doch gar nicht neidisch«, verteidigt sich Celia. Niemand hört ihr zu.
Das Haus zittert unter der Sprunghaftigkeit ihrer Schwester. Eines Nachts wacht Celia auf, und Katy sitzt auf ihrer Bettkante und starrt sie an. Celia verkneift sich gerade so einen lauten Schrei. »Was machst du da?«
»Dich im Auge behalten«, erwidert Katy unheilvoll. Sie wirft ihr einen letzten finsteren Blick zu, dann verschwindet sie wieder in ihrem Zimmer.
Zu dieser Zeit nimmt Celia allmählich ihre Umgebung wahr, was sie ruhelos und unglücklich macht. In den Vororten von Peterborough ist kein romantisches Leben möglich (Celia weiß das, sie hat es versucht). Die Straßen sehen alle gleich aus, genau wie die Häuser. Ihr wird schmerzlich bewusst, dass sie noch nie irgendwo hingereist ist (außer einmal im Urlaub nach Wales, und das zählt ja wohl nicht), wobei sie es gleichzeitig vielleicht doch behaupten könnte – wahrscheinlich sehen die Vororte im ganzen Land gleich aus, und so gesehen kennt sie das ganze Land. Der Gedanke ist nicht gerade erbaulich.
Hinter den eintönigen Ausläufern der Stadt wartet nichts Besseres. Wo die Häuser aufhören, beginnt das Moor, erstreckt sich unerbittlich flach in die Ferne, bis es am Horizont verschwimmt. Celia spürt, wie die entmutigende Leere in sie hineinsickert, ihre Sinne abstumpft und ihre Ecken abstößt.
Sie versucht, sich ein Leben als Erwachsene vorzustellen, scheitert jedoch jedes Mal.
Sie fragt Katy: »Wo willst du wohnen, wenn du groß bist?«
Und Katy erwidert: »Wieso? Damit du mir nachstellen kannst? Lass mich bloß in Ruhe, du blöde Schlampe. Ich behalte dich im Blick.«
Es beunruhigt Celia, dass sie sich nichts vorstellen kann, was über ihre derzeitigen Umstände hinausgeht.
Katy besteht ihre O-Level-Prüfungen mit nicht gerade fliegenden Fahnen, aber ihre Eltern wollen zur Feier des Tages trotzdem mit ihr essen gehen. Celia hat erst zwei Mal in ihrem Leben auswärts gegessen und will unbedingt mit, ist jedoch nicht eingeladen. Ihre Eltern behaupten, es läge daran, dass Katy gefeiert werden solle, und Celia sei ja bald selbst an der Reihe, doch sie kennt den wahren Grund: Katy geht seltener in die Luft, wenn ihre Schwester nicht dabei ist. (Als Celia schließlich ihre Prüfungsergebnisse bekommt, sind ihre Eltern mit anderen Dingen beschäftigt, und niemand kommt auf die Idee, mit ihr essen zu gehen.)
Nach ein paar Monaten in der Oberstufe lernt Katy Jonathan kennen und scheint ihre schwierige Teenagerphase zu überwinden. Sie quält Celia jetzt nicht mehr, sondern beachtet sie einfach nicht. So wie in Kindertagen. Celia kann Jonathan gut leiden, er ist neunzehn und sehr vernünftig. Er isst jeden Sonntag mit ihnen zu Mittag und lächelt Katy über die Soßenschüssel hinweg an. Wenn Katy behauptet, alle wären gegen sie, sagt Jonathan: »Ach Quatsch, Süße.«
Celia weiß zwar nicht, was das mit »Süße« soll, ist aber dankbar für den beruhigenden Effekt, den Jonathan auf ihre Schwester hat. Sie sieht in ihm ihren zukünftigen Schwager und geht davon aus, dass die Verlobung kurz nach Katys achtzehntem Geburtstag bekannt gegeben wird, sobald Katy die A-Levels abgelegt hat.
Weder Celia noch ihre Eltern erfahren je, was zur Trennung geführt hat. Katy kommt lediglich eines Sonntagmorgens nach Hause, obwohl sie eigentlich den ganzen Tag mit Jonathan verbringen wollte, schmeißt ihre Tasche im Wohnzimmer auf den Boden und verkündet: »Arschloch. Was für ein Arschloch.«
Celia und ihre Mutter sitzen auf dem Sofa, Celia liest, und ihre Mutter stickt. Ihre Mutter fragt: »Was ist denn los, mein Schatz?« Katy schluchzt los, und als ihre Mutter sie in den Arm nimmt, heult sie laut auf. Das Geräusch ist furchtbar, beängstigend und verzweifelt, und Celia geht aus dem Raum.