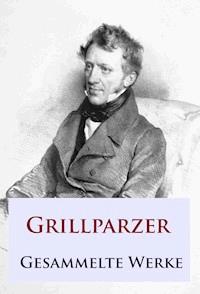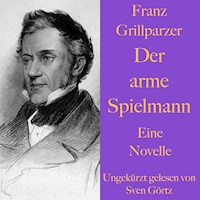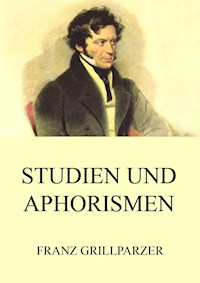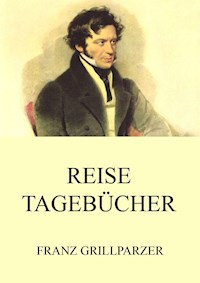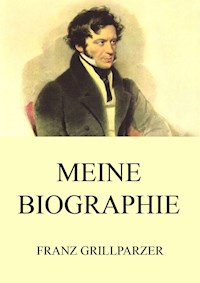
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Autobiographie des 1872 in Wien verstorbenen Dramatikers, der gerne auch als österreichischer Nationaldichter bezeichnet wird. Besonders bekannt sind viele seiner Dramen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Biographie
Franz Grillparzer
Inhalt:
Franz Grillparzer – Biografie und Bibliografie
Meine Biographie
Meine Biographie, F. Grillparzer
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849626433
www.jazzybee-verlag.de
Franz Grillparzer – Biografie und Bibliografie
Hervorragender Dichter, geb. 15. Jan. 1791 in Wien, gest. daselbst 21. Jan. 1872, war der Sohn eines geachteten Advokaten, der schon 1809 starb und seine Familie in Not zurückließ. Er studierte 1807–11 in Wien die Rechte, mußte sich aber frühzeitig nach Erwerb umsehen und trat 1813 als Konzeptspraktikant bei der niederösterreichischen Bankal-Gefällsadministration in den Staatsdienst, den er auch nicht wieder verließ, als er ein berühmter Dichter geworden war. 1823 wurde G. Hofkonzipist bei der Hofkammer (dem späteren Finanzministerium), 1832 ihr Archivdirektor, 1856 trat er als Hofrat in den Ruhestand. Verheiratet war er nie, obwohl er verlobt gewesen war und mit seiner Braut (Kathi Fröhlich, s. d.) bis zum Tode befreundet blieb. So einfach dieser Lebenslauf äußerlich zu sein scheint, so reich und merkwürdig ist Grillparzers innere und seine literarische Lebensgeschichte, die erst im letzten Jahrzehnt durch die Veröffentlichung seiner Tagebücher, Jugendwerke, Fragmente und kritischen Studien genauer bekannt geworden ist. Das Amt betrachtete G. wesentlich nur als Schutz für seine materielle Unabhängigkeit im dichterischen Schaffen, es legte ihm aber manchen Zwang auf und bestimmte vielfach auch sein literarisches Schicksal. Als G. heran wuchs, konnte er schon die Früchte der großen Blütezeit der deutschen Literatur genießen; Lessing, Herder, Schiller und Goethe wurden ihm vertraut, ihr Humanitätsideal wurde das seine, und er studierte auch eifrig die Kantsche Philosophie, deren Anhänger er zeitlebens blieb. G. wuchs ferner als Wiener in josephinisch-liberalen Traditionen auf, war ein eifriger Theaterbesucher, und die volkstümliche Literatur der Wiener Vorstadttheater wurde für die Bildung seines Geschmacks von nicht geringerer Wichtigkeit als das Studium der großen Tondichter Haydn, Mozart, Beethoven, das er mit Talent und Eifer pflegte. G. versuchte sich schon früh mit Kleinigkeiten in der dramatischen Kunst. 1807–1809 schrieb er ein weitschichtiges Trauerspiel. »Blanca von Kastilien«, das noch ganz im Banne Schillers (»Don Carlos«) steht (vgl. Hafner, Die Nachahmung Schillers im Erstlingsdrama Grillparzers »Blanca von Kastilien«, Meran 1901). Später ging ihm Sinn und Verständnis für die Kunst Goethes und Shakespeares auf, bis er seinen eignen Ton in dem prächtigen Torso einer (erst 1888 gedruckten) »Spartacus«-Tragödie fand, die seinem patriotischen Schmerz über die Franzosenherrschaft in Österreich vortrefflichen Ausdruck gibt. Auch mit der deutschen Romantik wurde G. vertraut; obgleich er sich später polemisch zu ihren Führern und Theorien stellte, so blieben sie doch nicht ohne Einwirkung auf ihn, indem sie ihm zum Studium der Spanier und zu seiner Anschauung der Geschichte die Anregung gaben. 1817 wurde in Wien seine erste Tragödie: »Die Ahnfrau«, ausgeführt und errang mit der stürmischen Leidenschaft ihrer Handlung und mit dem Zauber ihrer Sprache hier wie bald darauf in ganz Deutschland außerordentlichen Erfolg (vgl. Wyplel, Ein Schauerroman als Quelle der. Ahnfrau', im »Euphorion«, Bd. 7, Wien 1900; Kohm, Grillparzers Tragödie. 'Die Ahnfrau' in ihrer gegenwärtigen und frühern Gestalt, das. 1903). Nach diesem Werk zu urteilen, schien G. zur Gruppe der sogen. Schicksalsdichter zu gehören, und die »Ahnfrau« war in der Tat eine Schicksalstragödie. Aber schon ein Jahr später, 1818, lieferte er mit seinem klassisch vollendeten Trauerspiel »Sappho« den Beweis, das Eine Schicksalstragödie noch nicht den Charakter seines ganzen Dichtens bestimme. Daß dies aber von maßgebenden Kritikern seiner Zeit nicht bedacht wurde, und daß man ihn, ohne seine andern Werke zu prüfen, in die Reihe der Müllner und Houwald schob: das verdroß G. mit Recht sein lebelang und wurde der Grund für seine vielen bittern Urteile über deutsche Kritiker. In der »Sappho« stellte G. die Kluft zwischen Leben und Dichten, zwischen naiver Natur und reflektierender Genialität dar, »le malheur d'être poëte«, wie er selbst sagte. Mit diesem Seitenstück zu Goethes »Tasso« trat er in die Reihe der ersten dramatischen Dichter. Schon 1822 folgte seine große Trilogie. »Das Goldene Vlies«, bestehend aus den Dramen: »Der Gastfreund«, »Die Argonauten« und »Medea«, in denen G. wiederum das idyllische Glück der Natur und Naivität dem (ebenso natürlichen und eben darum tragischen) Streben nach bewußter Kultur, nach Größe und Ruhm gegenüberstellt. Denselben Gedanken verkörpert sein prächtiges dramatisches Märchen »Der Traum ein Leben« (1834): »Eines nur ist Glück hienieden,-Eins: des Innern stiller Frieden – Und die schuldbefreite Brust«. G. war nicht (wie Schiller) der Dichter der heroischen Tat, sondern des Zwiespalts zwischen Wollen und Können, den er auch persönlich am schmerzlichsten empfand; er war keine Kämpfernatur, sondern mied den politischen und literarischen Kampf in allzu scheuer Empfindlichkeit. Die Hinfälligkeit menschlicher Größe ist das tragische Grundmotiv auch seiner großen historischen Tragödie »König Ottokars Glück und Ende« (1825), welche eine Reihe österreichischer Historien eröffnen sollte. Im vormärzlichen Österreich, unter der Zensur- und Polizeiherrschaft, konnte jedoch solche Kunst nicht gedeihen, sie fand gar keine Unterstützung, ja, sie wurde geradezu unterdrückt. 1828 folgte »Ein treuer Diener seines Herrn«, eine Charaktertragödie, die lange Zeit ganz mißverstanden wurde und den Dichter, der mit Freimut einen Fürstenspiegel schuf, in den Verruf eines Fürstenknechtes brachte. Der Unverstand, mit dem diese, und die Kälte, mit der seine weihevolle Liebestragödie »Des Meeres und der Liebe Wellen« (1831) aufgenommen wurden, steigerten Grillparzers Neigung zur selbstquälerischen Schwermut ins Maßlose, so daß er an sich verzweifelte und sogar Selbstmordgedanken hegte. Mehrere Reisen, die er machte (1823 war er in Italien, 1826 in Deutschland und besuchte bei dieser Gelegenheit Goethe in Weimar, 1838 in Frankreich und England, 1843 in Athen und Konstantinopel), konnten sein Gemüt nicht befreien, und als 1838 sein geistvolles Lustspiel »Weh' dem, der lügt« in wenig ehrenvoller Weise abgelehnt wurde, da zog sich G. gänzlich von der Öffentlichkeit zurück und ließ kein neues Stück mehr ausführen. Doch trat er in den Stürmen des Jahres 1848 wieder Aufsehen erregend mit seinem Gedicht »An Radetzky« hervor. Denn wie sehr er auch unter dem Metternichschen System gelitten haben mochte, so schien ihm der Bestand und die Einheit seines geliebten Österreich von den Revolutionären gefährdet, und er rief dem Heerführer zu: »In deinem Lager ist Österreich!« Als Heinrich Laube Direktor des Wiener Hofburgtheaters war (1849–68), zog er die halbvergessenen Tragödien des vergrämten Dichters wieder aus Licht, und nun gelangten sie zu bleibender Geltung auf der deutschen Bühne. Grillparzers fernere Dichtungen von großer Bedeutung: »Die Jüdin von Toledo«, »Ein Bruderzwist im Hause Habsburg« und »Libussa«, gelangten erst nach seinem Tod in die Öffentlichkeit. nur das Fragment seiner herrlichen »Esther« erschien 1861 im »Dichterbuch« von Emil Kuh (ergänzt wurde es von N. Krauß, Stuttg. 1903). Seine langjährige Zurückgezogenheit füllte der Dichter mit literarischen Studien und mit der Abfassung von Epigrammen aus, die viel Bitterkeit, aber auch sehr viel Weisheit enthalten. Seine wundersam schöne Novelle »Der arme Spielmann« fand bei ihrer ersten Publikation 1848 keine große Verbreitung, une man sich überhaupt des hohen Wertes seiner Poesie, die auch be deutende lyrische Dichtungen (»Tristia ex Ponto« u. a.) enthält, erst nach seinem Tode bewußt wurde, als ihre Gesamtausgabe (10 Bde., Stuttg. 1871; 5. vermehrte Aufl., besorgt von A. Sauer, das. 1892–1894, 20 Bde.; 1902, 8 Bde.) erschien. Eine Ergänzung dazu bilden die »Briefe und Tagebücher«, herausgegeben von Glossy und Sauer (Stuttg. 1903, 2 Bde.). Sorgfältig kommentierte Ausgaben lieferten R. Franz (Leipz. 1903, 5 Bde.) und M. Necker (das. 1903, 16 Bde.). Die Zeitgenossen überhäuften den greifen Dichter mit Ehren: 1847 wurde er Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 1361 Mitglied des österreichischen Herrenhauses, sein 30. Geburtstag wurde in außerordentlicher, Weise, als ein Fest von ganz Österreich gefeiert; aber alle diese späten Auszeichnungen konnten wenig an der Stimmung des Greises ändern. Die Nachwelt sucht sich in liebevoller Hingabe seiner geistigen Hinterlassenschaft zu bemächtigen. Am 23. Mai 1889 wurde im Wiener Volksgarten sein Denkmal (modelliert von Kundmann, mit Reliefs von Weyr; vgl. Tafel »Wiener Denkmäler«) errichtet. Aus der reichen Literatur über G. heben wir hervor: August Sauers biographische Einleitung zu Grillparzers sämtlichen Werken (Stuttg. 1892); das »Jahrbuch« der 1890 in Wien gegründeten Grillparzer-Gesellschaft (redigiert von Glossy, Wien 1890 ff.; enthält Briefe, Tagebücher, Abhandlungen etc. von und über G.); H. Laube, F. Grillparzers Lebensgeschichte (Stuttg. 1884); Lange, G., sein Leben, Dichten und Denken (Gütersl. 1894); W. v. Wartenegg, Erinnerungen an Franz G. (Wien 1901); Sittenberger, G., sein Leben und Wirken (Berl. 1903) und Studien zur Dramaturgie der Gegenwart (Münch. 1898); vortrefflich ist Ehrhard, Franz G. Le théâtreen Autriche
Meine Biographie
mit einem Anhang: Hugo von Hofmannsthal – Rede auf Grillparzer
Selbstbiographie
Die Akademie fordert mich (nunmehr zum drittenmale) auf, ihr meine Lebensumstände zum Behufe ihres Almanachs mitzuteilen. Ich will es versuchen, nur fürchte ich, wenn sich das Interesse daran einstellen sollte, zu weitläuftig zu werden. Man kann ja aber später auch abkürzen.
Ich bin zu Wien am 15 Jänner 1791 geboren. Mein Vater war Advokat, ein streng rechtlicher, in sich gezogener Mann. Da seine Geschäfte und seine natürliche Verschlossenheit ihm nicht erlaubte, sich mit seinen Kindern viel abzugeben, er auch starb, ehe ich volle 18 Jahre alt war, und in den letzten Jahren seines Lebens Krankheit, die gräßlichen Kriegsjahre und der durch beides herbeigeführte Verfall seiner häuslichen Umstände, jene Verschlossenheit nur vermehrten, so kann ich von dem Innern seines Wesens mir und andern keine Rechenschaft geben. Sein äußres Benehmen hatte etwas Kaltes und Schroffes, er vermied jede Gesellschaft, war aber ein leidenschaftlicher Freund der Natur. Früher einen eigenen, später einen gemieteten Garten selbst zu bearbeiten und Blumen aller Art zu ziehen, machte beinahe seine einzige Erheiterung aus. Nur auf Spaziergängen, bei denen er, auf unglaubliche Entfernungen, manchmal die ganze Familie, häufig aber auch nur mich, noch als Kind, mitnahm, wurde er froh und mitteilsam. Wenn ich mich erinnere, daß es ihm, bei solchen Spaziergängen am Ufer der Donau, Vergnügen machte, den Inseln im Flusse, nach Art der Weltumsegler, selbstgewählte Namen zu geben, so muß ich glauben, daß in früherer Zeit die Regungen der Phantasie ihm nicht fremd gewesen sein müssen, ja noch später, in den Jahren meiner Lesewut, konnte ich ihm kein größeres Vergnügen machen, als wenn ich ihm Romane, aber ausschließlich Ritter und Geistergeschichten zutrug, die dann der ernste Mann, am schwedischen Ofen stehend und ein Glas Bier dazu trinkend, bis in die späte Nacht hinein las. Neuere Geschichten waren ihm wegen ihres Konventionellen zuwider.
Meine Mutter war eine herzensgute Frau, plagte sich mit ihren Kindern, suchte Ordnung herzustellen, die sie, die Wahrheit zu sagen, selbst nicht ganz genau hielt, und lebte und webte in der Musik, die sie mit Leidenschaft liebte und trieb.
Ich war der älteste von drei Brüdern, zu denen erst spät, als ich schon ziemlich erwachsen war, ein vierter hinzu kam. Man hielt mich für den Liebling meines Vaters, obwohl er mir nie ein Zeichen davon gab. Im Gegenteile unterhielt er sich am liebsten mit dem dritten, der ihn, von Geschäften ermüdet, durch unschädliche Wunderlichkeiten in seinem Entwicklungsgange erheiterte. Der zweite war ihm durch sein trotziges und störrisches Wesen beinahe zuwider.
Überhaupt kann man sich verschiedenere Charaktere als diese drei Brüder nicht denken. Von dem zweiten ist schon die Rede gewesen. Der dritte war ein bildschöner Knabe und dadurch von den Weibern verhätschelt. Da nun zugleich meine Mutter, wenn der Lärmen zu arg wurde, kein Mittel wußte, als die Schuldigen zu sich zu rufen und, in Form von Strafe, zu verhalten, an einem ›Strumpfband‹ zu stricken, so hatte der Jüngste die Sache ernsthaft genommen und strickte und stickte wie ein Mädchen. Er hatte sich drei Ecken des Zimmers mit gedachten und auch benannten Frauen bevölkert, denen er wechselweise Besuche abstattete. Mein Vater, abends im Zimmer auf und niedergehend, versuchte ihm auch für die vierte Ecke eine vierte Frau aufzudringen, die aber, da der vorgeschlagene Name den Spott gar zu deutlich an sich trug, der Knabe durchaus nicht akzeptierte.
Durch diese Grundverschiedenheit von meinen Brüdern entfernt gehalten, und da unser Vater zugleich sich von jeder Bekanntschaft abschloß, wuchs ich in völliger Vereinzelung heran. Um das Formlose und Trübe meiner ersten Jahre begreiflich zu machen, muß ich sogar unsere Wohnung beschreiben.
Mein Vater, mit der Absicht zu heiraten umgehend, suchte Quartier. Einmal abends bei einem Bekannten zu Gaste, kann er nicht fertig werden, die Wohnung des Wirtes zu loben. Zwei ungeheure, Saal-ähnliche Zimmer; den Zugang bildend ein minder großes, ganz geeignet für die Kanzlei des Advokaten, nach rückwärts noch einige Gemächer, zum Schlafzimmer und sonstigem Bedarf. Seinen ausgesprochenen Wünschen kommt der Inhaber der Wohnung mit der Äußerung entgegen, wie es leicht sei, sich den Besitz alles dessen zu verschaffen. Er selbst habe die Wohnung aufgekündet, und unter den Geladenen befinde sich der Hausherr, mit dem er sogleich sprechen könne. Gesagt, getan. Die Männer geben sich den Handschlag und mein Vater hat was er wünscht. Er hatte bemerkt, daß die Fenster der Wohnung nach zwei Seiten gehen. Was war also natürlicher, als daß die eine Hälfte die Aussicht auf die Straße, den »Bauernmarkt« hat und die andere in den ziemlich geräumigen Hof des Hauses. Bei späterer Besichtigung aber fand sich, daß es mit der Aussicht in den Hof allerdings seine Richtigkeit habe, die zweite Hälfte aber in ein enges, schmutziges Sack-Gäßchen ging, von dessen Existenz sogar viele Menschen in Wien gar keine Kenntnis haben.
In diesem Hause wurde ich geboren und verlebte meine ersten Knabenjahre. Finster und trüb waren die riesigen Gemächer. Nur in den längsten Sommertagen fielen um Mittagszeit einzelne Sonnenstrahlen in das Arbeitszimmer unsers Vaters und wir Kinder standen und freuten uns an den einzelnen Lichtstreifen am Fußboden.
Ja auch die Einteilung der Wohnung hatte etwas Mirakuloses. Nach Art der uralten Häuser war es mit der größten Raumverschwendung gebaut. Das Zimmer der Kinder, das so ungeheuer war, daß vier darin stehende Betten und einige Schränke kaum den Raum zu verengen schienen, empfing sein Licht nur durch eine Reihe von Glasfenstern und eine Glastüre von einem kleinen Hofe auf gleicher Ebene mit dem Zimmer, also wie das Zimmer selbst im ersten Stockwerke. Dieser Hof war uns streng versperrt, wahrscheinlich in Folge einer Konvention mit dem grämlichen Hausherrn, der den Lärm der Kinder scheute. Hierher verlegten wir im Gedanken unsere Luft und Sommerfreuden.
Nächst der Küche lag das sogenannte Holzgewölbe, so groß, daß allenfalls ein mäßiges Haus darin Platz gehabt hätte. Man konnte es nur mit Licht betreten, dessen Strahl übrigens bei weiten nicht die Wände erreichte. Da lag Holz aufgeschichtet. Von da gingen hölzerne Treppen in einen höhern Raum, der Einrichtungsstücke und derlei Entbehrliches verwahrte. Nichts hinderte uns, diese schauerlichen Räume als mit Räubern, Zigeunern oder wohl gar Geistern bevölkert zu denken. Das Schauerliche wurde übrigens durch eine wirkliche, lebende Bevölkerung vermehrt, durch Ratten nämlich, die in Unzahl sich da herumtrieben, und von denen einzelne sogar den Weg in die Küche fanden. Ein bei uns lebender Neffe meines Vaters und mein zweiter Bruder begaben sich manchmal, mit Stiefelhölzern bewaffnet auf die Rattenjagd, ich selbst konnte mich kaum ein paarmal entschließen, das Gewölbe zu betreten und mir Angst und Grauen zu holen.
Von der Küche ab ging ein zweiter langer Gang in ein bis zu einem fremden Hause reichendes abgesondertes Zimmer, das die Köchin bewohnte, die in Folge eines Fehltritts mit dem auch Schreibersdienste leistenden Bedienten verheiratet war, welche beide dort eine Art abgesonderten Haushalt bildeten. Sie hatten ein Kind und zu dessen Wartung ein halberwachsenes Mädchen, als Magd der Magd. Der Zutritt auch zu diesem Zimmer war uns verboten und wenn manchmal das schmutzige Mädchen mit dem unsaubern Kinde, wenn auch nur im Durchgange erschien, so kamen sie uns vor wie Bewohner eines fremden Weltteils.
In den ersten Jahren seit dem Erwachen meines Bewußtseins wurde das Traurige unserer Wohnung dadurch gemildert, daß mein Vater gemeinschaftlich mit seiner Schwiegermutter und einem seiner Schwäger ein großes Haus in Enzersdorf am Gebirge kaufte, das Raum genug bot, um drei Familien, ganz abgesondert von einander zu beherbergen. Das Beste daran war ein weitläuftiger Garten, in dem mein Vater, wenn er von Samstag abend bis Montag morgen hinauskam, seiner Gärtnerlust nachhing. Für uns Kinder wurde der Genuß dieses Gartens durch einen wie uns damals vorkam sehr großen Teich gestört, der sich an einem Ende desselben befand und der, obwohl man ihn mit einer schwachen Barriere eingefaßt hatte, doch eine immerwährende Gefahr des Hineinfallens darbot. Da war denn der Gebote und Verbote kein Ende und an ein Herumlaufen ohne Aufsicht war gar nicht zu denken. Besonders hatte der der Gartenmauer zugekehrte hintere Rand des Teiches, der nie betreten wurde, für mich etwas höchst Mysteriöses und ohne etwas Bestimmtes dabei zu denken, verlegte ich unter die breiten Lattigblätter und dichten Gesträuche alle die Schauder und Geheimnisse, mit denen in unserer Stadtwohnung das »Holzgewölbe« bevölkert war. Wir wurden gar nicht mit Gespenstern bedroht oder geschreckt. Demungeachtet als ich und mein zweiter Bruder einmal in dem gemeinschaftlichen Saale unterm Billard ganz allein spielten, schrieen wir beide zu gleicher Zeit auf. Als man herbeilief, erzählten wir, wir hätten einen Geist gesehen. Auf die Frage: wie er ausgesehen? sagte ich: wie eine schwarze Frau mit einem großen Schleier. Mein Bruder aber: wie ein »Hörndler« (Hirschkäfer).
Die Freude an dieser Landwohnung wurde nur zu bald gestört. Mein Vater trieb in dem gemeinschaftlichen Garten die Blumenzucht nicht ohne Pedanterie. Nun konnten sich aber meine damals noch unverheirateten Tanten gar keine andere Bestimmung für Blumen denken, als, wie eine hervorkam, sie abzureißen und entweder als Strauß an die Brust zu stecken oder in Wasser und Glas ans Fenster zu stellen. Noch ärger trieben es die schon etwas herangewachsenen und sich einer großen Ungebundenheit erfreuenden Kinder meines Onkels. Sie liefen ohne Umstände in den Beeten herum und zertraten die Pflanzen, ehe noch an Blumen zu denken war. Da gab es denn immerwährende Klagen, das Haus wurden allen drei Parteien verleidet und man war froh einen Käufer zu finden. Erst einige Jahre später mietete mein Vater einen Garten in Herrnals, wo wir den Sommer über wohnten und mein Vater als alleiniger Besitzer jede Störung von seinen geliebten Blumen abhielt.
Als die Sinnesart meines Vaters bezeichnend, erinnere ich mich noch, daß er einmal uns 3 Kindern Peitschen machte. Meine Brüder bekamen ganz einfache, handsame, mit denen sie nach Herzenslust klatschten. Für mich, seinen vorausgesetzten Liebling, aber nahm er einen so dicken Prügel und eine so starke Schnur, daß ich damit durchaus nichts anzufangen wußte, obgleich er selbst, mich im Gebrauch unterweisend, dem ungeheuern Werkzeug weitschallende Klatsche entlockte. Er konnte sich nicht gut in die Weise der Kinder finden.
Sonst weiß ich von Enzersdorf nur noch, daß ich daselbst durch einen alten Schulmeister die Anfangsgründe der Buchstabenkunde, wohl auch des Buchstabierens empfing. Der Mann war äußerst respektvoll und außer seiner Gestalt ist mir nur noch erinnerlich, daß er das Schmollen und Trotzen mit dem wunderlichen Namen des »Eserl-bindens« bezeichnete.
Wahrscheinlich fing schon in Enzersdorf an und setzte sich in der Stadt fort, was die Plage meiner Knabenjahre gemacht hat. Ehe ich noch den vollkommenen Gebrauch meiner Gliedmaßen hatte, setzte sich nämlich meine für Musik begeisterte Mutter vor, mich in die Geheimnisse des Klavierspiels einzuweihen. Noch gellt in meinen Ohren der Ton, mit dem die sonst nachsichtige Frau in ihrem Eifer die Lage der Noten: ober den Linien, unter den Linien, auf den Linien, zwischen den Linien in mich hineinschrie. Wenn nun gar der Versuch auf dem Klavier gemacht wurde, und sie mir bei jedem verfehlten Tone die Hand von den Tasten riß, duldete ich Höllenqualen.
In die Stadt zurückgekommen, wurde ein eigener Klaviermeister aufgenommen. Leider war meine Mutter in der Wahl nicht glücklich. Sie verfiel auf einen Johann Mederitsch, genannt Gallus, einen, wie ich in der Folge erfuhr, ausgezeichneten Kontrapunktisten, der aber durch Leichtsinn und Faulheit gehindert wurde, seine Kunst zur Geltung zu bringen. Bestellte Arbeiten konnte niemand von ihm erhalten, eine begonnene Oper mußte der Kapellmeister Winter vollenden, ja, durch einige Zeit in Diensten des letzten Königs von Polen, ging er jedesmal zur Hintertüre hinaus, wenn der Wagen des Königs am vorderen Tore anfuhr, so daß dieser ihn endlich entließ, ohne ihn je spielen gehört zu haben. Um nicht geradezu zu verhungern, mußte er Klavierunterricht geben, obwohl es ihm widerlich genug war. Mich gewann er lieb, aber sein Unterricht war eine Reihe von Kinderpossen. Die Finger wurden mit lächerlichen Namen bezeichnet: der schmutzige, der ungeschickte. Wir krochen mehr unter dem Klavier herum, als daß wir darauf gespielt hätten. Meine Mutter, die gegenwärtig war, begütigte er dadurch, daß er in der zweiten Hälfte der Stunde und oft darüber hinaus, phantasierte und fugierte, daß ihr das Herz im Leibe lachte. Statt mir Fingersatz und Geläufigkeit beizubringen, machte es ihm Spaß, mich bezifferten Baß spielen zu lassen, ja einmal komponierte er, der Faule, sogar für mich ein Konzert mit allen Instrumenten, das ich in seiner Wohnung aufführen mußte, bei dem, da ich gar nichts konnte, das Klavier wahrscheinlich nur einzelne Töne und Akkorde hatte, indes die Instrumente das übrige taten. Für einen Spaß konnte er sich sogar Mühe geben, zum Ernste war er nie zu bringen. Und doch war er kein Spaßmacher, mehr kindisch als scherzhaft. Da er nun zugleich in seinen Stunden sehr nachlässig war, so kam manchmal statt seiner seine Schwester, eine äußerst lange, sehr häßliche, übrigens aber vortreffliche Frau. Im Klavierspiele machte ich auch bei ihr keine bemerkbaren Fortschritte, dafür lehrte sie mich aber während der nur zu häufigen Ausruhe-Pausen nach einer damals wenig bekannten, gegenwärtig aber, wie ich höre, häufig angewandten Lautier-Methode buchstabieren und lesen, und zwar, da ich die Buchstaben schon kannte, am Klavier sitzend, ohne Buch. Ich weiß nicht wie es ging, aber ich konnte lesen, ehe noch jemand eine Ahnung davon hatte.
Nun wurde beschlossen, mich in die Schule zu schicken. Man wählte dazu eine unserer Wohnung am Bauernmarkte gegenüber liegende, alle Vorzüge einer öffentlichen genießende Privat-Anstalt. Da ich die Hauptsache: fertig lesen, konnte, so ging man über den Mangel der Kenntnisse im Rechnen und der Sprachlehre hinaus und versetzte mich sogleich in die höhere, zweite Klasse. Hier machte ich es nun, wie ich es leider immer gemacht hatte, trieb das was mich anzog nicht ohne Eifer, vernachlässigte aber das übrige. Das Einmaleins ist mir bis auf diese Stunde nicht geläufig. Einen Teil der Schuld trägt aber mein Vater, der nur immer vorwärts drängte und meinte, die versäumten Anfangsgründe würden sich schon nachholen. Später in der lateinischen Schule ging es nicht anders. Nichts aber trägt sich schwerer nach als Anfangsgründe. In dieser Schule habe ich zwischen Lob und Tadel zwei Jahre ausgehalten; lernte ganz gut schreiben, blieb in Rechnen und Grammatik zurück.
Den Mangel der letzteren ersetzte ich praktisch durch eine unermeßliche Leselust, die sich auf alles erstreckte, dessen ich habhaft werden konnte. Vor der Hand waren es die biblischen Geschichten des Neuen Testamentes in für Kinder bestimmter Erzählung. Was mir sonst in die Hände fiel, weiß ich nicht mehr.
Eins der frühesten Bücher, die ich las, war das Textbuch der Zauberflöte. Ein Stubenmädchen meiner Mutter besaß es und bewahrte es als heiligen Besitz. Sie hatte nämlich als Kind einen Affen in der genannten Oper gespielt und betrachtete jenes Ereignis als den Glanzpunkt ihres Lebens. Außer ihrem Gebetbuche besaß sie kein anderes als diesen Operntext, den sie so hoch hielt, daß, als ihr die Anfangsblätter abhanden gekommen waren, sie mit eigener Hand mühselig das Fehlende abschrieb und dem Buche beilegte. Auf dem Schoße des Mädchens sitzend, las ich mit ihr abwechselnd die wunderlichen Dinge, von denen wir beide nicht zweifelten, daß es das Höchste sei, zu dem sich der menschliche Geist aufschwingen könne.
Wenig später fiel mir eine uralte Übersetzung des Quintus Curtius in die Hände, wahrscheinlich als Derelikt unter altem Gerümpel auf dem Dachboden unserer Landwohnung, das mir der Hausherr, ein Tischler und Säufer von Profession, gerne überließ. Ich weiß nicht wie oft ich das dickleibige, großgedruckte Buch mit immer neuer Begeisterung von Anfang bis zu Ende durchlas. Was ich nicht verstand, ließ ich in den Kauf gehen, um so mehr, als weder meine Mutter, noch das Stubenmädchen mir Aufklärung geben konnten; meinen Vater zu fragen aber hielt mich die Furcht ab, er könnte mir das Buch, wie schon geschehen, als für mich nicht passend, wegnehmen. Vor allem quälte mich das erste lateinisch gedruckte Wort, mit dem der Übersetzer oder erste Herausgeber das von Curtius verloren gegangene erzählend beifügte. Es hieß wohl Paralipomena, oder ähnlich. Stundenlange marterte ich mich, um dem Zauberworte einen Sinn abzugewinnen, aber immer vergebens. Es machte mich unglücklich.
Eben auf dem Lande, wahrscheinlich aus derselben Quelle, geriet ich auf Heiligen- und Wundergeschichten des Pater Kochem, welche sich in meinem Kopfe mit den macedonischen Helden sehr gut vertrugen, nur daß die Taten dieser letztern mir keinen Wunsch zur Nacheiferung erweckten, indes ich glaubte, die Leiden und Qualen der Märtyrer ebenso gut erdulden zu können als jene Glaubensmänner. Ich beschloß Geistlicher zu werden, wobei ich aber nur auf den Einsiedler und Märtyrer mein Absehen richtete. In die Stadt zurückgekehrt wurde ein Meßkleid aus Goldpapier verfertigt. Ich las die Messe, wobei mein zweiter Bruder, der Klingel wegen, bereitwillig ministrierte. Ich predigte von einer Stuhllehne herab, wobei ich freilich als einzige Zuhörerin unsre alte Köchin hatte, die von meinem Unsinn sehr erbaut schien. Sie war auch mein Publikum am Klavier, aber nur für ein einziges Stück, das sie unaufhörlich wieder zu hören begehrte. Es war damals die Hinrichtung Ludwigs XVI noch in frischem Gedächtnis. Man hatte mir unter andern Übungsstücken auch einen Marsch gebracht, von dem man behauptete, daß er bei dieser Hinrichtung gespielt worden sei, in dessen zweiten Teile ein Rutsch mit einem einzigen Finger über eine ganze Oktave vorkam, welcher das Fallen des Mordbeiles ausdrücken sollte. Die alte Person vergoß heiße Tränen bei dieser Stelle und konnte sie sich nicht satt hören.
Meine kirchliche Richtung war übrigens nicht im mindesten religiös. Mein Vater war in der josephinischen Periode aufgewachsen und mochte nicht viel auf Andachtsübungen halten. Die Mutter ging alle Sonntage in die Messe, mit dem Bedienten, der ihr das Gebetbuch nachtrug; wir Kinder kamen nie in die Kirche. Ich erinnere mich noch, daß ich später im Gymnasium, wo jeder Schultag mit einer Messe begonnen wurde, immer, wie ein Wilder, meine Kameraden ansehen mußte, um aus ihrem Vorgange zu merken, wo man aufzustehen, niederzuknieen, oder an die Brust zu schlagen habe.
Bald darauf kam uns die Lust Komödie zu spielen. Wie sie kam und wer sie anregte, weiß ich nicht. Wir Knaben waren äußerst selten ins Theater gekommen. Von meiner Seite war es das erstemal, noch als Kind in eine italienische Oper mit meinen Eltern, denen ein ungarischer Graf, ein Klient meines Vaters, für den Abend seine Loge überlassen hatte. Ich erinnere mich nur, daß ich mich schrecklich langweilte und höchstens eine einzige Szene mich belustigte, wo die Leute in einer Laube Chokolade tranken, und der Geck des Stückes, der mit dem Stuhle schaukelte, samt Tasse und Becher rücklings über zu Boden fiel. Darauf folgte ein Ballett, dessen Titel: die Hochzeit auf dem Lande, mir noch jetzt gegenwärtig ist. Da ging es etwas besser und vor allem setzte mich in Erstaunen, daß in dem allgemeinen Tanze, gegen den Schluß, die Tänzer in eine auf halbe Theaterhöhe angebrachte fensterartige Öffnung mit einem Satze hineinsprangen. Sonst führte man uns Kinder höchstens an Namenstagen ins Leopoldstädter Theater, wo uns die Ritter- und Geisterstücke mit dem Käsperle Laroche schon besser unterhielten. Noch sehe ich aus den zwölf schlafenden Jungfrauen die Szene vor mir, wo Ritter Willibald eine der Jungfrauen aus einer Feuersbrunst rettet. Das Gebäude war eine schmale Seitenkulisse und die Flammen wurden durch herausgeblasenes Kolophonium-Feuer dargestellt, damals aber schien es mir von schauerlicher Naturwahrheit. Vor allem aber bewunderte ich die Verwandlung eines in schleppende Gewänder gehüllten Greises mit einer Fackel in der Hand, in einen rot gekleideten Ritter, wobei mir als das Wunderbarste erschien, daß der rote Ritter auch eine Fackel in der Hand hielt, was eben die schwache Seite der Verwandlung war, und von meinem damaligen Scharfsinn keine vorteilhafte Meinung gibt.
Außer diesen einzelnen Theaterabenden mochten zu unseren dramatischen Gelüsten auch die Erzählungen eines in unserm Hause lebenden verwaisten Neffen meines Vaters beigetragen haben, der in der Kanzlei als Schreiber verwendet wurde und der, um mehrere Jahre älter als wir, da er sich auf solche Art sein Brot selbst verdiente, einer ziemlich großen Freiheit genoß. Wie denn überhaupt mein Vater ein großer Freund von Verboten, aber nichts weniger als ein Freund von Beaufsichtigung war. Dieser Vetter, der nicht frei von einer gewissen Geckenhaftigkeit war, mochte uns nun von seinen Theatergenüssen erzählt haben, ja durch ihn bekam ich vielleicht die ersten Komödienbücher in die Hand, von denen ich mich nur noch auf Klara von Hoheneichen von weiland Spieß erinnere. Mein Vater nahm scheinbar oder wirklich von unsern Kunstbestrebungen keine Notiz, ja ich erinnere mich nicht, daß er unsern Darstellungen auch nur ein einziges Mal einen Blick gegönnt hätte. Die Mutter wurde dadurch gewonnen, daß unser Klavierlehrer Gallus, der die Sache, wie jede Kinderei, mit Eifer auffaßte, sich bereit erklärte, unsere Produktionen mit Ouvertüre und Zwischenakten in freier Phantasie auszuschmücken. Diese seine Improvisationen, zu denen er, wenn die Handlung bedeutender wurde, sogar melodramatische Begleitungen fügte, verschaffte unsern Absurditäten sogar eine gewisse Zelebrität. Einige Musikfreunde nämlich, worunter ein uralter Baron Dubaine, ein Vor-Mozartischer Kunstfreund, die nie Gelegenheit hatten, Gallus spielen zu hören, fanden sich nämlich, ohne sein Vorwissen, im Nebenzimmer ein, wo sie, durch die fingerweit offen gelassene Türe, sein Klavierspiel entzückt behorchten, ohne sich, wie natürlich, um unser Schauspiel, das sie nicht einmal sahen, auch nur im geringsten zu bekümmern.
Daß wir nur Ritterstücke aufführten, versteht sich von selbst, die Geister wurden durch das Mangelhafte unsers Apparats von selbst ausgeschlossen. Es ging nun an eine Verfertigung von hölzernen Schwertern mit papierenen Scheiden. Zu den Wämsern und Kollern wurden abgelegte Kleider mit Puffen und farbigen Schnüren ausstaffiert. Ich war sogar so glücklich, die untere Hälfte eines alten Atlaskleides meiner Mutter als Mantel benützen zu können. Meinem jüngsten Bruder fielen die Weiberrollen zu und er stickte sich Gürtel und Armbänder und Halsgeschmeide aufs prächtigste mit eigener Hand. Der mittlere mußte halb mit Gewalt gepreßt werden und er fügte sich in die Knappenrollen nur auf die Bedingung, daß ihm in seinen Kleidern die Ärmel und die Beinkleider auf halben Schenkeln abgeschnitten wurden, so daß er halbnackt einherging. Aber auch so war er kaum zum Auftreten zu bewegen, sondern warf sich auf sein Bett und mußte durch vereinte Kraft der ganzen Gesellschaft herabgezogen und auf die Szene gestoßen werden, wo er denn nur an den Gefechten Teil nahm. Unser Vetter Albert Koll und ich teilten uns in die Heldenrollen, wo denn immer eine Nebenbuhlerschaft um die Person meines jüngsten Bruders zu Grunde lag, der geraubt, befreit und in jeder Art auf dem Theater herumgeschleppt wurde. Da unser Personal doch gar zu klein war, so nahmen wir mit Vergnügen den Antrag unsers Orchesterdirektors Gallus an, seine kleine Tochter Marie in die Frauenzimmerrollen eintreten zu lassen. Das Mädchen war recht artig und für ihr Alter gescheit, hinkte aber zum Unglück beträchtlich, so daß wir, ihr gegenüber, unsern Mißhandlungen doch etwas Einhalt tun mußten. Das Amt des Theaterdichters fiel mir zu. Nicht als ob ich ein Wort niedergeschrieben, oder den Gang der Handlung anders als höchst allgemein vorausbestimmt hätte. Wir improvisierten, eine Szene gab die andere, und das Stück ging aus, wie es konnte und mochte. Nur der Ausgang der Kämpfe wurde festgesetzt, da niemand unterliegen wollte. Ein einzigesmal entschloß ich mich zum Schreiben, als ich Klara von Hoheneichen durch Hinweglassen von zwei Dritteilen des Stückes für unsere Bühne einrichtete, wo denn vor allem der Name des Ritter Adelungen geändert werden mußte, der mir durch seinen Gleichlaut mit dem verhaßten Adelung der Sprachlehre, unerträglich prosaisch vorkam. Im Lauf eines einzigen Winters begannen und endeten unsere theatralischen Vorstellungen, wozu die nächste Veranlassung war, daß ein uns sehr entfernt verwandter älterer Bursche, unter dem Vorwand Helme und Harnische von Pappe herbeizuschaffen, uns Geld aus unsern Sparbüchsen lockte, wo denn, als der Betrug herauskam, es sogar zu Auseinandersetzungen mit dem Vater des Schuldigen kam, und wir sowohl die Lust verloren, als unser Vater Einsprache tat.
Mittlerweile, ungefähr in meinem achten Jahre, hatte ich die deutschen Schulgegenstände zurückgelegt und sollte ins Gymnasium eintreten. Mein Vater aber, der, besonders mit Rücksicht auf meine große Jugend, dem Besuch der öffentlichen Schule abgeneigt war, beschloß uns Privatunterricht erteilen zu lassen. Es wurde daher ein Hofmeister aufgenommen. Das war nun einer der wunderlichsten aller Menschen. Ein sonderbares Gemisch von innerm Fleiß und äußerlicher Indolenz. Er kam als Theolog in unser Haus, änderte seine Meinung und studierte Medizin. Als ich ihn nach Jahren wiederfand, hatte er auch diese aufgegeben und die Rechte absolviert, so daß wir, trotz eines Altersunterschiedes von beinahe zwanzig Jahren, in gleicher Eigenschaft als Konzepts- Praktikanten bei der Finanzhofstelle gleichzeitig eintraten. Seine Lernbegierde ging über alle Grenzen. So hatte man ihm vorgeworfen, daß er nicht französisch könne. Nun legte er sich mit solchem Eifer auf diese Sprache und übte sich so unausgesetzt, daß, als wir zusammen bei der Finanzstelle dienten, er alle wichtigern Ausarbeitungen erst französisch konzipierte und dann für den Amtsgebrauch ins Deutsche übersetzte. Die fremde Sprache war ihm geläufiger geworden als die eigene.
Dabei grenzte aber seine Indolenz nach außen beinahe an Stumpfsinn, von dem eine große Blödsichtigkeit den körperlichen Ausdruck bildete. Wir hatten seine Schwächen bald weg und die Streiche, die wir ihm spielten, grenzen ans Unglaubliche. So liebte er zum Beispiel des Morgens lange im Bette zu liegen. Da stürzte ich denn eines Tages ins Zimmer mit der Nachricht, es sei eine Frau da, die unsere Wohnung besehen wolle in der Absicht sie zu mieten. Mein Gärtner, so hieß er, springt im Hemde aus dem Bette und flüchtet sich hinter einen Vorhang, der eine abgesperrte Verbindungstüre mit der Nachbarwohnung bedeckte. Unterdessen führe ich meinen Bruder herein in den Kleidern unserer Mutter, den ich ersuche Platz zu nehmen und die Rückkunft unserer Eltern abzuwarten. Da setzt sich denn der Bube, in der Mitte des Zimmers mit dem Rücken gegen den Vorhang gekehrt, in einen Sessel und bleibt ein paar Stunden lange sitzen, indes der arme Hofmeister im Hemde und mit bloßen Füßen alle Qualen der Angst und der Kälte erduldet.
Wenn es dem armen Teufel zu arg wurde, beschloß er endlich zu strafen. Die Strafe bestand in dem Verbote bei Tisch von der vierten Speise zu essen. Nun duldete mein Vater nicht, daß wir uns aus Vorliebe oder Abneigung im Essen wählerisch bezeigten. Wenn nun die verbotene Speise kam, schob der Sträfling seinen Teller von sich ab. Was soll das bedeuten? fragte mein Vater. – Ich danke, ich mag davon nicht essen. – Du wirst essen, sagte mein Vater. Und nun ließ sich der Schuldige reichlich herausfassen und aß nach Herzenslust, wobei er triumphierend nach dem Hofmeister blickte, der aus Furcht vor dem Vater sich nicht zu sagen getraute, daß eine Strafe im Mittel liege, deren volle Bestätigung und Ausführung sonst außer allem Zweifel gelegen hätte. Wir Brüder hätten uns nicht so leicht emanzipiert. Der Haupturheber war einer jener Söhne meines Onkels, die meinem Vater in Enzersdorf seine Blumenbeete zertreten hatten. Er besuchte uns manchmal und, um mehrere Jahre älter als wir, wurde er von dem in unserm Hause lebenden Vetter Albert Koll getreulich unterstützt. Sie marterten den armen Gärtner bis aufs Blut. Er aber glaubte alles und ging immer wieder von neuem in die Falle.
Ich selbst muß mir das Zeugnis geben, nur an den unschuldigem Neckereien Teil genommen zu haben, denn ich achtete ihn, obgleich seine Absurditäten gar zu verführerisch waren.
Meine Achtung gründete sich auf seine Bücher, die er unausgesetzt las und nach seiner Fahrlässigkeit auf allen Tischen liegen ließ. Da war nun ein französischer Telemach und ein lateinischer Autor, wahrscheinlich Suetonius, beide mit deutschen Anmerkungen und ausführlichen Sach- und Namen- Registern in derselben Sprache. In diese vertiefte ich mich, sooft ich ihrer nur habhaft werden konnte und ich kann daher wohl sagen, daß ich von dem guten Gärtner gefördert worden bin, obwohl ich in den Schulgegenständen von ihm rein nichts lernte.
Seine Trägheit ging nämlich so weit, daß er uns nicht einmal die Schulbücher kaufte, obwohl er das Geld dafür empfangen hatte, das sich bei der spätern Katastrophe unberührt in seinem Schranke vorfand. Er drohte uns täglich mit dem Ankauf dieser Bücher, kam aber nie dazu. Ja endlich wurde der Müßiggang als eine Belohnung für sonstiges Wohlverhalten oder für geleistete kleine Dienste förmlich zu Recht erhoben. Da er alles umherliegen ließ, seinen