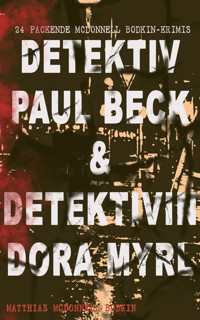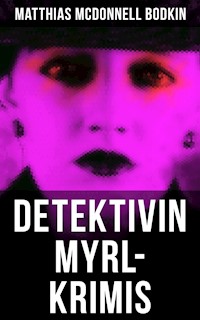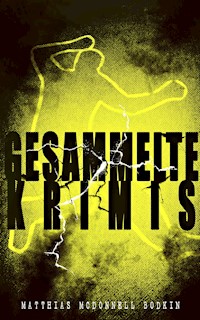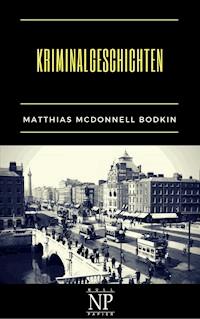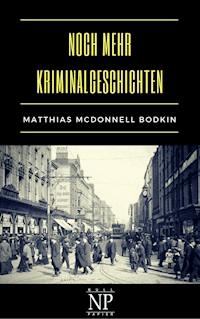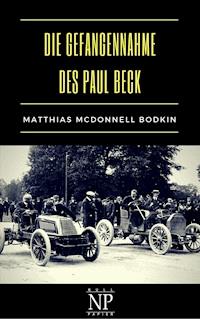Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der irische Politiker und Autor Bodkin gilt als einer der besten Kriminalautoren seiner Zeit. Seine Detektive Paul Beck oder Dora Myrl, eine der seltenen Frauen in diesem Genre, überzeugen durch Intelligenz, Logik und Scharfsinn. Dieser Band enthält die Geschichten: Ein weiblicher Detektiv Verschwindende Diamanten. Eine winzige Schlinge Nur ein Haar. Nicht mit eigener Hand. Der Hund und der Doktor Giftmischer. Ein Wettlauf. Verbrieft und versiegelt. Gelöst und gebunden Ein Münzverbrechen. Staatsgeheimnisse. Zwei Könige.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Detektivgeschichten
Mathias McDonnell Bodkin
Inhalt:
Ein weiblicher Detektiv
Der falsche und der wahre Erbe.
Die versteckte Violine.
Der Krückstock.
Die Sibylle.
Wer gewinnt?
Ein Seidenknäuel.
Auf der Lokomotive.
Des Großonkels Vermächtnis
War es eine Fälschung?
Ein Versteckspiel
Gewogen und zu leicht erfunden.
Künstliche Flügel.
Verschwindende Diamanten.
Eine winzige Schlinge
Nur ein Haar.
Nicht mit eigener Hand.
Der Hund und der Doktor
Giftmischer.
Ein Wettlauf.
Verbrieft und versiegelt.
Gelöst und gebunden
Ein Münzverbrechen.
Staatsgeheimnisse.
Zwei Könige.
Meine Detektivgeschichten, M. Bodkin
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849623166
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Cover Image: "Morning Fog" von A Guy Taking Pictures, lizenziert unter der Creative Commons LizenzNamensnennung 2.0 US-amerikanisch (nicht portiert) (CC BY 2.0)
Ein weiblicher Detektiv
Der falsche und der wahre Erbe.
»Unmöglich!« dachte Roderich Aylmer, der Besitzer von Dunscombe, während er durch das Erkerfenster auf den breiten Kiesweg hinausblickte: »dieser kleine Backfisch soll ein glänzendes Universitätsexamen gemacht haben und Doktor der Medizin sein – das ist ja rein lächerlich!«
Da kam mit raschem, flottem Schwung ein Fahrrad dahergesaust; ein zierliches, kleines Fräulein sprang ab und stieg leichtfüßig die steinernen Stufen herauf.
Sie trug auch wahrlich nicht den Stempel eines gelehrten Frauenzimmers, diese anmutige, bewegliche Gestalt, die jetzt auf der obersten Stufe im hellen Sonnenschein stand. Nach ihrer freundlichen und vergnügten Miene zu urteilen, hätte man sie viel eher für ein lustiges Schulmädchen halten können, das sich auf einem heißersehnten Ferienausflug ergötzt. Ein keckes Hütchen mit feuerrotem Federbusch saß auf den dicken glänzenden Flechten des krausen braunen Haares, und der kurze Rock ihres enganliegenden Kleides, den der leise Wind bewegte, ließ ihre zierlichen Füßchen sehen, die in hellbraunen Radfahrschuhen steckten.
Jetzt schritt sie unter den dorischen Säulen durch die Vorhalle und drückte auf die elektrische Klingel. »Kann ich Herrn Aylmer sprechen?« fragte sie den Diener, der die Türe weit öffnete, und reichte ihm ihre Visitenkarte. »Fräulein Dora Myrl« stand darauf.
Roderich Aylmer kam ihr selber entgegen. Er stieg die Treppe hinunter, durchschritt die kühle, mit schwarzen und weißen Marmorplatten belegte Halle und sagte, ihr die Hand reichend: »Seien Sie mir bestens willkommen!« Das Fräulein warf nur einen durchdringenden Blick auf sein ehrliches, hübsches Gesicht, dann legte sie ihr Händchen mit festem, herzlichem Druck in seine biedere Rechte.
»Wie ich Ihnen schon geschrieben habe, Fräulein Myrl,« begann er ohne weiteres, sobald sie zusammen im Wohnzimmer saßen, »ist meine Frau sehr krank und förmlich zum Schatten abgemagert: doch vermag kein Arzt ihr Übel zu erkennen. Als unser einziger Sohn vor zwölf Jahren geboren wurde, bekam sie ein schlimmes Fieber, von dem sie sich nie wieder ganz erholt hat. Sie ist immer geduldig, ja nur allzu sanft, wie mir dünkt: in Zorn gerät sie nie, aber es kommt auch kein Lächeln auf ihre Lippen. Obgleich sie unsern Sohn von ganzem Herzen liebt, scheint sie doch am traurigsten zu sein, wenn er bei ihr ist. Ihre Schwermut nimmt mit jedem Tage zu und wir führen ein trübseliges Leben. Deshalb schlage ich es Ihnen hoch an, daß Sie gekommen sind: ich würde Ihnen unendlich dankbar sein, wenn Sie meine arme Frau etwas herausreißen und erheitern könnten. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick; ich will ihr sagen, daß Sie hier sind, es wird ihr Freude machen.«
Als jedoch die hübsche Frau mit dem bleichen, abgezehrten Gesicht, auf den Arm ihres Gatten gestützt, langsam ins Zimmer trat, erkannte Dora Myrl auf den ersten Blick, daß die Herrin des Hauses über ihre Ankunft nicht erfreut war, sondern sich vor ihr fürchtete, wiewohl sie ihre geheime Angst unter einer liebenswürdigen Begrüßung zu verbergen suchte.
»Ich will ihr Vertrauen gewinnen und sehen, ob ich ihr nicht helfen kann,« dachte die scharfsinnige Dora in ihrem praktischen Sinn, während sie das tieftraurige Gesicht voll Mitleid betrachtete.
Die nächsten zwei Wochen vergingen in Dunscombe-Haus wie im Fluge. Aylmer fühlte sich neu belebt durch die Gesellschaft der munteren jungen Dame, die ihn ermutigte, sich im Tennis- und Croquetspiel auf dem glatten, grünen Rasen tüchtig anzustrengen und ihm Abends am Billard beim Schein der elektrischen Lampen manche Partie abgewann.
Auch der sanften Herrin des Hauses, die so traurige Augen hatte, war sie eine liebe Gefährtin. Selbst wenn sie ganz stumm bei einander saßen, hatte ihr teilnahmvolles Wesen etwas ungemein Trostreiches für dies schwergeprüfte Herz. Stets war sie fröhlich und hilfreich, aber obgleich ihre langen Gespräche mit Frau Aylmer oft in herzlicher Zärtlichkeit endeten und Dora mehr als einmal fühlte, daß sie dem verborgenen Kummer schon ganz nahe gekommen waren, so hatten sie ihn doch bis jetzt noch nicht berührt.
An einem warmen Nachmittag saßen sie beide in Alice Aylmers Boudoir, das auf den schattigen Garten hinausging, wo der kühle Springbrunnen plätscherte. Dora las und Frau Aylmer hielt eine Stickerei in der Hand, mit der sie sich stumm beschäftigte, aber trotzdem leisteten sie einander trauliche Gesellschaft. Während Dora mit den Blicken die Zeilen ihres Buches überflog und den Hauptinhalt der Geschichte auffaßte, waren ihre unruhigen Gedanken fortwährend mit dem Geheimnis beschäftigt, das sie in dem stillen Zimmer wie einen Druck zu spüren meinte.
Vertrauen erzeugt Vertrauen, überlegte sie, ich will damit anfangen, ihr etwas von mir zu erzählen. »Möchten Sie wohl wissen, Alice, wie es mir im Leben ergangen ist, ehe ich zu Ihnen kam?« fragte sie ohne besondere Einleitung.
»Nur wenn Sie gern davon sprechen, liebe Dora. Mir genügt es vollkommen, Sie als meine Freundin hier zu haben.«
»Aber Freundinnen sollten nichts voreinander verbergen,« sagte sie, und in ihren klaren grauen Augen leuchtete es hell auf. »Doch habe ich im Grunde wenig mitzuteilen, wenn ich's recht bedenke. Mein Vater war ein ehrwürdiger Universitätsprofessor in Cambridge. Er heiratete spät und meine Mutter« – hier bebte ihre Stimme und ihre Augen füllten sich mit Tränen – »habe ich nie gekannt. Sie starb, als sie mir das Leben gab. Meinem Vater tat es zuerst leid, daß ich kein Knabe war, später indes söhnte er sich ganz damit aus und er setzte seinen größten Ehrgeiz darein, daß ich zugleich eine feingebildete Dame und eine Gelehrte werden sollte. Die Ärzte sagten, er habe dem Tode noch drei Monate länger widerstanden, als sie es für möglich gehalten hätten, um zu erleben, daß ich mein Examen in Cambridge mit Auszeichnung absolvierte. Dann starb er befriedigt und ließ mich im Alter von achtzehn Jahren mit zweihundert Pfund und meiner Würde als Bakkalaureus allein in der Welt zurück. Das mühselige Leben einer Schullehrerin reizte mich nicht; so verwandte ich denn mein geringes Vermögen darauf, mir den Doktortitel zu erwerben. Allein die Patienten blieben aus und auf sie warten konnte ich weder, noch mochte ich es. So bin ich denn im Laufe des letzten Jahres Telegraphistin, Telephonistin und Zeitungsschreiberin gewesen. Letzteres gefiel mir am besten, doch habe ich meinen eigentlichen Beruf noch nicht entdeckt. Ich bin ein kleiner unruhiger Geist, dessen rastlose Wißbegierde schwer zu befriedigen ist. Als ich in der Zeitung die Anzeige Ihres Gatten las, der eine lebhafte Gesellschafterin suchte, wurde meine Neugier wach, ich gab meine Stellung auf und kam hierher.«
»Hoffentlich haben Sie es nicht bereut!«
»Durchaus nicht, nur möchte ich –«
Ein lautes Klopfen an der Türe unterbrach ihre Worte.
»Frau Caruth ist unten,« meldete die eintretende Dienerin.
»Laß sie heraufkommen.«
Aber ehe das Mädchen noch die Botschaft ausrichten konnte, drängte sich Frau Caruth selbst mit Ungestüm an ihr vorüber ins Zimmer.
Sie war eine vierschrötige Gestalt mit blitzenden Augen unter scharf gezeichneten Brauen; Mund und Kinn verrieten Entschlossenheit, ihr Gesicht war ausdrucksvoll, selbst hübsch zu nennen, doch machte sie den Eindruck einer Frau, die mehr Furcht als Vertrauen einflößt. So kam es wenigstens der scharfsichtigen Dora Myrl vor, als sie von Frau Caruth zu Alice Aylmer hinblickte, die bei der zudringlichen neuen Erscheinung bald rot bald blaß wurde und zitterte wie Espenlaub.
Dora sah sie die Farbe wechseln, sie sah das Beben ihrer Glieder und gleich dem geübten Arzt, der den Patienten mit dem Stethoskop untersucht, bis er den geheimen Sitz der Krankheit erforscht hat, murmelte sie leise vor sich hin: »Hier steckt die Wurzel des Übels.«
Währenddem musterte Frau Caruth Dora mit unverschämten Blicken, in denen die deutliche Frage lag: »Was hast du hier zu suchen?«
Sicherlich hätte sich Dora dies freche Anstarren nicht gefallen lassen, aber aus Frau Aylmers Augen sprach ein so beredtes Flehen, daß sie ihr nicht widerstreben konnte.
»Wenn es Ihnen recht ist, Alice, möchte ich ein paar Briefe schreiben,« sagte sie und verließ eilends das Zimmer. Sie hörte, wie die Türe hinter ihr heftig zugeschlagen und der Schlüssel herumgedreht wurde.
Wohl eine Stunde saß Dora wartend im Nebenzimmer und vernahm von Zeit zu Zeit die herrischen Laute einer zornigen Stimme und unterdrücktes Weinen.
Endlich erschien Frau Caruth mit triumphierender Miene auf der Schwelle und entfernte sich, ohne Dora auch nur eines Blickes zu würdigen. Drinnen aber lag Frau Aylmer auf dein Sofa ausgestreckt! sie verbarg ihr Gesicht in den Samtkissen und schluchzte so leidenschaftlich, daß ihr ganzer Körper bebte.
Es lag in Dora Myrls Eigenart – vielleicht war es ein Fehler ihrer Natur –, daß ihr trotz des warmen Mitgefühls, das ihr die leidende Freundin einflößte, doch der Gedanke durch den Kopf schoß: »Jetzt ist der günstige Augenblick gekommen, um das Geheimnis zu erfahren.«
Sie nahm neben dem Sofa Platz und umfaßte Alices matt herabhängende Rechte mit beiden Händen. »Nun sagen Sie mir alles, was Ihnen das Herz bedrückt,« bat sie.
Sie sprach freundlich wie zu einem Kinde, aber doch in so bestimmtem Ton, als könne von Widerspruch nicht die Rede sein, und Frau Aylmer, die durch Kummer und Furcht geschwächt war, fügte sich wie ein Kind ihrem Willen.
»Es war zur Zeit als mein Knabe geboren wurde,« begann sie.
»Ihr Sohn, der morgen in die Ferien nach Hause kommt?«
»Ja – nein – o mein Gott, Dora, haben Sie Geduld mit mir, ich will Ihnen alles bekennen. Aber unterbrechen Sie mich nicht, sonst verläßt mich die Kraft. – Seit drei Jahren war ich mit Roderich verheiratet und unendlich glücklich, aber doch wußte ich nur zu gut, wie sehr mein Gatte sich einen Erben wünschte. Als der Knabe endlich zur Welt kam, war die Freude groß, aber leider nur von kurzer Dauer. Ich fühlte mich entsetzlich schwach und mein armer Säugling war sehr zart und hinfällig. Seine Händchen tasteten nach der Mutterbrust, aber vergebens öffnete er die Lippen, um Nahrung zu suchen. Ich hatte keine Milch für meinen Erstgeborenen – o Dora – Sie wissen nicht, wie schwer das ist! Frau Caruth war bei mir in Dienst gewesen und hatte dann den Grobschmied des Dorfes geheiratet – einen Trunkenbold, wie ich später erfuhr. Am selben Tage, wie ich, hatte sie einen Knaben zur Welt gebracht und kam nun als Amme zu meinem Archibald. Es brach mir fast das Herz, als ich das winzige, blasse Geschöpfchen, das bei mir immer so kläglich wimmerte, in friedlichem Behagen an ihrer Brust liegen sah. Doch wurden wir täglich schwächer, der Knabe und ich; mir nahm wohl nur die Angst um das Kind alle Kraft. Eines Abends war ich fest eingeschlafen, und als ich erwachte, hörte ich in dem dunklen Zimmer meinen Mann und den Doktor im Flüsterton miteinander reden.
»›Für sie fürchte ich keine Gefahr,‹ sagte der Doktor mit solchem Nachdruck, daß es mich kalt überlief, denn ich erriet, was nun folgen würde.
»›Und der Knabe?‹ erkundigte sich mein Mann leise. Wie oft hatte ich mich gesehnt die Frage zu stellen!
»›Sind Sie stark genug, um die Wahrheit zu hören?‹
»›Ja; alles ist leichter zu ertragen als diese beständige Furcht.‹
»›Dann lassen Sie Furcht und Hoffnung fahren,‹ antwortete der Doktor feierlich. ›Der Knabe kann nicht am Leben bleiben.‹
»›Wie grausam ist dieser Ausspruch!‹
»›Sie wollten die Wahrheit hören.‹
»Ein leises verzweifeltes Stöhnen entrang sich der Brust meines armen Mannes. Mir blutete das Herz bei seinem Gram und ich hätte laut aufschreien mögen: da hörte ich, wie ihm der Doktor zuflüsterte: ›Nehmen Sie sich zusammen, damit Sie die Kranke nicht wecken.‹ Sie wußten wohl beide nicht, daß Frau Caruth im Zimmer war. Sobald sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, machte sie Licht, trat an mein Bett und sah mir ruhig ins Antlitz.
»›Sie haben gehört, was der Doktor sagte, Madame; als Sie den Atem anhielten, wußte ich, daß Sie wach wären.‹
»›O Martha, es wird meinen Mann umbringen,‹ stieß ich verzweifelt heraus, ›er kann es nicht überleben!‹
»›Möchten Sie ihm den Schmerz ersparen?‹
»›Um jeden Preis. Selbst meine Seele gebe ich dafür hin – doch es ist unmöglich.‹
»›Ich weiß einen Ausweg. Wir müssen die Knaben vertauschen.‹
»›Nun und nimmermehr!‹ rief ich.
»›Erst hören Sie meinen Plan,‹ sagte sie gebieterisch. ›Mein Sohn ist ein prächtiger Knabe und mehr wert als hundert solcher Jammerwesen wie Ihr Kind; Sie werden bei dem Tausch nur gewinnen. Ich kann Ihren Knaben nähren und vielleicht am Leben erhalten. In diesem Falle würden wir den Tausch wieder rückgängig machen. Stirbt er – schaudern Sie nicht so – Sie müssen darauf gefaßt sein – stirbt er, so braucht es ihr Gatte nie zu erfahren und er behält immer noch einen schönen, kräftigen Erben.‹
»Ich war so schwach und sie so stark; vielleicht dient mir das einigermaßen zur Entschuldigung. Meinem Gatten zuliebe willigte ich ein, mich von dem Knaben zu trennen: ich gab Frau Caruth Geld und Juwelen und ließ sie schwören, daß sie mein Kind gut behandeln würde.
»›Ich will es lieben, als ob es mein eigenes wäre,‹ versicherte sie mir unzählige Male.
»Hierauf muß ich wohl in einen Fieberzustand verfallen sein; ich weinte und stöhnte den ganzen Tag, daß mein Sohn sterben würde. Bisher hatte mich eine freundliche Wärterin gepflegt; sie hieß Kitty Sullivan, war eine Irländerin und katholischer Religion. Sie versuchte auf jede Weise, mich zu trösten, und kniete zuletzt an der Wiege hin, um voll Inbrunst für mein Kind zu beten: ›Gegrüßet seist du, Maria! Heilige Jungfrau!‹ hörte ich sie wieder und wieder sagen, bis ich endlich in einen unruhigen Schlummer sank; doch selbst im Schlaf wurde ich von Furcht gepeinigt.
»Die gute Kitty verließ mich an jenem Abend, und bis die neue Wärterin kam, sollte Frau Caruth meine Pflege übernehmen. Zur Nachtzeit betrat sie das düstere Krankenzimmer, zog ein Bündel unter ihrem Mantel hervor und machte sich an der Wiege zu schaffen. Ich schloß die Augen, um nicht zu sehen, wie sie die Kleider der beiden Kinder vertauschte. Wie ein finsterer Schatten glitt sie zur Türe hinaus und ich hörte ein Kind schreien. Das schnitt mir ins Herz gleich einem Messer: mein Knabe flehte mich an, ihn zu retten; aber alle Lebenskraft war von mir gewichen, ich fühlte mich sterbensmatt und fürchtete mich doch entsetzlich vor dem Tode.
»Als ich wieder zu klarem Bewußtsein erwachte, schien der helle Tag ins Zimmer. Ich ahnte nicht, daß inzwischen ein Monat vergangen war. Der Arzt sprach mit meinem Manne, dessen Blick auf mir ruhte.
»›Ihre Frau ist jetzt außer Gefahr,‹ sagte er. ›An ihrer Erhaltung habe ich übrigens nie gezweifelt; aber, daß der Knabe lebt, ist ein wahres Wunder.‹ Man brachte ihn mir ans Bett, er war frisch und rosig und ich schwelgte in seinem Anblick.
»Stellen Sie sich vor, Dora, daß ich Frau Caruth und ihren verruchten Plan gänzlich vergessen hatte und mir einbildete, es sei mein eigenes Kind. Welche Torheit, an den untrüglichen Instinkt der Mutter zu glauben! Ich liebte den Sohn jener abscheulichen Frau mit allen Fasern meines Herzens. Als mir die Erinnerung langsam zurückkehrte, brachte mich der Gedanke fast um den Verstand, aber an meiner Liebe änderte das nichts.
»Man sagte mir, Frau Caruth sei spurlos verschwunden. Nach zwei Jahren kehrte sie jedoch ins Dorf zurück und brachte einen kleinen Knaben mit – meinen und Roderichs Sohn, den wahren Erben von Dunscombe, den ich seiner Rechte beraubt hatte.
»Seitdem fühle ich mich unaussprechlich elend in dem Bewußtsein, was ich für eine unnatürliche Mutter bin. Aber ich konnte und kann den Knaben, den ich liebe, nicht für meinen Sohn hingeben, der meinem Herzen fremd ist.
»Frau Caruth war das wohl zufrieden. Ich gab ihr von Zeit zu Zeit Geld, und weiter verlangte sie nichts. Aber der Knabe, mein armer unglücklicher Sohn, ist auf böse Wege geraten. Heute kam sie, um mir zu sagen, man habe ihn auf einem Diebstahl ertappt und festgenommen. Ich müsse dafür sorgen, daß sein Vater ihn aus dem Gefängnis befreite, sonst würde sie alles verraten.
»O, ich bin das elendeste Wesen unter der Sonne. Helfen Sie mir, Dora! Was fange ich nun an?«
»Sie müssen die Wahrheit gestehen.«
»Das kann ich nicht. Wie sollte ich es wagen! Es brächte Roderich um, wenn er erführe, daß sein Sohn ein Dieb ist. Ich weiß wohl, wie grausam und sündhaft es ist, daß ich mein eigenes Kind hasse und einem andern an seiner Statt meine Liebe zuwende. Doch es läßt sich nicht ändern. Wenn Sie morgen Archibald sehen, werden Sie meine Gefühle begreifen und mich bemitleiden.«
Am andern Tag kam vom Bahnhof ein Jagdwagen am Haus vorgefahren; ein munterer krausköpfiger Schulknabe hüpfte heraus, sprang wie ein Gummiball die Stufen hinauf und in Alice Aylmers ausgebreitete Arme. Bebend und errötend schloß sie ihn an ihr Herz.
»Denke dir nur, Mutter, fast hätte ich mein ›Glück‹ verloren,« rief er, während er noch an ihrem Halse hing. »Es fiel mir von der Uhrkette auf den Bahnsteig und wäre fast auf die Schienen gerollt. Bitte, verwahre es, bis man es wieder an der Kette festmachen kann.« Damit legte er eine kleine silberne Medaille auf das Schränkchen, neben dem er stand.
»Gut, ich will es an mich nehmen,« versetzte sie. »Geh jetzt nur auf dein Zimmer.«
Sobald der Knabe fort war, schwand alle Freude aus Frau Aylmers Zügen und sie warf Dora einen flehenden Blick zu, dem diese jedoch auswich.
»Sein Glück? Was wollte er damit sagen?«
Dora hatte die Medaille in die Hand genommen und betrachtete sie von allen Seiten. Sie war alt und abgenutzt, doch konnte man noch eine weibliche Gestalt darauf erkennen, die eine Krone trug und rings von Pünktchen umgeben war, die wie Sterne aussahen.
»Das gehört auch zu der Geschichte,« sagte Alice. »Die Schaumünze war an einem dünnen weißen Band fest um des Kindes Hals gebunden, das ich zerschneiden mußte, um sie abzunehmen. Als ich Frau Caruth danach fragte, geriet sie zuerst in Verlegenheit und leugnete, etwas davon zu wissen.
»Nach einiger Zeit gestand sie mir aber, es sei ein Amulett, das ihr eine Zigeunerin gegeben habe. Natürlich glaube ich an solchen Zauber nicht, aber ich dachte, es könne nichts schaden, wenn der Knabe die Medaille an seiner Uhrkette trüge.«
»Haben Sie auch das Band aufbewahrt?« fragte Dora mit einer Erregung, die zu der unbedeutenden Tatsache in gar keinem Verhältnis stand.
»Jawohl,« versetzte Frau Aylmer verwundert. »Wollen Sie es sehen.«
Und sie schloß eine Schublade ihres Schreibtisches auf, wo unter andern Erinnerungszeichen aus Archibalds frühester Kindheit ein schmales weißes Band lag, das mit einem festen Knoten um des Kleinen Hals geknüpft gewesen und dicht am Knoten abgeschnitten war.
Dora Myrl nahm es der Mutter hastig aus der Hand, legte es neben des Knaben »Glück« auf den Tisch und betrachtete beides mit großer Aufmerksamkeit.
Dann wich plötzlich die Spannung aus ihren Mienen, und sie wandte sich mit strahlendem Lächeln zu Frau Aylmer hin.
»Es ist alles in Ordnung,« sagte sie.
»Aber was denn, liebe Dora?« fragte Alice erstaunt über die Zuversicht in Ton und Wesen der Freundin, die sie nicht zu deuten wagte.
»Sie sehen doch, daß das Band nur einmal zugeknüpft und nie wieder abgenommen worden ist?«
»Das ist ganz klar, aber –«
»Nur Geduld! Ich will Ihnen sagen, was das Amulett der Zigeunerin eigentlich ist: eine geweihte Denkmünze, auf deren Schutz die Katholiken fest vertrauen. Kein Wunder, daß Frau Caruth sich nicht erklären konnte –«
»O Dora, Sie erschrecken mich. Reden Sie weiter!«
»Sie werden mich gleich verstehen. Sagten Sie mir nicht, Ihre katholische Wärterin habe für den Knaben gebetet, noch ehe die Kinder vertauscht worden waren? Sie hat ihm die Medaille um den Hals gebunden, und sie ist niemals entfernt worden, bevor Sie das Band zerschnitten haben. Können Sie jetzt die frohe Botschaft erraten?«
»Es ist mein Kind, mein eigenes Kind!«
Die Worte kamen in gebrochenen Lauten über Frau Aylmers Lippen.
»Natürlich, Ihr eigenes Kind, liebe Alice,« versicherte Dora mit Bestimmtheit. »Ihre Mutterliebe hat sich nicht getäuscht. Frau Caruths Plan ist leicht zu durchschauen; sie hat weder die Kinder, noch deren Kleider jemals vertauscht, sonst hätte sie die Denkmünze bemerken müssen. Sie behielt ihr eigenes Kind, das sie gewiß auch auf ihre Art lieb hatte, und wußte Ihnen den Glauben beizubringen, daß es das Ihrige sei. Mochte Ihr Sohn nun leben, oder sterben, so hatte sie immer die Möglichkeit, aus dem Betrug Nutzen zu ziehen.«
Hoffnung und Freude malten sich in Frau Aylmers Blicken. Und als jetzt Archibald lustig ins Zimmer gestürmt kam, die Angelrute in der einen Hand und seine Ballkelle in der andern, war er nicht wenig erstaunt, als ihn die Mutter heftig an sich riß, so daß sein Spielzeug auf den Boden rollte, ihn mit Liebkosungen überhäufte und so fest ans Herz drückte, als wolle sie ihn nie wieder aus ihren Armen lassen. »Mein Sohn,« rief sie dabei, »jetzt endlich, endlich gehörst du mir ganz!«
Als Frau Caruth am nächsten Morgen Alice wieder zu sehen verlangte, wurde sie von Fräulein Dora Myrl empfangen. Bei dem Kreuzverhör, das die scharfsinnige junge Dame mit ihr anstellte, verlor die Betrügerin bald alle Fassung und gestand ihre Arglist ein. Mit Furcht und Zittern floh sie aus dem Dorfe und störte fortan Alice Aylmers Frieden niemals wieder.
»Sie sind unser guter Engel, Fräulein Myrl,« sagte Herr Aylmer an jenem Abend, als die drei beisammen saßen, und Alice lächelte dazu glückselig, wenn auch unter Tränen.
Sie hatte ihrem Gatten alles gestanden, und nun sie seiner Vergebung sicher war, kehrte wieder Ruhe in ihre Seele ein.
»Ja,« wiederholte Roderich Aylmer mit Nachdruck, »Sie sind unser guter Engel. Ihnen verdanken wir alles wiedergefundene Glück. Eine dunkle Wolke hing über unserm Hause und Sie waren die Sonne, die sie vertrieben hat. Nun müssen Sie uns aber auch gestatten, Ihnen unsre Dankbarkeit zu beweisen und –«
Da unterbrach ihn Dora mit munterem Lachen. »Reden Sie doch nicht in so poetischen Ausdrücken, Herr Aylmer,« sagte sie. »Ich bitte Sie nur, mich gelegentlich bei Ihren Freunden zu empfehlen, denn jetzt habe ich meinen Beruf entdeckt und will diese Karte sogleich nach der Druckerei schicken.«
Die junge Dame hatte, während sie sprach, etwas auf ein Stück Papier geschrieben, das sie jetzt vor Roderich Aylmer hinlegte.
In sauberer, klarer Schrift, fast so deutlich, als wäre sie gedruckt, waren darauf die Worte zu lesen:
Fräulein Dora Myrl, Geheimpolizistin.
Die versteckte Violine.
»Ich käme gerne, Sylvia, aber ich kann nicht.«
»Du mußt, Dora!«
»Das ist leicht gesagt. Ich habe einen dringenden Fall zu bearbeiten, der bis morgen fertig sein muß. Wo soll ich die Zeit hernehmen?«
»Du wirst es schon einrichten.«
Die beiden Mädchen hatten am Nachmittag in Doras freundlichem, kleinem Wohnzimmer behaglich bei einer Tasse Tee gesessen. Jetzt sprang Sylvia so hastig auf, daß ihr seidenes Kleid raschelte; schelmische Grübchen zeigten sich in ihren Wangen und ihre Augen leuchteten. Sie mußte wohl eine angenehme Überraschung für die Freundin auf dem Herzen haben, die sie nur noch mit Mühe zurückhielt.
Dora folgte ihr mit den Blicken.
»Höre Sylvia, ich bin zwar Geheimpolizistin, aber dein Rätsel kann ich nicht raten. Wenn du es etwa in deinem neumodischen seidenen Ärmel verbirgst, dann nur heraus damit! –«
Sylvia stellte sich in freudiger Erregung vor sie hin.
»Signor Nicolo Amati wird bei uns spielen. So, nun weißt du's.«
Dora Myrl dachte an keinen Widerstand mehr.
»Natürlich komme ich,« sagte sie lächelnd.
»Ob du Zeit hast oder nicht?«
»Unter allen Umständen!«
Eine solche Gelegenheit hätte sich auch niemand entgehen lassen, geschweige denn ein Mädchen wie Dora Myrl, der die Lebenslust in allen Fingerspitzen prickelte.
Ganz London – das heißt, das ganze gebildete und kunstliebende Publikum Londons, war noch immer voll davon, daß der berühmte Mäcen und Musikkenner, Lord Mellecent, bei einer Reise, die er mit seiner Tochter Sylvia durch Norditalien machte, in einem unter Weinlaub verborgenen Dörfchen am Ufer des Po einen wunderbaren Violinisten mit einer himmlischen Geige entdeckt hatte.
Der Lord war sofort überzeugt gewesen, daß die Geige ein Meisterwerk von Antonio Stradivarius sein müsse, und der Geiger erwies sich als ein direkter Nachkomme von Nicolo Amati, dessen Namen er trug. Seit Jahrhunderten hatte sich das kostbare Instrument von Generation zu Generation in der hochbegabten Familie Amati vererbt und für die einfachen Dorfbewohner Musik gemacht. Bei Hochzeiten hatte es zum Tanz aufgespielt und an den Gräbern hatte es seine Klage erschallen lassen. Unter allen Geigern aber, die je mit dem Bogen seine Saiten gerührt hatten, galt der junge Nicolo für den ausgezeichnetsten. Er wußte seiner wunderbaren Violine Töne zu entlocken, die lieblicher waren als das Vogelgezwitscher zur Frühlingszeit und wehmütiger als das Stöhnen des Herbstwindes in den entlaubten Bäumen.
Lord Mellecent geriet außer sich vor Entzücken und konnte sich von dem sonnigen Dörfchen nicht losreißen, bis es ihm nach einem Monat gelang, den Geiger samt seiner Violine nach dem nebligen London zu entführen. Man munkelte sogar, die blauen Augen seiner goldhaarigen Tochter Sylvia seien bei dieser Eroberung nicht ganz unbeteiligt gewesen.
Nicolo Amati hatte seine Kunst nicht auf theoretischem Wege erlernt. Die zauberhaften Melodieen, die er zu spielen verstand, wurden ihm nur, wenn man so sagen darf, durch das Gehör als Erbteil übermittelt. Seine ganze Seele war voll Sang und Klang, und die Musik entströmte den Saiten seines Instruments mit solcher Leichtigkeit, wie der Nachtigall ihr Lied aus der Kehle quillt. Als er nun die Meisterwerke der großen Komponisten kennen lernte, sah er sich in eine neue Welt versetzt, die ihm ungeahnte Genüsse bot.
Im Frühling war er nach London gekommen, und als man die Ankündigung las, daß er im Anfang des Herbstes zum ersten Male öffentlich auftreten werde, wurden die Gemüter von fieberhafter Erwartung erfüllt.
So standen die Dinge, als Lord Mellecents Tochter ihrer Freundin Dora Myrl die aufregende Nachricht verkündigte, daß der Künstler, noch vor dem öffentlichen Konzert, bei einem Empfangsabend in ihrem elterlichen Hause spielen würde.
Beide Mädchen waren Schulgefährtinnen gewesen. Die um drei Jahre ältere Dora, die sowohl in der Klasse als auf dem Spielplatz immer die Erste war, hatte sich der schüchternen blondlockigen Kleinen bei ihrem Eintritt in die Schule liebevoll angenommen und ihr alle Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt. Daraus entstand allmählich eine innige Freundschaft, doch war und blieb Dora für Sylvia immer eine Respektsperson, und die Grafentochter schaute mit Ehrfurcht und Liebe zu der Geheimpolizistin auf. Seit einiger Zeit widmete sie aber auch zugleich dem wunderbaren Italiener ihre Huldigung und Signor Nicolo Amati wurde häufig in den Gesprächen der Freundinnen erwähnt. Dora brannte vor Begierde, ihn zu sehen und zu hören, und zwar nicht um Sylvias willen. Sie selber liebte die Musik leidenschaftlich und wünschte sich persönlich davon zu überzeugen, ob der neue Abgott am Kunsthimmel des Weihrauchs würdig sei, den man ihm streute.
»Ich kenne natürlich seinen unvergleichlichen Wert,« sagte Sylvia, als die erste Aufregung der Mädchen verflogen war und sie wieder ruhig Platz genommen hatten. »Außer mir gibt es in ganz London aber nur noch zwei Leute, die ihn gehört haben, Papa und seinen alten Lehrer. Alle übrigen kommen fast um vor Neugier, gerade wie du, Dora. Und wenn du etwa glaubst, es wird sich herausstellen, daß mein Schwan nur eine Gans ist, so irrst du dich gewaltig. Wir werden an dem Abend nicht mehr als fünfzig Personen bei uns sehen, obgleich man mich förmlich bestürmt hat, um Einladungen zu erhalten. Seit vierzehn Tagen sehe ich mich genötigt, verkleidet umherzugehen, sonst wäre ich nicht mit dem Leben davongekommen.« In ihrer glückseligen Gemütsstimmung plauderte Sylvia immer weiter.
»Monsieur Gallasseau kommt auch. Nicht wahr, du kennst ihn doch? Er ist der zweitbeste Violinspieler der Welt. Bis jetzt hält er sich für den ersten Meister, aber er wird seinen Irrtum schon inne werden. Nein, schüttle nur nicht so ernsthaft den Kopf; du hast ja unsern Italiener noch nicht gehört?«
»Du meinst wohl deinen Italiener, Sylvia?«
»Wenn du mir die Worte im Munde verdrehst, Dora, nehme ich die Einladung für dich zurück, hörst du! Komm nur ja recht früh. Jetzt muß ich aber gehen.«
Sie war bei dem Scherz der Freundin lieblich errötet und verließ rasch das Zimmer.
Unter den fünfzig Eingeladenen, die im großen Empfangssaal des Mellecentschen Hauses in der Parkstraße versammelt waren, herrschte die freudigste Spannung! ja sie konnten es kaum erwarten, bis die Diener, die mit silbernen Teebrettern geräuschlos zwischen den Gästen umhergingen, die Erfrischungen herumgereicht hatten. Aus dem leisen Gemurmel der Stimmen hörte man immer nur einen Namen heraus oder allerlei abgerissene Sätze, wie: »Man sagt, es sei entzückend!« – »Die reinste Sphärenmusik!« – »Die ganze Geige soll aus einem Stück Holz geschnitzt sein!« – »Und er ist noch so jung und ein so schöner Mann!« – »Er hätte sich gar nicht von Lord Mellecent überreden lassen, nach London zu kommen, wäre Sylvia nicht gewesen. Aber man sagt, sie habe alles daran gesetzt.« – »Der Lord kann aber doch unmöglich seine Einwilligung geben. Er ist viel zu ...« – »Heutzutage ist nichts unmöglich. Das Genie dringt überall durch und zerbricht alle Schranken.«
Unterdessen saß Sylvia unbefangen neben Dora Myrl in der vordersten Zuhörerreihe, gegenüber dem Podium, in dessen Mitte das Violinpult auf dem dunkelroten Teppich stand. Sie sah reizend aus in dem weißen Kaschmirkleid mit den blauen Bandschleifen: freudige Erwartung strahlte aus ihren Blicken und ihre Wangen glühten wie die Rosen.
Jetzt entstand eine plötzliche Stille und aller Augen richteten sich auf das Podium, als Lord Mellecent mit zwei Herren aus einer Seitentür trat. Einige der ersten musikalischen Größen Londons folgten ihnen.
Der berühmte Franzose Gallasseau, ein großer, breitschulteriger Mann mit dunkler Gesichtsfarbe, schritt lächelnd zu Mellecents Rechten; doch der junge Italiener zu seiner Linken fesselte vorzugsweise die Blicke der Anwesenden. Hätte auch bisher nichts von seinem Genie verlautet, so würde seine Schönheit allein die allgemeine Aufmerksamkeit erregt haben. Man glaubte, eine griechische Göttergestalt zu sehen; sein blühendes Gesicht trug wahrhaft klassische Züge und aus seinen schwarzen Augen sprühte feurige Begeisterung.
Im Saal war alles totenstill, nur auf dem Podium hörte man Stimmengeflüster. Der geschmeidige Franzose bestand mit höflichen Worten darauf, seinem jungen Berufsgenossen den Vortritt zu lassen, und nach einigem Hin- und Herreden trat Nicolo Amati vor auf die Estrade.
Eine wundervolle alte Geige, die beim Kerzenlicht ihre satte, dunkelrote Färbung zeigte, schmiegte sich an sein Kinn. Er schien sie nur zu liebkosen, so leicht war der Griff, mit dem er sie hielt. Als er dann mit dem Bogen über die Saiten strich, lauschte das Publikum in atemloser Erregung. Solche Töne waren noch nie erklungen, seit Orpheus durch die Macht seiner Musik wilde Tiere gezähmt, Bäume und Steine bewegt und den grimmen Beherrscher der Unterwelt erweicht hatte. Die wahrhaft entzückenden, berauschenden Klänge nahmen Herzen und Sinne gefangen. Wechselvoll wie das Leben selbst riefen sie bald Freude und Liebe, bald Gram und Kummer wach. Gleich einem Regen vielfarbiger Funken perlten die Noten rasch und klar hervor, und dann wimmerte, klagte oder sang die Zaubergeige wieder in der Hand des Meisters. Sie floß über von süßen Melodieen, als habe sie allen Wohlklang bewahrt, der ihr je entlockt worden war, und wolle im Schatz ihrer Erinnerung schwelgen.
Als die Musik endlich in langen, schmelzenden Akkorden dahinstarb, füllten sich aller Augen mit Tränen und eine Weile schienen die Zuhörer noch im Geist den himmlischem Klängen zu lauschen. Dann brach der Beifall los, aber nicht wild und stürmisch, sondern gedämpft, mit ehrfurchtsvoller Scheu, wie aus tiefbewegten Herzen kommend.
Amati verbeugte sich dankend und Dora flüsterte: »Sein Spiel hat ihn selber gerührt, sieh nur den feuchten Glanz in seinem Blick.«
Sylvia erwiderte kein Wort, sie saß regungslos da und ihre Augen leuchteten wie verklärt.
Jetzt erhob sich ein Gemurmel im Saal.
Gallasseaus Namen wurde gerufen, aber ohne besondere Wärme. Doch der Franzose wollte auf nichts eingehen; er weigerte sich zu spielen. »Nein, nein,« sagte er und zog seine breiten Schultern in die Höhe. »Ich will den Zauber nicht brechen. Der Besiegte grüßt den Sieger,« fügte er hinzu, indem er sich lächelnd vor Amati verneigte, »doch möchten Sie mich gewiß nicht öffentlich an ihren Triumphwagen ketten, mon ami. Wenn ich Ihnen allein vorspielen und Ihrer Geige zuhören dürfte, würde ich es als eine Gunst betrachten. Aber das ist vielleicht zu viel verlangt.«
Ehe noch Lord Mellecent Einwendungen erheben konnte, erwiderte Amati höflich und in fließendem Englisch, das im Munde des Italieners einen besonderen Wohllaut gewann: »Sie sind allzu bescheiden, Monsieur Gallasseau. Es wird mir eine Ehre sein, wenn Sie mich morgen um zwölf Uhr in meiner Wohnung aufsuchen wollen. Ich stehe dann samt meiner Violine ganz zu Ihren Diensten.«
Gallasseau dankte ihm verbindlich und ohne eine Spur von Neid. Die meisten Zuhörer hatten sich erhoben und entfernten sich geräuschlos, als stünden sie noch unter dem Zauberbann der Musik.
»Dora, du bleibst!« flüsterte Sylvia der Freundin zu. »Amati verbringt den Abend bei uns und wird noch mehr spielen. Ihr müßt gute Bekannte werden.«
»Es ist nicht mein Verdienst, Signorina,« sagte der Italiener im Laufe des Abends zu Dora Myrl, die kaum Worte fand, und ihr Entzücken über seine Kunst auszusprechen. »Ich spiele nicht; meine Geige tut es. Sie ist voller Melodieen, die nur schlafen, bis mein Bogenstrich sie weckt.«
»Ein wunderbares Instrument!« fiel jetzt Lord Mellecent ein, der sich die Gelegenheit, sein Steckenpferd zu reiten, nicht entgehen lassen wollte. »Sie wissen doch,« fuhr er zu Dora gewandt fort, »daß es ein Meisterwerk von Stradivarius ist! dessen eigene Handschrift bürgt uns dafür. Er selbst hat die Violine seinem Paten, dem Sohn seines Lehrers Nicolo Amati, geschenkt. Zweihundert Jahre lang haben Mitglieder der Familie Amati auf der Geige gespielt und ihr Ton ist heute noch zauberhafter als an dem Tage, da sie aus des Meisters Hand hervorging. Keine Violine in der ganzen Welt läßt sich mit dieser vergleichen. Sehen Sie nur die Schnecke an, wie sauber, scharf und fein sie geschnitzt ist! Wie anmutig ist die Biegung des Halses, wie schön geschweift der Resonanzboden. Und erst der Firnis, dieser wunderbare Firnis, dessen Bereitung für die heutige Welt ein unerforschtes Geheimnis ist – er glüht von innen heraus, wie Drachenblut.«
Mellecent hielt die Violine gegen das Licht und die glatte Oberfläche funkelte wie dunkelroter Wein in fleckenloser Schönheit! nur an den Stellen, welche die Hand zahlloser Geiger während der langen Reihe von Jahren berührt hatte, schimmerte die Unterlage von goldgelbem Firnis durch das abgenutzte hellere Rot hindurch.
Dora, die überall Bescheid wußte, verstand sich auch auf Violinen und konnte den Wert des herrlichen Instruments gebührend würdigen. Die ganze Nacht hindurch klang die Musik ihr noch im Ohr und in der Seele fort; auch den Tag über mischte sie sich in alle ihre Gedanken, und störte sie bei der Bearbeitung des dringenden Falls, den sie gerade unter den Händen hatte.
Da kamen rasche Schritte die Treppe herauf, und ohne anzuklopfen, stürmte Sylvia ins Zimmer. Dora hatte sich mit ihrem Drehstuhl umgewandt und sah Nicolo Amatis schönes Gesicht mit trostlosem Ausdrucke hinter dem hastig erregten Mädchen auftauchen. Sobald Sylvia zu Atem gekommen war, ergriff sie das Wort! »Nicht wahr, Dora, du wirst sie wieder finden! Ich habe es dem Signore versprochen. Seine Violine, weißt du – sie ist gestohlen – verschwunden – aber du findest sie gewiß.«
»Wenn ich kann,« war Doras ruhige Antwort. Sie preßte die Lippen zusammen und in ihren klaren, grauen Augen blitzte es seltsam auf. »Vor allem muß ich die näheren Umstände erfahren. Beruhige dich, Sylvia, und nimm Platz. Setzen Sie sich, Signor Amati. Nun erzählen Sie mir, wie das zugegangen ist.«
Amatis Bericht über seinen Verlust wurde häufig von Sylvias teilnehmenden Ausrufungen unterbrochen. Viel hatte er nicht mitzuteilen. Monsieur Gallasseau war statt um zwölf Uhr, wie sie verabredet hatten, schon um Elf gekommen.
Als er mit seinem Violinkasten in einer Droschke vorfuhr, und man ihm sagte, Signor Amati sei ausgegangen, war er sehr enttäuscht. Zuerst beschloß er, zu warten, gab aber diese Absicht gleich wieder auf. Schon nach einigen Minuten kam er, den Violinkasten noch immer auf dem Arm, die Treppe herunter und fuhr fort.
Man teilte dies Amati mit, als er um zwölf Uhr nach Hause kam. Gleich darauf wollte er seine Geige aus dem Kasten nehmen, aber sie war verschwunden. Natürlich fuhr er sofort nach der etwa zwei Meilen entfernten Wohnung des Franzosen. »Als ich dort ankam,« erzählte Amati weiter, »sagte man mir, Monsieur wohne im vierten Stock. Am Eingang fand ich den Türhüter.
»›Kann ich Monsieur Gallasseau sprechen?‹ fragte ich.
»›Monsieur hat strengen Befehl gegeben, daß man ihn auf keinen Fall stören soll.‹
»›Haben Sie die Güte, ihm meine Karte zu bringen.‹
»Der Mann ging mit der Karte zum Fahrstuhl, und während er dort einen Augenblick warten mußte, lief ich unbemerkt vorbei und die steile Treppe hinauf.«
»Bravo!« murmelte Dora leise.
»Ich öffnete die Türe des Wohnzimmers im vierten Stock – doch es war leer. Da hörte ich über mir Geigentöne – das war meine Violine. Rasch stieg ich weiter. – Die Klänge wurden lauter und voller. O, er versteht zu spielen, dieser Monsieur Gallasseau. Ich drückte auf die Klinke; die Türe war verschlossen. Als ich heftig klopfte, hörte die Musik sofort auf; ich vernahm Schritte im Zimmer und ein Metallgeklingel, darauf öffnete sich die Türe und Monsieur Gallasseau stand lächelnd auf der Schwelle.
»›O, Signor Amati,‹ sagte er, ›wie freue ich mich, Sie zu sehen.‹ Indem kam der Türhüter herauf, doch er schickte ihn zornig fort. ›Ich war eben in Ihrem Hause,‹ erklärte er mir dann, ›fand Sie aber nicht. Haben Sie sich in der Stunde geirrt, oder liegt die Schuld an mir? Dann muß ich Sie freilich sehr um Entschuldigung bitten.‹
»Ich stand einen Augenblick wie verdutzt da über seine Frechheit. Dann brach ich los: ›Ich komme, um meine Violine zu holen, die Sie mir entführt haben.‹
»Er reichte mir mit verwunderter Miene seine eigene Geige hin, die auf dem Tisch lag. ›Wenn Sie spielen wollen – sie steht Ihnen zu Diensten. Doch ist Ihr Instrument natürlich viel schöner.‹
»›Meine Geige ist mir gestohlen worden, Monsieur.‹
»›Gestohlen? – Wie ist das möglich? Sie wissen also nicht, wo sie ist?‹
»›Doch, ich weiß es,‹ rief ich voll Zorn. ›Vor wenigen Minuten hörte ich Sie noch darauf spielen, ehe Sie die Tür öffneten.‹
»Er wollte auffahren! dann zuckte er lächelnd die Achseln. ›Eine wunderliche Behauptung, Signore,‹ sagte er; ›aber ich begreife, daß Sie Ihre schöne Geige über alles lieben. Durchsuchen Sie gefälligst mein Zimmer.‹
»Nun suchte ich überall, selbst an den unwahrscheinlichsten Plätzen, konnte aber nichts entdecken.
»›Haben Sie sich nun überzeugt?‹ fragte er höflich.
»›Daß Sie sich ein sehr schlaues Versteck ausgedacht haben müssen,‹ entgegnete ich.
»›Ich will Ihnen die Grobheit verzeihen, Signore, weil Sie einen so schweren Verlust erlitten haben. Adieu!‹
»›Nein, nicht adieu, Monsieur. Verlassen Sie sich darauf, ich kehre zurück.‹
»›Der Signore wird mir stets willkommen sein,‹ erwiderte er.
»Unterwegs bin ich sodann der Signorina Sylvia begegnet und sie hat mich hergebracht.«
Dora hatte mit halbgeschlossenen Augen und zusammengezogenen Brauen aufmerksam zugehört.
»Ich möchte noch ein paar Fragen an Sie stellen. Bitte Sylvia, sei du ganz still. – Hat Monsieur Gallasseau Ihnen offen ins Gesicht gesehen?«
»Jawohl, und er lächelte dabei. Solange ich im Zimmer war, ließ er mich nicht aus den Augen.«
»Haben Sie nicht bemerkt, ob er am Halse – doch, nein, auf so etwas gibt ein Mann nicht acht. – Können Sie mir sagen, ob ein Spiegel im Zimmer hängt?«
»O, ja, das wollte ich noch erwähnen, es waren vier kleine Spiegel in Metallrahmen da, die in Messingketten hingen. Aber alle vier waren mit dem Glas nach der Wand gekehrt.«
»Wie sonderbar. Haben Sie die Spiegel nicht umgewendet, Signore?«
»Nein, aber ich habe sorgfältig untersucht, ob nicht vielleicht dahinter eine Öffnung in der Mauer war. Ich fand jedoch nichts dergleichen.«
»Und sind Sie überzeugt, daß die Violine sich im Zimmer befand, als Sie klopften?«
»Vollkommen überzeugt. Ich habe sie gehört.«
»Könnten Sie sich über den Ton nicht täuschen?«
»Nein, das ist unmöglich! Eine Mutter würde das Lachen ihres Kindes, ein Liebender die Stimme der Geliebten nicht mit größerer Sicherheit erkennen.«
»Und Sie haben keine Ahnung, wo die Geige versteckt war?«
»Nicht die entfernteste.«
»Aber du weißt es, Dora!« rief jetzt Sylvia mit Ungestüm.
»Das muß sich erst noch herausstellen. Doch jetzt an unser Geschäft. Sie sagen, Signore, daß im Hause eine Wohnung leer steht, die sich gerade unter Monsieur Gallasseaus Zimmer befindet? Gut, morgen miete ich diese Wohnung, und ich werde mich freuen, wenn Sie mich dort so oft und so lange besuchen wollen, als es Ihre Zeit erlaubt. Das heißt, falls du nichts dagegen einzuwenden hast, Sylvia.«
Ein kleiner Puff und ein Kuß war Sylvias Antwort. Der Scherz gab ihr neue Zuversicht; Dora würde schwerlich so heiter sein, wenn sie ihrer Sache nicht gewiß wäre.
Als Amati am dritten Tage Dora in ihrer neuen Wohnung aufsuchte, begegnete ihm Gallasseau auf der Treppe und grüßte ihn mit verbindlichem Lächeln. Noch am selben Nachmittag, während Amati und Dora zusammen beim Tee saßen, ließen sich plötzlich die wundervollen Töne einer Geige vernehmen. »Das ist meine Violine, ja sie ist es!« rief Nicolo ausspringend; »ich will sie schon finden!«
»Nicht so hastig,« sagte Dora und legte die Hand beschwichtigend auf seinen Arm, »Sie haben es schon einmal vergebens versucht; jetzt ist die Reihe an mir.«
»Lassen Sie uns zusammen gehen.«
»Wie Sie wollen. Doch glaube ich nicht, daß Gallasseau uns beide einlassen wird.«
Leise schlichen sie die teppichbelegte Treppe hinauf. Immer lauter und entzückender ertönte die Musik.
»Haben Sie keinen Zweifel?« fragte Dora.
»Ganz und gar keinen.« Amati wollte die Tür öffnen, fand sie aber verschlossen. Sobald er daran rüttelte, schwieg die Geige; man hörte Schritte im Zimmer, der Schlüssel wurde umgedreht und Monsieur Gallasseau erschien in der offenen Tür.
»Guten Abend, Mademoiselle,« sagte er lächelnd, »guten Abend, Signor. Sie kommen, mich um Entschuldigung zu bitten, nicht wahr?«
»Ich komme, um meine Nachforschung fortzusetzen,« war die kurze Antwort.
»Was, wirklich?« sagte er mit verächtlichem Achselzucken. »Nun, gut, sei es drum. Aber es ist das letzte Mal, daß ich mir die Störung gefallen lasse.«
Dora und Amati wollten zusammen hinein; doch der Franzose blieb auf der Schwelle stehen, den Eingang versperrend.
»Nein, nein, beide dürfen Sie nicht eintreten. Entweder das Fräulein oder Sie, Signore. Mir wäre Mademoiselle natürlich angenehm.«
»Wie Sie wünschen, Monsieur,« sagte Dora. »Bitte, warten Sie unten in meinem Wohnzimmer, Signore; in fünf Minuten bringe ich Ihnen Ihre Violine.«
Belustigt lächelnd trat Gallasseau rückwärts ins Zimmer hinein und ließ Dora an sich vorbei. »Es ist sehr komisch,« sagte er, »aber ich heiße Sie, Mademoiselle, in meiner bescheidenen Wohnung willkommen. Finden Sie die Violine nur – wenn Sie können.«
Dora warf einen raschen Blick im Zimmer umher, doch begab sie sich nicht aufs Suchen.
»Weshalb haben Sie die Spiegel fortgenommen, Monsieur?« fragte sie ruhig.
Er machte ein bestürztes Gesicht, doch faßte er sich gleich wieder: »Meine Spiegel, ja so! Hätte ich gewußt, daß mich Mademoiselle mit einem Besuch beehren wollte, so würde ich sie noch nicht zum Lackierer geschickt haben. Es tut mir leid, daß Mademoiselle die Spiegel vermißt.«
»O, das tut nichts. Aber setzen Sie sich, Monsieur. Während ich meine Forschung anstelle, brauchen Sie doch nicht stehen zu bleiben.«
»Verzeihung, Mademoiselle, es wäre unhöflich, mich in Ihrer Gegenwart zu setzen. Ich will lieber stehen und Mademoiselle betrachten, wenn es gestattet ist.«
»Ganz wie Sie wollen.« Dora trat an den Tisch neben der Tür, wo des Franzosen eigene Violine lag. »Hier saßen Sie, Monsieur, und haben gespielt, als wir auf die Klinke drückten?«
»Jawohl, Mademoiselle.«
»Und Sie machten die Tür sofort auf?«
»Gewiß, im nächsten Augenblick!«
»Der Stuhl steht nur ein paar Schritte von der Tür. Da blieb Ihnen also keine Zeit, eine Violine zu verstecken.«
»Ganz und gar keine, Mademoiselle.«
»Außer, wenn Sie sie in Ihrer Nähe verbargen.«
»Natürlich,« stimmte der Franzose bei, der verwundert dreinschaute.
Jetzt gab Dora dem Gespräch plötzlich eine andere Wendung.
»Verzeihung, Monsieur, aber Sie haben da im Kragen ein weißes Band, das ganz fest angezogen ist. Das muß ja sehr unbequem sein. Sie erlauben mir wohl?«
Sie streckte die Hand aus, doch er wich erschreckt vor ihr zurück.
»Ach, es ist ja auch gar nicht nötig,« fuhr Dora gelassen fort. »Sie haben sich ohnehin bereits überzeugt, daß Ihr Spiel entdeckt ist. Bitte, drehen Sie sich um.«
Monsieur Gallasseau zögerte noch eine Sekunde, dann lächelte er mit süß-saurer Miene.
»Sie sind sehr klug, Mademoiselle,« sagte er, und als er sich umwandte, hing ihm wirklich die Violine am Rücken herunter, wie einer schönen jungen Dame ihr Goldhaar.
Der Krückstock.
Der junge Mann atmete erleichtert auf, als er den kleinen schwarzen Reisesack aus derbem Kalbleder dicht neben sich auf einen Platz in dem leeren Eisenbahncoupé gestellt hatte.
Es kostete ihn eine offenbare Anstrengung, den Sack zu heben, und doch war er groß und kräftig gebaut, auch gewissermaßen hübsch. Er hatte hellblondes Haar und trug einen Schnurrbart. Der Ausdruck seines runden Gesichts war ehrlich und gutmütig, doch nicht besonders geistreich, und in den blaßblauen Augen stand jetzt seine innere Sorge und Unruhe zu lesen. Kein Wunder – denn auf dem armen Menschen lastete eine schwere Verantwortlichkeit. Der unscheinbare schwarze Sack enthielt fünftausend Pfund Sterling in Gold und Banknoten, und er – ein jüngerer Kommis in dem berühmten Bankhaus Gower & Grant – sollte diesen Schatz von der Hauptbank in London nach einem zweihundert Meilen entfernten Zweiggeschäft auf der Eisenbahn mitnehmen. Der ältere und erfahrenere Kommis, dem die Beförderung des Goldes für gewöhnlich oblag, war im letzten Augenblick auf ganz unerklärliche Weise erkrankt und man hatte Jim Pollock gewählt, ihn zu vertreten. »Pollock ist groß und stark genug, um jedem, der ihm etwas anhaben will, den Schädel einzuschlagen,« sagte der Bankdirektor, »der ist unser Mann.«
So erhielt denn der junge Kommis den heiklen Auftrag, und es war dem kräftigen Burschen so bange dabei zu Mut wie einem kleinen Kinde, während er doch sonst keine Furcht kannte. Auf der ganzen Strecke hatte er den Sack immer mit der rechten Hand festgehalten und ihn nicht aus den Augen gelassen. Doch jetzt war der Anschluß in Eddiscombe glücklich erreicht! der Schaffner schloß den Reisenden in ein leeres Coupé erster Klasse ein und bis zum nächsten Haltepunkte ging die Fahrt siebenundvierzig Meilen ohne Unterbrechung weiter.
Froh, eine Zeitlang seine Besorgnis abschütteln zu können, lehnte sich Pollock in die weichen Kissen zurück, zündete seine Pfeife an, zog eine Sportzeitung aus der Tasche und vertiefte sich in den Bericht über den internationalen Wettkampf der Fußballklubs in Rugby. Jim hatte den Ehrgeiz, dort selbst einmal einen Preis zu gewinnen.
Der Zug verließ die Bahnstation und rasselte in gleichmäßiger Schnelligkeit durch das ebene Land. Jim las noch immer in seiner Zeitung: dabei bemerkte er nicht, daß zwei scharfe Augen unter dem Sitz gegenüber verstohlen aus dem Dunkel nach ihm spähten. Er sah nicht, wie eine lange, sehnige Gestalt sich einer Schlange gleich auseinanderwand und hervorkroch. Ahnungslos saß er da, bis ihm plötzlich zwei Mörderhände die Kehle zuschnürten und ein Knie ihm die Brust einzudrücken drohte.
Wohl war Jim stark, aber ehe er noch Zeit fand, seine Kraft zu betätigen, lag er schon auf dem Fußboden des Coupés hingestreckt und ein in Chloroform getränktes Tuch war ihm fest in Mund und Nase gesteckt.
Im ersten Augenblick wollte er verzweifelte Gegenwehr leisten und den tückischen Feind von sich schleudern. Doch das Betäubungsmittel raubte ihm Besinnung und Stärke: er fiel schwer auf den Rücken und lag wie ein Stück Holz am Boden.
Bevor den wackeren Burschen das Bewußtsein verließ, dachte er noch: »Nun ist das Geld verloren!« Dies war auch sein erster Gedanke, als er ganz schwindlig im Kopf und mit zermartertem Hirn aus der todähnlichen Ohnmacht erwachte. Der Zug fuhr mit voller Geschwindigkeit: die Coupétür war noch verschlossen, außer ihm befand sich kein Mensch im Wagen – aber der Sack war fort.
Wie wahnsinnig suchte Jim in den Netzen und unter den Bänken – alles leer. Er beugte sich zum Fenster hinaus und schrie um Hilfe.
Der Zug mäßigte seine Geschwindigkeit allmählich und fuhr schnaubend in die Station ein. Schaffner kamen herbeigestürzt und der Stationsvorsteher folgte ihnen bedächtig, eingedenk seiner Würde. Bald drängte sich eine dichte Menge um die Coupétür.
»Man hat mich beraubt,« schrie Jim, »ein schwarzer Sack mit fünftausend Pfund ist mir gestohlen worden.«
Jetzt bahnte sich der Inspektor einen Weg durch die Menge.
»Wo hat der Raub stattgefunden, Herr?« fragte er den aufgeregten Jim, der mit zerzausten Haaren in unordentlichem Aufzug vor ihm stand, mißtrauisch betrachtend.
»Eine Strecke hinter Eddiscombe, wo ich umgestiegen war.«
»Wie ist das möglich? Zwischen hier und Eddiscombe haben wir keine Haltestelle und das Coupé ist leer.«
»In Eddiscombe schien es mir auch leer, aber ein Mann muß unter dem Sitz versteckt gewesen sein.«
»Jetzt ist niemand dort versteckt,« sagte der Bahninspektor trocken. »Sie werden gut daran tun, die Polizei in Kenntnis zu setzen, es ist ein Detektiv auf dem Bahnsteig.«
Der Polizist, dem Jim Pollock seine Geschichte erzählte, hörte ihm zu, ohne eine Miene zu verziehen, und erklärte dann, er müsse ihn in Untersuchungshaft nehmen, bis die nötigen Nachforschungen angestellt wären.
Sofort wurde ein Telegramm nach Eddiscombe abgesandt, wobei sich ergab, daß die Verbindung unterbrochen war. Diese Störung konnte erst vor ganz kurzem eingetreten sein, denn noch eine Stunde zuvor war eine Depesche dort richtig angelangt. Die Ursache der Betriebsstörung ließ sich leicht entdecken, denn neun Meilen hinter Eddiscombe fand man eine Stelle der Leitung, wo mehrere Drähte fast bis auf die Erde herabgezogen und die Isolatoren an einer der Telegraphenstangen zertrümmert waren. Der Boden ringsum zeigte Spuren schwerer Fußtritte, die man durch mehrere Felder bis auf die Landstraße verfolgen konnte, wo sie sich verloren. Trotz aller Bemühungen gelang es der Polizei nicht, noch weitere Anhaltspunkte aufzufinden.
Einige Tage später wurde eine Visitenkarte für Dora Myrl in ihrem kleinen Bureauzimmer abgegeben, wo sie emsig arbeitend am Schreibtisch saß. Gleich darauf trat der bekannte Bankier Sir Gregor Grant, ein behäbiger Herr mittleren Alters mit wohlwollendem Gesicht, bei ihr ein.
»Mein Freund, Lord Mellecent, hat mir von Ihnen erzählt, Fräulein Myrl,« sagte er, ihr die Hand reichend. »Ich bin Teilhaber des Bankhauses Gower & Grant und komme, Sie um Ihren Beistand zu bitten. Vermutlich haben Sie von dem Raub auf der Eisenbahn gehört.«
»Was in den Zeitungen stand habe ich gelesen.«
»Weiter wissen wir auch nicht viel. Ich komme selbst zu Ihnen, Fräulein Myrl, weil mich die Sache persönlich sehr nahe angeht. Es ist nicht sowohl der Verlust des Geldes, den ich beklage, obgleich er bei der Höhe der Summe wohl empfindlich ist. Aber auch die Ehre der Bank steht auf dem Spiel. Wir haben immer unsern Stolz darein gesetzt, daß die Angestellten sich bei uns wohl befanden und unsre Fürsorge ist auch belohnt worden. Seit fast einem Jahrhundert ist kein einziger Fall von Betrug oder Unredlichkeit in unserm Bankhause vorgekommen und wir möchten seinen makellosen Ruf womöglich unbefleckt erhalten. Gegen unsern Gehilfen James Pollock liegt ein starker Verdacht vor. Ist er schuldig, so soll er natürlich bestraft werden. Aber ich hoffe, daß sich seine Unschuld beweisen läßt und deshalb komme ich zu Ihnen.«
»Was glaubt denn die Polizei?«
»Sie hält ihn für den Schuldigen und jeden Zweifel für ausgeschlossen. Nach ihrer Ansicht war niemand im Coupé, folglich konnte es auch niemand verlassen. Pollock muß das Geld einem Helfershelfer durchs Fenster zugeworfen haben. Man will sogar im Boden die Spur gefunden haben, die der schwere Sack beim Fallen hinterließ – etwa hundert Meter näher an Eddiscombe als die Stelle, wo die Telegraphendrähte beschädigt sind.«
»Was ist denn bis jetzt geschehen?«
»Man hat den jungen Pollock festgenommen und steckbrieflich nach einem Mann mit einem schweren kalbledernen Sack gesucht. Das ist alles. Den Hauptdieb meint die Polizei ja ohnehin schon in Händen zu haben.«
»Und was ist Ihre Ansicht?«
»Offen gestanden, Fräulein Myrl, mir ist die Sache zweifelhaft. Allem Anschein nach würde man es für unmöglich halten, daß jemand aus einem Zug entkommt, der in voller Fahrt ist. Aber ich habe unsern jungen Beamten im Gefängnis gesprochen und weiß nicht, was ich davon denken soll.«
»Könnte ich ihn nicht auch sehen?«
»Das würde mich sehr freuen.«
Nachdem Dora kaum fünf Minuten lang mit James Pollock verhandelt hatte, zog sie den Bankier beiseite. »Ich glaube, jetzt zu wissen, wie ich es anfangen muß, Sir Gregor,« sagte sie. »Doch kann ich den Fall nur unter einer Bedingung übernehmen.«
»Ich stelle Ihnen jede Summe zur Verfügung.«
»Um mein Honorar handelt es sich nicht. Davon ist bei mir nie die Rede, bevor der Fall entschieden ist. Aber ich brauche Herrn Pollocks Beistand. Ihr Gefühl hat Sie nicht betrogen – der junge Mann ist unschuldig.«
Auf der Polizei herrschte große Unzufriedenheit, als die Bank ihre Klage zurückzog und James Pollock aus dem Gefängnis entlassen wurde. Man munkelte sogar, die Staatsanwaltschaft werde Einspruch erheben. Pollock fuhr unterdessen in Dora Myrls Gesellschaft mit einem Morgenzug von London nach Eddiscombe. Er empfand eine grenzenlose Dankbarkeit und Ergebenheit für seine Befreierin. Natürlich bildete der Raubanfall ihr Hauptgespräch unterwegs.
»Der Sack war wohl recht schwer, Herr Pollock?« fragte Dora.
»Allzuweit hätte ich ihn nicht tragen mögen.«
»Und doch fehlt es Ihnen nicht an Kraft, sollte ich meinen.« Und sie prüfte seine vorstehenden Muskeln höchst sachverständig mit den Fingerspitzen, wobei er über und über rot wurde.
»Würden Sie den Räuber wieder erkennen, wenn Sie ihn sähen?«
»Auf keinen Fall. Ehe ich noch wußte, wie mir geschah, hatte er mir die Kehle zugedrückt und mir das Tuch mit dem Chloroform in den Mund gestopft. Nicht wahr, Sie glauben doch was ich sage, Fräulein Myrl? Die andern behaupten alle, es sei gar kein Mann dagewesen. Verübeln kann ich es ihnen freilich nicht, denn wie soll der Kerl den Zug verlassen haben, der mit einer Geschwindigkeit von sechzig Meilen die Stunde dahinsauste. Mir ist das unbegreiflich, und meiner Treu, wenn ich's nicht selber wäre, sondern ein andrer, ich würde ihn nach den Indizien auch für schuldig halten. Wissen Sie denn, wie das Kunststück gemacht worden ist, Fräulein Myrl?«
»Das bleibt einstweilen noch mein Geheimnis. Nur so viel kann ich Ihnen sagen, daß ich mich in dem Städtchen Eddiscombe nach einem Fremden mit einem Krückstock umsehen werde, wenn er auch keinen schwarzen Sack trägt.«
In Eddiscombe gab es drei Gasthäuser, aber Herr Mark Brown und seine Schwester machten große Ansprüche. Sie versuchten es mit allen dreien nacheinander, immer nach einem Fremden ausspähend, der einen Krückstock trug. In ihrer Mußezeit durchstreiften sie die Stadt und Umgegend auf zwei vorzüglichen Fahrrädern, die sie wochenweise mieteten.
Als Fräulein Brown (sonst Dora Myrl genannt) eine Woche nach ihrer Ankunft an einem sonnigen Nachmittag die Treppe des dritten Gasthauses hinunterging, begegnete ihr ein Mann in den besten Jahren, der ein klein wenig hinkte und sich auf einen starken eichenen Stock stützte, der glänzend lackiert war und einen gebogenen Griff hatte. Ohne ihn weiter zu beachten, schritt sie an ihm vorüber, aber am Abend plauderte sie mit dem Stubenmädchen und erfuhr, der Fremde sei ein Handlungsreisender, ein gewisser Herr Crowder, der seit einigen Wochen sein Absteigequartier in dem Gasthaus genommen habe und von Zeit zu Zeit mit der Bahn nach London fahre oder auf seinem Fahrrad über Land. »Ein netter, anspruchsloser, freundlicher Herr,« fügte das Mädchen aus eigenem Antrieb hinzu.
Am nächsten Tag begegnete Dora Myrl dem Fremden wieder auf der Treppe. Als sie zur Seite trat, um ihn vorbeizulassen, blieb ihr Fuß an dem Stock hängen, der ihm aus der Hand geschleudert wurde und polternd die Treppe hinunter bis in die Vorhalle rollte.
Dora eilte dem Stock nach, brachte ihn dem Eigentümer zurück, und entschuldigte sich höflich wegen ihrer Ungeschicklichkeit. Zuvor hatte sie jedoch auf der Innenseite der Krücke einen tiefen Einschnitt bemerkt, der durch den Lack ins Holz hineinging. An jenem Abend klimperte Dora eine Weile zerstreut auf dem Klavier in ihrem Wohnzimmer. Sie fuhr mit den Fingern, mechanisch über die Tasten, während ihre Gedanken offenbar ganz wo anders weilten. Plötzlich schloß sie das Klavier mit einem Krach.
»Morgen wollen wir einen Ausflug auf unsern Fahrrädern machen, Herr Pollock,« wandte sie sich an Jim, der ihr geduldig und verständnislos, aber voll Bewunderung zugehört hatte. »Die Stunde kann ich Ihnen noch nicht genau angeben, aber halten Sie sich auf alle Fälle bereit.«
»Jawohl, Fräulein Myrl.«
»Stecken Sie auch einen langen, starken Strick in die Tasche. Sagen Sie einmal, haben Sie einen Revolver?«
»Mein Lebtag habe ich noch kein solches Ding besessen.«
»Dann könnten Sie wohl auch nicht damit schießen?«
»Ich weiß kaum, was hinten und was vorn ist. Aber meine Fäuste verstehe ich zu gebrauchen, wenn das etwas nützen kann.«
»In diesem Fall ganz und gar nichts. Eine einzige Kugel kann dem geübtesten Preisfechter das Handwerk legen. Übrigens genügt ein sechsläufiger Revolver, und ich bin keine ganz schlechte Schützin.«
»Aber Sie wollen doch damit nicht sagen, Fräulein Myrl, daß Sie selber –«
»Ich will jetzt kein Wort weiter sagen. Sorgen Sie nur dafür, daß Sie die Fahrräder und den Strick bereit haben.«
Am nächsten Morgen frühstückte Dora ungewöhnlich zeitig, nahm dann ein Buch zur Hand und setzte sich im Wohnzimmer an das Erkerfenster, das auf die Straße ging. Während sie anscheinend las, hatte sie stets ein wachsames Auge auf die steinernen Eingangsstufen, die man vom Fenster aus sehen konnte.
Gegen halb zehn Uhr kam Herr Crowder die Stufen herunter, doch hinkte er gar nicht mehr, sondern trug ein Zweirad, an dessen Lenkstange ein großer Leinwandsack befestigt war. Ohne Zögern eilte Dora in die Halle hinunter, wo die Fahrräder bereit standen. Im nächsten Augenblick saßen Pollock und sie im Sattel und jagten auf der ebenen Straße mit Windeseile dahin. Weit unten sahen sie gerade noch Crowders hohe Gestalt um die Ecke verschwinden.
»Wir müssen ihn im Auge behalten,« rief Dora während der raschen Fahrt ihrem Gefährten zu. »Das heißt, ich darf ihn nicht aus dem Gesicht verlieren und Sie mich nicht. Ich fahre jetzt voraus und Sie bleiben zurück; aber sobald ich mit dem Taschentuch winke, kommen Sie angesaust.«