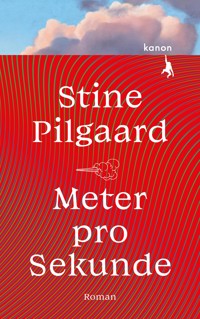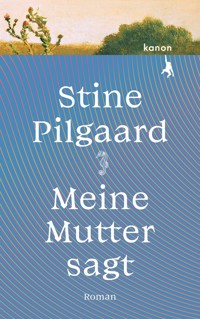
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Abschieden und vergangener Liebe.Nach dem Erfolg von »Meter pro Sekunde« erscheint nun das sprühende Debüt der erfolgreichsten dänischen Schriftstellerin unserer Tage. Witzig und warm schreibt Pilgaard über Liebe, Familie und das Alleinsein. Und darüber, wie wir uns doch mit Worten umsorgen.Nachdem die Ich-Erzählerin von ihrer langjährigen Freundin verlassen wird, muss sie zurück zu ihrem Vater ziehen, einem Pfarrer und Pink-Floyd-Fan. Während sie auf ebenso komische wie verzweifelte Art versucht, ihre Ex zurückzugewinnen, wird sie von Freunden und Familie mit Ratschlägen traktiert. Vor allem ihre Mutter bedrängt sie mit zweifelhaften Lebensweisheiten. Doch allmählich lernt sie, zu trauern, ihre inneren Widersprüche zu akzeptieren, laut, betrunken und auf ihre eigene Art weise zu sein. – Ein Roman voller Energie und Eleganz, von Hinrich Schmidt-Henkel aufs Treffendste übersetzt.»Meine Mutter sagt« ist ein moderner Roman über unsere Vereinzelung. Er handelt vom Aneinander-Vorbeisprechen, vom Alleinsein durch Missverständnisse, von Abschieden und vergangener Liebe – und vom Vermögen, sich doch durch Sprache zu erklären.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stine Pilgaard
Meine Mutter sagt
Roman
Aus dem Dänischen von Hinrich Schmidt-Henkel
Die Originalausgabe erschien erstmals 2012 unter dem Titel Min mor siger bei Samleren, Kopenhagen.
ISBN 978-3-98568-031-3eISBN 978-3-98568-032-0
1. Auflage 2022
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2022
Published by agreement with Winje Agency AS, Norway
Umschlaggestaltung: Anke Fesel / bobsairport
Unter Verwendung eines Gemäldes von Louis Gurlitt, »Liegender Baumstamm mit Wildpflanzen«, um 1834, Privatbesitz
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Marco Stölk
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Inhalt
Erster Teil
Seepferdchenmonologe I
Seepferdchenmonologe II
Seepferdchenmonologe III
Seepferdchenmonologe IV
Zweiter Teil
Seepferdchenmonologe V
Seepferdchenmonologe VI
Seepferdchenmonologe VII
Seepferdchenmonologe VIII
Dritter Teil
Seepferdchenmonologe IX
Seepferdchenmonologe X
Seepferdchenmonologe XI
Seepferdchenmonologe XII
Stine Pilgaard
Meine Mutter sagt
Erster Teil
In dem eine junge Frau viel telefoniert und im Pfarrhof ihres Vaters Zuflucht sucht, als sie entdeckt, dass sie eine enge Verwandte der Seepferdchen ist.
Meine Mutter findet, da ich jetzt Urlaub habe, sollte ich in ihr Sommerhaus kommen. Egal, wo im Lande man sich gerade aufhält, nach Amtoft kommt man gar nicht so ohne Weiteres. Man muss erst den Zug nehmen, dann den Bus, dann mehrfach umsteigen, und die Linien verkehren jeweils nur zweimal am Tag. Ich hasse blaue Busse, sage ich. Hass ist ein starkes Wort, sagt meine Mutter. Ich sage, wenn man in den Ferien und zu Feiertagen Kontakt mit der Familie pflegen will, ist es schwachsinnig, sich ein Ferienhaus im Amtoft anzuschaffen. Sie redet über den Limfjord und die friedliche Natur. Ich sage, die Taschenkrebse im Limfjord sind eigentlich als die aggressivsten von ganz Dänemark bekannt. Meine Mutter nennt mich Schätzchen und findet, ich soll nicht so negativ sein. Ich sage, ich gebe ja nur Informationen über schlechte Busverbindungen und dänische Kriechtiere weiter. Schalentiere, ruft der Mann meiner Mutter im Hintergrund. Ich sage, Taschenkrebse kriechen schließlich und schalen nicht, außerdem ist meine Liebste Tierpflegerin, also weiß ich das wohl besser. Aber sie trainiert Seelöwen, keine Taschenkrebse, sagt meine Mutter. Ich mache mir eine Zigarette an. Meine Mutter sagt, im Internet gibt es etwas namens Routenplaner, da sollte ich wirklich mal nach Verbindungen schauen. Ich sage, was ein Routenplaner ist, weiß ich selbst. Sie buchstabiert ihn. Ich sage, Routenplaner kann ich selbst buchstabieren. Dot dk, ruft ihr Mann. D-o-t, buchstabiert meine Mutter. Ich atme tief durch. Meine Mutter fürchtet, ich werde nie nach Amtoft durchfinden, sie redet über meinen Orientierungssinn. Wie kann man nur eine so miserable Orientierung haben. Ich frage, ob ich in ihren Augen überhaupt in etwas gut bin. Jetzt sagt sie, dass ich mit eineinhalb Jahren schon vollkommen fehlerlos sprechen konnte. Dass ich erst kurz vor drei richtig laufen konnte, stehe auf einem anderen Blatt. Bisschen peinlich in der Müttergruppe, aber man liebt ja seine Kinder, egal wie, sagt meine Mutter. Die Gesundheitsberaterin hatte noch nie ein motorisch derart unbegabtes Kind gesehen, sagt sie. Eine Zeit lang hielt sie mich regelrecht für entwicklungsgestört. Ich sage nichts. Nun ist es keine Schande, wenn man ein bisschen zurückgeblieben ist, also rein motorisch, sagt meine Mutter, und heute kannst du ja ohne Probleme laufen, denk mal an Leute, die an Muskelschwund leiden. Die kriegen wenigstens Förderung aus Benefizkonzerten, sage ich. Meine Mutter sagt, sie liest gerade einen großartigen Thriller. Klingt ja spannend, sage ich. Meine Mutter sagt, ich bin ein Snob, ein richtiger Snob, aber wenn ich unbedingt so elitär sein will, sollte ich mal aufhören, Shu-bi-dua zu hören. Man muss konsequent sein. Ich sage, ich sollte mich wohl besser aus Amtoft fernhalten. Jetzt hör schon auf, Schätzchen, lacht sie. Sie habe gedacht, wir könnten ihren Sechzigsten planen, das würde doch sicher Spaß machen. Sie redet über Einladungen und Sitzplan und Blumenschmuck. Bis dahin ist es fast noch ein Jahr, sage ich. Zehneinhalb Monate, sagt meine Mutter. Länger als von Empfängnis bis Geburt, sage ich, das werden wir schon schaffen. Du bist genau wie dein Vater, sagt meine Mutter, alles immer im letzten Moment. Ich soll anrufen, sobald ich in Aalborg bin, damit sie weiß, mit welchem Zug ich komme. Ich sage, ich bin ein Jahr lang durch Indien gereist, allein, da sollte ich das wohl schaffen. Sie sagt, man könne Indien und Amtoft in dieser Hinsicht nicht vergleichen. Ich sage, da hat sie möglicherweise recht. Mütter haben in der Regel immer recht, sagt meine Mutter.
Als ich die Tür hinter mir zuknalle, schreie ich, dass sie dabei ist, den Fehler ihres Lebens zu begehen. Mag schon sein, sagt sie, aber das ist jetzt so, nichts mehr zu machen. Es gibt immer noch was zu machen, sage ich. Ich habe keine Lust, etwas zu machen, sagt sie, ich bin nicht froh. Man kann auch nicht unablässig froh sein, das Elend ist eine Grundtatsache des Lebens, rufe ich, hast du denn nie Camus gelesen. Sie redet davon, dass wir uns an verschiedenen Stellen im Leben befinden. Ich sage, wir sind an genau derselben Stelle, ich stehe in ihrem Wohnzimmer, direkt vor ihr, sie soll aufhören mit diesen ewigen Ortsmetaphern. Vergiss nicht zu atmen, sagt sie und hält mir mein Asthmaspray hin. Ich frage, ob es ums Kinderkriegen geht. Irgendwie schon, sagt sie. Okay, sage ich, in Ordnung, dann kriegen wir eben ein Kind. Ich breite resigniert die Arme aus und wische eine Topfpflanze zu Boden. Jetzt hat der Topf einen Sprung. Patina, sage ich, das ist derzeit sehr in Mode, die Sachen brauchen nicht immer eine makellose Oberfläche zu haben, rustikal ist besser. Sie kehrt die Erde zusammen und sagt, ich sei nicht bereit, Kinder zu kriegen. Im Gegenteil, ich fühle mich total bereit, ich höre laut meine biologische Uhr ticken, sage ich. Sie sagt, das ist es nicht nur, es geht auch um den Altersunterschied zwischen uns. Herrgott, sage ich, die zehn Jährchen, das ist nichts Neues, das kann hundertmal schlimmer sein, ich könnte jede Menge Fälle aufzählen, Emmanuel Macron und seine Brigitte, Josef und die Jungfrau Maria, ich könnte stundenlang weitermachen, sage ich, weil mir sonst niemand mehr einfällt. Hier geht es aber um uns, sagt sie. Ulrik Wilbek hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Unterschiede machen stark, sage ich. Sie sagt, in dem geht es um Handball, nicht um Paarbeziehungen. Teamwork ist Teamwork, sage ich. Halt den Mund, sagt sie. Ich frage sie, seit wann sie denn angefangen hat, solche Grenzen zu setzen. Sie sagt nichts mehr.
Ich sitze im Wohnzimmer meines Vaters. Ich schaue zu der Kirche hinüber, wo er arbeitet. Als er nach Hause kommt, wirkt er erschöpft. Es wäre ihm lieber, wenn die Mitternachtsgottesdienste zu einer anderen Uhrzeit anfingen, sagt er. Ich habe eine LP von Pink Floyd aufgelegt. Hey you, would you help me to carry the stone, open your heart, I’m coming home, singe ich, die Hände als Trichter vor dem Mund. Mein Vater tätschelt mir den Kopf und dreht die Musik etwas lauter. Ich sage, sie muss bei mir bleiben, ich bin nicht der Typ, den man verlässt. Mein Vater brummt etwas, er setzt sich auf den Stuhl mir gegenüber. Er sieht sich im Wohnzimmer um. Da stehen ein paar schwarze Säcke mit meinem Zeug drin, und ich habe ein Plakat mit Karen Blixen aufgehängt, an der Stelle, wo sonst immer der Asger Jorn gehangen hat. Mein Vater macht eine Flasche Wein auf und stellt zwei Gläser auf den Tisch. Ich sage, die hat doch verflucht noch mal keine Ahnung von Qualität oder Frauen oder von was auch immer. Er schaut erschrocken drein, wie einer, der denkt, o nein, sie wird doch nicht weinen, und nimmt ein Kartenspiel. Er räuspert sich, ich soll es als Chance sehen, etwas zu tun, das ich bisher nicht habe tun können. Ich sage, dann will ich eine Junkiebraut in Berlin sein und ein Buch über Elend und Schmerzen schreiben, wie Christiane F. Er teilt jedem von uns beiden sieben Karten aus und schreibt unsere Namen auf ein Stück Papier. So, sagt mein Vater, jetzt spielen wir Fünfhundert. Ich sage, wenn das so ist, kann ich auch rausgehen und mich in irgendeinem Fluss ertränken. Das kann ihr dann eine Lehre sein. Er sagt, der Tod durch Ertrinken soll der allerschlimmste sein, und gewinnt in der zweiten Runde, aber das ist keine Kunst, wenn man drei Joker hat. Ich starre wütend auf seinen Trumpf. Er gießt mir Rotwein nach. Mein Vater sagt, alles hat ein Ende. Ich trinke den Rotwein mit drei Schlucken aus und sage schlimme Dinge über Frauen, während ich Karten verteile, und er stimmt mir in meinen Betrachtungen zu. Diesmal gewinnt er erst nach drei Runden, ich habe schon hundertfünfunddreißig Minuspunkte. Mein Vater schaut etwas furchtsam drein. Er redet über Strategien und davon, etwas zu wagen, und von der Wichtigkeit, nicht einfach nur tatenlos auf eine bestimmte Karte zu warten. Ich sehe aus dem Fenster. Er mischt die Karten neu und sagt, es geht ihm nicht darum, mir Ratschläge zu geben. Also über Beziehungen. Er redet über Prioritäten und Kompromisse und dass man einander nicht für garantiert nehmen sollte. Ich mache darauf aufmerksam, dass er dreimal verheiratet war. Das war Thomas Hansen Kingo auch, sagt mein Vater. Er hört sich selbst ganz gerührt zu, wie er über spontane Waldspaziergänge redet, über kleine Aufmerksamkeiten im Alltag und Offenheit, das ist das Wichtigste, sagt mein Vater, Offenheit. Ich nicke, während er zum dritten Mal gewinnt, seine mitleidige Miene ist das Schlimmste. Er macht mir eine Zigarette an und gießt mir Wein nach. Hast du auch ein paar Oblaten dazu, frage ich. Ich blicke zu den Umzugskartons, die im Wohnzimmer gestapelt stehen. Er redet über das Jungsein, sagt, auch seine Konfirmanden kommen ihm entwurzelt vor. Tine Bryld, die Radiotante mit ihrer Ratgebersendung für junge Menschen, erfüllt ihn geradezu physisch, auf eine Weise, die mich nervös macht. Ich lege mein Gesicht in meine Hände. Er streichelt mir die Haare, und ich fühle mich wie ein Hund. Einer von denen mit diesen melancholischen Augen, einer aus der Marmeladenreklame von Die alte Fabrik. Ich hebe den Kopf und frage ihn, was für ein Hund ich wäre, wenn ich ein Hund wäre. Er blickt verwirrt drein und sagt, ich sei ja keiner. Ich sage, bei so was kann man nie wissen, und er nickt, ich wäre wahrscheinlich ein Labrador. Ich kann ihm ansehen, dass ich fragen soll, warum. Warum, frage ich. Weil das mein Lieblingshund ist, lächelt er. Ich nehme an, dass das irgendwie eine Art von Kompliment ist, und der Labrador trottet aus dem Wohnzimmer, gefolgt von Tine Bryld, jetzt sind wir wieder allein. Ich sage, alles, was ich anfasse, geht kaputt. Er blickt erschrocken auf das Rotweinglas in meiner Hand. Er ist wirklich ein guter Vater, ich überlege laut, ob der Staat ihm ein Gehalt zahlt, um mich zu ertragen, ob es für solche besonders beanspruchten Elternpaare einen Härtezuschlag gibt. Er sagt, so funktioniert das nicht, man liebt seine Kinder immer. Er summt ein Liedchen und sieht mich erwartungsvoll an. Ich erkenne ein paar Melodiefetzen aus dem Lied des alten Gärtners, irgendwas von wegen, man soll Licht und Freude reinlassen.
Meine Mutter ist eben aus ihrem Sommerhaus zurückgekommen. Jetzt will sie mir eine Diashow zu Amtoft zeigen. Ich weiß schon, wie es in deinem Sommerhaus aussieht, sage ich. Hier sitze ich im Garten, meine Mutter deutet auf ein Bild. Ach tatsächlich, sage ich. Hier grillen wir am Strand, sagt meine Mutter. Auf dem Bild wendet ihr Mann lächelnd ein Steak. Aha, sage ich. Irgendwas stimmt nicht, sagt meine Mutter, das kann ich dir anhören. Ich schüttele den Kopf. Eine Mutter merkt alles, sagt meine Mutter. Ihre Augen glänzen, sie sieht aus wie ein Detektiv kurz vor der Aufklärung eines Mordes. Ich bin für Beziehungen einfach nicht so gut geeignet, sage ich langsam. Meine Mutter sagt, typisch Einzelkind, vielleicht hast du ja früher zu viel Aufmerksamkeit bekommen. Na ja, sage ich. Sie streichelt mir die Wange. Ich bin in den Pfarrhof gezogen, sage ich. Bist du sehr unglücklich, fragt sie. Ich nicke. Jetzt sieht meine Mutter auch unglücklich aus. Kannst du nicht mit deinem Hausarzt sprechen, fragt sie. Der kann ihr wahrscheinlich auch nicht begreiflich machen, dass sie die Frau meines Lebens ist, sage ich. Meine Mutter fragt, ob ich zur Fatalistin geworden bin, sie sagt, die einzig Richtige gibt es nicht. Das ist ein soziales Konstrukt, sagt sie und meint, das brauchen die Filmindustrie und Interflora eben zum Überleben. Meine Mutter rechnet aus, mit wie vielen Einwohnern Dänemarks ich potenziell eine Beziehung eingehen könnte. Sie dividiert die Anzahl meiner Beziehungen durch die Lebensjahre, seit ich sexuell aktiv bin. Ungefähr 1,5 pro Jahr, sagt sie, wenn man die Araberin mitrechnet. Da ist noch jede Menge übrig, sagt meine Mutter. Sie nennt Leute aus meinem Bekanntenkreis, Freundinnen und Freunde, über die sie mich hat reden hören, und schlägt auch ein paar Promis vor, die ihr geeignet erscheinen. Sie fand Prinz William immer so ansprechend. Der hat gerade geheiratet, sage ich. Ach, Kate, das ist doch eine Eintagsfliege, sagt meine Mutter, die ist schnell wieder vergessen. Ich sage, ich weigere mich darüber zu diskutieren, warum ich nicht mit Prinz William verheiratet bin. Es geht um die Einstellung, sagt meine Mutter, es geht darum, offen zu sein. Du klingst, als wolltest du eine Wohnung verkaufen, sage ich, das ist eine Berufskrankheit, warum muss alles, was du sagst, wie ein Werbeslogan klingen. Das ist Lebenserfahrung, sagt meine Mutter. Sie fragt, was ich jetzt vorhabe. Vor die Hunde gehen, sage ich, oder ins Kloster, oder irgendwo in den Himalaja. Das geht nicht, sagt sie, nicht bei deinem Orientierungssinn, denk nur daran, wie schwierig du es findest, dich nach Amtoft durchzuschlagen, den Himalaja findest du nie im Leben. Und dann müssen Vater und ich dich von Interpol und dem Suchdienst des Roten Kreuzes und wer weiß wem aufspüren lassen. Sie verdreht die Augen gen Himmel. Und du weißt ja, wie langsam dein Vater ist, sagt sie, dann verpassen wir sämtliche Flüge und haben einander in den Wahnsinn getrieben, schon bevor wir überhaupt in Kopenhagen sind. Sie seufzt, wirklich ein schlimmes Durcheinander. Jetzt kommt der Sitzplan für meinen Geburtstag aber ins Schleudern, sagt meine Mutter, deine Frau war die Einzige, die mit Tante Jette reden konnte. Ich mache alles kaputt, sage ich. Weißt du was, Schatz, ich setze Jette einfach ans Ende des Tisches, kein Problem, sagt sie auf Deutsch. Meine Mutter macht die Diashow aus. Ich hasse es, wenn Menschen aus meinem Leben verschwinden, sage ich. Hass ist ein starkes Wort, sagt meine Mutter. Sie macht das Fenster auf und schaltet die Dunstabzugshaube an. Heute darfst du gerne drinnen rauchen, sagt meine Mutter.
Die Wände im Wartezimmer meines Arztes sind gelb gestrichen. Bunte Plakate mit Landschaftsansichten hängen daran, auf dem Tisch steht eine Kristallvase mit Sonnenblumen. Neben meinem Stuhl befinden sich ein Schaukelpferd und zwei Plastikkisten mit Bauklötzen. Ich baue einen kleinen Turm auf dem Tisch. Als keine Bauklötze mehr übrig sind, lege ich eine Broschüre über Heuschnupfen als Dach darauf. Versehentlich komme ich an einen der untersten Klötze, der Turm schwankt, stürzt ein und wirft die Kristallvase um. Jetzt steht eine verlassene Ruine inmitten einer Überschwemmung auf dem Tisch. Ich sammle die Sonnenblumen zu einem kleinen Strauß zusammen. Ich halte ihn in der Hand und betrachte eine Zeit lang die Scherben. Ein Mann sieht mir vom Rezeptionstresen aus zu. In fragendem Tonfall nennt er meinen Namen und reicht mir die Hand. Ich gebe ihm die Hand ohne Sonnenblumen drin. Er stellt sich vor und fordert mich auf mitzukommen. Ich folge ihm ins Behandlungszimmer. Mein Arzt setzt sich auf einen Stuhl mir gegenüber und fragt, wie er mir helfen kann. Mir fällt auf, dass ich immer noch die Sonnenblumen in der Hand habe, ich lege sie auf seinen Tisch. Er füllt einen weißen Wasserkrug. Während er die Blumen arrangiert, grübele ich, ob er mir überhaupt helfen kann. Mir fällt ein, dass ich mal bei einer Hochzeit neben einem Mediziner gesessen habe. Mein Tischherr war HNO-Arzt. Aus Höflichkeit fragte ich ihn nach seiner Lieblingsdiagnose. Nach einem längeren Monolog rückte er damit heraus, dass es wahrscheinlich das Kartagener-Syndrom sei, irgendwas mit abnormen Zilien. Zilien, das sind zum Beispiel die Flimmerhärchen in den Luftwegen, flüsterte er mir vertraulich zu. Ich drückte meine Zigarette aus. Das kommt häufiger bei Kindern mit rezidivierenden Sinusiten vor, erzählte er. Ich hätte gedacht, Sinusiten wären eine Untergruppe von Eskimos auf Grönland. Ich teilte meinem Tischherrn mit, der Barock sei eine hochinteressante Periode der Literaturgeschichte, denn er ziehe in mancherlei Hinsicht die Postmoderne vor. Er lächelte höflich und sagte, ein interessanter Diagnoseschritt bestehe in Röntgenaufnahmen des kindlichen Thorax. Ich sagte, ist Thorax nicht eine Dinosaurierart, und fragte, ob er Jurassic Park gesehen habe. Er lachte wissend in sich hinein und sagte, das sei der Brustkorb, Patienten mit dem Kartagener-Syndrom wiesen einen situs inversus auf, mit anderen Worten, die inneren Organe seien spiegelverkehrt angeordnet. Ich sagte, ja genau, die Spiegelung sei interessant. Die Dichter des Barock verwendeten Spiegelungen symbolisch, um zu zeigen, dass die Welt nicht eindimensional sei. Er sagte, der situs inversus liege wahrscheinlich an einer abnormen Funktion der Zilien bereits beim Embryo, in einer Entwicklungsphase namens Gastrulation. Ich nickte und merkte an, die Barockdichter hätten zahlreiche Vanitas-Symbole verwendet, er sollte bloß nicht denken, er sei hier der Einzige, der was Lateinisches sagen könne. Diese Symbole lägen häufiger in Form von Seifenblasen vor, als Verkörperung des vergänglichen Augenblickes, sagte ich. Er blickte mich irritiert an, gewann dann wieder seine Konzentration zurück und erzählte, dass die dysfunktionalen Zilien für eine unzureichende Strömung des Fruchtwassers sorgen würden. Ich sagte, ganz ähnlich wie die Denker des Barock versuche die Postmoderne, die Unzulänglichkeit des Lebens festzuhalten, wenn auch mit recht verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten. Er sagte, genau das könne zu situs inversus führen.
Mein Arzt räuspert sich und fragt, was mich zu ihm führt. Wenn ich lüge, dann nur selten, um peinlichen Situationen auszuweichen, vielmehr als eine Art narrative Verpflichtung. Ich rede ein bisschen hin und her über irgendwelche Bauchschmerzen, eine Art muskuläre Kontraktionen um den Nabel herum. Es tut richtig weh, sage ich. Ich schaue hoch und werde von seinem grünen Röntgenblick eingefangen. Er sieht mich todernst an und nickt etwas zu lange rhythmisch. Ich verspüre den plötzlichen Drang, ihm alle möglichen Geheimnisse anzuvertrauen. Ich sage, ich hätte meine Liebste einmal betrogen, aber da sei ich restlos besoffen gewesen und hätte danach wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, und außerdem hätte ich nie Verbrechen und Strafe gelesen, obwohl ich immer so tu als ob. Überhaupt läuft es zurzeit nicht so gut, sage ich. Er zieht die Augenbrauen hoch, lächelt kurz angebunden und nickt stumm. Ich erzähle dem Arzt, dass meine Liebste mich verlassen hat und ich Menschen wirklich nur sehr schwer loslassen kann. Mein außergewöhnlich gutes Gedächtnis behindert mich dabei, im Leben weiterzukommen, sage ich. Mein Arzt sagt, die bewusste Überführung von Erinnerungen aus dem Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis geschehe in einem Gehirnareal namens Hippocampus. Das sei das lateinische Wort für Seepferdchen,