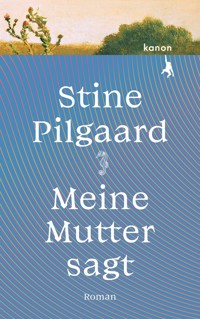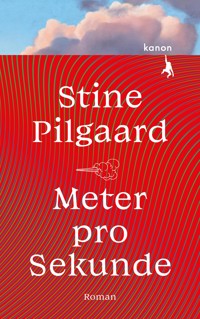
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein turbulentes Jahr voller FreundschaftIn Dänemark war »Meter pro Sekunde« der erfolgreichste Roman der letzten Jahre. Seine besondere Mischung aus Humor, Menschenfreundlichkeit und Sprachkunst macht ihn zum Buch unserer Tage.Kühe, Windräder und die sonderbare Welt einer Internatsschule: Eine junge Mutter zieht mit Mann und Baby nach Westjütland, ins »Land der kurzen Sätze«. Eine einfache Unterhaltung wird für sie zum Wagnis, und das Leben selbst ist auf einmal voller Hindernisse. Mutterschaft, Ehe und Fahrprüfung: alles kaum zu schaffen. Doch als sie Kummerkasten-Redakteurin bei der lokalen Zeitung wird, ändert sich ihr Leben, und der Himmel bricht auf. – Übersetzt in zahlreiche Sprachen, von Hinrich Schmidt-Henkel in ein wunderbar klingendes Deutsch.Ausgezeichnet mit dem renommierten Goldenen Lorbeer wie u.a. Karen Blixen, Tove Ditlevsen und Peter Hoeg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:5 Std. 48 min
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
StinePilgaard
MeterproSekunde
Roman
Aus dem Dänischenvon Hinrich Schmidt-Henkel
ISBN 978-3-98568-011-5
eISBN 978-3-98568-012-2
3. Auflage 2022
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2022
Umschlaggestaltung: Anke Fesel / bobsairport
Unter Verwendung des Bildes »Skagen No. 12« von Susanne Mull
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 und einer Illustration von
iStock / Nickolai Shito
Lektorat: Frank Heibert
Satz: Marco Stölk
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Stine Pilgaard
Meter pro Sekunde
Zum Gedenken an
Maja Trappaud Ahlgren Westmann
mit geschlossenen augen
es ist als könnte
keine strömung mich ertränken
keine trauer mich ersticken
nicht ganz –
es ist als käme
die liebe zu mir
über alle meere,
denn eine weiche saite schwingt allzeit
in mir –
Gustaf Munch-Petersen, das unterste land, 1933
Inhalt
Natur plus Gegenwart
Schlachtlied für den Anhang
Herbstlied ohne Wind
Danke für Schnee und Schmetterlinge
Der Tag und die Straße
Krissers Lied
Winterlied ohne Schnee
Wiegenlied für die Untröstlichen
Im Land der kurzen Sätze
Hoffnungsloses Frühlingslied
Sommerlied ohne Sonne
Im Land der kurzen Sätze
Immer noch sind wir neu im Gelände, verwirrt gehen wir umher mit unserem Kinderwagen, zwei ruhelose Ritter der Landstraße. Wir blicken auf die Windräder, wie sie vor dem Himmel stehen, Besuchern aus der Zukunft gleich, futuristische Erinnerungen an andere Planeten. Wie fröhliches Unkraut sprießen sie um unser Haus herum, und wenn sie mal stillstehen, ist es, als hielte der Erdball eine kurze Sekunde lang den Atem an, sprachlos, weil der Wind ausbleibt. Wir gehen durch eine neue Welt, durch unser neues Leben, mit unserem neuen Kind, die Natur liegt flach vor uns, und der Sonnenuntergang über der Nordsee betrachtet uns mit seinem roten Auge. Die Rehe blicken gelassen in die Scheinwerfer des Autos, die überfahrenen Tiere strecken sich zwischen den Fahrstreifenmarkierungen der Landstraße aus. Die Landmänner grüßen mit einem Finger am Mützenschirm, ich begreife, so macht man das hier. Winkend, lächelnd, rollend bewege ich mich zwischen Mais und Kartoffeln hindurch, zwischen Roggen und Weizen, und tue so, als ob ich die Hunde der Leute mögen würde. Wie alt ist der denn, sage ich, was für eine Rasse, Labrador, ah ja, da weiß man, was man hat. Ich mag den Dialekt der Leute in Westjütland, das grammatikfreie Festhalten an der Tradition, den Fjord, der wie Glasscherben in der Sonne glitzert. Die Windradschwerlasttransporter balancieren über die Landstraßen, ein Flügel ragt in den Gegenverkehr, alle weichen in die Landschaft hinein aus, ducken sich, danken und reihen sich wieder ein. Wir in Velling wollen was, steht auf dem Ortsschild, aber was wir wollen, ist unklar. Die Wirklichkeit hüllt uns ein wie Nebel, und wir sind gerade erst angekommen.
Natur plus Gegenwart
Die Leiterin der Heimvolkshochschule klopft dreimal in rascher Folge und öffnet die Haustür dann selbst. So machen wir das hier draußen, sagt sie, ich sehe überrascht aus. Hat denn niemand in Velling Sex, frage ich, schaut Pornos oder onaniert, dreimal klopfen, so schnell kriegt doch kein Mensch die Hose wieder hoch. Die Leute finden Mittel und Wege, sagt die Schulleiterin und nimmt zwei Tassen aus dem Schrank. Sie hat ein Päckchen schwarzen Tee und ein kleines Sieb gekauft, denn für meinen Pickwick hat sie nichts übrig. Das ist Tee für Kaffeetrinker, sagt die Schulleiterin, ein Schritt vor Ostfriesen, wer will denn so was. Sie war gerade drüben in der Schule, um Blumen in die Zimmer der Schüler zu stellen, nicht mehr lange, und sie kommen in blauen Bussen aus dem ganzen Lande angefahren. Dann ist es aus mit dem Frieden, sage ich, und mein Mutterschaftsurlaub ist auch bald rum. Die Schulleiterin dreht die Tasse langsam zwischen ihren Händen, während mein Sohn sich unter ihrem roten Kleid versteckt wie unter einem Zelt. Er braucht einen Namen, die Schulleiterin deutet runter zwischen ihre Beine. Sie sagt, die Leute fangen schon an zu reden, sie hat Kontakt zur Gemeindeverwaltung und weiß, dass die uns schon drei Verwarnungen geschickt hat. Du klingst wie ein Mafiaboss, sage ich. Die Schulleiterin hebt unseren Sohn hoch, er greift nach der Plastikblüte auf ihrer Haarspange. Bist du ein kleiner Nicolai, fragt sie ihn. Mein Sohn sabbert gleichgültig vor sich hin. Ein Name ist eine große Verantwortung, sage ich. Jeden Tag werden Lehrer diese Reihenfolge von Buchstaben aufrufen, wenn sie ins Klassenbuch schauen. Seinen Namen wird unser Sohn jedes einzelne Mal nennen müssen, wenn er einen anderen Menschen kennenlernt. Auf dem Spielplatz, in der Diskothek, bei Bewerbungsgesprächen. Er wird Dokumente mit diesem Namen unterzeichnen, den wir aussuchen, der Name wird in der Ecke von seinen Zeichnungen stehen, die wir an den Kühlschrank hängen werden. Er wird in die hässliche Keramikschale geritzt sein, die wir zu Weihnachten kriegen, und seine Tage auf einem Grabstein beenden. Bis dahin wird er in Krankenberichten stehen, auf Examensarbeiten, Mietverträgen, Lohnabrechnungen, Weihnachtskarten, in der Verbrecherkartei oder in Wikipedia. Man ahnt gar nicht, wo so ein Name überall hinkommt, sage ich. Die Schulleiterin schlägt Frederik vor. Ich verwerfe das rasch, mein erstes Kriterium sei, dass der Name sich reimen können muss. Konfirmation, sage ich, runde Geburtstage, jetzt hat man noch die Chance, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Severin, sagt die Schulleiterin, Clementine. Die Betonung liegt nicht auf derselben Silbe, sage ich, wir suchen nach zwei Silben und Vokalendung, da wäre schon viel gewonnen. Du musst aus deiner Blase raus, sagt die Schulleiterin. Das ganze Jahr, seit wir in Velling wohnen, habe ich nichts als gekotzt, geboren und gestillt, und mein Sohn grinst mich an, als ob er damit nichts zu tun hätte. Er braucht einen Namen, und du brauchst einen Job, sagt die Schulleiterin. Es geht um Integration, die Erfahrung zeigt, dass unsere Lehrer nur hier wohnen bleiben, wenn die Ehepartner sich einfügen. Wir sind nicht verheiratet, sage ich. Dann schau zu, dass sich das ändert, sagt die Schulleiterin und deutet auf meinen Sohn, als wäre der ein stummes Argument. Sie ist von der provinziellen Angst erfüllt, dass neue Familien wieder verduften, während die örtliche Gemeinschaft gerade aufblüht. In ihrer Freizeit sucht die Schulleiterin mögliche Partner für Leute, damit die nicht wegziehen. Sie ihrerseits war als Tanzlehrerin bei einem Sommerkurs der Schule engagiert gewesen und hätte eigentlich nur vier Wochen bleiben sollen. Das ist jetzt dreißig Jahre her, so ist es vielen ergangen, der Ort hat so eine Art Schwerkraft, die es unmöglich macht, ihn zu verlassen. Die Lehrer und ihre Angehörigen erschaffen die Erzählung der Schule, sagt die Schulleiterin. Sämtliche Angestellten wohnen mit ihren Familien in Dienstwohnungen um das rote Klinkergebäude herum, als ob das eine Kirche wäre, das natürliche Zentrum einer hysterischen religiösen Gemeinschaft. Die Schule, das seid ihr alle, sagt die Schulleiterin und deutet auf mich. Ihre Stimme steigt und fällt, malt Bilder und macht Reklame. An der Straße Richtung Højmark ist ein Hofladen, man braucht einfach nur die Einfahrt runterzufahren und das Geld auf den Tresen zu legen, hundert Prozent Öko. Die Stadt ist voll von Start-ups und Idealisten und so vielen Vegetariern, dass man die Schweine damit füttern könnte. Nicht nur Nerzfarmen und Innere Mission, die Bauern reden auch über was anderes als Äcker, die Fischer über was anderes als Fisch. Was kannst du denn so, fragt die Schulleiterin und nimmt ihre Brille ab. Ihre Augen sind leuchtend türkisfarben, die Hängelampe über dem Tisch pendelt in ihrer linken Iris hin und her. Ich bin eine Art Orakel, sage ich, das weiß nur kaum wer. Orakel, murmelt die Schulleiterin und schaut drein wie eine, die gerade hochkomplizierte außenpolitische Probleme löst. Ich habe den starken Eindruck, dass die Stadt, vielleicht sogar das ganze Land nur durch sie funktioniert. Freundlich zieht sie ein paar Fäden, wo nötig, auch etwas unsanfter, verschiebt mit einem Wink ein paar Dünen, gleich haben alle freien Blick aufs Meer. Wir brauchen junge Kräfte, sagt die Schulleiterin und verpasst mir einen Job, den es nicht gibt und um den ich mich nicht beworben habe, während sie mich eindringlich mustert und flüsternd ein paar rasche Telefonate erledigt. Das war die Tageszeitung, sagt die Schulleiterin, da könnten sie tatsächlich wen für den Kummerkasten gebrauchen, für alle Altersgruppen. Ich hebe meinen Sohn ins Laufställchen. Viele Ehen werden auch in Verbindung mit einer Taufe geschlossen, sagt die Schulleiterin, zwei Fliegen mit einer Klappe. Er wird nicht getauft, sage ich. Die Schulleiterin nickt ein wenig, wie für sich selbst, und sagt, da reden wir noch drüber. Sie tut Tee und Sieb in die oberste Schublade, fürs nächste Mal. Danke, sage ich und kullere meinem Sohn einen gelben Ball zu. Wir in Velling wollen was, sagt die Schulleiterin. Ja, wir wollen was, sage ich.
Lieber Kummerkasten,
ich schreibe dir, weil ich ein Problem mit der Zeit habe, das sagen jedenfalls mehrere Menschen in meiner Umgebung. Ich kann wirklich nicht gut in der Gegenwart leben und bin meiner Zeit in Gedanken oft Wochen voraus. In meinem Job bin ich ständiges Organisieren gewöhnt, ich arbeite als Koordinatorin in einem größeren Unternehmen. Auch zu Hause muss viel organisiert werden, wir haben drei Kinder, Schulbesuch, Freizeitaktivitäten und alles, was so dazugehört. Mein Mann ist ziemlich zerstreut, es kommt öfter vor, dass er Termine doppelt oder dreifach verplant. Das hat dazu geführt, dass seine Familie und unsere Freunde sich an mich wenden, sobald etwas organisiert werden muss. Das muss ich mal mit der Planungshexe besprechen, sagt mein Mann, und das meint er sicher liebevoll, trotzdem erlebe ich es als Kritik. Ich versuche, mithilfe von Meditation und Delfinmusik im Hier und Jetzt zu leben, aber ich muss zugeben, es fällt mir schwer. Bin ich ein Kontrollfreak, und was soll ich tun?
Mit den besten Grüßen, eine Planungshexe
Liebe Planungshexe,
es soll hier nicht um mich gehen, aber ich muss ehrlich zugeben, ich gehöre eher zu denen, die Probleme damit haben, Sachen auf die Reihe zu kriegen. Das liegt nicht an einer eher spontanen Lebenseinstellung, sondern ist eine Mischung aus Faulheit und Wankelmut. Ich persönlich finde, die Gegenwart wird überbewertet. Lebe jeden Tag, als wäre es der letzte, heißt es, aber das ist Unsinn. Hört um Gottes willen damit auf. Die Straßen wären menschenleer, kein Mensch würde mehr Verantwortung für irgendwas übernehmen. Die Leute würden den ganzen Tag mit ihren Liebsten im Bett bleiben und Zigaretten rauchen, ihre Eltern anrufen und denen alles verzeihen. Ich habe die Gegenwart so satt, immer ist man mittendrin, jetzt ist jetzt und jetzt noch mal und verdammt, jetzt schon wieder. Es ist kein Verbrechen, an morgen zu denken. Wenn man seine Familie oder eine Gruppe von Freunden zusammenbekommen will, muss einem klar sein, das passiert nicht von selbst. Es ist ja nicht so, dass man ein Café betritt, und auf einmal sitzen sie alle da und plaudern über früher. Ich habe einen Freund, Mathias. Er liebt es zu organisieren, es macht ihn ganz euphorisch. Mathias ist die wandelnde Initiative und bewegt sich zielstrebig durch das Leben. Er fuchtelt mit den Händen und schreibt lange Mails über Kleinkram. Wenn keine Antwort kommt, schickt er mit lustigen Smileys verzierte Erinnerungsmails, angehängt der Wetterbericht und Vorschläge für vernünftige Kleidung. Ich weiß nicht, warum wir Mathias immer damit aufziehen, wahrscheinlich weil es so leichtfällt. Wie viele andere sind mein Freund und ich bequeme Menschen, alle beide. Wir begeben uns in Situationen, als ob die Welt eigens für uns erfunden worden wäre. In jedem Freundeskreis gibt es bequeme Leute. Du kannst uns daran erkennen, dass wir bei Mitbringpartys immer mit Chips oder Schnaps auftauchen. Wir sind sehr sensibel und antworten im letzten Moment. Für unser Empfinden wird das Leben zum Gefängnis, wenn wir zu viele Verabredungen eingehen. Wir sehen die Zeit als etwas Abstraktes, mit einem eigenen Willen Begabtes an. Uns fällt es schwer, etwas zu verstehen, das eigentlich sonnenklar ist. Ohne Datum kein Weihnachtsessen. Da muss geschmückt werden, ein Fortbewegungsmittel muss organisiert werden. Wir kommen mit einem schiefen Lächeln an, und wegen unseres schlechten Gewissens benehmen wir uns schlecht. Mensch, entspann dich doch mal, sagen wir zu Mathias, oder Hakuna Matata. Aber aufgepasst. Nicht ohne Grund stammt dieses Motto von zwei Zeichentrickfiguren. Unsere Welt ist aber nicht von Walt Disney erschaffen, die Sterne versammeln sich nicht zu einem Löwenhaupt, um uns zu erzählen, wer wir sind, sondern das tut ihr. Liebe Planungshexe, lieber Mathias. Entschuldigt bitte. Wer ein großes Herz hat, wird immer aufgezogen. Bleibt unbeirrbar, blockt meinen Kalender, verplant meine Zeit. Eure Pläne und Träume sind der Maibaum, um den wir anderen herumtanzen. Danach gehen wir nach Hause, wir haben es ja so eilig. Und beim Aufräumen denkt ihr darüber nach, dass es doch Spaß machen würde, im nächsten Sommer Kanus zu mieten und eine Fahrt auf der Gudenå zu machen. Von Herzen Dank.
Herzlichen Gruß, der Kummerkasten
Ich habe für die Fahrstunden ein Theoriebuch bestellt und gehe zum Kaufmann, das Päckchen abholen. Ich weiß doch, wer du bist, sagt er, als ich ihm meinen Ausweis hinhalte. Tatsächlich, sage ich. Er nickt. Ich weiß, wo du wohnst, sagt er, unten neben der Schule in dem kleinen roten Haus. Noch ein Treffer, sage ich. Er stellt sich in die Tür, und ich bin ganz überwältigt von der Auswahl an Süßigkeiten zum Selberabfüllen. Draußen fahren Autos vorbei, der Kaufmann hebt die Hand an die Schläfe. Er trifft sie haargenau nicht, aber diese Bewegung, Hand an die Beinaheschläfe, denke ich, führt er wahrscheinlich gegen hundertmal täglich aus. Kannst du überhaupt sehen, wer drinsitzt, sage ich. Es schadet ja nichts, wen zu grüßen, den man nicht kennt, sagt der Kaufmann, als würde er etwas zugeben. Er fragt, ob wir uns gut eingelebt haben. Ich wäre gern gut Freund mit dem Kaufmann und stelle mir vor, wie er uns abends besucht, wir könnten Musik hören und Wein trinken, lustige Bemerkungen machen und zusammen darüber lachen. Man geht zurück auf Los, sage ich, man muss sich in der neuen Umgebung neu erfinden. Ich rede über die Entwurzelungsgefühle neu Zugezogener, und der Kaufmann räumt ein paar Waren ein. Wenn ich mit Leuten rede, klinge ich, als würde ich in den Krieg ziehen. Ich bin ganz aufgeregt, stehe allein in der Suppe von Geräuschen, präsentiere mich den anderen wie ein griffbereit in Scheiben geschnittener Braten auf einer Platte oder wie ein schmelzendes Eis zum Nachtisch, mit fancy Sonnenschirmchen. Der Kaufmann schaut aus dem Fenster, ganz offensichtlich hofft er auf Verstärkung. Ein mittelaltes Ehepaar betritt den Laden. Sie wohnen in Hee, kaufen aber immer hier ein, denn ihre Kinder besuchen die Freie Schule in Velling. Das Gespräch tastet sich langsam durch eine ziemlich kleine Landschaft und hält begeistert an den ungefährlichsten Orten inne. Ein gewaltiger Regenschauer, die Herbstferien, die schon wieder um die Ecke sind, Aussagen, hinter denen ein Fragezeichen undenkbar ist. Gefühlt zehn Minuten lang stehen sie vor dem Tresen und geben einander in allem Recht. Das Ehepaar hat gerade seine Garage aufgeräumt. Mein Gott, was man alles ansammelt, aber gemacht muss es ja werden. Ja, nicht wahr, unbedingt, sagt der Kaufmann, und es erfüllt mich mit einer Mischung von Faszination und Ekel, wie er es schafft, ihnen in einem einzigen Satz dreimal zuzustimmen. Es wirkt, als würden die anderen dichter zusammenrücken, während ich selbst immer weiter weggeschoben werde, über einen Rand hinaus, auf einen Abgrund aus Einsamkeit zu. Als das Ehepaar gegangen ist, drei Froschkuchen aus der Vitrine im Gepäck, lege ich eine gestreifte Papiertüte auf den Tresen. Höflichkeit macht mich ganz paranoid, man ahnt ja nicht, was auf der anderen Seite eines solchen Berges liegt, sage ich und suche in der Tasche nach meinem Portemonnaie. Hundertachtundachtzig fünfzig, sagt der Kaufmann, vielleicht denkst du zu viel über die Dinge nach. Ganz sicher, sage ich und verlasse den Laden, während der lachende Phantomkaufmann mit Rotweinglas in meiner Küche sich in kleine, flirrende Pünktchen auflöst.
Zu Hause im Wohnzimmer jammere ich über meine Probleme in Gesprächssituationen. Ich werde noch enden wie eine von diesen einsamen Frauen mit fünfzig Katzen, nur ohne Katzen, schluchze ich. Mein Freund meint, ich soll den Kaufmann als Genre begreifen und nicht als Zurückweisung. Du denkst in Prosa, sagt er, die Leute hier fassen sich aber kurz. Haiku, sagt mein Liebster, der alles mit Literatur vergleicht, siebzehn Silben, Natur plus Gegenwart. Er verwendet seinen Intellekt immer als Schutzschirm vor meinen großen Gefühlen, und mit ein bisschen Glück kriege ich einen Vortrag umsonst dazu. Dir kommt das sehr kompliziert vor, sagt mein Freund, der selbst aus einer kleineren Provinzstadt stammt, aber die Gespräche im öffentlichen Raum machen die erzwungene dörfliche Gemeinschaft erträglich. Der Kaufmann hat selbst gefragt, ob wir uns gut eingelebt haben, sage ich. Mein Freund wedelt kopfschüttelnd mit dem Zeigefinger. Falsch, sagt er, der Kaufmann hat anerkannt, dass du dich in seinem Laden befindest, dass ihr am selben Ort lebt. Wenn mein Freund mich besonders begriffsstutzig findet, greift er zu den blühendsten, unwahrscheinlichsten Bildern. Zwei Löwen desselben Rudels begegnen sich in der Savanne über einem fast toten Zebra, sagt er langsam. Sie nehmen ein paar Bissen, das linke Hinterbein zappelt noch ein wenig. Danach gehen sie beide ihres Weges, wissen aber, dass sie einander in ein paar Tagen möglicherweise am selben Kadaver wieder begegnen werden. Es ist wie eine Formel, sagt mein Liebster, ein kurzes Ritual. Wie geht es, jo, geht gut. Lieber Himmel, so ein Wind, ja, also wirklich. Und wieder Montag, ja, das bleibt nicht aus. Langsam spreche ich es ihm nach wie eine Zauberformel, an die ich nicht so recht glaube. Mein Freund rät mir, meinen Hang zu Vertraulichkeiten zu zähmen oder ihn wenigstens etwas besser zu erklären. Denk mal an Anders Agger, der kann mit allen Leuten reden, sagt mein Liebster und sucht sofort im Netz nach ein paar von Aggers Reportagefilmen. Wir gehen in die Küche und machen Popcorn. Und sonst so, sagt er, als er es in eine große Schüssel füllt, nichts Besonderes, murmele ich, wir machen es uns auf dem Sofa gemütlich und üben. Wie geht’s, fragt mein Freund. Danke, gut, antworte ich. Hattest du ein gutes Wochenende, fragt er. Ich sage, tut gut, nach einer hektischen Woche etwas runterzuschalten. Mein Liebster nickt anerkennend. Kein Mensch will wissen, wie es dir geht, sagt er, vergiss das nicht.
Lieber Kummerkasten,
mein Mann und ich begehen nächstes Jahr unsere kupferne Hochzeit, und wir haben vier schöne Hunde. Wir wohnen in einer hübschen Gegend etwas außerhalb von Vedersø, haben beide feste Arbeit und keinen Grund zum Klagen. Mein Mann beschäftigt sich immer intensiv damit, wie wir unser Leben optimieren könnten. Wenn ich nach einem langen Tag ins Bett gehe, schaut er mich manchmal an und fragt: Bist du eigentlich glücklich? Gleich bin ich noch erschöpfter. Mein Mann fürchtet, wir könnten als Paar stagnieren und aufhören, einander herauszufordern. Ich habe keine Angst davor, aber ich bin es mit der Zeit ein wenig müde. Vielleicht bin ich zu wenig anspruchsvoll, aber ich bin dankbar für unser Leben. Hättest du einen Vorschlag, wie mein Mann etwas zur Ruhe finden könnte?
Mit freundlichen Grüßen, David
Lieber David,
ich verstehe, dass du es müde bist, aber es ist wichtig, dass du begreifst, welche Mechanismen deinen Mann antreiben. Nicht alle haben ein Talent zum Wohlfühlen. Meine Schwiegerfamilie gehört zu einem Clan von Kaufleuten von der Insel Fünen, sie sind unglaublich auf Kolonialwaren fixiert. Sie vergleichen die verschiedenen Filialgrößen der Supermarktkette Brugsen miteinander: LokalBrugsen ist das schwarze Schaf und von Abwicklung bedroht, die mittelgroßen Filialen werden schon eher akzeptiert, aber Super-Brugsen geht aus allen Vergleichen siegreich hervor. Da arbeiten sie alle miteinander, die Großmutter mütterlicherseits meines Freundes hat sogar eine Keramikserie mit den Initialen von SuperBrugsen auf dem Kaffeeservice entworfen. Die ganze Familie hebt ihre Tassen mit SB darauf und prostet sich mit Kaffee zu. Ich liebe meine Schwiegerfamilie, aber ich fühle mich nur wohl, wenn ich mich mit kranken Menschen in Disharmonie befinde. In der Welt des Missverständnisses kenne ich mich aus, ich registriere Konflikte, wie andere Menschen ein- und ausatmen. Ganz automatisch analysiere ich einen Tonfall, bemerke die Schärfe am Rand einer Stimme. Ein gekränktes Gefühl, einen beleidigten Zug im Mundwinkel, angespannte Kiefer, hochgezogene Augenbrauen. Ich kann vermitteln wie niemand sonst und Zwistigkeiten mit subtilen Methoden beilegen, eigentlich müsste ich einen Beruf daraus machen. Mein großer Kummer besteht darin, dass normale Familien keine Verwendung für meine Dienste haben. Ich lächele und suche nach Gefahrensignalen, bin stets auf dem Sprung, bereit, sie vor etwas zu bewahren, das nie eintreten wird. Scheidungen sind böhmische Dörfer, die Gutmütigkeit geht ihren Gang in ordentlich aufgebauten Sitzgruppen. Weihnachten reisen wir heim zum Hofe unserer Herkunft, die Schwiegertöchter stechen Kerngehäuse aus und bereiten Bauchfleisch mit Äpfeln zu. Wir arrangieren Käseplatten mit roter und gelber Paprika und falten mit fröhlichen Weihnachtsmännern bedruckte Servietten. Ich reiße mich zusammen und füge mich ein, so gut es geht. Du schaffst das, flüstere ich mir selber zu, du bist unerschütterlich und weiß wie eine Statue, du bist ein goldgerahmtes Gemälde im Speisezimmer deiner Großmutter, du bist Hirsch und Waldsee, bist auf den Wellen schaukelnde Enten. Du bist Ikea, panisches Zoom auf Blütenblätter, Tautropfen im Sonnenschein, millionenfach reproduziert. Du bist so neutral, dass du in sämtlichen Hotelzimmern der Welt hängst, du bist das letzte, was die Leute sehen, wenn sie sich in die Badewanne sinken lassen und sich die Pulsadern aufschneiden, du passt in jedes Heim. Lieber David. Das ist mein kleiner Merkspruch, vielleicht kann er deinem Mann helfen. Sei barmherzig. Nicht allen Menschen fällt Harmonie von Natur aus leicht.
Herzlichen Gruß, der Kummerkasten
Mein Liebster und ich stehen vor einem Einfamilienhaus in Velling. Wir stellen unsere Räder im Carport unter, gleich haben wir ein Gespräch mit der künftigen Tagesmutter unseres Sohnes. In kleinen Laternen brennen Stearinkerzen, an der Tür hängt ein Kranz mit roten Beeren. Wir haben uns beide gut angezogen und reichen einer mittelalten Frau die Hand, dazu lächeln wir. Sie deutet auf eine Holzbank in der Küche, wir setzen uns. Wir haben das zu Hause nicht besprochen, aber ich glaube, uns ist nicht ganz klar, wer sich hier bewirbt, wir oder sie. Die Frau sagt, sie heiße Maj-Britt und sei seit zweiunddreißig Jahren Tagesmutter. Alte Garde, sagt ihr Mann, der kurz den Kopf zur Tür reinstreckt. Ja, danke, Bent, sagt sie und gießt Kaffee ein. Maj-Britt, sage ich, das ist der dänische Vorname mit den meisten verschiedenen Schreibweisen. Ich verspüre aufbrausende Begeisterung. Bindestrich und Doppel-t, sagt sie und holt einen Wochenplan hervor, der in den Ecken mit kleinen Marienkäferchen verziert ist. Sie erzählt, sie betreibe eine grüne Kita mit besonderem Schwerpunkt auf der Natur. Das Coole ist, dass der Name eigentlich kurz ist, sage ich, und trotzdem gibt es so viele Möglichkeiten, sowohl für die erste als auch für die zweite Silbe. Ai, j und y, einfaches t oder doppeltes, mit und ohne h, unendliche Variationen. Unendlich nicht, sagt mein Liebster und stellt auf seinem Telefon Berechnungen an. Wir verschieben munter die Buchstaben, ich notiere auf einer Serviette. Siebenundzwanzig, sagt mein Liebster. Er meint, der zweite Teil des Namens stamme von dem keltischen Maj-Britt, was die Leuchtende oder die Erhabene bedeute. Ihr könnt es buchstabieren, wie ihr wollt, ich weiß ja, wen ihr meint, sagt Maj-Britt. Sie fragt, ob wir uns hier in Westjütland gut eingelebt hätten. Mein Freund schaut mich mahnend an. Keine Klagen, sage ich. Draußen im Vorgarten hält ein großes Wohnmobil. Bent schenkt Kaffee nach und sagt, das sind Dauercamper in Tarm, einmal im Jahr stecken sie alle Kinder in den Wagen und nehmen sie mit. Maj-Britt zeigt ein paar Fotos von einem typischen Kita-Tag und erkundigt sich, ob wir Fragen haben. Ich erforsche mein Hirn und erkenne, dass wir bezüglich des Ortes, an dem unser Sohn die nächsten Jahre verbringen wird, deutliche Meinungen haben sollten. Ach, es geht ja so schnell, sagt Maj-Britt, kaum hat man bis drei gezählt, schon kommen sie in den Kindergarten. Ich sage, wirklich Wahnsinn, wie schnell die wachsen, wenn man dran denkt, dass es nur zehn bis fünfzehn Minuten gedauert hat, sie zustande zu bringen. Vielleicht eine halbe Stunde, grinse ich, wenn’s hochkommt. Mein Freund räuspert sich, und ich sage in einem ernsten Tonfall, dass wir ein wenig mit gerötetem Popo zu kämpfen haben. Das kriegen wir schon hin, sagt Maj-Britt, als ob wir gerade Alliierte in einem Krieg geworden wären. Sie sagt etwas von einer besonderen Zinksalbe, die sie sich aus Schweden kommen lässt, und mich erfüllt für einen Moment das Gefühl von Erfolg. Was macht ihr beiden denn so, fragt Bent. Mein Liebster berichtet von seinem Unterricht in der Schule, und ich sage, ich bin in der Orakelindustrie tätig. Ach was, sagt Maj-Britt. Sie hat einen Kummerkasten, sagt mein Liebster. Praktisch, da weiß man immer, wo man einen Rat kriegt, sagt Bent, und ich verspreche ihm, stets zur Stelle zu sein. Maj-Britt und mein Freund reden über das Wetter. Ich habe mich zu Hause gründlich vorbereitet und verbreite mich über Temperaturen, Wolkenschichten, Federwolken und Schleierwolken. Es klingt nicht ganz so authentisch wie gehofft, aber Maj-Britt wirkt zufrieden. Ja, das war’s dann mit dem Sommer, sagt Bent, und ich habe das Gefühl, dass wir für gut befunden wurden. Draußen bei unseren Fahrrädern schauen wir einander an. Was meinst du, wie ist es gelaufen, fragt mein Freund, und ich zucke mit den Schultern. Für uns ist es mittlerweile vollkommen selbstverständlich, so zu reden, als stünden wir vor einer Prüfungskommission, wenn wir als Eltern auftreten sollen. Super Idee, das mit dem Popo, sagt er.
Die versammelte Lehrerschaft der Schule wartet oben auf dem Parkplatz, um die herbstliche Schülerschar zu empfangen, ich stehe am Fenster und habe alles im Blick. Die Schüler kommen mit dem Bus oder mit ihren Eltern. Die einen wirken total selbstbewusst, die anderen verlegen, sie fragen einander, wo sie herkommen und für welche Fächer sie sich angemeldet haben. Ich setze mich an einen Tisch in der Raucherecke beim Schuleingang und komme mir vor wie im Theater. Manche Schüler haben beschlossen, wer sie sein wollen, ich bilde mir ein, ich könnte diejenigen erkennen, die dabei am stärksten von ihrer eigentlichen Persönlichkeit abweichen. Ihre Körpersprache hat etwas Überdeutliches an sich, das amüsiert mich. Kein Mensch ist entspannt, am ehesten gefallen mir die, die nicht versuchen, das zu verhehlen. Ein junger Mann mit üppigen Locken trommelt ein wenig mit den Fingern auf dem Tisch. Musiker, was, frage ich, er nickt und reicht mir die Hand. Malte, sagt er ernst. Ich sage, ich bin in der Orakelindustrie tätig, und er kann mich bei Bedarf stets ansprechen. Er nimmt die Zigarette an, die ich ihm hinhalte. Die Musikschüler leben sich schnell ein, sage ich, sie tun sich zusammen und gründen Bands mit Namen wie Spielaufspieler oder Die Notennerds. Ein paar Wochen lang sagen sie diese Namen ironisch, aber mit Fortschreiten des Halbjahrs klingt es genauso, als würde man Rolling Stones oder Beatles sagen. Ein schwarzhaariges Mädchen mit knallrotem Lippenstift starrt auf den Aschenbecher, als hätte er ihr persönlich eine schwerwiegende Grenzüberschreitung angetan. Die Schreibschüler rauchen immer, sie stehen fröstelnd in der Kälte, einen gehetzten Ausdruck im Gesicht. Als Lehrer mit Schwerpunkt Literatur kriegt mein Freund viele von den sogenannten schwierigen Schülern ab, die wie alle Schreibenden das Bedürfnis verspüren, sich zu erklären, und diffus erwarten, das Schreiben würde sie retten. Scheidungskinder mit hohem Notendurchschnitt, deprimiert oder bipolar, unter ihnen auch immer ein paar zukünftige Journalisten mit stark ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn. In ein paar Wochen werden sie sich bei uns die Klinke in die Hand geben, mit der vagen Empfindung, mein Freund hätte die Antwort auf etwas, das sie gern verstehen würden. Sie trinken schwarzen Kaffee und rauchen in seinem Arbeitszimmer, vor allem seine Zigaretten. Würdest du gern über etwas reden, wird mein Freund fragen, und ich werde zu den Tönen eines ratlosen Jugendlichen in Tiefschlaf verfallen, der selbst nicht weiß, ob er einen Vater oder einen großen Bruder sucht, einen Geliebten oder einen Freund. Die Schulleiterin kommt in einem langen lila Kleid angesegelt, das Haar zu einer vielsagenden Frisur aufgesetzt. Ihr Gang hat etwas Wirbelndes an sich, das rauschende Kleid erinnert an Flügel, man könnte durchaus sagen, sie flöge. Wie eine Schafsherde dirigiert sie die Schüler zum Vortragssaal hinüber, wo sie in Volkstanz unterrichtet werden sollen. Peinlich berührt trampeln sie nach den Anweisungen der Schulleiterin auf den Boden. Die meisten sind gerade mit dem Gymnasium fertig und hoffen, hier in der Heimvolkshochschule den gesuchten Lebenssinn zu finden. Das haben sie auf dem Herweg beschlossen, das steht bereits auf der Postkarte nach Hause, das ist für sie so sicher wie der tagtägliche Sonnenaufgang. Diese Schule ist ein Konzentrat, ein Suppenwürfel der Träume von einer Gemeinschaft, die herbeigesungen, -getanzt und -erzählt werden kann. Sie bezahlen für das Angebot der Schule, sie wissen, dass die Menschen um sie herum haargenau dasselbe wollen, und darum hat ihr kleines Universum etwas Albernes, Widerstandsloses an sich. Sie wünschen sich Freunde, also spielen sie Freunde, bis sie tatsächlich welche geworden sind, sie hängen im Handumdrehen unglaublich aneinander, nach ein paar Wochen sagen sie typischdu und wirmachenimmer. Es gibt immer eine Handvoll etwas ältere Schüler, die das Ganze entlarven wollen. Entweder haben sie zu viel gelesen, oder sie pausieren mit einem geisteswissenschaftlichen Studium, das sie mit einem schmerzerfüllten, aber triumphierenden Widerwillen