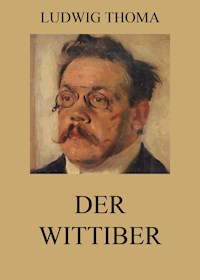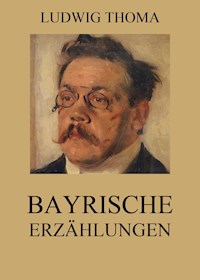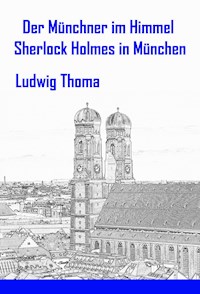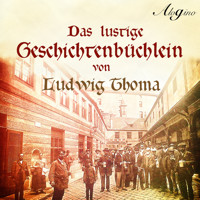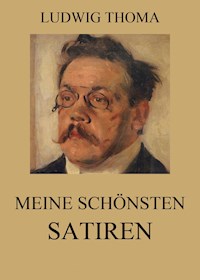
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ludwig Thoma gehört ohne Zweifel zu den bayrischen Literatur-Urgesteinen. Tiefschwarz sind seine Satiren und immer wieder legt er den Zeigefinger in die bayrische Kultur. In diesem Band sind enthalten: Assessor Karlchen Tja -! O Natur! Käsebiers Italienreise Der Postsekretär im Himmel Peter Spanningers Liebesabenteuer Der Star Das Kälbchen Der Krieg in China Die Halsen-Buben Agricola Solide Köpfe Monika Das Volkslied u.a.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine schönsten Satiren
Ludwig Thoma
Inhalt:
Ludwig Thoma – Biografie und Bibliografie
Assessor Karlchen
Tja –!
O Natur!
Käsebiers Italienreise
Der Postsekretär im Himmel
Peter Spanningers Liebesabenteuer
Der Star
Das Kälbchen
Der Krieg in China
Die Halsen-Buben
Agricola
Solide Köpfe
Monika
Das Volkslied
Der Biedermann
Unser guater, alter Herzog Karl
Der Hofbauer
Eine psychologische Studie
Meine schönsten Satiren , Ludwig Thoma
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849637583
www.jazzybee-verlag.de
Ludwig Thoma – Biografie und Bibliografie
Geb. am 21. Januar 1867 in Oberammergau als fünftes Kind des Försters Max Thoma und dessen Ehefrau Katharina, gest. 26. August 1921 in Tegernsee. Mit 7 Jahren Umzug nach München-Forstenried und Tod des Vaters. Schon als Schüler war Thoma immer wehrhaft gegen die damalige Doppelmoral und besuchte bis zum Abitur 1886 insgesamt 5 Gymnasien. Es folgte ein Jura-Studium und eine Anstellung als Rechtspraktikant von 1890 bis 1893. Nach dem Tod der Mutter 1894 beginnt er in Dachau als Rechtsanwalt zu arbeiten und entdeckt alsbald seine literarische Ader. 1899 widmet sich Thoma mehr und mehr der Zeitschrift "Simplicissimus" und wird im folgenden Jahr dessen Chefredakteur. Es folgte seine produktivste Zeit, die 1906 in der Herausgeberschaft der Zeitschrift "März", zusammen mit Hermann Hesse, gipfelte. Im Ersten Weltkrieg dient Thoma als Sanitäter, erkrankt aber selbst an der Ruhr. Er stirbt 1921 an Magenkrebs in seinem Haus in Tegernsee.
Wichtige Werke:
1897: Agricola1899: Die Witwen1901: Die Medaille1901: Assessor Karlchen1902: Die Lokalbahn1904: Der heilige Hies, illustriert von Ignatius Taschner1905: Lausbubengeschichten1906: Andreas Vöst1907: Tante Frieda1907: Kleinstadtgeschichten1909: Moral1909: Briefwechsel eines bayrischen Landtagsabgeordneten1910: Erster Klasse1911: Der Wittiber1911: Lottchens Geburtstag1911: Ein Münchner im Himmel1912: Magdalena1912: Jozef Filsers Briefwexel1913: Die Sippe1913: Das Säuglingsheim1913: Nachbarsleute1916: Die kleinen Verwandten1916: Brautschau1916: Dichters Ehrentag1916: Das Kälbchen1916: Der umgewendete Dichter1916: Onkel Peppi1916: Heimkehr1916: Das Aquarium und anderes1917: Heilige Nacht1918: Altaich1919: Münchnerinnen1919: Erinnerungen1921: Der Jagerloisl1921: Der Ruepp1921: Kaspar Lorinser (Fragment)Assessor Karlchen
Ich kenne Karlchen schon lange. Wir waren zusammen auf dem Gymnasium. Ich schmiss ihn einmal so an den Ofen, dass er einen Backenzahn verlor und ich wegen entsetzlicher Roheit zwei Stunden Karzer erhielt. Karlchen hatte nämlich schon damals eine Neigung zum Anzeigeerstatten und lief zum Rektor, welcher mir erklärte, dass auch bei den alten Griechen die Verbrecher ihre Laufbahn mit solchen Handlungen begonnen hätten.
Man sieht, es sind keine angenehmen Erinnerungen, die Karlchens Name in mir wachruft, aber niemand soll glauben, dass ich deshalb diese Geschichte von ihm erzähle. Ich hatte ihm wirklich verziehen, weil er der Dümmste in unserer Klasse war. Später wurde er Assessor in München.
Diese Bevorzugung flößte ihm eine hohe Meinung von seinen Fähigkeiten ein und er verschmähte es fortan, mich auf der Straße zu grüßen. Trotzdem werde ich ganz objektiv bleiben.
Eines Tages also meldete sich bei Karlchen der Kriminalschutzmann Alois Schmuttermaier und erzählte, dass eine gewisse Baronin Werneck im nördlichen Stadtviertel seine Aufmerksamkeit erregt habe. »Dieses Frauenzimmer«, sagte er, »scheint einen unbändigen Lebenswandel zur Schande der Nachbarn zu führen.«
»Wie sprechen Sie von den Spitzen der Gesellschaft? Was erlauben Sie sich eigentlich?«, fragte Karlchen und seine wasserblauen Augen sahen drohend über den Zwicker hinweg.
»Entschuldigen, verzeihen, Herr Assessor, ich glaube gehorsamst, das Mensch ist gar keine Baronin, sondern aus Salzburg«.
»Ah so! Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?«
»Entschuldigen, verzeihen ...«
»Schon gut! Merken Sie sich ein für alle Mal, ich liebe Klarheit, absolute Klarheit. Fahren Sie fort!«
»Jawoll, Her Assessor! Ich habe eifrig recherchiert, weil mir Herr Assessor befahlen auf die Unzucht ein wachsames Auge zu werfen.«
Karlchen nickte beifällig.
»Ich habe«, fuhr Schmuttermaier fort, »verschiedene Verdachtsmomente gesammelt. Allein, wenn mir Herr Assessor erlauben zu bemerken, ich glaube, dass man diese Frauenzimmer in flagranti erwischen muss, weil man sonst nichts ganz Gewisses weiß.«
»Allerdings, hm! Allerdings!«
»Und wenn mir Herr Assessor erlauben, ich habe eine Idee.«
»Nur heraus damit«, sagte Karlchen leutselig, »Sie wissen ja, ich liebe es, wenn die Vollzugsorgane Initiative zeigen.«
»Jawoll, Herr Assessor!«
»Nun also, was ist das mit Ihrer sogenannten Idee?«
»Ich meinte gehorsamst, wenn ich ... wenn ich, hm!« Hier räusperte sich Schmuttermaier verlegen und nestelte mit der Hand an seinem Uniformkragen.
»Etwas rascher!«, drängte Karlchen.
»Zu Befehl, Herr Assessor ... wenn ich ... wenn ich das Frauenzimmer selbst auf die Probe stellen würde.«
»Probe? Wie denn? Was denn?«
»Als Don Schuang!«
»Ach so! Hm! Ja, das ist wahr, das geht. Aber, Schmuttermaier, ich hoffe, dass Sie nur aus Pflichtgefühl auf diesen Gedanken gerieten?«
»Jawoll, Herr Assessor!«
»Schön! In diesem Falle haben Sie meine Billigung. Sie können gehen.«
Schmuttermaier rührte sich nicht vom Platze.
»Was wollen Sie noch?«, fragte Karlchen.
»Zu Befehl, Herr Assessor! Ich habe kein Geld nicht.«
»Hm! An der Kasse können Sie es nicht wohl erheben. Ich will Ihnen was sagen, Schmuttermaier, ich habe Sie als diensteifrigen Beamten kennen gelernt. Hier haben Sie zwanzig Mark, aber ich mache es Ihnen zur unabweislichen Pflicht, ich gebe Ihnen den dienstlichen Befehl, verstehen Sie wohl, den dienstlichen Befehl, dass kein anderes Gefühl in dieser heiklen Angelegenheit aufkommen darf als das der strengsten Pflichterfüllung.«
»Jawoll, Herr Assessor!«, sagte Schmuttermaier so laut, knapp und militärisch, wie man es bei der Verwaltung liebt. Dann drehte er kurz um und begab sich auf seine Mission.
Zwei Tage später kam in den Einlauf der Polizeidirektion eine sechs Seiten lange Anzeige des Schutzmannes Alois Schmuttermaier betreff Philippine Weizenbeck alias Baronin Werneck wegen überraschter Unzucht.
Karlchen freute sich als Mensch und Beamter über diese prompte Entlarvung eines jener unseligen Geschöpfe, welche im Sumpfe der Großstadt gedeihen. Er ließ die Delinquentin sofort zitieren; Philippine erschien. Sie erfüllte den Korridor und das Verhörzimmer mit durchdringendem Patschuliduft und versuchte ganz vergeblich durch den Liebreiz ihrer Erscheinung auf Karlchen zu wirken. Sie wies mit Entrüstung die »ordanären« Verleumdungen zurück; allein, als sie im besten Zuge war, erschien unter der Türe der klassische Zeuge Alois Schmuttermaier in Uniform.
Der Eindruck war fürchterlich; das treuherzige Geschöpf sah ein, dass sie dem überlegenen Polizeigeist zum Opfer gefallen war, und ließ alles mit sich geschehen; sie wurde acht Tage eingesperrt und sodann in ihre schöne Heimat verschubt.
Karlchen verfehlte nicht, höheren Ortes darauf hinzuweisen, dass seinem Spürsinn die Entdeckung der Salzburger Bathseba gelungen war, und er konnte aus manchen Dingen schließen, dass ihm die Tat hoch angerechnet wurde.
Eines Tages begab es sich sogar, dass ihn Exzellenz ansprachen, als sie sich gerade auf die Retirade begeben wollten.
»Ah, da ist ja der Herr Assessor Maier! Schön, schön«, sagten Exzellenz und zogen sich dann zurück.
Diese Äußerung wurde in der Beamtenwelt viel bemerkt und man prophezeite unserm Karlchen eine gute Zukunft.
Kein Mensch dachte mehr an die Philippine Weizenbeck; selbst Schmuttermaier hatte sie vergessen, sie, die doch ganz anders war als die Kocherl seines Bezirkes.
Da wurde er plötzlich an sie erinnert. Aus Salzburg kam ihm die Botschaft. Sie war auf jenem Papier geschrieben, welches die kaiserlich-königliche Regierung für amtliche Kundmachungen und zum Einwickeln des Tabakes benützt.
In dem Schriftstück hieß es, dass eine sichere Weizenbeck ledigen Standes ein Kind geboren und hiezu als Vater das bayerische Sicherheitsorgan Schmuttermaier benannt habe. Ob sich der Genannte hierzu bekenne und diesfalls den Unterhalt mit sieben Gulden den Monat bestreiten wolle?
Als sich der Adressat von der ersten Überraschung erholt hatte, ging er zu dem königlichen Assessor Karl Maier und berichtete ihm das Geschehnis.
Karlchen war wütend. »Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Ihre Recherche von dem strengsten Pflichtgefühl getragen sein muss? Habe ich das gesagt?«
»Jawoll, Herr Assessor!«
»So? Und jetzt kommen Sie mir mit dieser ... mit dieser Schweinerei? Die Folgen haben Sie selbst zu tragen! Abtreten!«
Alois Schmuttermaier war keineswegs gesonnen, seinen Gehalt um sieben Gulden oder zwölf Mark pro Monate zu kürzen.
Er richtete ein längeres Schreiben an die Salzburger Behörde, in welchem er ausführlich darlegte:
Erstens, dass er überhaupts kein Geld nicht habe, und zweitens, dass es sich hier nicht um die Frucht der unerlaubten Liebe, sondern einer dienstlichen Verrichtung handle. Indem in Bayern der Grundsatz gelte, dass der Staat für die amtlichen Handlungen seiner Beamten aufkomme und hier also die königliche Polizeidirektion das durch kriminelle Recherche zur Welt gekommene Kind bezahlen müsse. Indem es doch kein Gesetz gebe, welches den Beamten für seinen Gehorsam bestraft. »Einer jenseitigen kaiserlich-königlichen Bezirkshauptmannschaft ganz ergebenster Alois Schmuttermaier.«
Die Österreicher verweigerten den rechtlichen Anschauungen des bayrischen Sicherheitsorganes ihre Anerkennung und ersuchten kurzerhand die Polizeidirektion selbst, die Sache in Ordnung zu bringen.
Auf diese Weise musste Schmuttermaier vor das Angesicht des Herrn Präsidenten treten. Der Gedanke an die Schmälerung seiner Einkünfte verlieh ihm Kraft. Er blieb fest und berief sich darauf, dass er im Vollzuge eines dienstlichen Auftrages gehandelt habe.
Nun wurde Karlchen herbeigeholt. Als er in längerer Rede dartun wollte, dass Schmuttermaier entgegen dem klaren Befehle offenbar nicht bloß das strengste Pflichtgefühl beim Vollzuge der Recherche habe walten lassen und so weiter, wurde er barsch unterbrochen.
Exzellenz bedeuteten ihm, dass vor allem jeder Skandal vermieden werden müsse und dass es ohnehin höchst sonderbar sei, wenn ein Beamter die niedrigen Gelüste eines Gendarmen durch Darlehen von zwanzig Mark unterstütze, »höchst sonderbar, hö... höchst sonderbar, ze ze!«
Was blieb meinem Karlchen übrig?
Er musste retten, was noch zu retten war, und so kam es, dass er, der königlich bayerische Bezirksamtsassessor, die Alimente bezahlte für das illegitime Kind der Philippine Weizenbeck alias Baronin Werneck, welches zum Dank hierfür bei der Taufe den Namen Karl erhielt.
Tja –!
Eine bunte Gesellschaft, wie sie die Sommerfrische zusammenführt, saß im Postgarten zu Binswang und freute sich des schönen Abends und führte kluge Gespräche über dies und das. Alle Anwesenden vorzustellen wäre ermüdend, denn es waren zwei lange Tische, an denen in dichter Folge Männer und Frauen saßen, und es genügt hier zu sagen, dass ein Kommerzienrat Distelkamp aus Barmen wie auch ein Landgerichtsdirektor Höfler aus Fürth und ein pensionierter Hauptmann darunter waren und dem Kreise das Gepräge der besseren Gesellschaft verliehen.
Auch das bedeutende oder interessante Element fehlte nicht, da am Vormittag der bekannte Schriftsteller Harry Mertens eingetroffen war, dessen lyrische Gedichte und Versdramen nicht erst hervorgehoben werden müssen.
Er saß neben seiner Frau, die ihn an Stattlichkeit bei weitem übertraf, denn er war eine kleine, semmelblonde Erscheinung mit kreisrunden blauen Augen und einem merkwürdig entsagungsvollen Lächeln um den süßen Dichtermund, während die einen heftig arbeitenden Busen, pralle Arme und ein Doppelkinn hatte.
Die Gesellschaft würdigte vollkommen die Ehre, mit einem gedruckten, besprochenen und aufgeführten Genius unseres Volkes an einem Tisch zu sitzen, und nicht nur waren es die Damen, welche mit leuchtenden Augen an ihm hingen, sondern auch die Herren Diestelkamp und Höfler legten eine mit Neugierde vermischter Ehrerbietung an den Tag.
Man hatte unmittelbar nach Mertens' Ankunft nicht geahnt, mit wem man es zu tun hatte, und Frau Mertens hatte nicht früher als beim ersten Mittagmahl Gelegenheit gefunden solche Bemerkungen einzustreuen, welche allgemeine Aufklärung verschafften, indem sie laut nach einer Zeitung rief und den Semmelblonden fragte, ob nichts von ihm oder über ihn darin stünde. Sie wiederholte die Frage, schlug die stark rauschenden Blätter hastig um, überflog das Gedruckte und sagte, dass zu ihrer Verwunderung keine Notiz zu finden sei.
Sie beruhigte sich erst, als die Pfeile saßen und von den Nebentischen forschende Blicke ihren Mann streiften, der seine Suppe aß und sich apathisch wie ein dem Publikum vorgezeigter Menagerielöwe verhielt.
Frau Mertens warf zwischen Rindfleisch und Mehlspeise und zwischen Mehlspeise und Kaffee noch mehrmals die Angel aus, und als man sich erhob, biss Frau Direktor Höfler an und erhielt auf schüchterne Fragen eine erschöpfende Belehrung über das Stück Literaturgeschichte, welches der Zufall in ihren Kreis geworfen hatte.
Am Abend war dann alle Welt so unterrichtet, dass sie dem Dichter Bewunderung zeigen und Kenntnis seiner Werke heucheln konnte.
»Woher nehmen Sie Ihre Stoffe«, fragte Landgerichtsdirektor Höfler, der hier zum ersten Mal einen Genius verhören konnte und entschlossen war das Wesen der Schriftstellerei zu zerlegen. »Bietet sich Ihnen der Stoff, wenn ich so sagen darf, zufällig dar oder erfassen Sie durch einen Willensakt die Materie, der Sie dann poetische Form verleihen?«
»Tja ...«, sagte der Dichter.
»Ich meine, gehen Sie mit Überlegung und Absicht an das Objekt heran oder drängt es sich unabhängig und gewissermaßen fertig Ihrem subjektiven Empfinden auf oder ...«
»Tja ...«, sagte der Dichter.
»Oder«, wiederholte Höfler mit erhobener Stimme, denn er liebte es nicht, unterbrochen zu werden, »oder ist die Produktion in ihrem ersten Stadium ein von den den Willen bildenden Momenten unabhängiger Vorgang Ihrer Phantasie, welcher dann erst in seinem späteren Verlaufe in den Bereich Ihrer geistigen Machtsphäre gelangt und so Ihrem formenden Verstande unterworfen wird?«
»Er macht alles mit der Phantasie«, warf Frau Mertens ein, »er sitzt oft den ganzen Tag da und hat bloß Phantasie im Kopf; und dann kann man mit ihm reden, was man will – er hört einen nicht.«
»Das wäre also ein passiv empfangender Vorgang, der zeitlich dem aktiv gestaltenden vorausgeht«, bestätigte Direktor Höfler und sammelte zustimmendes Kopfnicken ein, indem er die Tafel entlangblickte.
»Ich denke es mir furchtbar interessant«, sagte Frau Kommerzienrat Diestelkamp, »wie so eine Dichtung entsteht; das muss zu spannend sein! Was hat man da nun eigentlich für ein Gefühl dabei?«
»Tja ...«, sagte der Dichter.
»Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, was wir da für ein Gefühl haben«, warf wiederum Frau Mertens ein. »Zuerst, wenn wir anfangen, ist es sehr nett, weil man sich darauf freut, und dann in der Mitte wird es traurig, weil es oft nicht geht, aber dann, wenn es heraußen ist, sind wir wieder froh.«
»Ich kann mir das sehr gut vorstellen«, meinte Frau Diestelkamp, »zuerst und dann ...«
»So dass wir gewissermaßen drei Momente der aktiven Gestaltung unterscheiden«, warf der Direktor in erklärender Weise ein, »der von Hoffnungen getragene Beginn, das behinderte Werden und die Erleichterung der Vollendung.«
»Ja, ich bin immer erleichtert, wenn er es heraußen hat, denn Sie glauben nicht, was man als Frau dabei aussteht. Beim zweiten Akt ist es am ärgsten, weil man da immer stecken bleibt. Beim ersten hat er noch Appetit und schläft gut und hat auch seinen regelmäßigen Stuhlgang. Sie entschuldigen, wenn ich das erzähle ...«
»Aber ich bitte Sie, es ist ja so interessant«, unterbrach hier Frau Diestelkamp die lebhafte Dichtersgattin, welche sogleich fortfuhr.
»Ja, beim ersten Akt ist alles in Ordnung, aber sowie der zweite angeht, isst er weniger und wacht mitten in der Nacht auf und verliert seine Regelmäßigkeit und verändert sich überhaupt. Ich kenne es sofort, wenn der zweite Akt angeht, und ich sage dann zu meiner Köchin, dass sie leicht verdauliche Speisen kocht und dass mir immer Kompott auf den Tisch kommt, und ich lasse ihn dann auch fleißig Hunyadywasser trinken, bis wir den zweiten Akt heraußen haben, denn der dritte geht schon wieder viel leichter. Er kriegt dann eine bessere Gesichtsfarbe und schwitzt auch nicht mehr so stark in der Nacht.« »Also die Lösung des Knotens gestaltet sich weniger schwierig, Herr Mertens?«, wandte sich der Direktor an den Mann, der sich teilnahmslos erklären ließ.
»Tja ...«, antwortete dieser und schnitt an seinem Rettich weiter.
Seine Frau aber ließ den Faden nicht aus der Hand gleiten.
»Der dritte Akt geht auch viel schneller. Wir haben höchstens vierzehn Tage Arbeit damit. Heuer beim ›Barbarossa‹ haben wir drei Wochen gebraucht, weil eine Szene vorkam, wo sich alles reimen musste. Ich habe es ihm gleich gesagt, dass wir stecken bleiben; aber es war eine Liebeserklärung und da hat er es so im Kopf gehabt. Ein paar Tage hat es gefährlich ausgesehen und meiner Köchin ist es auch aufgefallen. Sie hat mich gleich gefragt: ›Was hat denn der gnä' Herr? Es wird doch um Gottes willen nicht schon wieder einen zweiten Akt geben?‹ – ›Nein‹, sagte ich, ›Lina, den haben wir dieses Jahr glücklich hinter uns, aber es muss sich vier oder fünf Seiten voll reimen und Sie können ja für morgen eine Eierspeise mit Pflaumenmus richten, und wenn es dann noch nicht besser wird, wollen wir schon sehen.‹ Aber zum Glück waren dann am andern Tag die Verse heraußen und es ging wieder von selbst.«
Die Frauen der Tafelrunde hatten mit großem Ernst zugehört und nickten nun verständnisvoll mit den Köpfen.
»So lebt man doch eigentlich als Frau die Werke seines Mannes mit!«, unterbrach Frau Direktor Höfler das kurze Schweigen.
»Ich kann es mir so gut vorstellen«, sagte Frau Kommerzienrat Diestelkamp.
»Sie dürfen mir glauben, dass ich als Frau meinen Kopf beisammen haben muss, wenn er dichtet.«
Frau Mertens zeigte bei diesen Worten auf ihren Gatten, der kindlich lächelnd seinen Rettich einsalzte. »Ich muss an alles denken und mich trifft es viel härter wie ihn. Er sitzt einfach in seinem Zimmer und schreibt, aber ich habe die Haushaltung und muss genau Acht geben, dass wir noch waschen und reinemachen, vor der zweite Akt angeht, denn dann ist keine Zeit mehr zu so was und es muss gut eingeteilt werden. Wie wir den ›Perikles‹ gedichtet haben, sind wir mit dem Stöbern gerade noch drei Tage in den zweiten Akt hineingekommen und ich kann Ihnen bloß sagen, ich möchte das nicht wieder erleben, und ich habe auch beim ›Theoderich‹ eine zweite Zugeherin genommen, dass wir nur ja schnell fertig geworden sind.«
»Wie interessant!«, rief Frau Diestelkamp aus, »es wird einem alles so näher gebracht. Ich habe bis jetzt gar keine rechte Vorstellung gehabt, wie es wohl in Dichterfamilien ist, und nun verstehe ich manches.«
»Sie müssen aber trotzdem sehr glücklich sein«, fügte Frau Höfler hinzu. »Als Gattin eines Dichters! Ich stelle mir das entzückend vor.«
»Ich möchte mit niemand tauschen«, erwiderte Frau Viertens, »obschon manches vorkommt, was einem Sorgen macht. Denken Sie sich, wir haben fünfzehn Jahre lang romantisch gedichtet und jetzt geht das nicht mehr und wir müssen modern schreiben oder realistisch, wie man auch sagt. Das ist ein Schlag, kann ich Sie versichern! Mein Mann wollte noch immer nicht, aber was kann man gegen die Kritiker machen?«
»Erlauben Sie mir die Bemerkung, gnädige Frau, dass ich da ganz auf Seite Ihres verehrten Gemahls stehe«, rief Herr Diestelkamp, »wir wollen gerade in unserer nüchternen Zeit die Romantik nicht missen und wir suchen bei unsern Dichtem die herrliche Quelle der ... den ... den Ritt in ... ich wollte sagen, wir wollen immer noch einen Trunk aus der romantischen Quelle schlürfen.«
»Es geht nicht«, sagte Frau Mertens mit einer Schärfe, die erraten ließ, dass man hier auf ein eheliches Streitthema gekommen war. »Es geht durchaus nicht. Das nächste Stück muss er modern schreiben. Ich will nicht, dass die Zeitungen noch einmal von veralteter Manier schreiben oder dass die Frau Nathusius die Nase rümpft, wenn sie mir begegnet, weil ihr Mann schon dreimal hochmodern gedichtet hat.«
»Aber die romantische Muse Ihres Mannes wird sich dagegen sträuben«, sagte Direktor Höfler.
»Sie hat sich gesträubt«, rief die streitbare Frau und blickte dabei mit einiger Strenge auf ihren Mann, der den endlich weinenden Rettich aß; »sie hat sich allerdings gesträubt, aber das ist jetzt vorbei. Ich muss es auch aushalten, und wenn es noch schlimmer wird bei den zweiten Akten.«
»So geben also auch Sie den Ritt ins alte romantische Land auf?«, fragte Diestelkamp, der sich nun auf das vorher gesuchte Zitat besonnen hatte, mit starkem Pathos.
»Tja ...«, antwortete der Dichter.
O Natur!
Personen: Er – Sie – Ein Holzknecht. Ort: Im Gebirge.
Er: Wie das hier schon ganz anders riecht, Lizzi! A-ah! Endlich aus der Stadt in die Natur geflohen!
Sie: Himmlisch!
Er: Stelle dir vor! Der Schnee in unseren Straßen, schwarz, schmutzig, nass. Und hier blinkt und glitzert er.
Sie: Er ist direkt keusch, finde ich.
Er: Man denkt an Weihnachten, Christabend, an irgendwas Poetisches.
Sie: Karl, du Guter! Nein, wie bin ich dir dankbar, dass du mich aus dem schrecklichen Trubel in diesen Frieden gebracht hast!
Er: Nicht wahr?
Sie: Weißt du, als ganz kleines Mädchen bin ich auch einmal im Winter auf dem Lande gewesen. Bei Großmama. Da weiß ich noch, wie da auch die Bäume verschneit waren und so merkwürdig aussahen.
Er: Du bekommst förmlich große Augen, wie du das sagst, Lizzi!
Sie: Es muss die heimliche Sehnsucht nach der Natur sein, die in einem lebt. Trotz allem, weißt du, Karl?
Er: Ja, ja. Trotz allem.
Sie: Nein! Sieh mal dort die große Tanne! Wie ein Ungeheuer sieht so ein Zweig aus. Wie was Lebendiges.
Er: Wie ein Märchen. Sie: Die Natur ist doch das einzig Wahre!
Er: Man sollte hier immer leben!
Sie: Das wäre herrlich! Ich ließe mir einen großen Pelz dazu machen; weißt du, grünen Samt, mit Zobel besetzt, und innen auch Zobel, oder Seal.
Er: Das sollte man tun, hier leben.
Sie: Oder Skunks, Karl, obwohl ich eigentlich Skunks nicht sehr liebe.
Er: Das würde sich schon finden.
Sie: Und weißt du, eine Pelzmütze sollte ich haben. Ich habe vorgestern bei Bachmann eine entzückende Mütze gesehen.
Er: Dieser Friede ringsum!
Sie: Ich glaube, sie war aus Otterfellen und hatte vorne eine Agraffe, in der eine Reiherfeder steckte.
Er: Sieh dort, Lizzi, wie die Bergspitze noch von der Abendsonne beschienen ist.
Sie: Wun–der–voll! Weißt du, man könnte statt Reiher auch eine andere Feder nehmen. Meinst du nicht?
Er: Ja – ja. Ich könnte hier stundenlang in den Anblick versunken stehen.
Sie: Und ich möchte am liebsten durch den Schnee waten. Wie ein Schulmädchen, und ganz rote Backen davon kriegen.
Er: Und nasse Füße, Liebling!
Sie (enttäuscht): Das ist wahr!
Er: Man müsste eben andere Schuhe tragen. Und sich überhaupt daran gewöhnen. Oh! Hier muss ein Mensch gesund werden!
Sie: Ich fühle mich jetzt schon ganz anders.
Er: Ich meine körperlich und geistig gesund werden. A-ah! Diese Luft! Diese Luft!
Sie: Wie die Sonne verglüht! Das sollte man jeden Abend haben.
Er: Und sich von dem Zauber der Natur umfangen lassen.
Sie: Ich möchte am liebsten gar nicht mehr weg.
Er: Weißt du was? Wir bleiben einfach morgen noch hier.
Sie: Ach ja – das wäre himmlisch! Aber es geht nicht, Schatz. Ich muss morgen zur Schneiderin und dann sollen wir bei Hofrats Besuch machen und abends ist der »Rosenkavalier« und ...
Er: Richtig, ja! Na, denn nich! Eigentlich ist es schade!
Sie: Mir blutet ja das Herz, dass man sich von hier losreißen soll.
Er: Mir auch. Diese Farben! Nein, diese Farben!
Sie: Du, dort kommt ein Mann.
Er: Er hat so was wie 'ne Säge umhängen. Das ist sicher 'n Holzfäller.
Sie: Wie stilvoll er aussieht!
Er (seufzend): Ach, wenn man auch so einer wäre! He, guter Mann!
Holzknecht: Han?
Er: Sie leben wohl immer hier heraußen?
Sie: In der Natur?
Er: Und wissen vielleicht gar nicht, wie beneidenswert Sie sind!
Holzknecht: Am – – –! (Entfernt sich.)
Sie: Wie? Was hat er gesagt?
Er: Ach, so was ... so was Bäuerliches, was die Leute hier oft sagen. Nun wollen wir aber umkehren. (Bleibt stehen und atmet tief auf.) Nein! Diese Natur!
Käsebiers Italienreise
Fabrikant Friedrich Wilhelm Käsebier aus Charlottenburg, seine Frau Mathilde und seine Tochter Lilly konnten endlich die längst ersehnte Reise nach dem sonnigen Süden antreten.