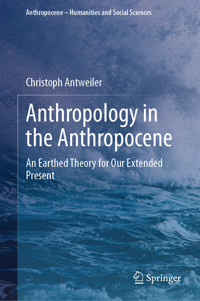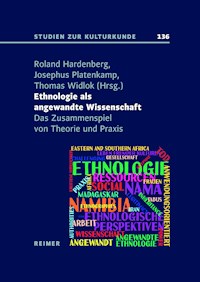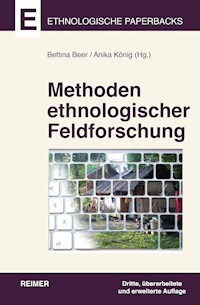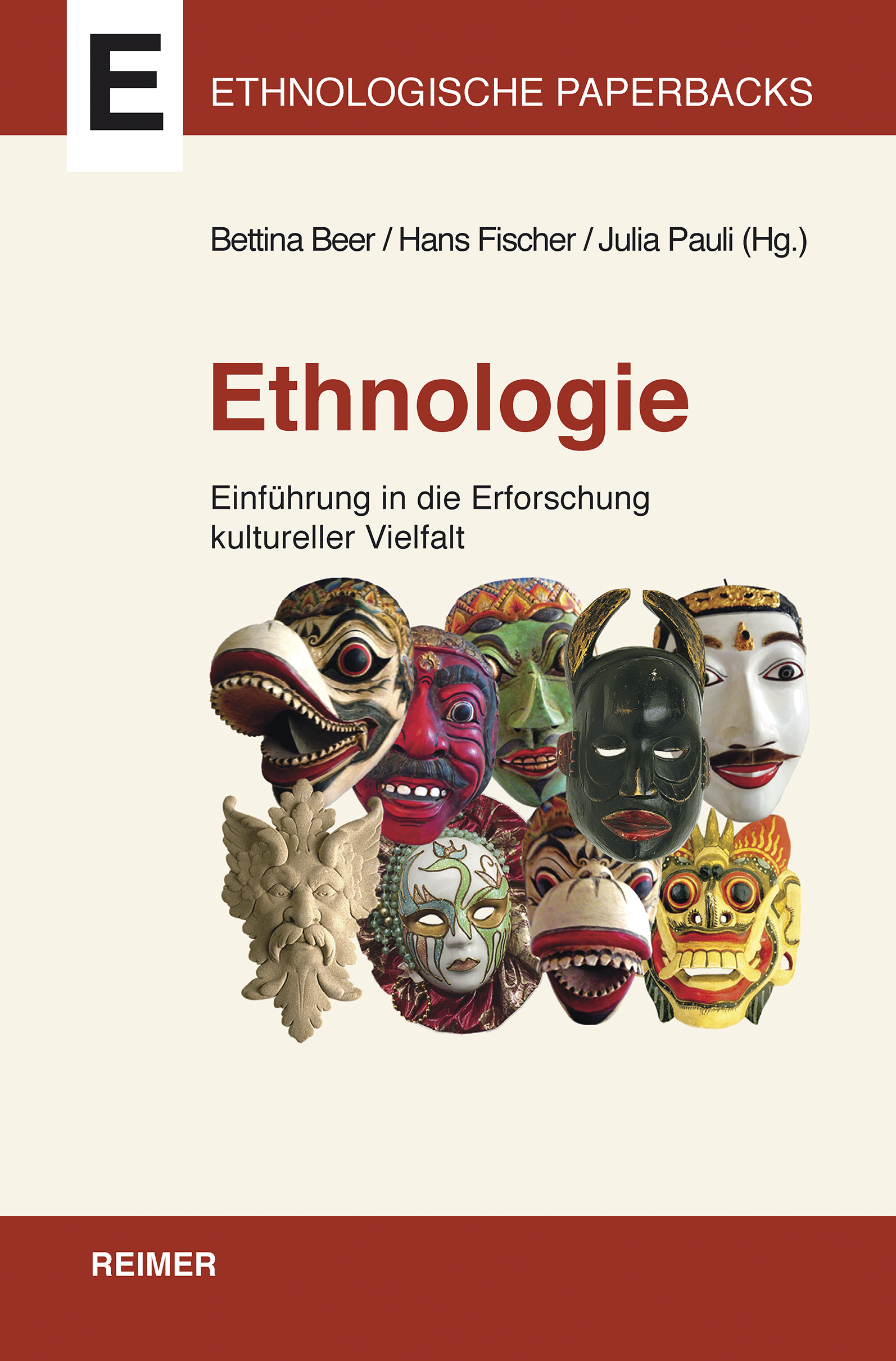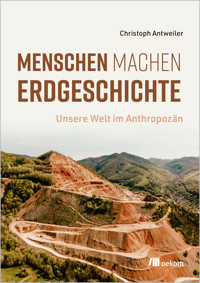
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Im Anthropozän machen Menschen nicht nur Geschichte – sondern auch Erdgeschichte. Denn unser heutiger Konsum wird die ferne Zukunft prägen. Die Enkel unserer Enkel werden mit den Resten der Plastikflaschen, Asphaltbeläge, Covid-Masken und Hühnerknochen leben. Gleichzeitig verbrauchen wir heute Rohstoffe, deren Entstehung viele Millionen Jahre brauchte. Ein derartig rasanter Wandel ist in der Erdgeschichte beispiellos. Die Epochenbezeichnung »Anthropozän« beinhaltet eine besondere, naturbezogene Gesellschaftskritik. Angesichts des Anthropozäns sind gängige Nachhaltigkeitskonzepte zu kurzsichtig, zu stabilitätsorientiert und zu wachstumsorientiert. Das Anthropozän fordert eine neue, eine geerdete Politik. Christoph Antweiler bietet dazu eine umfassende, fundierte und kritische Orientierung. Sein Buch möchte dazu beitragen, dass tiefenzeitliches Denken – von tiefer Vergangenheit bis in die ferne Zukunft – in der Gesellschaft ankommt. Denn morgen ist schon heute: Wir sind das Anthropozän.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1163
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christoph Antweiler
Menschen machen Erdgeschichte
Unsere Welt im Anthropozän
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2025 oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Goethestraße 28, 80336 München +49 89 544184 – 200
www.oekom.de
Layout und Satz: oekom verlag
Umschlaggestaltung: Laura Denke, oekom verlag
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9783987264245
DOI: https://doi.org/10.14512/9783987264085
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Vorwort:
Eine Geoanthropologin in der Zukunft wundert sich
Kapitel 1:
Menschen machen Erdgeschichte – neue Erde und neue Anthropologie
1.1:
Das »Menschenzeitalter« – willkommen im Anthropozän?
1.2:
Geowissenschaften und Anthropologie – Fragen und Argumentationsgang
1.3:
Planetarer Raum und tiefe Zeit – eine geosoziokulturelle Epoche
1.4:
Tiefenzeit und Periodisierung – umstrittene Zeitlichkeit
Kapitel 2:
Kulturelle Resonanz – Begriffskarriere und Historisierung
2.1:
Eine multiple Geburt – Zeitenbruch und Populärkultur
2.2:
Anthropozän – tatsächlich eine neue Perspektive?
2.3:
Wendepunkte und Brüche – wann wurde der Mensch geologisch?
Kapitel 3:
Endzeitgeschichten – Ängste und Hoffnung
3.1:
Alarm und Dystopie – Umweltnarrative mit Mobilisierungspotential
3.2:
Globus, Planet und
Gaia
– Welt‐Bilder voller Resonanz
3.3:
Erdsphären und kritische Zone – die menschliche Haut der Erde
3.4:
Neues Ordnen der Welt – wirkmächtige Narrative und moralische Visualisierung
3.5:
Natur‐ und Menschenbilder – zwischen Misanthropozän und »reifen Anthropozän«
Kapitel 4:
Stärken und Schwächen – Kritiken des Anthropozän‐Denkens
4.1:
Brücke zwischen Fächern sowie Raum‐ und Zeitmaßstäben
4.2:
Stärken der Anthropozän‐Idee gegenüber verwandten Konzepten
4.3:
Allgemeine Einwände – Diffusität und Atlantozentrismus
4.4:
Ahistorische Periodisierung – die »große Trennung«
4.5:
Ideologie – Depolitisierung, Anthropozentrik und Genderblindheit
4.6:
Bourgeoiser Universalismus – Pauschalisierung der Verantwortung
4.7:
Im Neologismozän – die vielen Namen des Widerstands
Kapitel 5:
Anthropozäne Ethnologie –
Culture Matters
!
5.1:
In der Kontaktzone der Disziplinen – Resonanz in der Ethnologie
5.2:
Ethnologie – ein Profil und eine Position
5.3:
Geerdete Ethnologie – Natur, Klimawandel und Anthropozän
5.4:
Lokalisierung – Ethnologie als Anwältin kleiner Maßstäbe im Anthropozän
5.5:
Patchy Anthropocene
– eine Programmatik im Modus der Abgrenzung
5.6:
Konzepte – Bedeutung, Verkörperung und Abwägungsverfahren
5.7:
Kultur – ethnologischer Holismus
revisited
5.8:
Lokal und gegenwartsbezogen – Chancen der Feldethnologie
5.9:
Kulturwandel und Kulturrevolution – vergessene Fachbestände
Kapitel 6:
Erdung in Raum und Zeit – zur Geologisierung des Sozialen
6.1:
»Anthropogen« – Menschen
in
Natur
6.2:
Kulturgeschichte ist grundiert in Erdgeschichte – Geosphäre als Palimpsest
6.3:
Anthropos
und
Prometheus – Homo
und
Anthropos
6.4:
Umwelt und Kultur – biokulturelles Niemandsland und Sozialtheorie
6.5:
Jenseits von Nachhaltigkeit? – ökologische Brüche versus holozänes Denken
6.6:
Tiefenzeit und soziale Zeiten – Paläontologie der Gegenwart
6.7:
Planetarität – Maßstabs‐
Clashes
und zwei Seiten menschlicher Handlungsmacht
Kapitel 7:
Gesellschaften konstruieren und erben Nischen – Vergangenheit trifft Zukunft
7.1:
Kultur quert Materialität – multi‐materiale Verschränkungen
7.2:
Nischenkonstruktion – Kulturgeschichte trifft Naturgeschichte
7.3:
Menschheit als Skalenbegriff – Postkolonialismus trifft Geologie
7.4:
Öko‐Kosmopolitismus – lokalisierte WeltbürgerInnen?
7.5:
Asianizing the Anthropocene – Beispiel einer Rezentrierung
7.6:
Anthropozäne Reflexivität – für und wider eine »anthropozäne Wende«
Zusammenfassung und Fazit – Wir sind das Anthropozän
Das Anthropozän ist anders als andere Krisen
Befunde
Für eine geerdete Anthropologie
Fazit in sieben Thesen
Glossar – ein Wörterbuch zum Anthropozän
Vorbemerkung
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Autor und Dank
Orientierung im Anthropozän‐Dschungel – ein Medienführer
Literatur
Index
für Dario und Craig
VorwortEine Geoanthropologin in der Zukunft wundert sich
… the current definition of »Anthropocene« is a bet on the future and, as such, its meaning and eventual formalization depend on the future development of human affairs.
Valentí Rull 2011: 56
Kein Ort der Welt ist mehr gänzlich unberührt vom Menschen. Anthropozän ist der Name dafür, dass Menschen bereits heute die Erdoberfläche so stark prägen, dass man das in ferner Zukunft noch als geologische Schicht erkennen wird. Der Einfluss des Menschen ist inzwischen nicht mehr auf lokale Eingriffe in die Natur beschränkt. Menschliche Eingriffe haben die Geosphäre radikal verändert. Naturwissenschaftler kommen zum Befund, dass menschliches Handeln spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts in einer Weise Veränderungen der Erdoberfläche prägt, die in der Erdgeschichte beispiellos sind.
Innerhalb der Geschichte des Menschen hat die Ausbeutung der Natur mit der Nutzung fossiler Energie völlig neue Maßstäbe erreicht. Seit rund 200 Jahren sind die menschlichen Einflüsse auf die Erdoberfläche so stark, dass sie als eigene Naturkraft anzusehen sind. Menschliche Aktivitäten betreffen jedwede Natur auf der Erdoberfläche, sie haben weltweiten Maßstab und sind teilweise unauslöschlich – so der zentrale empirische Befund. Damit hat der Mensch das Potenzial, ungewollt Instabilitäten bis hin zu katastrophalen Veränderungen im ganzen System der Geosphäre zu erzeugen – so die Befürchtung.
Das Wortkompositum benennt diesen Bruch in der jüngeren Geschichte der Erde, genauer der Geosphäre, eben das »-zän«, das »neue, ungewöhnliche« (altgriechisch καινός, kainos), welches durch den Menschen (ἄνθρωπος, ánthrōpos) erzeugt wird. In der etablierten geologischen Zeitrechnung leben wir seit knapp 12.000 Jahren in der Erdepoche des Holozäns, dem jüngsten, nacheiszeitlichen relativ klimastabilen Abschnitt der Periode des Quartärs. Resultate menschlicher Aktivitäten lagern sich dauerhaft im Sediment ab. Beton wird ein ganz normaler Gesteinstyp der Geologie der Zukunft sein. Aufgrund des Ausmaßes menschlicher Eingriffe in die Erdhülle (Geosphäre) und der erdgeschichtlich gesehenen Plötzlichkeit sollte dieser neuen Phase der Geschichte der Rang einer geologischen Erdepoche, des Anthropozäns, zugesprochen werden – so die zentrale Idee.
Im Unterschied zu anderen geologischen Perioden, die viele Millionen Jahre dauern, hätte diese Epoche des Anthropozäns bislang nur die extrem kurze Zeitdauer nur eines Menschenlebens. Aus geologischer Sicht ist das Anthropozän nicht einfach die »Epoche des Menschen« oder das »menschliche Zeitalter«. Es ist vielmehr das neues Erdzeitalter, dessen jetzige Gesteinsschichten von Rückständen jüngster menschlicher Aktivität geprägt sind bzw., da es ja noch weiterläuft, in Zukunft sein werden. Anthropozän ist also zweierlei – einerseits eine Sache, zu der es klare geologische Befunde gibt, und andererseits eine Idee, ein Konzept. Lassen Sie uns die Bedeutung des geologischen Befundes und des dadurch ausgelösten begrifflichen Erdbebens anhand einer Zeitreise in die Zukunft verdeutlichen.
Vera ist Geoanthropologin, lebt in der Zukunft, im geologischen Zeitalter des Quintärs. Sie hat sich schon im Studium auf Paläontologie spezialisiert und als naheliegendes Nebenfach Anthropologie gewählt. Sie hat ihre jetzige Stelle als Kulturpaläontologin angetreten. Gerade ist Vera dabei, Daten zu Sedimenten aus der jüngeren Erdgeschichte auszuwerten. Sie stammen aus dem späten Quartär, nur gut zehn Millionen Jahre vor ihrer Zeit, genauer aus den 2000er‐Jahren nach der damaligen christlichen Zeitrechnung. Vera weiß, in Schichten diesen Alters finden sie und Kollegen weltweit immer wieder die Leitfossilien, die das »Anthropozän« markieren, der Phase, in der die Menschheit zu einem echten Geofaktor geworden war: Plastikstücke, Betonreste und künstliche Radionuklide, wie das stabile Blei‑207 am Ende der Zerfallsreihe des radioaktiven Uran 235. All das war damals für die Formung der Erdoberfläche bestimmender geworden als Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis.
In den kulturpaläontologischen Archiven mit Resten aus den damaligen Kulturen studieren Vera und Kollegen neben Humanfossilien aber auch elektronische Dokumente und ganz selten auch erhaltene Schriftstücke, die Diskussionen aus dieser fernen Vergangenheit bezeugen. Und da kann sich Vera manchmal nur wundern. Damals hatten doch tatsächlich viele Wissenschaftler, darunter auch Geologen und Paläontologen, dagegen argumentiert, dass eine solche Epoche namens »Anthropozän« überhaupt formal in die Stratigrafie eingeführt und damit den bisherigen Erdzeitaltern gleichgestellt werden sollte.
Vera denkt: okay, damals gab es diese Effekte menschlichen Handelns ja noch nicht so lange. Es hatte in den Jahren zwischen 2000 und etwa 2020 damals noch christlicher Zeitrechnung vor allem wissenschaftliche Kontroversen darum gegeben, ab wann der menschliche Geoeinfluss wirklich stark war. Hatte das vor 70 Jahren, 700 Jahren oder 7000 Jahren eingesetzt oder gar vor noch längerer Zeit, vielleicht mit Beginn der Landwirtschaft oder den ersten Städten? Als Wissenschaftler, die in sehr langen Zeiträumen denken, hatten viele Kollegen das damals für ein kleines und vorübergehendes Ereignis in der Geschichte der Menschheit gehalten. Noch im Jahr 2024 hatte das leitende Gremium der Geologie die Formalisierung als geologische Epoche zunächst abgelehnt.
Später im Quartär hatte die Menschheit noch gerade so die Kurve gekriegt. Nach langen Verhandlungen und der formalen Anerkennung waren tatsächlich weltweit akzeptierte Vereinbarungen erreicht worden. Die menschliche Überformung der Umwelt wurde zurückgefahren. Das Anthropozän war um 2100 zu Ende gegangen und bildet seitdem die kürzeste Epoche in der geologischen Zeittafel. Aus Vorlesungen zur Fachgeschichte weiß Vera, dass es schon ab 2020 die ersten Versuche gegeben hatte, den geologischen Einfluss einzelner Gesellschaften und sogar den Umwelteffekt einzelner Menschen zu messen. Diese sogenannte biografisch‐anthropozäne Methode war damals anhand eines Politikers namens Donald Trump eingeführt worden. Es hatte aber, wie die Fachhistoriker wissen, noch lange gedauert, bis sich die Methode auch bei den Erdgeschichtlern als Standardverfahren etabliert hatte. Sowohl das Konzept Anthropozän als auch die damals neuen Wissenschaften der Geoanthropologie, Kulturgeologie und Kulturpaläontologie hatten lange gebraucht, um akzeptiert zu werden. Aber Vera sagt sich auch: Jetzt, in der nachanthropozänen Ära und mit gehörigem Zeitabstand ist es natürlich leicht, diese damalige geohistorische Schwelle, ja diesen Bruch in der Menschheitsgeschichte klar zu erkennen. Jetzt, im Postanthropozän, ja im Quintär, ist es sonnenklar, dass das Anthropozän mehr war als ein vulgärwissenschaftliches Krisen‐Mem des beginnenden 21. Jahrhunderts.