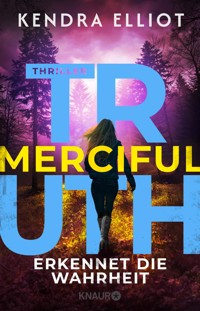9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Mercy Kilpatrick Serie
- Sprache: Deutsch
Ritualmorde und die Schrecken der Vergangenheit: Im romantischen Thriller »Merciful Secret – Verzeihet meine Sünden« muss sich FBI-Agentin und Überlebenskünstlerin Mercy Kilpatrick etwas Schrecklichem stellen, um ihren 3. Fall zu lösen. Für Mercy Kilpatrick bieten die Wälder Oregons die einzig wahre Sicherheit. Obwohl ihre Familie ihr nicht verziehen hat, dass sie den Prepper-Clan für das FBI verlassen hat, hält Mercy an ihren alten Überzeugungen fest. Es sind ihre Geheimnisse – so gut gehütet wie das kleine Schutzhaus, das sie in den Ausläufern des Gebirges heimlich gebaut hat. In einer Hütte in der Nähe ihres Verstecks trifft Mercy eines Tages auf ein junges Mädchen, dessen Großmutter mit einem Messer grausam ermordet wurde. Hunderte von Meilen entfernt wird die Leiche eines Richters entdeckt, der auf ganz ähnliche Weise ums Leben kam. Die Opfer könnten unterschiedlicher nicht sein – was also verbindet sie? Zusammen mit Polizeichef Truman Daly muss Mercy den Killer finden, bevor die Zahl der Toten steigt. Sie weiß, dass ihre Vergangenheit sowohl sie selbst als auch ihre Familie belastet. Aber wie kann sie ihre Geheimnisse bewahren, wenn ihr Schweigen weitere Morde zur Folge hat? Slow burn Romance und explosiver Thriller in einem. Die toughe und geheimnisvolle Mercy und der aufrichtige Cop Truman sorgen für jede Menge romantische Spannung und knallharte Action. Kendra Elliots twistreiche Pageturner um Mercy Kilpatrick und die Prepper-Szene sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Merciful Death – Erbarme dich ihrer - Merciful Truth – Erkennet die Wahrheit - Merciful Secret – Verzeihet meine Sünden
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kendra Elliot
Merciful Secret
Verzeihet meine Sünden
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Kerstin Fricke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Obwohl ihr Vater ihr nicht verziehen hat, dass sie den Prepper-Clan für das FBI verlassen hat, hält Mercy Kilpatrick an ihren alten Überzeugungen fest. Sie sind ihr Geheimnis – so gut gehütet wie das kleine Schutzhaus, das sie in Oregons Wäldern heimlich gebaut hat.
In dessen Nähe trifft Mercy eines Tages auf ein junges Mädchen, dessen Großmutter erstochen wurde. Hunderte von Meilen entfernt wird eine weitere Leiche mit ähnlichen Verletzungen entdeckt. Die Opfer – eine Einsiedlerin und ein Richter – könnten unterschiedlicher nicht sein. Mit Polizeichef Truman Daly muss Mercy den Mörder finden, bevor die Anzahl der Toten steigt.
Sie weiß, dass ihre eigene Vergangenheit sowohl sie als auch ihre Familie belastet. Kann sie ihre Geheimnisse bewahren, wenn ihr Schweigen doch weitere Morde zur Folge haben könnte?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Dank
Für Megan und auf neue Anfänge
Eins
Mercy glaubte zuerst, es wäre ein Reh.
Aber es war ein Mädchen, das aus dem Gebüsch am Rand der dunklen Straße ins Scheinwerferlicht ihres SUV stürzte. Sie trat auf die Bremse und riss das Lenkrad nach rechts. Der Wagen geriet ins Schleudern und wackelte, als die Reifen über die schneebedeckten Spurrillen des Standstreifens holperten. Er kam zum Stehen, und sie umklammerte das Lenkrad und rang nach Luft.
Ich habe sie nicht getroffen.
Hände schlugen gegen das Fahrerfenster. »Sie müssen mir helfen! Bitte!«
Rote Striemen zogen sich über das Glas, und in den großen Augen des Mädchens spiegelte sich Entsetzen wider.
Jemand hat sie angefahren und ist abgehauen.
Mercy riss die Tür auf, und das zitternde Mädchen stürzte in ihre Arme. »Bitte helfen Sie ihr! Sie stirbt!« Ihre Hände waren mit Blut verschmiert, das auch ihre Wangen bedeckte. Sie konnte nicht älter als zehn sein, und ihr kurzärmliges T-Shirt war für die eisige Nachtluft nicht im Geringsten angemessen. Sie packte Mercy am Mantel und zerrte sie in Richtung Straße. »Sie ist da vorn!«
»Warte! Bist du verletzt?« Mercy hielt das Kind am Handgelenk fest und untersuchte erst die blutige Hand, dann drehte sie seinen Kopf so, dass sie ihm ins Gesicht sehen und nach Verletzungen Ausschau halten konnte. Die Kleine versuchte nach Leibeskräften, sich aus ihrem Griff zu befreien.
»Das ist nicht mein Blut! Ich bin nicht verletzt, aber meine Großmutter! Sie stirbt!« Das Mädchen rutschte aus, als es versuchte, Mercy vom Wagen wegzuziehen. »Sie müssen uns helfen!«
»Wo ist sie?«
»Hier lang!« Sie forderte Mercy mit dem Blick auf, ihr zu folgen.
Mit rasendem Herzen zog Mercy das Mädchen zum Heck ihres Tahoe und nahm eine Reisetasche vom Rücksitz. »Wäre es nicht schneller, zu deiner Großmutter zu fahren?«
»Die Abkürzung durch den Wald ist am schnellsten.« Das Kind erstarrte und beäugte hoffnungsvoll die Tasche. »Sind Sie Ärztin?«
»Nein.« Mercy holte ihr Handy heraus. Kein Empfang. Verdammt! »Hast du den Notruf gewählt?«
»Wir haben kein Telefon.«
Wer hat denn heutzutage kein Telefon? Sie schaute sich die Kleine genauer an. Sie musste dringend mal zum Friseur, und ihre Jeans waren bestimmt fünf Zentimeter zu kurz. Ihr Gesicht war schmal und zart, sodass sie beinahe an eine Elfe erinnerte. »Meine Mutter hat eins, aber sie ist nicht zu Hause. Können Sie sich bitte beeilen?«
Ihr panischer Blick brach Mercy beinahe das Herz. »Ich muss nur noch eine Sache einstecken.« Sie ließ den Blick über die hoch aufragenden Kiefern auf beiden Straßenseiten schweifen. Zehn Minuten zuvor hatte sie ihre Hütte verlassen, aber sie befand sich noch immer in einem der dichtesten Wälder auf der Ostseite der Cascade Mountains. Die Straße war kaum befahren, und da es fast 3 Uhr morgens war, würde hier so schnell auch niemand vorbeikommen. Rasch kehrte sie auf die Fahrerseite zurück und griff nach ihrer Handtasche mit der Pistole in der darin verborgenen Innentasche, wobei sie bereute, ihr Schulterholster nicht zu tragen.
Sie verstaute ihre Handtasche in der Reisetasche und schwang sich den strapazierfähigen Gurt über die Schulter, wobei sie sich an das schwere Gewicht anpassen musste. »Dann mal los.« Das Mädchen drehte sich um und sauste durch den Schnee in Richtung des Gebüschs, aus dem es aufgetaucht war. Mercy schloss ihren Wagen mit der Fernbedienung ab und fischte eine Taschenlampe aus der Reisetasche.
Ich werde tun, was ich kann, und dann Hilfe holen.
Der Verbandskasten in der Reisetasche sah nicht aus wie einer aus dem Supermarkt. Vielmehr hatte sie darin Skalpelle, chirurgisches Nähzeug, Spritzen, Epinephrin und Lidocain zusätzlich zu dem üblichen Sortiment an Verbänden und Kleber. Während sie dem Mädchen folgte, das zwischen den Bäumen verschwand, machte sie in Gedanken eine Bestandsaufnahme. Notfalldecke, Anzünder, Stirnlampe, Beil, Plane, Proteinriegel, Wasserreinigungstabletten. Mercy wusste ganz genau, dass man sich keinesfalls ohne Vorräte blindlings in den Wald stürzen durfte.
Sie richtete den Strahl ihrer Taschenlampe auf das Mädchen. Die Kleine war verschwunden. Mercy suchte das Gebüsch ab, in dem sie das Kind vermutete. »Hey! Warte! Wo steckst du?« Ich weiß nicht mal, wie sie heißt.
Das Elfengesicht erschien plötzlich im Lichtstrahl. »Beeilen Sie sich!«
Mercy lief hinter ihr her, wobei ihre Stiefel in den zehn Zentimeter tiefen Schnee einsanken. »Wie ist dein Name?«
»Morrigan.« Sie lief direkt vor dem Lichtstrahl der Taschenlampe her und wich geschickt herabgefallenen Ästen und großen Steinen aus.
Mercy versuchte, ihnen beiden den Weg zu leuchten, aber Morrigan schien nachts so gut wie eine Katze sehen zu können. Nach einer Weile gab Mercy den Versuch auf und konzentrierte sich darauf, sich nicht den Knöchel zu verstauchen. Keiner weiß, wo ich bin. Bei diesem Gedanken wurde ihr ganz mulmig zumute, doch sie verdrängte ihn. Ihr Freund Truman und ihre Nichte Kaylie wussten, dass sie in ihre Hütte gefahren war, und ihr Wagen stand am Straßenrand. Wenn jemand nach ihr suchte, würde er sie finden.
Hoffentlich in einem Stück.
»Was ist mit deiner Großmutter passiert, Morrigan?« Sie gab sich die größte Mühe, mit dem Kind Schritt zu halten.
»Ich weiß es nicht! Da war überall Blut.«
»Wie weit ist es noch?«
»Wir sind fast am Haus.«
»Wir hätten fahren sollen«, murmelte sie.
»Nein, die Straße zum Haus macht einen großen Bogen nach Norden. Dieser Weg ist schneller. Da ist es!«
Mercy hob ihre Taschenlampe höher. Weit voraus konnte sie die Umrisse eines kleinen Hauses im Ranchstil erkennen. Ein schwaches Licht schimmerte hinter einem Fenster. Keine Außenbeleuchtung. Sie hatte gar nicht gewusst, dass in dieser Gegend ein Haus stand. Jahrelang war sie die alte Landstraße entlanggefahren und hatte nie einen Hinweis darauf entdeckt, dass in diesem Teil des Waldes jemand lebte. Und ich dachte, ich hätte hier Privatsphäre.
Morrigan rannte ein paar schiefe Betonstufen hinauf und stieß die Tür auf. »Grandma!«, rief sie.
Mercy hielt am Fuß der Treppe inne und prüfte ihr Handy auf Empfang. Nichts. Wie soll ich ihre Großmutter zum Tahoe bringen? Ich hätte darauf bestehen sollen, dass wir mit dem Wagen herkommen.
Vorsichtig betrat sie das dunkle Haus und ging in die Richtung, aus der Morrigans leises Schluchzen kam. Sie betätigte einen Lichtschalter, aber nichts geschah. Daher leuchtete sie mit der Taschenlampe jede Ecke des Raumes aus, um nicht überrascht zu werden. Es roch nach altem Staub, als ob das Haus seit Jahren verlassen wäre, aber es war voll möbliert, und es gab deutliche Hinweise auf Bewohner. Ein Buch auf dem Beistelltisch. Eine Tasse neben einem Zeitschriftenstapel. Zu ihrer Rechten befand sich eine winzige Küche, deren begrenzte Arbeitsfläche von einem Abtropfgestell und einem Schongarer eingenommen wurde.
»Sie ist hier drin!«, rief Morrigan. »Beeilen Sie sich! Bitte!« Die Angst in ihrer Stimme bewirkte, dass Mercy ihren gesunden Menschenverstand vergaß und einen dunklen Flur entlangstürzte. Sie folgte den Geräuschen und stieß in einem Schlafzimmer, das nur spärlich von einer Sturmlaterne beleuchtet wurde, auf Morrigan. Die Großmutter des Mädchens saß in einem alten Fernsehsessel, dessen Rückenlehne um fünfundvierzig Grad gekippt war. Sie war eine sehr dünne Frau und füllte gerade mal einen Bruchteil des großen Sessels aus. Eine Steppdecke bedeckte sie vom Hals abwärts. Selbst im schwachen Licht konnte Mercy sehen, dass die Decke mit Blut getränkt war.
Die Frau hatte den Kopf leicht gedreht, als Mercy hereingekommen war, und sie gab einen flehentlichen Laut von sich. Mercys Finger fanden einen weiteren nutzlosen Lichtschalter, sie ließ ihre Tasche neben dem Sessel fallen und ging auf ein Knie. Du musst die Blutung stoppen. »Wo sind Sie verletzt?«, fragte sie, während sie sanft das Handgelenk der Frau nahm, um ihren Puls zu prüfen. Er fühlte sich an wie das schwache Flattern eines kleinen Vogels. Die Frau gab weitere leise Laute von sich und versuchte, sich aufzusetzen. »Halten Sie still«, sagte Mercy. »Bring die Lampe her«, bat sie Morrigan. »Und halte meine Taschenlampe, damit ich besser sehen kann.« Das Mädchen gehorchte, und Mercy stockte der Atem, als sie den verzweifelten Blick der Frau bemerkte. Sie krallte sich in Mercys Arm und versuchte, sich am Stoff festzuhalten, während sich ihre Blicke trafen. Ihre Augen waren feucht, ihre Lider von Altersfalten umgeben, und ihre Laute wurden immer drängender.
Kann sie sprechen?
Mercy keuchte auf, als sie die nasse Decke langsam zurückzog, und Morrigans Großmutter stieß einen leisen Schrei aus.
Die Frau hatte Schnittwunden an der Brust, am Bauch und an den Oberarmen. An diesen Stellen war ihr dünnes Nachthemd von der Waffe durchtrennt worden. Die dunklen Flecken bildeten grässliche Flecken auf dem Stoff, und die Verletzungen bluteten noch immer.
»Wer hat Ihnen das angetan?« Mercy konnte sich nicht bewegen. Ihr Gehirn wollte die brutale Bestrafung, die der Frau zugefügt worden war, nicht akzeptieren. Die Frau fing mit leiser Singsangstimme an zu singen, doch Mercy konnte die Worte nicht verstehen.
»Was ist mit ihr passiert, Morrigan?«, fragte sie, während sie in ihrer Tasche nach Verbandszeug kramte.
»Das weiß ich nicht. Ich bin aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen, und fand sie dann so. Danach bin ich auf die Straße gerannt, um Hilfe zu holen.«
Mercy drückte dicke Verbände auf die Wunden, die schnell mit Blut getränkt waren. Das ist zu viel Blut. Sie beeilte sich und benutzte Klebeband, um den Verbandsmull zu fixieren. Sie wurde immer besorgter, denn sie wusste, dass ihr kleiner Vorrat an medizinischen Hilfsmitteln nicht ausreichen würde. Schon bald hatte sie das letzte Verbandsmaterial verbraucht. »Hol mir ein paar saubere Handtücher oder Laken«, bat sie Morrigan. Das Mädchen eilte aus dem Zimmer.
Mercy nahm die Hand der Frau und bemerkte, dass sie weitere blutende Schnittwunden hatte. Hat sie sich verteidigt? Mercy zwang sich zu einem Lächeln und sah in die besorgten dunklen Augen. »Das wird schon wieder«, murmelte sie mit einem flauen Gefühl im Magen. Die Frau sang immer weiter, und Mercy überlegte kurz, ob sie eine amerikanische Ureinwohnerin vor sich hatte. Sie sieht eher italienisch aus. »Was sagt sie?«, fragte sie Morrigan, als das Mädchen mit einem Stapel Handtücher wieder neben ihr auftauchte. Mercy schnappte sich eines davon und drückte es auf den Schnitt am Hals der Frau, aus dem das meiste Blut zu fließen schien.
Das Mädchen schwieg einen Moment lang. »Ich weiß es nicht. Ich habe die Zaubersprüche nicht gelernt.«
Zaubersprüche?
»Ich glaube nicht, dass es ein schlimmer ist. Sie klingt nicht böse.«
Das ist vermutlich gut. »Wie ist ihr Name?«
»Grandma.«
»Ihr richtiger Name.«
Das Mädchen dachte angestrengt nach. »Olivia.«
»Olivia«, sagte Mercy. »Was ist mit Ihnen passiert? Wer hat das getan?« Olivia starrte sie weiter an und formte mit den Lippen noch immer die fremdartigen Worte. Es hört sich nicht wie Italienisch an. Oder wie irgendeine andere Sprache, die ich schon mal gehört habe. Dann verstummte die Frau und atmete immer angestrengter. Sie hustete tief und abgehackt, und Blut rann über ihre Lippen. Mercy drückte fester zu und wies Morrigan an, mit einem weiteren Handtuch Druck auf den blutenden Unterleib auszuüben.
Das Mädchen gehorchte. »Wird sie sterben?«, flüsterte es weinend.
Mercy konnte die Kleine nicht anlügen. »Ich weiß es nicht. Es sieht nicht gut aus.«
Olivia hustete abermals, wobei noch mehr Blut aus ihrem Mund rann. Zittrig hob sie eine blutverschmierte Hand und berührte Mercys Wange. »Danke.« Das war das erste Wort, das Mercy verstehen konnte.
Ihre Hand war warm und feucht, und ihre Finger glitten an Mercys Gesicht herunter, während sie den Blickkontakt hielt. Das Entsetzen in Olivias Augen war Zufriedenheit gewichen.
Sie stirbt.
»Nein! Ich werde Sie nicht gehen lassen, Olivia!« Mercy rüttelte die Frau an der Schulter. »Sprich mit ihr, Morrigan. Bring sie dazu, dir zuzuhören.« Das Mädchen fing an, seine Großmutter anzuflehen, die müde in seine Richtung blickte.
Panik simmerte unter Mercys Haut. Sie konnte keinen Krankenwagen rufen. Ihr blieb nur die Wahl, die Frau zu ihrem Tahoe zu tragen, hierzubleiben und weiter zu versuchen, die Blutung zu stoppen, oder den Wagen zu holen und die lange Fahrt zurück zum Haus zu riskieren, bevor sie sie ins Krankenhaus brachte. Mercy wägte jede Option ab. Ich brauche den Tahoe. Sie richtete sich auf. »Ich werde meinen Wagen herholen.«
Olivia legte ruckartig die Hand um Mercys Handgelenk. »Bleib.«
Mercy erstarrte. Dann sank sie langsam auf die Knie, ergriff erneut die blutende Hand und sah der sterbenden Frau in die Augen. Sie will nicht allein sein. Eine innere Ruhe ging von der Hand der Frau auf Mercy über und beruhigte ihre Nerven.
Ich werde das für sie tun.
Olivia schaute von Mercy zu Morrigan und schloss dann die Augen.
Mercy beobachtete, wie sich ihr Brustkorb vier weitere Male hob, bevor er sich nicht länger bewegte.
Wie benommen umklammerte sie die Hand der Frau und lauschte Morrigans Schluchzen.
Zwei
Tut mir leid, dass ich Ihre Kleidung mitnehmen muss, Special Agent Kilpatrick«, murmelte ein Deputy des Deschutes County, als Mercy ihren Mantel, ihren Pullover und ihre Jeans in seine Papiertüte warf, nachdem sie sich in Morrigans Zimmer umgezogen hatte.
»Kein Problem. Ich habe immer einen zweiten Satz Kleidung dabei.« Nachdem sie einen Blick auf ihren blutigen Pullover geworfen hatte, war ihr klar gewesen, dass sie alles, was sie am Leibe trug, für die Ermittlungen abgeben musste, und bevor sie sich umzog, hatte der Forensiker sie in dem befleckten Outfit fotografiert.
Mercy stand da und starrte geradeaus, als der junge Mann sie umkreiste und Fotos schoss. Er war näher herangetreten, um ihr Gesicht zu fotografieren, und sie kämpfte gegen die Schuldgefühle an, die sie überkamen, weil sie Olivia nicht hatte retten können. Verlegen bat er sie um die Erlaubnis, ihr eine Haarsträhne abzuschneiden. Mercy nickte und beobachtete, wie mehrere ihrer mit geronnenem Blut benetzten schwarzen Haare in den Umschlag fielen, den er bereithielt. Dann nahm er einen Tupfer, feuchtete ihn an und berührte damit ihr Gesicht. Olivias Blut war auf ihrer Wange verkrustet und hatte dafür gesorgt, dass sich Mercys Haut spannte. Sie hatte sich kurz gekratzt, bevor sie merkte, was dort klebte. Ein paar Reste hafteten noch immer unter ihren Fingernägeln, obwohl der Forensiker den Großteil herausgeschabt hatte.
Ich habe getan, was ich konnte.
Ein Schauder durchfuhr sie, und ihr ganzer Körper verkrampfte sich, als sie beobachtete, wie der Deputy den Beutel verschloss. Er warf ihr einen kurzen, mitfühlenden Blick zu.
Sie hatte den Tod schon aus der Nähe gesehen, sogar die Hand ihres Bruders umklammert, als er gestorben war.
Aber dies war etwas anderes. Olivias Bedürfnis nach menschlicher Berührung, ihr Wunsch, dass jemand bei ihr blieb und sie nicht allein sterben musste, hatte Mercy das Herz gebrochen.
Dieser Moment würde ihr für immer in Erinnerung bleiben.
Mercy hatte danach noch mehrere Minuten lang bei Olivia gesessen, bevor sie Morrigan auf den Schoß nahm und in den Armen hielt, bis das Mädchen nach einer Weile aufhörte zu weinen und einschlief. Sie zog dem Mädchen einen dicken Mantel über, trug es durch den Schnee zurück zu ihrem Tahoe und fuhr dann so lange, bis ihr Handy wieder Empfang hatte. Morrigan schlief völlig erschöpft auf dem Rücksitz, und ihr Kopf war ihr auf die Brust gesunken und schaukelte hin und her. Nachdem Mercy den Todesfall gemeldet hatte, wollte sie zum Haus zurückfahren, musste Morrigan jedoch wecken, um sich von ihr den Weg zeigen zu lassen. Morrigan hatte recht gehabt, denn die gewundene Nebenstraße, die zu dem kleinen Haus führte, kam ihr endlos lang vor.
Jetzt wartete Deschutes County Detective Evan Bolton im Wohnzimmer von Olivias Haus auf Mercy. Der Detective war jung, wahrscheinlich jünger als Mercy, aber seine Augen wirkten alt und zynisch, als hätten sie schon sämtliche Schrecken der Welt gesehen. Als er in aller Herrgottsfrühe hier eingetroffen war, hatte er sich Mercys kurze Geschichte schweigend angehört und nur wenige Fragen gestellt, dennoch glaubte sie, dass ihm so gut wie nichts entging. Nun musterte er sie mitfühlend, als sie auf ihn zukam.
Die vierundzwanzig Stunden ohne Schlaf standen ihr zweifellos ins Gesicht geschrieben.
»Wo ist Morrigan?«, fragte sie ihn.
»Sie zeigt einem der Deputys ihre Hühner und Ziegen.«
Mercy entspannte sich ein wenig. Sie hatte Morrigan in den letzten vier Stunden, während sie auf die Ermittler aus dem Deschutes County warteten, in ihrer Nähe behalten. Als sie nun aus dem Fenster schaute, sah sie einen Forensiker in ihrem brandneuen FBI-Tahoe Fotos schießen. Auch das Wageninnere war voller Blut. In ihrer Erschöpfung hatte Mercy nicht bemerkt, dass Morrigans Mantel mit Olivias Blut bedeckt war, und es so auch in ihren Wagen übertragen.
Raschelnde Geräusche hinter Mercy ließen erkennen, dass die Forensiker in dem kleinen Haus weiterhin Beweise sicherten. Am liebsten hätte sie den Tatort verlassen und eine Woche lang geschlafen, aber die Augen des Detectives verrieten, dass er andere Pläne hatte. »Wollen Sie mich gleich jetzt befragen?«, erkundigte sie sich.
»Ich weiß, dass Sie schon lange auf den Beinen sind, würde die Details aber gern hören, solange Sie sie noch frisch im Gedächtnis haben.«
Das konnte sie nachvollziehen. »Wurde Morrigans Mutter denn inzwischen informiert?«
»Bisher nicht. Bei der Telefonnummer, die sie uns gegeben hat, landen wir sofort auf einer vollen Voice-Mailbox.«
»Weiß Morrigan, wo ihre Mutter ist?«
»Sie meinte, sie wäre in die Stadt gefahren. Als ich sie fragte, wann sie aufgebrochen ist, konnte sie das nicht genau sagen. Es könnte eine Woche, aber auch nur einen Tag her sein.«
Mercy runzelte die Stirn. »Wann kommt das Jugendamt?«, fragte sie.
Der Detective machte ein finsteres Gesicht. »Wir arbeiten daran.«
»Dann habe ich viel Zeit zum Reden, denn ich gehe nirgendwohin, solange niemand hier ist, der sich um Morrigan kümmern kann. Wie lange wird es noch dauern, bis die Rechtsmedizinerin eintrifft?«
Er hob beide Brauen. »Höchstens eine Stunde. Ich dachte, ich wäre hier derjenige, der die Fragen stellt.«
»Wo sollen wir uns unterhalten?« Mercy schaute sich in dem überfüllten Wohnbereich um. Jetzt, wo etwas Tageslicht durch die Fenster hereinfiel, konnte sie erkennen, dass der Raum sehr sauber war, die Möbelpolster jedoch geflickt und die Teppiche an einigen Stellen so gut wie durchgetreten waren. Mehrere Türen der Küchenschränke fehlten, aber das Geschirr stand in perfekt gleichmäßigen Stapeln darin.
»Gehen wir vor die Tür«, schlug er vor.
Sie verließen das beengte Haus, und Mercy atmete die eisige Luft tief ein. Um sie herum ragten die schneebedeckten Kiefern zum klaren blauen Himmel empor. Es sind bestimmt minus fünf Grad. Drei Tage zuvor war die Gegend von einem Schneesturm heimgesucht worden, der in kürzester Zeit knapp zwanzig Zentimeter Neuschnee mitgebracht hatte. Seitdem war jeder Tag herrlich klar, aber bitterkalt gewesen. Typisch für einen Winter in Central Oregon.
Sie liebte das.
Mercy zog ihre Handschuhe aus den Taschen ihrer dicken Jacke, führte den Detective zu einer kleinen Holzbank und wischte den Schnee herunter. Sie trug eine Thermohose, ein langärmliges T-Shirt und Schneestiefel, die aus dem Vorrat in ihrem Wagen stammten. Dankbar für die dicke Hose, setzte sie sich, und er tat es ihr gleich und zog ein kleines Aufnahmegerät und ein winziges Notizbuch aus der Tasche. Der blaue Mantel des Detectives hatte beinahe denselben Farbton wie der Himmel und verlieh diesem düsteren Morgen eine seltsam heitere Note. Mercy war wie fast immer von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet.
»Sie sagten, Sie seien von Ihrer Hütte zurück in die Stadt gefahren«, sagte Detective Bolton. »Wo genau liegt diese Hütte?«
Mercy nannte ihm die Adresse. »Ich war vielleicht zehn Minuten unterwegs, als ich Morrigan gesehen habe. Es ist also nicht besonders weit.«
»Sind Sie öfter nachts um drei mit dem Wagen unterwegs?«
»Tatsächlich kommt das öfter vor.«
Er verharrte mit dem Bleistift über dem Block und sah sie erwartungsvoll an. »Warum?«
»Ich schlafe nicht besonders viel. Hier draußen zu sein entspannt mich.«
»Sie leben in Bend«, bemerkte er. »Die Fahrt hierher muss eine ganze Weile dauern.«
»Das hängt von den Straßenverhältnissen ab.« Sie war nicht in der Stimmung, weitere Informationen über ihre nächtlichen Gewohnheiten preiszugeben.
»Wie lange arbeiten Sie schon für das FBI-Büro in Bend?«
»Ich habe letzten Herbst dort angefangen. Davor war ich mehrere Jahre im Büro in Portland.«
»Und Sie hatten Morrigan oder Olivia zuvor noch nie gesehen?«
»Das ist korrekt. Hier draußen kann man mühelos im Wald untertauchen. Eine Person könnte fünfzehn Meter von einem entfernt stehen, ohne dass man sie überhaupt bemerkt.«
»Wahrscheinlich besitzen Sie aus diesem Grund ein Haus hier draußen.«
Mercy verspannte sich und musterte ihn, doch in seinen Augen war nichts als beiläufige Neugier zu erkennen. »Ich habe gern Privatsphäre. Es ist schön, mal aus der Stadt herauszukommen.«
Er nickte. »Können Sie mir noch einmal schildern, was genau passiert ist, nachdem Morrigan Ihr Fahrzeug angehalten hat?«
Sie wusste, dass sie diese Geschichte noch diverse Male erzählen müsste. Eine Frau war ermordet worden, und sie war eine wichtige Zeugin. Mercy schloss kurz die Augen und berichtete dann alles, woran sie sich erinnerte.
Detective Bolton hörte ihr aufmerksam zu und machte sich Notizen. »Sie konnten in ihrem Gesang also keine Worte oder Namen ausmachen?«
»Nein. Ich habe seitdem mehrmals darüber nachgedacht, habe jedoch nicht die geringste Ahnung, was das für eine Sprache war. Morrigan behauptete, es wären Zaubersprüche und dass sie sie nicht verstehen könne.«
Der Detective blickte erstaunt von seinem Block auf. »Das ist ja mal was Neues. Ich würde gern mit Morrigan sprechen, möchte sie aber nicht befragen, ohne dass ein Familienangehöriger oder jemand vom Jugendamt anwesend ist.« Er sah auf die Uhr. »Man konnte mir beim Jugendamt nicht sagen, wann jemand hier sein würde, und ich würde nur ungern zu viel Zeit verstreichen lassen. Sie ist jung. Ihre Geschichte könnte sich ändern.« Frustration breitete sich auf dem Gesicht des Detectives aus.
»Ich kann mich dazusetzen«, schlug Mercy vor. »Ich glaube, sie vertraut mir, und in Anbetracht der ernsten Lage dürfte ich einen annehmbaren Rechtsbeistand abgeben.«
Der Detective warf ihr einen prüfenden Blick zu und wog seine Optionen ab.
»Detective?« Ein Deputy stand auf einmal in der offenen Haustür. »Ich glaube, das sollten Sie sich ansehen.«
Detective Bolton stand sofort auf, steckte seinen Notizblock und sein Aufnahmegerät ein und eilte ins Haus.
Mercy folgte ihm.
Als sie den schmalen Flur entlanggingen, warf Detective Bolton Mercy einen Blick über die Schulter zu, den sie dreist erwiderte.
Ich weiß, dass das Ihre Ermittlungen sind, aber ich komme trotzdem mit.
Der Deputy führte sie zu einer offenen Tür auf der Rückseite des Hauses und trat dann zur Seite. »Wir wussten bis vor einer Minute nicht einmal, dass dieser Raum überhaupt existiert. Die Tür wurde so gestaltet, dass sie mit der Holzverkleidung des Flurs verschmilzt. Mir ist allerdings eine kleine Lücke am Boden aufgefallen, wo die Vertäfelung nicht ganz mit dem Teppich abschließt, und da habe ich mal etwas fester gegen die Wand gedrückt. Dies ist das erste Mal, dass ich einen geheimen Raum entdeckt habe.« Er wirkte regelrecht aufgeregt.
»Gute Arbeit.« Bolton klopfte ihm auf die Schulter.
»Es ist recht eng da drin«, warnte der Deputy sie. Bolton trat durch die Türöffnung und verharrte. Mercy blickte über seine Schulter, wobei sie wieder einmal dankbar für ihre überdurchschnittliche Größe war, und schnappte nach Luft. An einer Wand des fensterlosen Raums stand eine einfache Werkbank, über der mehrere offene Regale angebracht waren. Die gegenüberliegende Wand zierten Messer. Hunderte von Messern. Ihre Klingen hingen an einem guten Dutzend Magnetstreifen, die sich über die gesamte Länge des Raums erstreckten.
»Da ist wohl jemand Sammler«, murmelte Bolton.
Mercy stimmte ihm schweigend zu und ließ den Blick von Messer zu Messer schweifen. »Das ist unglaublich.« Messer so groß wie ihr kleiner Finger, Messer so lang wie ihr Arm, Messer in Militärqualität, Messer, die wie handgeschmiedet aussahen, kunstvoll geschnitzte Griffe aus Holz, Metall und Elfenbein, geätzte und gebogene Klingen. Sie hielt Ausschau nach leeren Stellen in der Sammlung und fragte sich, ob die Mordwaffe von der Wand entfernt worden war. Doch soweit sie es beurteilen konnte, schien die Sammlung komplett zu sein. Würde irgendjemand merken, dass eine fehlt?
»Es wurde noch keine Mordwaffe gefunden, richtig?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete der Deputy.
Zwischen der Werkbank und der Messerwand war kaum genug Platz für zwei Personen, aber sie und Bolton drängten sich dennoch in den Raum.
»Sehen Sie sich die Gläser an«, sagte der Deputy.
Dutzende von Gläsern in allen Größen standen perfekt aufgereiht in den offenen Regalen. Beim näheren Hinschauen entdeckte Mercy Pulver, getrocknete Blätter und ziemlich knusprig aussehende getrocknete Käfer. Sie rümpfte die Nase, beugte sich näher heran und bemerkte ein Glas mit winzigen durchsichtigen Skorpionen. Keines der nicht zueinanderpassenden Fläschchen war beschriftet. Mercy konnte die meisten frischen Kräuter identifizieren, die getrockneten waren für ihr ungeübtes Auge jedoch nicht genau zu bestimmen. Auch die Namen der Pulver waren ihr schleierhaft. Grobe gelbe Körner, feiner weißer Staub, klobige braune Krümel, feine graue Körner. So viele Gläser.
Dies war alles andere als ein gewöhnlicher Gewürzschrank.
Die Werkbank sah makellos und sehr ordentlich aus. Ein Kanister enthielt eine Vielzahl von Küchenutensilien, und sie bemerkte vier verschiedene Sets aus Mörser und Stößel sowie zwei perfekt gefaltete Stapel sauberer Lappen. Präzise gestapelte Glasschüsseln und kleine Gläser. Mercy musste an die Ordnung in den Küchenschränken denken. War Olivia für all das verantwortlich oder Morrigans Mutter?
»Was halten Sie davon?«, wollte der Deputy wissen.
Bolton und Mercy tauschten einen Blick. »Ich glaube, da hat jemand Spaß an seinen Hobbys«, erwiderte Bolton. »Die auf uns eher ungewöhnlich wirken.«
»Das ist auf jeden Fall interessant«, stimmte Mercy zu und fragte sich, ob Olivia in altmodischen Heilkünsten bewandert gewesen war. Zaubersprüche. Oder vielleicht hatten sie es hier auch mit etwas anderem zu tun. Sie beäugte die getrockneten Käfer und die diversen anderen Tierchen, während ihr Märchen über Hexerei im Kopf herumschwirrten. Das ist doch lächerlich!
»Ich sehe kein Blut auf einer der Klingen, werde die Forensiker aber dennoch bitten, sich das genauer anzusehen«, sagte Bolton. »Ich bezweifle, dass sich unsere Mordwaffe hier befindet … obwohl sie von hier stammen könnte.« Er deutete auf ein Gefäß. »Sind das Hühnerfüße?«
Mercy grinste. Bolton war ganz eindeutig nicht auf einer Farm aufgewachsen. »Ja.«
Er seufzte. »Die Forensiker werden mir schon mitteilen, wie sie hier vorzugehen gedenken.« Dann bedeutete er Mercy, vor ihm hinauszugehen. Auf dem Flur begegneten sie Natasha Lockhart, der Rechtsmedizinerin, die ihre schwarze Tasche in der Hand hielt. Sobald sie Mercy erblickte, hellte sich ihre Miene auf. »Sind Sie die FBI-Agentin, die die Leiche gefunden hat?«, fragte sie nach einer kurzen Begrüßung.
»So ist es. Sie war noch am Leben, als ich hier ankam.«
»Oh, gut. Das wird mir die Arbeit erleichtern.« Die kleine Rechtsmedizinerin bat Mercy, ihr in den Raum zu folgen, in dem sich Olivias Leiche befand. Detective Bolton blieb schweigend und aufmerksam in der Tür stehen, und der Deputy, der das Messerzimmer gefunden hatte, verharrte ernst hinter ihm. Nach Betreten des Raums blieb die Rechtsmedizinerin stehen und ließ den Blick langsam über den Tatort schweifen. Der Forensiker, der zuvor Mercy fotografiert hatte, wartete auf sie und hielt seine Kamera bereit, um alle benötigten Fotos zu schießen.
Mercy schluckte schwer und sah Olivia an. Das Forensikteam hatte eine Lampe aufgestellt, deren grelles Licht harte Schatten auf das friedliche Gesicht der Toten warf. Die zahlreichen Verbände, die Mercy ihr angelegt hatte, bedeckten noch immer den Körper der Frau und waren durch das getrocknete Blut bräunlich geworden. Die Frau wies mindestens ein Dutzend Schnittwunden auf. Vorsätzliche Folter oder einfach nur Wut? Die Decke, die ihre Beine bedeckte, hatte ein ringförmiges Muster, dessen schöne blassblaue und lavendelfarbene Teile für immer ruiniert waren.
»Wie heißt sie?«, fragte Natasha und streifte sich die Handschuhe über.
»Olivia«, antwortete Mercy und sah dann Bolton an. Ich kenne ihren Nachnamen gar nicht.
»Olivia Sabin«, ergänzte er.
Der Nachname kam Mercy bekannt vor, was sie nicht überraschte. Sie hatte bis zu ihrem achtzehnten Lebensjahr in der nahe gelegenen kleinen Gemeinde Eagle’s Nest gelebt und kannte einen Großteil der Bevölkerung persönlich. Damals war ihre Welt noch viel kleiner gewesen.
»Ist das Ihr Werk?« Natasha deutete auf die Verbände.
Mercy nickte und bekam keinen Ton heraus.
Natasha entfernte die Verbände und Handtücher von Brust und Bauch der Frau und schnalzte leise mit der Zunge, um ihr Mitgefühl zu bekunden. Mit behandschuhten Händen tastete sie den tiefen Schnitt im Unterleib ab. »War sie bei Bewusstsein?«
»Nur kurz.«
»Wahrscheinlich wurde eine Arterie getroffen. Zumindest weit genug, um sie langsam verbluten zu lassen. Oder vielleicht war das Trauma einfach zu viel für ihr Herz.« Sie schaute über ihre Schulter zu Mercy herüber. »Ich glaube nicht, dass Sie das hätten verhindern können«, sagte sie und hielt Mercys Blick.
Verstanden. Der Knoten in ihrem Magen lockerte sich bei der Aussage ein wenig, verschwand aber nicht ganz. Ein leiser Zweifel würde wohl ewig zurückbleiben.
»Könnte sie sich selbst verletzt haben?«, fragte der Deputy.
»Nur wenn das Messer von allein von hier wegspaziert ist«, entgegnete Bolton.
»Das Mädchen könnte es versteckt haben«, schlug der Deputy vor.
Mercy bezweifelte das. Morrigan hätte es erwähnt.
Oder etwa nicht?
Natasha bewegte die Hände geschickt über den Körper der Frau, drückte hier und da und verbog die Finger der Toten, um deren Bewegungsspielraum zu testen.
»Um wie viel Uhr ist sie gestorben?«
Mercy schaute auf die alte, gelb angelaufene Uhr an der Wand. »Um kurz nach drei.«
»Ich werde noch ein paar Messungen vornehmen, um das zu bestätigen.« Sie holte ein großes Thermometer aus der Tasche.
Ich gehe dann besser.
Mercy drängte sich an Bolton vorbei, eilte den Flur entlang und zur Tür hinaus. Draußen bemerkte sie Morrigan, die sich angeregt mit einem Deputy unterhielt und dabei wild mit den Armen fuchtelte, während sie aufgeregt in den Wald deutete. Mercy beobachtete sie. Kinder sind robust. Sie sah sich den Rest des Grundstücks an. Links von ihr befand sich ein kleiner Pferch mit einem Hühnerstall, rechts eine große Scheune. Die Scheune sah neuer aus als das Haus. Das Holz war frisch gestrichen, und die Türbeschläge glänzten im Licht der aufgehenden Sonne. Die Lichtung, die das Haus umgab, war mit Fußabdrücken übersät. Die Bewohner des Hauses hatten den Schnee platt getrampelt, daher bestand wenig Hoffnung, in Hausnähe auf die Spuren des Mörders zu stoßen. Sie würden tiefer im Wald suchen müssen. Es sei denn, er kam mit dem Auto her.
»Geht es Ihnen gut?« Bolton blieb neben ihr stehen.
»Ja.« Sie sah ihn nicht an, sondern richtete den Blick auf Morrigan.
»Ich würde jetzt gern mit dem Mädchen sprechen, wenn Sie dazu in der Lage sind.«
»Ihr Name ist Morrigan«, sagte Mercy schroff. »Und ja, das schaffe ich.«
Drei
Truman Daly überprüfte zum zwanzigsten Mal sein Telefon, als er in Richtung Polizeirevier stapfte.
Mercy hatte noch immer nicht auf seine Guten-Morgen-Nachricht geantwortet.
Das war zu ihrer Routine geworden. Wenn sie die Nacht nicht zusammen verbrachten, schrieben sie sich am nächsten Morgen eine Nachricht. Sie hätte schon längst wach sein müssen. Er wusste, dass sie vorgehabt hatte, abends ein paar Stunden in ihrer Hütte zu verbringen, und dass diese Besuche oft bis nach Mitternacht gingen, aber sie verschlief nie.
Leichtes Unbehagen regte sich in seiner Magengrube.
Er kickte einen schmutzigen Schneeklumpen vom Bürgersteig und öffnete die Tür des Reviers, wobei ihn leiser Stolz überkam, als er seinen Namen unter dem Logo des Eagle’s Nest Police Departments sah. Chief Truman Daly. Er liebte seinen Job und betrachtete es als Ehre, den Menschen in seiner kleinen Stadt helfen zu können. Nach einiger Zeit in der Großstadt hatte er feststellen müssen, dass das nichts für ihn war. Vielmehr genoss er den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde und hatte sich im letzten Jahr die Namen fast aller Einwohner gemerkt.
»Guten Morgen, Boss«, grüßte ihn Lucas, der seinen großen Körper hinter den Schreibtisch quetschte. »Heute früh gibt’s noch nichts Dringendes.«
»Danke, Lucas.« Truman betrachtete das knallrote Rentier auf dem Pullover seines Büroleiters, während er seinen Cowboyhut abnahm. »Sie wissen schon, dass Weihnachten seit einem Monat vorbei ist?«
Der neunzehnjährige Mann blickte an sich herunter. »Ich mag diesen Pullover. Es ist arschkalt, darum habe ich ihn angezogen. Er bringt jetzt sogar noch mehr Leute zum Lächeln als im Dezember.«
»Gutes Argument. Ist noch jemand hier?«
»Royce ist zu einem Autounfall gefahren, und Ben müsste jeden Moment hier sein.«
Das Unbehagen in seinem Bauch nahm weiter zu. »Gab es bei dem Autounfall Verletzte?«
»Nein, es war nur ein kleiner Blechschaden, und ein Wagen ist in den Graben gerutscht. Beiden Männern geht es gut.«
Seine Anspannung löste sich. Sie war nicht darin verwickelt. Mercy hatte letzten November einen schlimmen Autounfall gehabt, und es machte ihm schwer zu schaffen, dass sie sich an diesem Morgen noch nicht gemeldet hatte.
Er ging den Flur hinunter zu seinem Büro und schrieb Mercys Nichte Kaylie eine Nachricht:
Sag Mercy, sie soll mal auf ihr Handy schauen.
Er bekam sofort eine Antwort.
Sie ist nicht zu Hause.
Wo steckt sie?
Da summte auch schon das Telefon in seiner Hand, und er nahm Kaylies Anruf an.
»Sie war nicht zu Hause, als ich heute früh aufgestanden bin«, berichtete der Teenager.
»Wann ist sie gestern Abend aufgebrochen?«
»Gegen sieben. Gleich nach dem Abendessen. Sie sagte, sie würde erst nach Mitternacht wieder zurück sein.«
»War sie zu Hause und ist heute sehr früh wieder aufgebrochen?« Truman wurde immer mulmiger zumute.
»Das glaube ich nicht. Es ist kein Kaffee in der Kanne. Sie kocht immer Kaffee.«
Ja, das tut sie.
Kaylie klang nicht besorgt. »Sie hat wahrscheinlich in der Hütte geschlafen. Das macht sie manchmal. Du hast bestimmt schon versucht, sie anzurufen, oder?«
»Ich habe ihr eine Nachricht geschrieben.«
»Der Handyempfang da draußen ist echt miserabel. Das macht mich immer wahnsinnig«, gestand sie mit dem hörbaren Abscheu eines Teenagers.
»Sag ihr bitte, sobald du etwas von ihr hörst, dass sie mich anrufen soll.«
»Mach ich.«
Truman starrte auf seine unbeantwortete Nachricht. Ich muss da rausfahren.
Mercys Hütte war ihr Rettungsanker. Ihr Zentrum. Ihr Ausgleich. Da sie in einer Prepper-Familie aufgewachsen war, verspürte sie das tiefe Bedürfnis, jederzeit auf einen Teotwawki vorbereitet zu sein. Das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Truman verstand die Logik, die hinter einem Vorrat an Wasser und Notrationen steckt, aber bei Mercy nahmen diese Vorbereitungen völlig neue Dimensionen an. Sie war durchaus dazu in der Lage, auf unbestimmte Zeit in ihrer Hütte zu leben, sollte sich die Welt drastisch verändern. Truman bewunderte ihre Hingabe und kommentierte es nicht, wenn sie mitten in der Nacht stundenlang Holz hackte oder Antiquitätenläden nach alten Werkzeugen durchforstete, um elektrische oder gasbetriebene zu ersetzen.
Vielleicht hat sie mit der Axt eine Arterie getroffen.
»Verdammt.« Er drehte sich um, setzte seinen Hut wieder auf und marschierte zum Empfangsbereich. »Lucas? Ich bin erst mal unterwegs. Rufen Sie an, wenn Sie mich brauchen.«
»Hey, Augenblick noch. Das ist gerade reingekommen. Elsie Jenkins kommt nicht von ihrem Grundstück runter, weil der Schneepflug einen riesigen Haufen am Ende ihrer Auffahrt hinterlassen hat.«
Truman stellte sich ihr ländliches Bauernhaus bildlich vor. »Es liegen doch gerade mal zwanzig Zentimeter Schnee.«
»Das mag ja sein, aber ihr zufolge wurde der Schnee meterhoch vor ihrer Auffahrt aufgetürmt. Das sind ihre Worte, nicht meine.«
»Und sie sitzt schon seit drei Tagen dort fest?«
»Sie wollte erst abwarten, ob der Haufen schmilzt, aber so langsam gehen ihnen der Scotch und die Kekse aus. Auch das waren ihre Worte.«
Ihre alte Farm lag grob in derselben Richtung wie Mercys Hütte. »Ich bin schon unterwegs. Sagen Sie ihr, dass ich in zwanzig Minuten da bin.«
»Haben Sie eine gute Schneeschaufel?«, fragte Lucas.
»Aber sicher.«
Auf der Fahrt zu Elsie rief Truman das Highway Department an, um den Zuständigen mitzuteilen, dass eine alte Dame ihr Grundstück aufgrund der Schneepflüge nicht mehr verlassen konnte. Er fügte außerdem hinzu, dass ihr langsam die Medikamente ausgingen, weil er fand, dass eine kleine Übertreibung nicht schaden konnte.
Die junge Frau am anderen Ende der Leitung versprach, so bald wie möglich einen Schneepflug hinzuschicken. Truman wusste, dass das noch Stunden dauern konnte, und bereitete sich mental darauf vor, einen Berg Schnee wegzuschaufeln. Immerhin schien die Sonne.
Dreißig Minuten später verfluchte er die Sonne, die den lockeren Schnee zu einem schweren Matschhaufen verdichtet hatte. Wieder und wieder stieß er die Schneeschaufel in den riesigen Berg. Er hatte gehofft, nicht mehr an Mercy denken zu müssen, wenn er sich dem Schaufeln widmete, doch das genaue Gegenteil geschah. Seine Gedanken schweiften ab, und er hoffte inständig, dass es ihr gut ging.
Und er erinnerte sich an die vielen Flugblätter, die er zwei Abende zuvor auf ihrem Küchentisch gesehen hatte. Sie hatte sich gerade im Schlafzimmer umgezogen, während er beiläufig eins überflog – und ihm beinahe das Herz stehen blieb. Es waren Hausprospekte. Rasch sah er sich das halbe Dutzend unterschiedlicher Angebote an. Das hat sie mir gegenüber mit keinem Wort erwähnt. Er hatte gewusst, dass sie nur vorübergehend in ihrer Wohnung bleiben wollte, war jedoch stets davon ausgegangen, dass sie irgendwann bei ihm einziehen würde … oder dass sie sich gemeinsam etwas suchten. In seinen Zukunftsplänen lebten Mercy und er zusammen.
Offenbar teilte sie diese Vision nicht.
Er gab seiner Schaufel einen besonders kräftigen Stoß und schob den Schnee und seine Gedanken beiseite. Elsie hatte mit der Unmenge an Schnee recht gehabt. Truman schimpfte auf den unbekannten Schneepflugfahrer, der ihre lange Auffahrt nicht bemerkt hatte. Ihm tat schon langsam der Rücken weh, als er endlich das Rumpeln des Pflugs hörte.
Gott sei Dank.
Er fuhr seinen Wagen beiseite und sah zu, wie der Pflug mühelos eine Schneemenge beseitigte, für die er drei Stunden gebraucht hätte. Der Fahrer reckte einen Daumen in die Luft und fuhr weiter. Truman sah sich das Ergebnis an und verbrachte weitere zwei Minuten damit, die letzten Reste wegzuräumen.
Danach stieg er in seinen SUV und rief Lucas an. »Geben Sie Elsie Bescheid, dass der Weg wieder frei ist.«
»Wow. Das haben Sie aber schnell geschaufelt. War es doch nicht so viel Schnee?«
»Es war sogar verdammt viel Schnee, aber ich hatte eine richtig gute Schaufel.«
»Offensichtlich.«
»Gab es weitere Anrufe?«, fragte Truman hoffnungsvoll. Wenn Mercy ihn aus irgendeinem Grund nicht erreichen konnte, würde sie bei Lucas eine Nachricht hinterlassen.
»Keine. Alles ruhig. Ben ist Donuts holen gegangen.«
»Hebt mir den mit Apfel auf.« Er beendete das Gespräch, ließ den Motor an und fuhr zu Mercys Hütte.
Vierzig Minuten später stieß er auf einen SUV des Deschutes County, der einige Kilometer vor der Zufahrt zu Mercys Grundstück an der Hauptstraße parkte.
»Oh, Scheiße.« Er hielt Ausschau nach Mercys Tahoe und fragte sich, ob sie vielleicht von der Straße abgekommen war.
Doch er entdeckte nichts.
Daher hielt er neben dem Wagen und ließ das Fenster herunter.
»Guten Morgen, Chief. Sie sind weit weg von zu Hause«, sagte der Deputy, der im SUV saß.
Der Deputy kam ihm irgendwie bekannt vor. »Ist alles in Ordnung?« Trumans Innerstes krampfte sich schmerzhaft zusammen.
»Es gab einen verdächtigen Todesfall.« Der Deputy deutete mit dem Kopf in Richtung Wald. »Ich soll hier Wache halten.«
Truman wurde übel, als er eine schmale Straße entdeckte, die sich zwischen den hohen Kiefern entlangschlängelte. Sie war ihm bislang nie aufgefallen. Keine Schilder oder Markierungen wiesen auf die Abzweigung hin.
»Wer ist das Opfer?«, fragte er angespannt, während ihm unter den Achseln der Schweiß ausbrach.
»Eine ältere Dame. Der Tatort ist in ihrem Haus dort hinten.«
Trumans Erleichterung setzte derart spontan ein, dass er leichte Kopfschmerzen bekam.
»Das war alles ziemlich verrückt. Vor Ort gab es weder Telefon noch Fahrzeuge«, fuhr der Deputy fort. »Die zehnjährige Enkelin der Toten hat mitten in der Nacht ein vorbeifahrendes Fahrzeug angehalten.«
»Lassen Sie mich raten: Darin saß eine FBI-Agentin.«
Der Deputy starrte ihn verdutzt an. »Dann wissen Sie schon Bescheid?«
»Das war eher ein Glückstreffer.« Truman stieß die Luft aus. »Ist die Agentin noch vor Ort?«
»Ja, das ist sie.«
Vier
Mercy saß neben Morrigan auf der Bank, und das kleine Mädchen umklammerte ihre Hand.
Im Morgenlicht sah Mercy, dass die Kleine viel dünner war, als sie ursprünglich angenommen hatte. Morrigan wirkte allerdings nicht unterernährt, sondern drahtig. Sie strahlte eine kindliche Energie aus und rutschte immer wieder auf dem harten Holz hin und her. Detective Bolton hatte vorgeschlagen, das Gespräch im Haus zu führen, doch Mercy war die frische Luft lieber gewesen. Und der Abstand zur Leiche von Morrigans Großmutter. Jetzt waren sie draußen, und der Detective saß ihnen gegenüber auf einem niedrigen Hocker, den er im Haus gefunden hatte. Er stellte sich vor und erklärte, wer Mercy war.
Morrigan wich leicht zurück und musterte Mercy von Kopf bis Fuß. »Sie sind Agentin?«
In ihrer Stimme lag ein Hauch von Missbilligung, und Mercy fragte sich, mit welchen regierungsfeindlichen Geschichten Morrigan aufgewachsen war. So etwas kam hier draußen durchaus häufiger vor.
»Ich arbeite als Ermittlerin für die Vereinigten Staaten«, erklärte sie. »So wie Detective Bolton für die Menschen im Deschutes County zuständig ist, bin ich es für alle Menschen, die in den Vereinigten Staaten leben. Einschließlich deiner Großmutter und dir.« Sie schenkte dem Mädchen ein Lächeln und hoffte, es dadurch ein wenig zu beruhigen.
Eine kleine Falte erschien zwischen Morrigans Augenbrauen, und nach einem Moment ließ sie resigniert die Schultern sinken. »Dann ist es vermutlich in Ordnung, wenn ich mit Ihnen rede. Sie haben versucht, meiner Großmutter zu helfen.« Sie blinzelte mehrmals schnell.
»Das habe ich. Ich wünschte, ich hätte sie retten können.« Wer hat ihr verboten, mit Bundesagenten zu sprechen?
»Da war viel Blut«, sagte Morrigan langsam. »Ich glaube nicht, dass ihr noch jemand helfen konnte.«
»Morrigan«, schaltete sich Bolton mit freundlicher Stimme ein, »weißt du, was mit deiner Großmutter passiert ist?«
»Sie wurde verletzt.«
»Aber wie hat sie sich verletzt?«
Das Mädchen lehnte sich an Mercys Seite und wandte sich vom Detective ab.
»Das weiß ich nicht«, flüsterte sie in den Ärmel von Mercys Mantel.
»War letzte Nacht noch jemand im Haus?«, fragte Bolton.
Morrigan schüttelte den Kopf, wobei ihr Haar über Mercys Mantel strich.
»Hast du etwas gehört? Hat deine Großmutter nach dir gerufen?«
Das Mädchen schniefte, fuhr sich mit dem Unterarm über die Nase und riskierte einen Blick zu Bolton. »Nein. Ich musste auf die Toilette und ging in ihr Zimmer, weil ich sie singen hörte und mir das komisch vorkam. Es klang, als würde sie keine Luft mehr bekommen.«
»Hast du sie gefragt, was passiert ist?«
»Ich glaube nicht. Ich konnte die Wunden sehen, wusste aber nicht, was ich tun sollte.«
»War es denn nicht dunkel? Wie konntest du die Verletzungen sehen?«
»Sie lässt ihre kleine Lampe die ganze Nacht brennen, weil das die bösen Geister fernhält.«
Mercy erinnerte sich an die Sturmlampe und daran, dass sie nicht in der Lage gewesen war, das Licht einzuschalten. »Wieso geht das Licht im Haus nicht, Morrigan?«
»Einige Lampen kann man anmachen. Wir müssen nur mehr Glühbirnen kaufen. Mom vergisst das immer.«
»Du hast gesagt, deine Mutter wäre nicht in der Stadt«, sagte Bolton. »Und du weißt nicht, wann sie zurückkommt, richtig?«
Das Mädchen nickte.
»Wo gehst du zur Schule, Morrigan?«, fragte Mercy.
»Ich werde zu Hause unterrichtet. Meine Großmutter macht das … hat das gemacht.« Sie verzog das Gesicht, und ihr kamen erneut die Tränen.
»Hast du noch andere Verwandte in der Nähe?«, erkundigte sich Bolton.
Morrigan schüttelte den Kopf. »Es gibt nur uns.«
»Aber du hast doch bestimmt Cousins und Cousinen oder Tanten und Onkel, die woanders wohnen«, meinte Mercy.
»Nein, es gibt nur uns.«
Mercy begegnete Boltons Blick. Keine Verwandten? Sie legte die Frage vorerst zu den Akten, um sie später Morrigans Mutter zu stellen, wenn sie auftauchte. Falls sie auftauchte. Mercy wusste nicht, was sie von einer Frau halten sollte, die ihrer Tochter keine Möglichkeit gab, sie zu erreichen. Sie wusste, dass Bolton noch mehrmals bei der Handynummer angerufen und diverse Nachrichten geschickt hatte. Bislang ohne Reaktion.
Ist ihrer Mutter etwas zugestoßen?
»Was ist mit deinem Vater?«, fragte Bolton.
»Ich habe keinen Vater«, antwortete Morrigan schlicht.
Abermals sahen Mercy und Bolton einander an. »Hattest du früher einen?«, warf sie ein.
»Nein. Den hatte ich noch nie. Mom sagte, sie und Grandma wären alles, was ich brauche. Wir sind eine komplette Familie.« Sie wischte sich wieder mit dem Ärmel über die Nase, und sowohl Mercy als auch Bolton kramten in ihren Taschen nach Taschentüchern. Mercy fand eine kleine Serviette und hielt sie Morrigan hin.
»Die brauche ich nicht.« Morrigan benutzte ein weiteres Mal den Ärmel.
»Nimm sie«, verlangte Mercy entschieden. Morrigan nahm die Serviette entgegen und hielt sie in ihrem Schoß fest.
»Morrigan«, sagte Bolton. »Diese Verletzungen wurden mit einem sehr scharfen Gegenstand erzeugt. Hast du ein Messer gesehen, als du in das Zimmer deiner Großmutter gegangen bist? Lag es vielleicht auf dem Boden oder auf der Bettdecke?«
Das Mädchen überlegte kurz. »Nein.«
»Was glaubst du, wie deine Großmutter verletzt wurde?« Mercy wartete gespannt, ob das Mädchen den Raum voller Messer erwähnen würde.
»Irgendjemand hat das getan.«
»Das bedeutet, dass gestern Abend jemand in eurem Haus war. Hast du eine Idee, wer das gewesen sein könnte?«, wollte Bolton wissen.
Morrigan riss die Augen auf. »Mom sagt Grandma immer, dass sie die Türen abschließen soll. Aber sie tut es nie. Und jetzt ist sie tot!«, jammerte sie und drückte das Gesicht wieder gegen Mercys Mantel.
Mercy umarmte sie fest und legte die Wange auf ihren Kopf, wobei sie selbst gegen die Tränen ankämpfen musste. »Es ist schon okay, Morrigan. Alles wird wieder gut«, murmelte sie, obwohl sie genau wusste, dass das Leben des Mädchens nie wieder so sein würde wie früher. Ihre Welt schien sehr klein zu sein, was den Verlust ihrer Großmutter zu einer noch größeren Tragödie machte. Mercy hätte sie sehr gern vor diesem Schmerz bewahrt. Wo ist ihre Mutter?
»Sie hat gesagt, dass es ihr gut gehen wird«, murmelte Morrigan in Mercys Mantel.
»Wer hat dir das gesagt?«, hakte Mercy nach.
»Grandma. Als ich gestern Abend nicht wusste, was ich tun sollte … da sagte sie mir, dass es ihr gut gehen würde. Aber ich wusste, dass das nicht sein kann! Ihre Zaubersprüche funktionieren nicht immer.«
Da ist dieses Wort schon wieder.
»Sie kann zaubern?«, fragte Mercy vorsichtig. »Letzte Nacht hast du gesagt, sie hätte einen Zauberspruch gesungen, als ich sie nicht verstehen konnte.«
»Ich verstehe den Text auch nicht. Mom sagt, ich muss warten, bis ich dreizehn bin, bevor ich Zaubersprüche lernen darf.«
Bolton zog eine Augenbraue hoch und begegnete Mercys Blick. Ich weiß doch auch nicht, was ich davon halten soll.
»Wieso bist du auf die Straße gelaufen?«, fragte Bolton. »Es war doch schrecklich dunkel und kalt.«
»Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich konnte ihr nicht helfen, darum musste ich Hilfe holen. Im Wald kenne ich mich aus und verirre mich auch im Dunkeln nicht. Wenn kein Auto angehalten hätte, wäre ich zu Fuß zu einem Haus gegangen.«
»Zu wessen Haus?« Mercy wusste ganz genau, dass es in der Gegend nur wenig Häuser gab.
»Zu irgendeinem Haus. Ich kenne sonst niemanden, aber man hätte mir doch geholfen, oder nicht?« Sie sah zu Mercy auf. »Aber dann habe ich Ihr Auto gehört, bevor ich bei der Straße war, und bin schneller gelaufen. Ich wusste nicht, ob ich es rechtzeitig bis zur Straße schaffe.«
»Ich hätte dich fast überfahren.«
»Morrigan.« Bolton lenkte die Aufmerksamkeit des Mädchens wieder auf sich. »Hat in den letzten Tagen jemand deine Großmutter besucht?«
»Das ist schon ein oder zwei Wochen her.«
»Was macht deine Mutter?«, wollte Bolton wissen.
»Was sie macht?«
»Welcher Arbeit geht sie nach?«
»Sie verkauft Sachen im Internet.«
»Was für Sachen?«
Das Mädchen zuckte mit den Achseln. »Sie macht Sachen im Bastelraum.«
»Meinst du den Raum mit den ganzen Messern?«, fragte Mercy.
»Manchmal schon. Meist ist sie in ihrem Scheunenzimmer.«
»Ich glaube, ich habe noch nie so viele Messer auf einem Fleck gesehen«, meinte Mercy. »Einige waren sehr ungewöhnlich.«
»Ich darf sie nicht anfassen. Sie sind scharf. Und bei einigen ist was auf den Klingen.«
Mercy war sofort alarmiert. »Was denn?«
»Gift.«
Bolton sprang auf und stürzte ins Haus.
Großer Gott! Was, wenn sich einer der Forensiker versehentlich verletzt?
Ihr fiel ein, dass sie Olivias Wunden ohne Handschuhe berührt hatte. War auf der Klinge etwa auch Gift? Mercy starrte auf ihre Hände und suchte nach Entzündungen oder Rötungen. Sie hatte die Feuchttücher aus ihrem Vorrat benutzt, um Olivias Blut zu entfernen, anstatt sich im Badezimmer zu waschen, da sie in den Waschbecken des Hauses keine Beweise zerstören wollte.
Ihre Hände sahen gut aus, aber ihr Herz schlug unregelmäßig. Habe ich durch die Haut etwas aufgenommen? Sie schloss die Augen, atmete tief durch und zwang sich, ihren Herzschlag zu beruhigen. Als sie die Augen aufschlug, bemerkte sie, dass Morrigan sie besorgt anstarrte.
»Geht es Ihnen gut?«
»Ja.« Sie zwang sich zu einem Lächeln.
»Wer wird jetzt auf mich aufpassen?« Morrigans Augen wirkten in ihrem Elfengesicht sehr groß.
Mercy strich ihr das widerspenstige Haar aus der Stirn. »Bis deine Mutter zurückkommt, wird sich eine nette Frau von dem … Amt, das Kindern hilft, gut um dich kümmern.« Die hoffentlich ein freundlicher Mensch ist.
»Oh.«
»Hoffentlich bleibt deine Mutter nicht so lange weg.«
»Sie hat nur den kleinen Koffer mitgenommen, nicht den großen.«
Das ist beruhigend. »Gut.« Ihr Herzschlag fühlte sich fast wieder normal an. Sowohl sie als auch Morrigan blickten in Richtung Straße, als sie ein Fahrzeug näher kommen hörten. Mercy erkannte den schwarzen Tahoe mit dem Lichtbalken sofort.
Erleichterung und ein Funken Glück erfüllten sie.
Truman konnte sie in jeder Menschenmenge finden.
Mercy zog seine Aufmerksamkeit auf sich, als hätte sie einen Peilsender und er wäre innerlich damit verdrahtet. Seine Nervensensoren fixierten sie, sobald er sie auf dem Hof entdeckt hatte, und ließen sie nicht mehr los. Augenblicklich beruhigte er sich, denn er hatte sich ganz zerrissen und leer gefühlt, nachdem er sie so lange Zeit nicht hatte erreichen können. Ganz zu schweigen davon, dass er sich große Sorgen gemacht hatte.
Sie stand da, eine große, schlanke, ganz in Schwarz gekleidete Gestalt, ihr langes dunkles Haar nur eine Nuance heller als ihre Kleidung.
Er runzelte die Stirn. Sie trug die Ersatzkleidung aus ihrer Notfalltasche. Was ist mit ihren Sachen passiert?
Ein kleines Mädchen im braunen Mantel und in viel zu kurzen Jeans hielt ihre Hand. Truman nahm an, dass es sich um die Enkelin handelte, die der Deputy erwähnt hatte, und war erstaunt, dass das Kind es geschafft hatte, den ganzen Weg bis zur Hauptstraße zu laufen, um Mercy anzuhalten.
Er parkte und eilte über den Schnee, der unter seinen Stiefeln knirschte, wobei er Mercy die ganze Zeit in die grünen Augen schaute. Sie lächelte breit, als er ihr direkt in die Arme lief und sie an sich drückte. »Du wirst massenhaft Nachrichten von mir bekommen, sobald du wieder Empfang hast.« Truman atmete ein, nahm den schwachen Zitronenduft ihres Haars auf, und der Großteil seiner Angst verpuffte. Er schlang die Arme etwas fester um sie und genoss es, sie auf diese Weise zu spüren.
»Bitte entschuldige. Ich wusste, dass du dir Sorgen machen würdest.«
Er trat ein Stück zurück, legte ihr die Hände an die Wangen und küsste sie, ohne sich um die Vorschrift zu scheren, die Zärtlichkeiten während der Arbeit verbot. Vier Monate zuvor war sie in seine Stadt gekommen, und er hatte gewusst, dass sein Leben nie wieder dasselbe sein würde. Mercy hatte es auf die bestmögliche Art und Weise verändert. Sie stritten sich. Sie versöhnten sich. Sie gerieten aneinander. Aber er genoss das alles ungemein. Das Leben vor Mercy war aus seinem Gedächtnis getilgt worden, und jetzt fühlte es sich an, als wäre sie schon immer bei ihm gewesen.
»Ja, ich habe mir Sorgen gemacht.«
»Wer hat dir verraten, wo du mich finden kannst?«
»Ich habe einfach auf meinen Instinkt vertraut.«
Sie runzelte die Stirn.
»Ich war auf dem Weg zu deiner Hütte, um nachzuschauen, ob du noch da bist, und sah dann am Straßenrand einen Wagen des Countys parken. Der Deputy sagte, dass du hier bist. Was ist eigentlich passiert?«
Die Geschichte, die sie ihm erzählte, bewirkte, dass er sich Morrigan zuwandte. »Du bist im Dunkeln den ganzen Weg zur Straße gelaufen?«, fragte er und hielt Mercys Hand fest umklammert.
Das Mädchen zeigte in eine Richtung. »Es gibt eine Abkürzung.«
Truman drehte sich um und betrachtete den dichten Wald. Da würde ich nachts nicht hindurchgehen. »Du bist sehr mutig.«
»Ich weiß«, erwiderte sie achselzuckend.
Die Eingangstür des Hauses ging auf, und ein Mann im hellblauen Mantel trat heraus. Mercy ließ Trumans Hand los, als der Blick des Mannes von Truman zu Mercy wanderte. Er gesellte sich zu ihrer Gruppe, und Mercy stellte den Detective vor. Truman bemerkte, dass Bolton leicht die Lippen verzog, als sie sich die Hand gaben.
Du dachtest wohl, sie wäre Single?
Tja, Pech gehabt.
»Hat sich die Spurensicherung schon die Messer angesehen?«, fragte Mercy Bolton.
»Noch nicht. Und ich habe mit der Rechtsmedizinerin gesprochen und sie gewarnt, dass möglicherweise Gift auf der Klinge war, mit der …« Bolton hielt inne, und sein Blick zuckte zu Morrigan, die ganz in der Nähe stand und aufmerksam zuhörte.
Mercy legte Morrigan eine Hand auf die Schulter und schaute sich um. Als sie einen Deputy in der Tür entdeckte, winkte sie ihn heran. »Morrigan hat einige interessante Tiere. Haben Sie sie schon gesehen?«, fragte sie den Deputy, der sofort begriff, was sie von ihm wollte.
»Nein, aber ich würde sie gern sehen«, sagte er an Morrigan gewandt. »Hast du auch Kaninchen?«, hörte Truman ihn fragen, als die beiden weggingen.
»Hat Natasha gesagt, ob man das Gift an den Wunden erkennen kann?«, wollte Mercy von Bolton wissen.
»Ich habe sie nicht danach gefragt.«
»Die Antwort lautet: Das hängt vom jeweiligen Gift ab«, sagte Natasha Lockhart, die soeben aus dem Haus kam. Truman mochte die kleine Rechtsmedizinerin. Für eine Person, die tagtäglich mit dem Tod zu tun hatte, war sie witzig und lächelte viel. Sie gesellte sich zu ihnen auf den verschneiten Hof. »Hallo, Truman«, begrüßte sie ihn. »Wart ihr beide schon in dem Thai-Restaurant, das ich euch empfohlen habe?«
»Ja«, antwortete er. »Wir waren schon drei Mal dort. Aber mir ist völlig schleierhaft, wie die Betreiber über die Runden kommen. Das Restaurant ist immer leer.«
»Ich glaube, die meisten Leute holen ihr Essen dort ab. Haben Sie schon mal …?«
»Was wollten Sie uns über das Gift sagen, Dr. Lockhart?«, unterbrach Bolton sie und warf ihr einen leicht ungeduldigen Blick zu.
»Richtig«, murmelte sie. »Einige Gifte können eine Verätzung am Wundrand verursachen, aber das hängt von ihrer Stärke und Art ab. Olivias Wunden haben stark geblutet, daher ist auf dem Gewebe nicht besonders viel zu sehen, aber ich werde danach Ausschau halten und einige Tests durchführen, sobald ich sie auf dem Tisch liegen habe.«
»Vielleicht ist das auch nur viel Lärm um nichts.«
»Es ist ein Anfang.« Natasha hielt inne und schaute zur Scheune hinüber, in der Morrigan und der Deputy soeben verschwanden. »Es gibt Anzeichen dafür, dass jemand zudem versucht hat, die Frau zu ersticken. Offensichtlich erfolglos, aber sie hat Petechien in den Augen.«
»Diese kleinen roten?«, hakte Truman nach. »Glauben Sie, dass das vor den Stichen passiert ist?«
»Im Moment vermute ich, dass der Erstickungsversuch zuerst erfolgte. In der Nähe des Sessels lag ein Kissen auf dem Boden, daher habe ich die Forensiker gebeten, es einzutüten und auf Speichelreste zu untersuchen. Es sah sauber aus, und es hätte Blut darauf sein müssen, wenn man versucht hätte, sie zu ersticken, nachdem ihr diese Wunden zugefügt worden waren.«
»Findet man auf Kissen denn nicht so gut wie immer Speichelreste?«, fragte Truman, dem durch den Kopf ging, dass Menschen nun einmal nachts sabberten.
»Schon, aber das war ein Zierkissen. Normalerweise schläft man darauf nicht. Ein normales Kissen lag noch unter ihrem Kopf.«
»War das Kissen auf dem Boden dunkelgrün?«, warf Mercy ein. »Auf dem Sofa liegt ein dunkelgrünes Kissen.«
»Das war es.« Natasha nickte. »Möglicherweise hat es jemand aus dem Wohnzimmer geholt.«
»Mit der Absicht, sie zu ersticken«, fügte Truman mit Blick auf Bolton hinzu. »Was war Ihrer Ansicht nach das Motiv? Gibt es Anzeichen für einen Diebstahl?«
»Kein Hinweis auf einen Einbruch«, antwortete Bolton. »Und Morrigans Mutter ist wahrscheinlich die Einzige, die uns sagen kann, ob etwas fehlt.«
»Wer würde eine alte Frau ermorden wollen?«, fragte Mercy. »Morrigans Worten zufolge scheint sie nur selten das Haus verlassen zu haben.«
»Vielleicht war sie nicht das Ziel«, schlug Truman vor.
»So oft sticht man nicht zufällig auf jemanden ein«, gab Natasha zu bedenken.
»Es braucht schon eine Menge Wut, um den Schaden anzurichten, den ich gesehen habe«, sagte Mercy nachdenklich. »Unser Verdächtiger könnte wütend gewesen sein, weil sein beabsichtigtes Opfer nicht hier war. Vielleicht hatte er es eigentlich auf die Mutter abgesehen.«
»Wir werden die Mutter gründlich unter die Lupe nehmen«, versprach Bolton. »Und weder Sie noch Chief Daly haben in diesem Fall irgendeine Rolle.« Er deutete auf Mercy. »Sie sind eine Zeugin, sonst nichts.«
Truman bemerkte, dass Mercy stur den Kopf neigte, und empfand schon jetzt Mitleid mit Detective Bolton.
Fünf
Mercy hielt den Blick des Detectives. Dass ich mich von diesem Fall zurückziehe, können Sie getrost vergessen.
»Entschuldigen Sie, Detective Bolton?«, kam eine Stimme von hinten. Mercy drehte sich zusammen mit dem Detective um.
Es war der Deputy, der sich Morrigans Tiere anschauen wollte. Das Mädchen war nirgends zu sehen.
»Wo ist Morrigan?«, fragte Mercy sofort.
»Sie füttert die Ziegen. Niedliche kleine Biester.« Der Deputy grinste schief. »Ich weiß, dass die Scheune anfangs nach einem Verdächtigen durchsucht wurde, aber hat sich seitdem mal jemand gründlicher darin umgesehen?«
»Wieso?«, wollte Bolton wissen.
»Ganz hinten ist ein Raum, von dem ich annahm, er sei für Vorräte gedacht, aber er ist vollgepackt mit … Dingen. Da drin sieht es aus wie in einem Miniaturdorf. Es gibt noch eine Werkbank wie die im Haus mit einigen Messern und anderen scharfen Werkzeugen.«
»Morrigan sagte, dass ihre Mutter einen Bastelraum in der Scheune hat«, berichtete Mercy.
Der Deputy nickte. »Das ist definitiv ein Bastelraum. Wenn meine Frau so einen hätte, würde ich sie da gar nicht mehr rausbekommen.«
»Ich sehe mir das mal an.« Bolton ging mit dem Deputy zur Scheune.
»Ich muss los«, sagte Natasha zu Mercy. »Morgen früh widme ich mich dann Ihrem Opfer. Heute ist mein Terminkalender schon voll.«
Aha! Sogar Natasha findet, dass ich mit einbezogen werden sollte. Mercy verabschiedete sich von der Rechtsmedizinerin und tauschte dann einen Blick mit Truman. Sie machten sich gleichzeitig auf den Weg zur Scheune.
»Das ist nicht dein Fall«, sagte Truman leise.
»Pech für ihn. Solange ich nicht davon überzeugt bin, dass Morrigan in Sicherheit ist, halte ich mich auch nicht raus. Warum braucht die Frau vom Jugendamt denn so lange?«
»Sie wird sich noch um andere Kinder kümmern, hat mit dem Schnee zu kämpfen und einen langen Fahrtweg.«
Sie warf ihm einen Seitenblick zu. »Das hatte ich nicht wörtlich gemeint.«
Sein Grinsen wärmte sie bis in die kalten Zehen. »Was glaubst du, wo ihre Mutter ist?«, fragte er.
»Gute Frage.« Sie ließ die Schultern hängen. »Kannst du dir vorstellen, nach Hause zu kommen und zu erfahren, dass deine Mutter ermordet wurde?« In der Sekunde, in der die Worte ihren Mund verließen, wollte sie sie auch schon wieder zurücknehmen. Truman hatte schließlich seinen ermordeten Onkel gefunden.