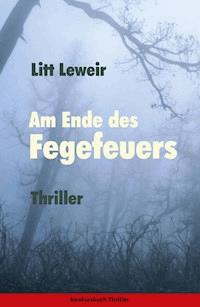9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jojo schlägt sich mit Dienstleistungen aller Art mehr schlecht als recht durchs Leben, da kommt ein lukrativer Auftrag gerade recht. Ein Koffer muss transportiert werden. „Jedes Detail ist wichtig. Wenn irgendetwas schiefgeht, könnte es sein, dass Sie nicht mehr zurückkommen. Nie mehr, Sie verstehen?“, sagt der Auftraggeber. Doch im Nachtzug geht etwas schief. Am anderen Morgen ist Jojos Geliebte tot und Jojo entkommt mit einem Koffer voll Geld. So beginnt eine Odyssee, die Jojo quer durch Europa und bis nach Tunesien ans Tor zur Sahara führt. Aus Jojo wird Mersand. Mersand verliebt sich in Nick, begegnet Pensionswirtin Rosa, Instrumentenbauer Sebastian, dem Straßenjungen Alf. Doch die Menschen in Mersands Umfeld haben die Tendenz, gewaltsam zu Tode zu kommen. Ist der mysteriöse Charon dafür verantwortlich, der Mersand ständig kryptische Botschaften zukommen lässt? Und was hat es mit der geheimnisvollen Brook auf sich, der Mersand immer wieder begegnet? „Mersand“ erzählt eine spannende Geschichte von Tod und Gewalt, aber auch von Liebe und Freundschaft und der Sehnsucht nach einem Platz in der Welt, „hardboiled“ mit einem wachsweichen Kern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Litt Leweir
Mersand
Thriller
konkursbuch VERLAG CLAUDIA GEHRKE
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Buch
(Fast) Das Ende
Nachtzug nach München
Auf der Insel: Tote Augen und ein Koffer voll Geld
Fata Morgana
Hummus
Feuer und Rauch
Schlafwandeln
Exen
Ein Besucher
Ein Gespenst geht um
Zwei Monde
London: Im Wodkaland
Erinnern
Rekonvaleszenz
Sechs Dinge
Alf
Greenwich
Darkroom
Tunesien: Charda Palace
Drei Wüsten
Fahrt nach Tunis
Die Sehnsucht nach Düften: Arles
Runaway Train
Zurück auf der Insel: Die große Schlange
Der Brunnen
Besuch
Sie atmen
Nicks Mutter
Freunde und Frieden
Hanna
Die Detektivin
Nach Hannas Tod
The Wind of Change: Nummer eins: Pferde am Pool
Nummer zwei: Antonias Traum
Nummer drei: Brooks Rückkehr
Nummer vier: Die Waffe ist weg
Nummer fünf: Gerüche und Schatten
Nummer sechs: Anna ist weg
Nummer sieben: Poo-tee-weet
Charon
Fine Ukes and Guitars
Zur Autorin
Impressum
Zum Buch
„Mersand“ erzählt eine spannende Geschichte von Tod und Gewalt, aber auch von Liebe und Freundschaft und der Sehnsucht nach einem Platz in der Welt, „hardboiled“ mit einem wachsweichen Kern.Jojo schlägt sich mit Dienstleistungen aller Art mehr schlecht als recht durchs Leben, da kommt ein lukrativer Auftrag gerade recht. Ein Koffer muss transportiert werden. „Jedes Detail ist wichtig. Wenn irgendetwas schiefgeht, könnte es sein, dass Sie nicht mehr zurückkommen. Nie mehr, Sie verstehen?“, sagt der Auftraggeber. Doch im Nachtzug geht etwas schief. Am anderen Morgen ist Jojos Geliebte tot und Jojo entkommt mit einem Koffer voll Geld. So beginnt eine Odyssee, die Jojo quer durch Europa und bis nach Tunesien ans Tor zur Sahara führt. Aus Jojo wird Mersand. Mersand verliebt sich in Nick, begegnet Pensionswirtin Rosa, Instrumentenbauer Sebastian, dem Straßenjungen Alf. Doch die Menschen in Mersands Umfeld haben die Tendenz, gewaltsam zu Tode zu kommen. Ist der mysteriöse Charon dafür verantwortlich, der Mersand ständig kryptische Botschaften zukommen lässt? Und was hat es mit der geheimnisvollen Brook auf sich, der Mersand immer wieder begegnet?„Der Roman liest sich wie ein rasanter ,film noir’, man gerät streckenweise in die Atmosphäre von Highsmiths talentiertem Mr. Ripley.” (Regina Nössler)
(Fast) Das Ende
E
s war ein heißer Tag. Jetzt sind Wolken aufgezogen. Es wird ein Gewitter geben. Ein Windstoß bläst gelben Staub in unsere Gesichter. Ich blicke hinauf zum gelben Himmel über dem Berg gegenüber. Dann wende ich mich wieder Charon zu.Sein schwarzer Anzug sieht aus, als wäre er mit gelbem Puder überzogen. Auf seiner Stirn steht Schweiß. Ein Tropfen kullert seine Wange herunter, zieht eine Linie durch den gelben Staub. Ist es wirklich nur Schweiß, oder ist es eine Träne? Zittert er vor Angst, oder ist es der Wind, der durch seinen Anzug weht, der ihn schaudern lässt?
»Zu spät«, zische ich und drücke die Pistole fester gegen seine Schläfe.
Aber noch drücke ich nicht ab.
Ich blicke noch einmal auf, an Alf vorbei auf den Pool. Das Wasser sieht schmutzig aus, dabei war es vor Kurzem noch so wunderbar blau.
Blau wie das Meer, denke ich.
Ich spüre den Wind in meinem Haar, Kraft, die mich durchströmt.
Ich werde es zu Ende bringen.
Jetzt.
Mein Name ist Mersand. Das war nicht immer so. Wir hatten beide einmal einen anderen Namen, Charon und ich. Das Ende davon ist der Beginn meiner Geschichte.
Nachtzug nach München
D
er Zug steht. Wassertropfen brechen das orange-farbene Licht, das vom Bahnsteig hereindringt. Draußen rumpelt es, laute Männerstimmen rufen einander etwas zu. Ein Wagen mit Postsäcken fährt vorbei. Die beiden Frauen auf den Sitzen gegenüber werden lauter. Sie sind eine Station vorher zugestiegen und kleben seither aneinander wie Fliegen auf einem Honigbrot. Ich sehe lieber weg. Auf das Nachtlicht über der Abteiltür, auf den Bahnsteig, den Regen, auf eine Ecke des Aktenkoffers, der zwischen meiner Hüfte und der Zugwand klemmt.Ich taste nach dem Buch in meinem Schoß, versuche, mich an den Text zu erinnern, den ich auswendig gelernt habe. Allein die Vorstellung, ihn laut aufsagen zu müssen, lässt mir das Blut in den Kopf schießen. Ich versuche, an etwas anderes zu denken. Doch es gelingt mir nicht.
23:05 Uhr zeigt das Display meines Mobiltelefons. Noch eine knappe Stunde und meine Geburtsminute jährt sich zum dreißigsten Mal. Nur zwei Minuten früher und aus mir wäre kein Aprilscherz geworden. Womöglich wäre ich dann auch nicht hier, sondern läge gemütlich zu Hause in meinem Bett, vielleicht sogar in Gesellschaft. So wie meine Schwester Marie, die es eine halbe Stunde früher in diese Welt geschafft hat. Ich habe es beinahe nicht geschafft, sie mussten mich holen. Und dann war ich so schwach, dass ich noch eine Weile an Schläuchen hing, während Marie schon längst fröhlich an den Nippeln unserer Mutter saugte. Auch alles Weitere ist Marie schneller und besser gelungen als mir. Das fing mit dem Sprechen- und Laufenlernen an und endete mit dem Abitur. Danach trennten sich unsere Wege. Maries führte zu einem erfolgreich abgeschlossenen Physikstudium in der Schweiz und einem Doktortitel. Im Mai geht es dann weiter zu einer Anstellung in einem Spital in Zürich. Sie hat bereits Visitenkarten, Medical Physicist steht unter ihrem Namen und daneben Division ofMedical Radiation Physics. Zu allem Überfluss hat sie auch noch eine Frau, die im sechsten Monat schwanger ist. Wenigstens eine Frau sollte ich auch haben. Findet Marie.
»Du wirst dreißig«, hat sie bei unserem vorletzten Telefonat gesagt, »wird Zeit, dass du was aus deinem Leben machst.«
»Ich hab mein Geschäft«, antworte ich, doch Marie lacht nur. »Komm doch am Samstag zu uns zum Essen«, sagt sie, »Christine wird auch da sein.«
Christine ist die Frau, mit der Marie mich schon seit Längerem verkuppeln will. Sieht gut aus, hat einen guten Job und ein gutes Herz. Das ist zusammengefasst Maries Beschreibung von Christine. Dann dürfte sie doch kein Problem haben, jemanden zu finden, oder?
Diesmal wäre ich tatsächlich gekommen, wenn ich mich nicht erkältet hätte. Marie will es nicht glauben.
»Ich habe wirklich Fieber«, sage ich.
»Na gut«, erwidert sie, »wir haben ja bald Geburtstag.«
»Was hat das damit zu tun?«, frage ich.
»Wirst schon sehen.«
Noch eine gute halbe Stunde bis Mitternacht. Um Mitternacht soll ich eine Frau treffen. In Wagen 8 vor Abteil 213.
»Sie können sie kaum verfehlen, sie trägt eine Krawatte«, hat der Mann gesagt, der vor ein paar Tagen in meinem Büro aufgetaucht ist. Er sieht genauso aus, wie man sich so einen Typen vorstellt. Dunkler Anzug, Hut, Sonnenbrille, die er nicht abnimmt, obwohl es bei mir im Erdgeschoss ziemlich düster ist. Keine Ahnung, wie der Mann auf mich gekommen ist. Auf mein Geschäft vielmehr. Dienstleistungen aller Art. Katzen füttern. Hunde ausführen. Fenster putzen. Zimmer streichen. Botendienste … Botendienste, das muss es gewesen sein.
»Ich habe einen lukrativen Auftrag für Sie, aber er ist riskant.« Er schiebt einen Koffer über den Schreibtisch. Und später sagt er: »Halten Sie sich unbedingt an die Anweisungen. Jedes Detail ist wichtig. Wenn irgendetwas schiefgeht, könnte es sein, dass Sie nicht mehr zurückkommen. Nie mehr, Sie verstehen?«
Ich verstehe nicht die Bohne.
»Um was geht es denn genau?«, frage ich.
»Je weniger Sie wissen, umso besser für Sie.«
Die ganze Sache ist mir suspekt. Ich bitte um Bedenkzeit.
»Okay«, sagt der Mann und nimmt den Koffer vom Schreibtisch, »wenn Sie es machen wollen, kommen Sie am 31. März um 19:45 Uhr zum Hauptbahnhof. Wir treffen uns auf Gleis 9 unter der Uhr. Seien Sie pünktlich und bringen Sie eine Rose mit. Eine rote Rose. Sollte Ihnen jemand folgen, ignorieren Sie es einfach. Das ist besser für Sie, glauben Sie mir.«
Am nächsten Morgen wache ich auf und überlege, ob ich ihn vielleicht nur geträumt habe. Aber der Zettel, auf den er mir den Treffpunkt und die Uhrzeit geschrieben hat, liegt tatsächlich noch auf meinem Schreibtisch.
Ich entscheide mich schnell. Die nächste Miete ist fällig, und ich habe Geburtstag, zwei gewichtige Gründe dafür.
»Nein, ich kann nicht feiern, ich muss arbeiten«, sage ich allen, die mich auf meinen Geburtstag ansprechen. »Nein, ich feiere auch nicht nach. Es ist ein großer Auftrag. Ich muss am 31. nach München, ich nehme den Nachtzug. – Nein, ich weiß noch nicht, wann ich wieder zurücksein werde.«
Falls ich überhaupt wieder zurückkomme. Aber bisher habe ich mich an alle Anweisungen gehalten. Ich habe sogar geschafft, was mir sonst kaum gelingt, ich bin pünktlich um 19:45 Uhr am Bahnsteig. Sogar an die Rose habe ich gedacht. Der Mann ist da, gibt mir den Koffer, einen Zettel mit den Anweisungen und eine Anzahlung.
»Den Rest bekommen Sie dann in München. Sie werden am Bahnsteig erwartet.«
Wie angewiesen belege ich den reservierten Sitz im Abteil mit meinem Rucksack und einem Tuch. Als Nächstes soll ich im Speisewagen warten, doch alle Tische sind belegt. Ich überwinde mich und setze mich zu einem älteren Ehepaar auf den einzigen freien Platz. Der Tisch ist zu klein und mit Tellern und Tassen so vollgestellt, dass ich Schwierigkeiten habe, die Rose neben den Kaffee zu legen. Aber so steht es nun mal auf meinem Zettel: Legen Sie die Rose neben Ihre Kaffeetasse.
Am Tisch gegenüber bemerke ich eine Frau in Anzug mit Weste und Krawatte, die ihren Blick von meinem Aktenkoffer zu meinem Gesicht schweifen lässt und interessiert die Rose neben dem Kaffee beäugt.
Ich lese noch einmal den Zettel mit den Anweisungen des Mannes mit dem Hut. »Wenn Sie die Frau mit der Krawatte schon früher treffen sollten, ignorieren Sie sie!«, steht da.
Aber das ist schwer. Unsere Blicke treffen sich, ich kann es nicht verhindern. Die Frau lächelt. Für einen Moment kommt es mir sogar so vor, als zwinkere sie mir zu, und ich kann gar nicht anders als hinsehen.
Kurz bevor die Zugbegleiterin erscheint, streckt noch eine andere Frau mit Krawatte den Kopf in den Speisewagen, schaut sich um und verschwindet, ehe ich sie mir genauer ansehen kann.
Wäre es ein Fehler, wenn ich schon jetzt zum Treffpunkt ginge? Der Mann hat nicht gesagt, dass ich keinesfalls vorher erscheinen darf. Ich verlasse den Speisewagen.
Ich warte vor Abteil 213, dem Treffpunkt. Ich bin allein im Gang, die Frau ist wie erwartet noch nicht da. Ich stelle den Koffer auf den Boden, dann öffne ich das Fenster. Die kühle feuchte Luft tut mir gut, es riecht nach Öl und nasser Erde. Die Wagentür öffnet sich, und die Krawattenträgerin, die mir im Restaurant gegenübersaß, kommt auf mich zu. Sie lächelt.
»Sie sind zu früh«, sage ich, als sie mich erreicht.
»Es ist nie zu früh«, antwortet sie. Ihre Krawatte sitzt locker, die oberen beiden Knöpfe ihres weißen Hemdes stehen offen, ebenso ihre schwarze Weste. Ihr Hemd hängt über der Hose. Das Jackett trägt sie über ihrem Arm. Eine Strähne ihres kurzen braunen Haares hängt ihr in die Stirn.
»Soll ich den Code aufsagen?«, frage ich.
»Den Code?«
»Noch nicht?«
»Nur zu!«
Ich hole tief Luft und gebe mir einen Ruck. Aber ich sehe sie nicht an, während ich den Text aufsage. Ich schau lieber aus dem Fenster. Dann ist es vorbei, mein Kopf glüht, und ich wage kaum zu atmen, während ich gespannt auf ihre Reaktion warte. Endlich räuspert sie sich. »Das ist der – Code?«, fragt sie.
»Ja. Stimmt etwas nicht?«
Sie zögert einen Moment, dann holt sie tief Luft und sagt: »Komm mit!«
Ich folge ihr in den nächsten Wagen. Vor einer Abteiltür bleibt sie stehen, schließt auf und bedeutet mir voranzugehen. Sie macht kein Licht, bietet mir auch keinen Platz an. Nachdem sie die Abteiltür geschlossen hat, ist es dunkel. Nur die Nachtlampe über der Tür spendet ein wenig Licht.
Ich spüre sie neben mir, warte, dass irgendetwas geschieht, sie etwas sagt. Jetzt hat sie sich bewegt, steht nun hinter mir. Ich höre den Stoff ihrer Kleidung rascheln. Ihr Atem streift meinen Nacken. Sie legt ihre Hände auf den Aktenkoffer, den ich vor mir halte, und schmiegt sich an meinen Rücken.
»Gib mir den Koffer!«, flüstert sie mir ins Ohr.
»Ich soll ihn nach München bringen«, sage ich. Plötzlich packt sie meinen rechten Arm und dreht ihn nach oben. Ein stechender Schmerz schießt durch meine Schulter. Der Koffer fällt auf meine Zehen, und ich spüre etwas Kaltes an meinem Nacken.
»Jetzt halt schön still, Herzchen, sonst puste ich dir den Kopf weg.«
Sie tastet mich ab, findet mein Mobiltelefon in der Hosentasche und nimmt es an sich.
»Hat Mickey dich geschickt?«
»Ich kenne keinen Mickey.«
»Wo ist das Geld?«
»Ich weiß von keinem Geld …«
Sie drückt das Kalte, das allmählich warm wird, fester in meinen Nacken und zieht meinen Arm weiter nach oben.
»Du machst jetzt schön den Mund auf, oder ich blas dich weg!«
»Ein Mann mit einem Hut war in meinem Büro«, sage ich keuchend.
»Also nicht Mickey?«
Ich erzähle ihr alles, was ich weiß. Sie lässt meinen Arm los und schiebt mich in Richtung Bett. Ich höre ein metallisches Klicken, dann umschließt kühles Metall mein linkes Handgelenk. Jetzt erst lässt der Druck an meinem Nacken nach. Sie schaltet das Licht ein, nimmt meinen Rucksack, öffnet ihn und kippt meine Sachen auf das Bett. Sie greift nach dem Buch, schnalzt mit der Zunge.
»Du liest vielleicht Sachen!« Sie lacht, nimmt den Koffer, knipst das Licht aus und geht zur Tür. »Sei schön brav, ich komme wieder.«
Meine rechte Schulter schmerzt, mir ist schlecht, am liebsten würde ich mich setzen, doch es geht nicht. Ich hänge mit den Handschellen irgendwo fest.
Ich muss einen Fehler gemacht haben, aber welchen? Ich gehe noch einmal alles durch, sehe mich den Bahnsteig entlanggehen mit einer Rose in der Hand. Ich sitze im Speisewagen mit der Rose neben dem Kaffee. Ich sehe die verhuschte Zugbegleiterin, die mir das Buch in den Schoß legt, nicht lange, nachdem ich meinen Platz im Abteil eingenommen habe.
»Die Zugbegleiterin trägt ein Buch unter dem Arm. Auf ihrer Weste ist ein kleiner weißer Fleck, das ist das Erkennungszeichen«, höre ich den Mann mit dem Hut sagen. Ja, hat alles gestimmt, der Fleck, das Buch. Das Buch steckte in einem Umschlag. Als ich es herausnehme, weiß ich sofort, warum.
Während ich versuche, mir den Text einzuprägen, kommen die beiden Frauen ins Abteil. Schnell lege ich das Buch auf meinen Schoß und den Umschlag darauf, aber ich glaube, sie haben es bereits gesehen. Ein Lächeln, ein Hallo, dann lassen sie sich auf die Sitze fallen. Nicht lange und ich sehe ihre ineinander verkeilten Körper, ihre Zungen, die Hände unter den T-Shirts, das Tuscheln und hin und wieder verstohlene Blicke. So als wollten sie mich provozieren, so als hätte sie der Anblick des Buchcovers dazu angestachelt.
O Gott, die Rose! Ich habe die Rose im Speisewagen vergessen. War das der Fehler?
Die Abteiltür geht auf, das Licht an. Mein Herz klopft hart.
»Da hat sich wohl jemand einen Aprilscherz mit dir erlaubt!«, sagt die Frau und wirft den Aktenkoffer aufs Bett.
»Sieh mal, ich hab uns etwas mitgebracht.« Sie stellt zwei Sektgläser auf ein Tischchen neben dem Fenster und eine Flasche daneben. Sie nestelt in ihren Jackentaschen und zieht einen Schlüssel heraus.
»Du wirst doch auch schön artig sein, oder?«, flüstert sie mir ins Ohr. Ihr Atem lässt mich schaudern. Sie merkt es und lacht. Sie küsst meinen Nacken, schiebt ihre Hände unter mein Hemd. Die Berührung erregt mich, das gefällt mir gar nicht.
»Und? Gefällt dir das?«
»Nein.«
»Weißt du was, es ist mir egal, ob es dir gefällt.« Sie nimmt meine freie Hand und schiebt sie sich in die Hose.
»Bin ich feucht?«, fragt sie.
»Ja«, antworte ich zögernd.
»Wie feucht?«
Ich antworte nicht.
»Sag schon! – Oder muss ich nachhelfen?«
»Feucht wie – wie das Meer.«
»O ja, wie das Meer, das ist gut, das gefällt mir.«
Sie fährt mit der Zunge über meine Wange, steckt sie in mein Ohr. Sie tastet nach dem Bund meiner Hose, öffnet den Knopf, lässt ihre Hand dort liegen. Ich spüre, wie sich dort das Blut sammelt, wie es pulsiert, und sie scheint es auch zu spüren, denn sie lächelt.
»Sag den Code noch einmal!«
»Bitte nicht.«
»O doch. Oder willst du die ganze Nacht hier herumhängen?«
Ich versuche, mich zu konzentrieren. Meine Stimme zittert. Ich verheddere mich, komme über die ersten Zeilen nicht hinaus.
»Nun mach schon!«, flüstert sie. Ich spüre ihren Atem an meinem Hals und dann ihre Hand mit der Knarre. Sie schiebt sie von hinten in meine Hose. Ich zucke zusammen, verkrampfe. Mein Herz rast. Sie scheint es zu spüren, lässt von mir ab.
»Keine Angst«, sagt sie. Dann befreit sie mich von den Handschellen und dreht mich zu sich. »Tut mir leid, ich will dir nicht wehtun. Das ist nur ein Spiel, weißt du.« Sie streicht mir über die Wange. »Du hast wirklich nichts mit Mickey zu tun, oder?«
Ich schüttle den Kopf.
»Da versucht wirklich jemand, dich zu verarschen.« Sie steckt die Waffe in ihr Jackett, zieht es aus und wirft es über meine Sachen auf dem Bett. Sie legt die Schuhe ab und kickt sie in die Ecke.
»Ich mach’s mir jetzt bequem. Du kannst abhauen, wenn du willst.«
Bremsen quietschen, das Licht flackert und erlischt ganz. Ein Ruck geht durch den Zug. Sie fällt auf das Bett, ich lande halb auf, halb neben ihr.
Eine Weile ist es still, bis auf den Regen und den Wind. Dann setzt der Zug sich quietschend in Bewegung. Aber das Licht geht nicht wieder an.
Die Frau blickt mich an, das vermute ich zumindest, denn ich sehe das Weiß in ihren Augen im Licht des blassen viereckigen Mondes über der Tür. Ihr Mund nähert sich meinem, ich kann schon fast ihre Lippen spüren. Sie zögert, rückt wieder von mir ab. »Ich heiße übrigens Luise. Das ist mein Künstlername.«
Ich blicke zum Fenster. Der Fahrtwind presst den Regen in Schlieren gegen das Glas. Ich schließe die Augen und öffne meine Lippen.
Der Zug rauscht durch die Nacht, Regen prasselt gegen das Fenster. Gläser klirren. Mit einem leisen Plop entweicht der Korken. Perlende Flüssigkeit schäumt in die Gläser. Der Champagner prickelt auf meiner Zunge.
»Was ist deine Kunst?«, frage ich.
»Was?«
»Wenn du einen Künstlernamen hast, musst du doch eine Kunst beherrschen.«
»Ich knacke Tresore.«
Als ich aufwache, ist Luise verschwunden. Den Koffer hat sie mitgenommen. Auf dem Tischchen neben dem Bett liegt eine rote Rose auf einem Blatt Papier.Hotel California, Zimmer 888, 15 Uhr, Luise.
Von Weitem sehe ich eine Gruppe Menschen, die ein Plakat hochhalten. Die Schrift ist verschwommen. Der Bahnsteig ist lang, und es dauert eine Weile, bis ich die Buchstaben lesen kann: April, April! Wie passend! Ich lache trocken.
Ich fühle mich dumpf, mein Kopf ist leer, nur in meinem Bauch flimmert es flau. Ich habe meinen Auftrag nicht erfüllt, keine Ahnung, was jetzt mit mir geschehen wird. Ich blicke auf den Boden. Am besten, ich sehe niemanden an. Vielleicht schaffe ich es ja aus dem Bahnhof heraus, ohne dass sie mich entdecken. Zu spät denke ich an die Rose in meiner Hand, das Erkennungszeichen. Jemand packt mich am Handgelenk. Fast bleibt mein Herz stehen.
»Wo zum Henker warst du?«, zischt Marie.
Marie ist nicht allein. Die beiden Frauen aus dem Abteil sind bei ihr, sie halten das April-April-Plakat. Die Zugbegleiterin ist auch da. Und die andere Frau mit Krawatte, die, die kurz den Kopf in den Speisewagen gestreckt hat, steht neben Marie und sieht furchtbar traurig aus.
»Christine hat zwei Stunden auf dich gewartet. Vor Abteil 213. Kannst du nicht einmal etwas richtig machen?«
Marie redet auf mich ein, doch ich höre sie nicht, ich blicke in Richtung Schließfächer. Dort geht Luise. Sie sieht gehetzt aus, in ihrem Blick liegt Angst. Ich will ihr folgen, aber Marie hält mich fest. Als es mir endlich gelingt, mich loszureißen, ist es zu spät. Luise ist verschwunden.
Um 14 Uhr betrete ich das Hotel California, eine Stunde zu früh, aber das wird schon nicht so schlimm sein. Zimmer 888 liegt im achten Stock. Ich klopfe. Als niemand reagiert, öffne ich einfach die Tür. Das Zimmer ist nur auf den ersten Blick leer. Zwei schwarze Aktenkoffer liegen auf dem Bett. Beide sind offen. In dem einen befindet sich Geld. Ich trete näher. Hundert-Euro-Scheine. Bündel an Bündel. Im zweiten Koffer liegen nur eine Visitenkarte und ein rotes Blatt Papier. Happy Birthday, mein liebes kleines Aprilscherzchen, ich wünsch dir ein schönes neues Leben. Dein Schwesterherz Marie. Erst als ich das Blatt in den Koffer zurücklege, entdecke ich Luise neben dem Bett. Sie trägt einen weißen Bademantel und liegt auf dem Bauch. Ihr rechtes Knie ist leicht angewinkelt, ihre rechte Hand über dem Kopf ausgestreckt, ihr Kopf zur Seite gedreht. Blut sickert aus ihrem Haar in den plüschigen Teppich. Ihre Augen stehen offen und blicken in Richtung ihrer Hand. Ein paar Zentimeter von ihrer Hand entfernt liegt eine Waffe. Als ich nach dem Telefon auf dem Nachttisch greifen möchte, höre ich ein Geräusch aus dem Badezimmer und halte inne. Es klingt nach einer Toilettenspülung.
Ich stecke die Waffe in meine Jackentasche. Dann nehme ich den Koffer mit dem Geld. Einen Moment überlege ich, ob ich Maries Visitenkarte auch mitnehmen soll. Aber ich tu’s nicht. Ich verlasse das Hotelzimmer und lasse sie dort.
Auf der Insel: Tote Augen und ein Koffer voll Geld
D
er Duft irgendeiner Pflanze zieht durch den Raum. Keine Ahnung, was es ist, ich verstehe nichts von Pflanzen. Mir ist warm, dabei ist doch erst April und meinen nackten Körper bedeckt nur ein leichtes Baumwolllaken. Ich strample es ans Fußende des Bettes. Aber es hilft nichts, ich kann nicht schlafen.Vielleicht hätte ich doch nicht den nächsten Flug nehmen sollen. Vielleicht wäre der übernächste ja an einen kühleren Ort gegangen.
Es ist nicht nur die Hitze, die mich nicht schlafen lässt. Ich bekomme das Bild von Luise nicht aus meinem Kopf. Das Bild von Luises toten Augen. Und von Maries Visitenkarte. Warum habe ich sie bloß dort gelassen?
Ich blicke auf den Sessel am Fenster. Dort liegen mein T-Shirt und meine Jeans, das Einzige, was mir geblieben ist. Abgesehen von meiner Jacke und meinem Rucksack natürlich. Und den paar Sachen, die sich darin befinden. Unter anderem meine Brieftasche mit meinem Ausweis. Und mein Telefon. Die SIM-Karte habe ich am Münchner Flughafen in die Toilette gespült, die Pistole in der Lüftung darüber deponiert. Meine Fingerabdrücke habe ich natürlich zuvor abgewischt.
Für einen Moment denke ich mit Wehmut an meine kleine Erdgeschosswohnung in Berlin. Aber so toll war die auch wieder nicht. Viel zu dunkel. Und in einem schlechten Zustand, die Tapete fleckig, der Teppich zerschlissen. Die Möbel alt. Die Umgebung schrecklich, ein Wettbüro neben dem anderen. Haustiere habe ich keine. Jedenfalls keine, die ich mir freiwillig zugelegt habe. Es gibt ein paar Menschen, die ich vermissen werde, aber vielleicht ja auch nicht. Ich hatte noch nie eine Begabung, Menschen an mich zu binden. Oder mich an sie. Was habe ich also verloren? Und was habe ich noch zu verlieren?
Einen Koffer mit Geld. Ich habe es noch nicht gezählt. Vielleicht werde ich es morgen zählen. Vielleicht will ich es aber auch gar nicht wissen. Denn eigentlich sind es nicht Luises tote Augen, die mir keine Ruhe lassen. Der Koffer mit dem Geld beunruhigt mich. Ich habe Angst, dass er mir abhandenkommt. Der Gedanke daran macht mir Herzklopfen. Ich reibe mir kalten Schweiß von der Stirn. Der kommt bestimmt nicht von der Hitze, so heiß ist es nämlich gar nicht. Ich weiß, eben habe ich noch behauptet, es sei heiß. Na und? Marie hat immer gesagt, ich würde meine Meinung alle fünf Minuten ändern. Ich sei so unberechenbar wie ein Elektron. Die würden sich auch nie festlegen wollen. Wie ein Elektron? Auf solche Vergleiche kann auch nur Marie kommen.
Ich hätte niemals Maries Visitenkarte im Hotel zurücklassen sollen. Niemand würde mich mit dem Mord in Verbindung bringen, wenn ich es nicht getan hätte. Ich weiß, zunächst werden sie Marie damit in Verbindung bringen und nicht mich. Aber sie werden schnell herausfinden, dass Marie es nicht gewesen sein kann. Sie hat sicher ein Alibi, ihre ganze Entourage war ja schließlich bei ihr. Und dann werden sie auf mich kommen.
Es war auch ein Fehler zu fliegen. Das dämmert mir allmählich, als ich im Flugzeug sitze. Nervosität den ganzen Flug über, so schlimm, dass ich keinen Bissen essen kann. Herzklopfen, als ich am Rollband auf den Koffer warte. Erleichterung, als ich ihn auf mich zukommen sehe. Wieder Herzklopfen, als ich durch den Zoll gehe. Ich hätte ein Schiff nehmen sollen, den Zug, einen Bus. Nein, ich hätte zu Fuß gehen sollen. Zu-Fuß-Gehen ist eines der wenigen Dinge, die ich immer schon gut konnte. Und es birgt von allen Fortbewegungsmitteln die wenigsten Gefahren. Nicht nur wegen der geringen Geschwindigkeit. Wäre ich zu Fuß gegangen, hätte ich meinen Ausweis nicht vorzeigen müssen. Natürlich hätte ich zu Fuß nicht hierherkommen können, aber es gibt eine Menge Orte, die ich zu Fuß hätte erreichen können. Ich hätte nicht fliegen müssen. So viel hätte schiefgehen können. Ich habe wirklich großes Glück gehabt, dass ich meinen Koffer noch habe. Mehr Glück als Verstand. Das hat auch mein Vater immer gesagt, wenn mir zufällig etwas gelungen ist. Hinterher hat er sich meistens entschuldigt.
Wenigstens habe ich daran gedacht, die Pistole loszuwerden. Beinahe hätte ich sie mitgenommen. Ab jetzt werde ich erst nachdenken und dann handeln, nehme ich mir vor, als ich mit dem Koffer in der Hand vor den Flughafen trete und zwei Frauen, die zufällig vor mir durch die Glastür gehen, zu einem Bus folge.
»Zum Strand?«, frage ich den Busfahrer.
Der sieht mich einen Augenblick verwirrt an, und ich denke schon, ich muss einen anderen Bus nehmen, um zum Strand zu kommen. Irgendeinen Strand wird es hier doch wohl geben, das ist doch eine Insel, oder? Doch dann nickt er und gibt mir auf einen Zwanzig-Euro-Schein heraus.
Wo bin ich hier eigentlich, frage ich mich, als der Bus an einer Windmühle vorbeifährt. In Holland doch nicht, oder? Eine Reihe vor mir sitzen die beiden Frauen, denen ich zum Bus gefolgt bin, eng beieinander und unterhalten sich lebhaft. Ich verstehe nicht alles. Doch ich bekomme so ungefähr mit, dass die eine der anderen von einer abgelegenen Finca vorschwärmt. Sie erzählt von drei Terrassen, eine nach Osten, eine nach Westen, die dritte nach Süden. Von einem großen Grundstück mit Skulpturen und einer Steinspirale,mitAvocadopflanzen und Eukalyptusbäumen. Von Abendessen draußen in warmen Sommernächten, von Lagerfeuern und von einem Swimmingpool mit einem wundervollen Blick über die Hügel gegenüber. Und von einsamen Sandstränden, an die sich zu dieser Jahreszeit kaum ein Tourist verirrt. Das könnte mir auch gefallen. Ich stelle mir vor, wie ich mit Luise beim Abendessen oder beim Lagerfeuer sitze oder in einem Pool schwimme. Ich stelle mir Luise besser nicht mehr vor, Luise ist tot. Als die Frauen aussteigen, steige auch ich aus. Ich wäre ihnen gerne weiter gefolgt, doch ein Jeep wartet auf sie.
Der Passant, den ich frage, wo der Strand ist, sieht mich an, als wäre ich nicht ganz dicht. Erst denke ich, er versteht mich nicht. Ich verstehe ihn definitiv nicht. Ich versuche es mit Englisch, doch er spricht kein Englisch. Zum Glück versteht mich das Paar, das ich als Nächstes frage.
»Der Bus ist gerade weg«, sagt der Mann, »und der nächste kommt erst in ungefähr zwei Stunden.«
»Vielleicht gehen Sie erst mal einen Kaffee trinken«, schlägt die Frau vor.
Ich nehme den Rat der Frau an. Zum Glück finde ich schnell einen Ort, an dem ich einen Kaffee bekomme. Mit einer Kellnerin, die mein Englisch versteht. Als sie mir den bestellten Kaffee bringt, frage ich sie nach einer Unterkunft. Es stellt sich heraus, dass die Frau nicht bloß eine Kellnerin ist, sondern die Wirtin. Und sie hat selbst Zimmer zu vermieten, direkt über dem Café. Sie fragt nicht einmal nach meinem Ausweis, und das Formular, das ich ausfüllen muss, legt sie weg, ohne es sich anzusehen. So bemerkt sie nicht, dass mein Name nicht zu entziffern ist. Ich bezahle eine Woche im Voraus. In bar selbstverständlich. Ein Bündel Geld habe ich bereits auf der Toilette im Münchner Flughafen aus dem Koffer genommen.
»Ich bin Rosa«, sagt sie und gibt mir die Hand.
Weil mir so schnell kein anderer Name einfällt, nenne ich ihr meinen richtigen Vornamen. So heißen bestimmt ganz viele, ist also kein Problem. Sie zeigt auf meinen Aktenkoffer und fragt: »Nur Handgepäck? Ist Ihr anderes Gepäck verloren gegangen?«
Ich nicke.
»Oh, hoffentlich bekommen Sie es wieder.«
Ich bekomme ein schönes Zimmer nach hinten. Es ist nicht sehr groß, aber es hat alles, was ich brauche, auch ein kleines Waschbecken in der Ecke. Das Badezimmer liegt über den Flur, und ich teile es mit den anderen Gästen.
Mir ist kalt. Ich taste nach dem Laken und ziehe es wieder über meinen nackten Körper. Aber es hilft nicht, ich friere weiter, während es draußen allmählich hell wird.
Aber vielleicht stimmt das alles nicht. Vielleicht liege ich gar nicht in einem Pensionszimmer und friere. Vielleicht gibt es keinen Koffer mit Geld. Vielleicht ist niemals ein Mann mit Hut bei mir aufgetaucht und hat mich beauftragt, einen anderen Koffer nach München zu bringen. Und wenn doch, vielleicht habe ich seinen Auftrag nicht angenommen. Vielleicht liege ich zu Hause in meinem Bett und schlafe. Vielleicht träume ich nur, hier zu sein, in diesem fremden Pensionszimmer. Dann wäre jetzt die Gelegenheit aufzuwachen. Ich schnippe mit den Fingern, nichts geschieht. Ich zwicke mir in den Arm, dann schlage ich mir mit den flachen Händen auf die Wangen. Auch das ändert nichts.
Ich rolle mich aus dem Bett, ziehe den Koffer unter dem Bett hervor und öffne ihn. Ein Bündel Hundert-Euro-Scheine reiht sich an das andere. Ich blinzle, aber es ändert sich nichts an dem Anblick. Ich schließe den Koffer wieder, schiebe ihn zurück an seinen Platz. Ich schlüpfe in Jeans und T-Shirt, setze mich ans Fenster und blicke in den kleinen Hinterhof mit dem Mosaiksteinboden, wo ich am Tag zuvor meinen Kaffee getrunken und etwas später auch zu Abend gegessen habe. Dort tut sich etwas. Ich höre Geräusche, das Schaben von Metall auf Stein. Ich sehe hinunter. Meine Zimmerwirtin ist dabei, die Tische abzuwischen, dabei schiebt sie ab und zu einen Stuhl zur Seite. Als sie fertig ist, steht sie eine Weile da und schaut in den Himmel.
»Hola«, ruft sie mir fröhlich zu, als sie mich entdeckt, »guten Morgen. Gut geschlafen?«
Ich lerne, wie der Ort heißt, in dem ich gestrandet bin. Ich lese es auf der Visitenkarte der Goldschmiedin, die in einer Vitrine in der Ecke des Cafés ihre silbernen Ringe und Anhänger ausstellt. Aber sicher kann ich nicht sein, die Goldschmiedin könnte ihr Geschäft auch in einem anderen Ort haben. Und Rosa wage ich nicht zu fragen.
Nach einem üppigen Frühstück im Mosaikbodenhinterhof besuche ich den Markt. In der Markthalle vor einem Fischstand begegne ich den Frauen aus dem Bus. Sie erinnern sich an mich und nicken mir zu. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Besser wäre, an mich würde sich niemand erinnern. Besser, ich mache mich unsichtbar. Besser, ich verlasse jetzt diese Markthalle, sonst muss ich kotzen. Nicht wegen der Frauen, die haben nichts damit zu tun. Es sind die toten Fische und das Fleisch und der Geruch, den sie ausströmen. Ich flüchte nach draußen. Und allmählich lässt meine Übelkeit nach. Der Duft von Kräutern, von in Knoblauch eingelegten Oliven und frischem Brot zieht in meine Nase und lässt mich die toten Fischaugen und den Verwesungsgestank vergessen.
Auf diesem Markt gibt es nicht nur Kräuter, Knoblauch, Oliven und Brot. Es gibt auch Steingut und Körbe. Und es gibt Hosen und T-Shirts und Sonnenbrillen. Ich kann mir alles kaufen, was ich möchte, wird mir auf einmal bewusst, ich habe einen Koffer voll Geld. Ich kaufe mir drei Paar Jeans, fünf T-Shirts, Unterwäsche, Socken und eine Kappe. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist eine Tarnkappe. Ich kaufe auch ein Paar Sportschuhe, ein Paar Sandalen und eine Sonnenbrille. Ich kaufe Brot, Käse und Oliven. Dann gehe ich noch in einen Supermarkt und kaufe eine Zahnbürste und Zahnpasta.
Ich bringe die Einkäufe in mein Zimmer, putze meine Zähne und ziehe mir neue Sachen an. Ich setze die Kappe auf und die Sonnenbrille. Dann gehe ich wieder hinaus. Ich schlendere eine Weile durch den Ort, durch gemütliche Gassen mit kleinen Wohnhäusern und Geschäften. Ich komme an dem Laden der Goldschmiedin vorbei. Nun weiß ich wirklich, wie dieser Ort heißt. Er heißt wie Kunst auf englisch, mit A am Ende. Und genauso ist der Ort auch: Wie für mich persönlich gemalt.
Ich gehe in den Laden und kaufe einen Ring. Bisher habe ich noch nie Ringe getragen, aber es ändert sich gerade so viel in meinem Leben, warum nicht auch das. Und der Ring gefällt mir wirklich gut, es ist ein schlichter Ring aus Silber. Aber das sind nicht die eigentlichen Gründe, warum ich den Ring kaufe. Ich kaufe ihn, weil ich es kann.
Ich frage die Goldschmiedin nach dem Weg zum Meer. Auch sie rät mir, den Bus zu nehmen, als ich ihr sage, dass ich kein Auto habe. Der nächste Bus zum Meer kommt erst in einer knappen Stunde. So weit wird es schon nicht sein, denke ich und beschließe, zu Fuß zu gehen.
Aber es ist weit, viel weiter, als ich gedacht habe. Macht nichts, irgendwann werde ich schon ankommen. Erst denke ich unterwegs an Luise, und mein Herz wird schwer. Doch ich lasse mich davon nicht beirren. Ich lasse Luise in meinem Kopf und mein Herz schwer sein und gehe einfach weiter. Bald ist mein Herz wieder leicht, und in meinem Kopf sind nur noch meine Füße. Ich setze einen vor den anderen, bis ich schließlich ankomme.
Ich finde immer noch keinen Strand, aber wenigstens das Meer. Ich stehe an einem Geländer und beobachte, wie die Wellen gegen die Felsen schlagen. Hinter mir liegt eine kleine Stadt, zwischen der Stadt und mir ein Restaurant. Ich setze mich an einen der Tische auf der Terrasse. Ich kann das Meer immer noch sehen, aber nicht mehr, wie es ans Ufer brandet. Ich bestelle Fisch und ein Glas Wasser. Als ich den Fisch dann auf meinem Teller liegen sehe, wird mir schlecht. Vielleicht hätte ich Filet nehmen sollen. Ich schiebe den Fisch weit von mir und versuche, nicht auf den Kopf zu sehen und die toten Fischaugen zu vergessen. Doch das ist gar nicht so einfach, solange der tote Fisch noch vor mir auf dem Teller liegt. Ich winke den Kellner heran.
»Schmeckt es nicht?«, fragt er, als ich ihn bitte, den Teller wieder mitzunehmen. Ich weiß nicht, was ich antworten soll, also schweige ich.
»Kann ich Ihnen sonst noch etwas bringen?«
»Haben Sie Wein?«, frage ich.
»Selbstverständlich.«
Ich nehme den Wein, den er mir empfiehlt. Es ist Weißwein. Eigentlich mag ich Rotwein lieber. Eigentlich wollte ich nur ein Glas, aber ich bekomme gleich eine ganze Flasche. Er gießt mir ein. Ich bin Alkohol nicht gewöhnt, deshalb bin ich ziemlich schnell betrunken.
Es ist dunkel geworden, die Flasche ist leer, meine Übelkeit verflogen. Ich zahle.
Dann schlendere ich eine Weile durch den Ort. Der Wein hat meine Seele in Watte gelegt. Das gefällt mir. Das Fahrrad im Schaufenster des Fahrradgeschäftes, an dem ich vorbeikomme, gefällt mir auch. Ich könnte es kaufen. Aber das Geschäft hat geschlossen, und ich habe nicht genug Geld bei mir. Aber ich könnte es morgen kaufen. Ich könnte sogar zwei kaufen, wenn ich wollte. Wahrscheinlich könnte ich das ganze Geschäft kaufen. Der Gedanke macht mich glücklich.
Ich finde die Bushaltestelle nicht mehr. Ich könnte jemanden nach dem Weg fragen. Aber warum sollte ich? Ich kann doch genauso gut ein Taxi nehmen. Steht da nicht eins, vorne an der Ecke?
Zurück in meinem Zimmer über dem kleinen Café setze ich mich ans Fenster und verschlinge das Brot, den Käse und die Oliven, die ich am Vormittag auf dem Markt gekauft habe. Dabei blicke ich in den Himmel. Er ist klar, Sterne funkeln. Vom Mosaikhinterhof dringen Stimmen herauf. Nachdem ich gegessen habe, stütze ich mich auf die Fensterbank und blicke nach unten. Fast alle Tische sind besetzt. Ich lasse meinen Blick darüber schweifen, bis er sich mit etwas verhakt. Ich reibe mir die Augen, dann sehe ich noch einmal genauer hin. Eine Frau. Sie sitzt bei einem Glas Wein. Sie ist nicht allein, es sind noch zwei andere bei ihr, doch die nehme ich kaum wahr.
Ich hätte mir noch etwas Besseres zum Anziehen kaufen sollen, nicht nur Jeans und langweilige T-Shirts. Ich sehne mich nach einem schönen Hemd aus glänzendem Leinen. So eins, wie es die Frau im Hinterhof trägt. Nur in einer anderen Farbe. Nicht weil mir die Farbe ihres Hemdes nicht gefällt, nein, sie gefällt mir sehr, erinnert mich an Brombeersaft. Aber wäre es nicht peinlich, wenn wir beide ein Leinenhemd in der gleichen Farbe trügen?
Die Wirkung des Weins hat nachgelassen. Aber nicht ganz, ein wenig spüre ich ihn noch. Vielleicht verlässt mich deshalb der Mut nicht ganz. Ich suche mir das schönste T-Shirt aus. Seine Farbe kommt der ihres Brombeersafthemdes sehr nahe, aber weil es ein T-Shirt ist, ist das in Ordnung. Ein Tisch ist noch frei, nicht weit von dem der Frau im Brombeerhemd. Aber das lässt sich von jedem Tisch im kleinen Mosaikhinterhof sagen. Ich bestelle eine Karaffe Rotwein, wie auch die Frau sie vor sich auf dem Tisch stehen hat. Nach dem zweiten Glas bin ich mutig genug, zu der Frau hinzusehen. Jetzt beneide ich sie um ihr glänzendes schwarzes Haar. Und ich schäme mich meines Haars, stumpf und unscheinbar braun und in letzter Zeit nur von mir selbst geschnitten, weil ich mir einen Friseurbesuch nicht mehr leisten konnte.