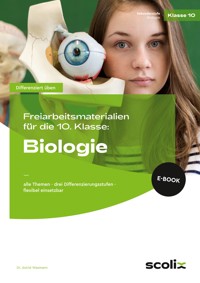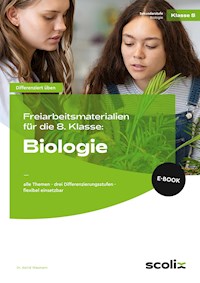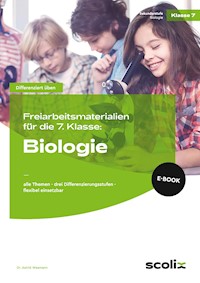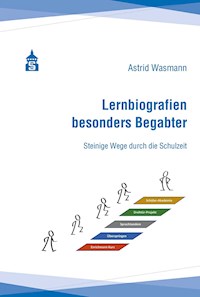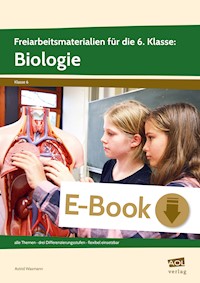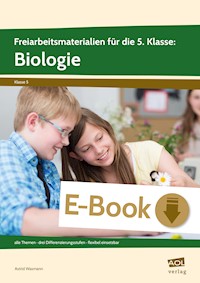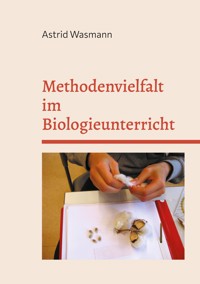
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch werden Unterrichtsmethoden beschrieben, die für den Biologieunterricht geeignet sind. Als erstes werden die Erkenntnismethoden, die ja einen Teil der Biologiewissenschaften abbilden, vorgestellt. Das sind Betrachten und Beobachten, Untersuchen, Experimentieren, Vergleichen und Modellieren. Sie sind aus dem Biologieunterricht nicht wegzudenken und auch in den Bildungsstandards gefordert. Als nächste Gruppe folgen allgemeine Unterrichtsmethoden wie Gruppenpuzzle, Concept Map und Mystery. Die dritte Gruppe der Methoden bildet größere Veränderungen des Unterrichts ab. Darunter fallen Projektunterricht und außerschulisches Lernen. Schließlich wird Lernen mit digitalen Medien beschrieben, was auch größere Umwälzungen hin zu individualisiertem Lernen ermöglicht. Das Buch Methodenvielfalt im Biologieunterricht ist besonders für Junglehrer und Junglehrerinnen gedacht, die erst einmal ein breites Spektrum an Methoden erarbeiten müssen, um zu den für sie geeigneten Methoden zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Erkenntnismethode – Beobachten
Erkenntnismethode - Untersuchen
Erkenntnismethode – Experimentieren
Erkenntnismethode – Vergleichen
Erkenntnismethode - Modellbildung
Gruppenarbeit
Methode - Gruppenpuzzle
Methode – Graf-Iz
Methode – Concept Map
Methode - Mindmapping
Methode – Mystery
Methode - Fischbowl
Methode – Lernen an Stationen
Methode - Projektunterricht
Lernen an außerschulischen Orten
Digitales Lernen
Individualisiertes Lernen
Literaturverzeichnis
Impressum
Einleitung
In diesem Buch wird eine Methodensammlung für den Biologieunterricht vorgestellt und gleich mit zahlreichen Beispielen hinterlegt. Will man einen spannenden, lernfördernden Biologieunterricht machen, ist es wichtig, ein breites Methodenspektrum zu kennen. Bei der Vorbereitung auf den Unterricht tauchen viele Fragen auf: Wie kann ich Schüler und Schülerinnen zum Lernen aktivieren? Wie kann ich den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler Rechnung tragen? Welche Formen des Übens und Sicherns bieten sich für die Lerngruppe an? Welche Sozialformen eignen sich, um bestimmte biologische Fragestellungen zu bearbeiten? Methoden sind wichtig für die Abwechslung beim Lernen. Sie können immer neu motivieren. Schülerinnen und Schüler sprechen auf unterschiedliche Unterrichtsmethoden an. Damit das Lernen für alle interessant bleibt, ist ein Mix verschiedener Methoden sinnvoll. Noch wichtiger ist aber die richtige Methode passend zum Lerninhalt zu finden, denn eine adäquate Methode unterstützt den Erwerb von neuem Wissen und geht damit über die reine Motivation hinaus. Während lehrerzentrierter Unterricht an alle Lernenden die gleichen Anforderungen stellt, bieten die hier vorgestellten Methoden Raum für Binnendifferenzierung und individualisiertes Lernen.
Bei der Auswahl sollte man eine Methode nicht nur um ihrer selbst willen wählen, sondern die Unterrichtsmethode, mit der am besten ein Thema verarbeitet werden kann. Also für eine Frage an die Natur ist das Experimentieren geeignet. An Modellen können sonst nicht wahrnehmbare Eigenschaften veranschaulicht werden. Will man Bewertungskompetenz vermitteln, muss man nicht die Methode Vergleichen einsetzen, sondern lieber ein Gruppenpuzzle oder ein Fishbowl. Für die Vermittlung von Artenkenntnis ist die Erkenntnismethode Beobachten geeignet und für das Ordnen von Tieren und Pflanzen bildet die Methode des Vergleichens die Basis. Also aus einem breiten Methodenrepertoire sollte man verschiedene auswählen können, und zwar genau die Methode, die am besten zu einem bestimmten Inhalt passt, denn es gibt zahlreiche Wechselwirkungen zwischen Inhalten und Methodik.
Bei der Auswahl der Methoden orientiert man sich an dem Ziel, die verschiedenen unterrichtlichen Herausforderungen so gut wie möglich abzudecken und die allgemeinen Methoden speziell auf die Biologie anzuwenden. Zuerst bespreche ich die Erkenntnismethoden:
Beobachten
Untersuchen
Experimentieren
Vergleichen
Modellieren.
Dies sind die Methoden, mit denen in der Forschung neue Erkenntnisse gewonnen werden. Ohne diese Methoden gäbe es wohl die meisten biologischen Erkenntnisse nicht. Der Biologieunterricht umfasst sowohl die Inhalte als auch die Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften. Um die
Erkenntnismethoden wirklich als Teil der Biologie abzubilden, ist ihre Vermittlung explizit in den Nationalen Bildungsstandards als Kompetenzbereich Erkenntnisgewinn neben Fachwissen und Bewertungskompetenz verankert. Sie sind als Kompetenzziele in Form von Bildungsstandards im Curriculum verankert und so überprüfbar. Insofern ist ein grundlegendes Ziel des Biologieunterrichts, dass Schülerinnen und Schüler Kompetenzen im Experimentieren und in den anderen Erkenntnismethoden erwerben, um Fachinhalte selbstständig aufzubauen und lebenslang naturwissenschaftlich lernen und denken zu können. Der Erwerb von Kompetenzen naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung ist ein zentrales Bildungsziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts, einschließlich der Biologie.
Im nächsten Abschnitt folgt eine Auswahl allgemeiner Unterrichtsmethoden, die in jedem Schulfach eingesetzt werden. An ihnen zeige ich auf, wie sie im Biologieunterricht lernwirksam eingesetzt werden können. Das sind:
Gruppenarbeit
Gruppenpuzzle
Graf-Iz
Concept Map
Mindmapping
Mystery
Fishbowl
Diese Methoden haben in allen Unterrichtsfächern ihren Platz. Ich habe hier Beispiele für ihren Einsatz im Biologieunterricht zusammengestellt, sozusagen aus der Praxis für die Praxis. So können die Lernenden mit einem Gruppenpuzzle große Informationsmengen, die zum Beispiel als Basis für eine Diskussion etwa über den Klimawandel notwendig sind, verarbeiten. Die Methode Graf-Iz dient dazu ein Thema übersichtlich zu strukturieren und zu präsentieren. Eine Concept Map sollte eingesetzt werden, um Zusammenhangswissen eines komplexen Themas zu visualisieren. Und ein Mystery, also ein rätselhafter Fall, regt Schüler und Schülerinnen an, auf die Suche nach der Wahrheit und nach Zusammenhängen zu gehen.
Das letzte Kapitel ist den Großformen des Unterrichtens gewidmet. Dabei geht es nicht nur um Unterrichtsöffnung in Bezug auf selbstgesteuertes Lernen, sondern auch um das Öffnen der Schule hin zu außerschulischen Lernorten. Schließlich wird digitales Lernen dargestellt, das das Unterrichten grundlegend verändert und in vielfältiger Weise eingesetzt werden kann. So kann es zum Homeschooling, in Freiarbeitsphasen, für Lerntheken oder für individualisiertes Lernen genutzt werden. Auch das individualisierte Üben durch interaktive Lernmaterialien wird durch digitale Medien ermöglicht:
Lernen an Stationen
Lernen in Projekten
Lernen an außerschulischen Orten
Digitales Lernen
Individualisiertes Lernen
Diese Unterrichtsformen können auf einer fortlaufenden Skala von lehrerzentriertem hin zum offenem Unterricht eingeordnet werden, hier in einer Grafik dargestellt:
Skala von Instruktion und Konstruktion
Instruktion ist ein anderes Wort für lehrerzentrierten Unterricht. Der Begriff meint die vom Lehrer ausgehende Steuerung und Strukturierung des Unterrichts. Auf der anderen Seite der Skala steht die Konstruktion. Darunter verstehen wir, dass Schüler und Schülerinnen selbst aktiv werden und neue Inhalte selbstständig erarbeiten. Nach Auffassung des Konstruktivismus bedeutet Lernen, dass jeder selbst Wissen konstruiert und es im eigenen Begriffsnetz verankert.
Lernen an Stationen ist der erste Schritt der Unterrichtsöffnung. Es ermöglicht selbstverantwortliches Lernen. Wochenplanarbeit öffnet zu weiterer Selbstständigkeit. Dabei üben Schüler und Schülerinnen insbesondere Zeitmanagement. Auch hier müssen bestimmte Themen meist mit Hilfe von Arbeitsblättern bearbeitet werden. In der Freiarbeit gibt es vorgegebene Zeiträume, in denen Schüler und Schülerinnen selbstständig an einem Thema lernen. Projektunterricht steht am Ende der Unterrichtsöffnung. In Projekten wird selbstgesteuert gearbeitet. Das geht einen Schritt über eigenverantwortliches Lernen hinaus. Schüler und
Schülerinnen müssen sich die Zeit in Freiarbeitsphasen und im Projektunterricht gut einteilen.
Für die immer häufiger an Schulen eingerichteten Freiarbeitszeiten ist das digitale Lernmaterial besonders geeignet. Damit verbunden ist eine immer stärkere Individualisierung des Lernens, was sich im Homeschooling, im Distanzlernen und ebenso im interaktiven Üben zeigt. Digitales Lernen eröffnet Unabhängigkeit vom Klassenraum. Schüler und Schülerinnen können zeit- und ortsunabhängig üben.
Ich habe zahlreiche Hinweise auf Praxisbeispiele einfließen lassen. Diese Praxisbeispiele befinden sich auf der Plattform Eduki (eduki.com)
Gutes Gelingen!
Erkenntnismethode – Beobachten
Beobachten ist neben Experimentieren und Vergleichen die wichtigste Methode zur Erkenntnisgewinnung in der Biologie. Zudem spielt sowohl beim Experimentieren als auch beim Vergleichen das Beobachten eine zentrale Rolle.
Betrachten. Die einfachste Arbeitsweise in der Biologie ist das Betrachten. Damit wird das Erscheinungsbild eines Naturobjekts erfasst, und zwar in Ruhe ohne Bewegung. Das Betrachten findet häufig in unteren Klassenstufen statt, etwa beim Bearbeiten des Skeletts oder eines Tiermodells wie beispielsweise das eines Karpfens. Schülerinnen und Schüler verarbeiten beim Betrachten bewusst Form, Aufbau und Zustand verschiedener Pflanzenorgane sowie verschiedener Pflanzenfamilien und Tiergruppen. Für das Bestimmen von Pflanzen und Tieren ist diese Erkenntnismethode die Basis.
Beobachten. Das Beobachten ist schon eine komplexere Arbeitsweise. Es umfasst Wahrnehmungen sowohl statischer als auch bewegter biologischer Objekte und geht damit über das reine Betrachten hinaus, denn auch Bewegungen werden erfasst. In den Naturwissenschaften versteht man darunter eine systematische Vorgehensweise, die die Wahrnehmung zeitlicher und räumlicher Veränderungen von Abläufen und Handlungen umfasst. Dabei kommen verschiedene Techniken zum Tragen: Betrachten, Beschreiben, Sammeln, Ordnen, Vergleichen und Messen. So kann zum Beispiel ein Auftrag darin bestehen, lebende Tiere zu beobachten. Dabei kommt es darauf an, dass mit dem Beobachtungsauftrag auch Kriterien genannt werden, nach denen beobachtet werden soll. Bei der Tierbeobachtung im Zoo steht deshalb als Anweisung nicht nur „Beobachte ein Tier.“, sondern eine große Zahl an Aspekten, unter denen die Schüler und Schülerinnen beobachten sollen, strukturiert die Beobachtungsprozesse der Schüler. Jeder Beobachtung liegt also ein Kriterium zu Grunde, nach dem entschieden wird, was beobachtet werden soll und was nicht, also ob die Schülerinnen und Schüler unter dem Kriterium Körpergröße, Ohren, Zähne, Beine oder doch Bewegungen beobachten sollen. Es ist sinnvoll, die Beobachtungen schriftlich festzuhalten. Dabei können auch eine Zeichnung oder ein Foto der Beobachtung angefertigt werden. Ein Beispiel für eine Bleistiftzeichnung betrifft den Zersetzungsvorgang, der von Sechstklässlern beobachtet werden sollte. Für diesen Versuchsansatz wurden Blätter und ein Filtrierpapier auf dunkle Erde gelegt. Die Schülergruppe, die dies angesetzt hat, protokollierte die Veränderungen 14 Tage lang. Auch eine Zeichnung kann ein Protokoll sein. Also zeichneten sie und, wie ich finde, ist es ihnen gelungen, die Entwicklung zeichnerisch darzustellen. Sie haben auch Daten dazu notiert, etwa wann das Filtrierpapier und das Blatt ganz verschwunden waren. Sie markierten es, indem sie ein Kreuz durch die Objekte machten und ein Datum dazu schrieben.
Zeichnung zu Versuchsbeginn
Zeichnung nach 14 Tagen
Gerade jüngere Schüler und Schülerinnen neigen dazu Beobachtung und Deutung zu vermengen. In Experimenten wird zunächst beobachtet, und zwar ganz ohne Werturteile. Danach erfolgt die Deutung. Im Biologieunterricht sollte großer Wert auf die Trennung der beiden Phasen gelegt werden.
Daher lautete mein Arbeitsauftrag: Zeichne hier die Lage der Blätter hinein und protokoliere genau jede Veränderung über einen längeren Zeitraum. Die vorgegebenen Kreise entsprechen den Petrischalen und dienen dazu, dass Schüler nicht irgendwie protokollieren, sondern dem Objekt angemessen.
Beobachtungen an lebenden Tieren motivieren Schülerinnen und Schüler in höchstem Maße. Jüngere Schüler und Schülerinnen überschlagen sich dabei in ihrem Eifer. Tierbeobachtungen sind aber kein Selbstgänger, denn es muss einiges beachtet werden. Man darf nicht mehr viele Tierarten zur Beobachtung freigeben, beispielsweise stehen alle Amphibien unter Naturschutz, alle Säuger und die meisten Wirbeltiere dürfen ebenfalls dem Schulstress nicht mehr ausgesetzt werden. Fischbeobachtungen im Aquarium sind noch möglich. Selbst die Rote Waldameise darf nicht mit in den Klassenraum genommen werden, da sie unter Naturschutz steht, es sei denn, die Naturschutzbehörde hat eine besondere Erlaubnis erteilt. Ich empfehle einen Unterrichtsgang nach draußen, um Insekten zu beobachten. Lässt man Schülerinnen und Schüler an bestimmten Pflanzen Insekten beobachten, erfassen sie gleich noch den Zusammenhang von artspezifischer Nutzung eines Habitats. Für ein solch gezieltes Beobachten ist eine hinführende Anleitung notwendig.
Beobachtung mit technischen Hilfsmitteln. Insekten sind wegen ihrer geringen Größe nicht leicht zu beobachten. Dafür ist der Einsatz einer Lupe notwendig. Dieses alte Biologen-Werkzeug wird in der Freilandbiologie immer zusammen mit Schnappdeckelgläsern mitgeführt. So können auch Blüten genau bestimmt werden oder etwa, wie die Behaarung an Stängeln und Blättern angeordnet ist. Auch das fasziniert Schülerinnen und Schüler und fördert genaues Hinschauen.
Für weitere Details kommt ein Binokular (= Stereolupe) in Frage. Es hat im Gegensatz zum Mikroskop zwei Okulare. Damit können auch jüngere Schülerinnen und Schüler umgehen, denn sie sehen dort die Naturobjekte dreidimensional. So erkennen Schüler und Schülerinnen die Sechseckigkeit der Facettenaugen, die Behaarung von Insektenbeinen oder die Öffnungen der Tracheen, die Stigmen. Ich habe für den Biologieunterricht regelmäßig tote Insekten gesammelt und sie mit in den Unterricht genommen. Sie stellen ein gutes Lernobjekt dar, um den Umgang von Beobachtungstools zu lernen, eine Beobachtungsschulung zu erhalten und Insekten selbstgesteuert kennenzulernen. Dabei stellt man fest, dass der Einsatz des Binokulars für den Biologieunterricht sehr motivierend ist.
Der Übergang zum Mikroskop ist dagegen schon schwieriger, denn es eröffnet sehr kleine Dimensionen, die zweidimensional zu sehen sind. Im Zentrum des Mikroskopierens steht die Zellebene. Zellen und Gewebe sind jüngeren Schülern und Schülerinnen fremd, da ihre Größe außerhalb des Auflösungsvermögens unserer Augen liegt. Folglich fällt es ihnen schwer, die Räumlichkeit der Zellen zu erkennen. Sie müssen sich dreidimensional vorstellen, was sie zweidimensional sehen, und das in einer für sie fremden Mikrowelt. Zudem sind die Präparate oft ziemlich farblos. Um dennoch gute Ergebnisse zu erzielen, sind zusätzliche Methoden wie Schneiden, Kontrastieren und Färben erforderlich. Lippenblütler eignen sich wegen ihrer Festigkeit besonders zum Schneiden. Es werden mehrere Schnitte angefertigt und auf einen Wassertropfen gelegt. Mit einem Deckgläschen darauf kann der Stängelquerschnitt mikroskopiert werden. Eine einfache Färbemethode besteht darin, das Objekt mit Methylenblau zu beträufeln. Das dient dem kontrastreichen Mikroskopieren. Beide Techniken ermöglichen das Sichtbarmachen von kleinsten Strukturen. Lässt man Schülerinnen und Schüler häufiger mikroskopieren, erwerben sie zunehmend Sicherheit im Umgang mit dem Mikroskop und den damit verbundenen Techniken. Die Beobachtung am Mikroskop wird am besten durch eine Bleistiftzeichnung festgehalten. Damit werden Schüler und Schülerinnen zum genauen Hinsehen angehalten. Nicht nur die Beobachtung statischer Zellen ist in der Schule möglich, sondern auch Vorgänge wie Plasmolyse können am Mikroskop in vivo beobachtet werden.
Leider wird in der Mittelstufe viel zu selten mikroskopiert. Oft benutzen Schüler und Schülerinnen genau einmal ein Mikroskop in der Mittelstufe, und zwar um eine Zwiebelhaut anzusehen. Dann passiert lange nichts und beim nächsten Mikroskopieren Jahre später haben sie die Handhabung schon wieder vergessen. Man sollte auch in der Mittelstufe möglichst häufig das Mikroskop nutzen. Es gibt genug Anlässe, beispielsweise Schweineblut, Lebergewebe, Pollen oder Torfmoos, Plasmolyse oder auch die Bodenstruktur, Pflanzenhaare und Stängel im Querschnitt. Durch die Beobachtung eines mikroskopischen Ausschnitts des Torfmooses beispielsweise verstehen Schülerinnen und Schüler besser, warum Hochmoor immer nass ist. Das liegt daran, dass die zarten Torfmoosblättchen in Chlorophyll tragende Zellen und Wasserleitungszellen aufgeteilt sind. Letztere nehmen ständig und automatisch Wasser kapillar auf.
Kompetenzerwerb im Beobachten. Zunächst findet Beobachtung eher zufällig und beiläufig statt. Der Beobachtungsvorgang ist kurz und ungenau. Unsystematisches Beobachten erfolgt interessengeleitet. Anfangs gehen Beobachtung und Deutung noch durcheinander und werden weniger planmäßig eingesetzt.
Kompetenzerwerb im Beobachten bedeutet, dass es ein planvoller, aktiver Erkenntnisprozess wird. Die Beobachtung steht unter einer biologischen Fragestellung und man folgt einem Beobachtungsplan. Schüler und Schülerinnen lernen zwischen Beobachtung und Deutung zu unterscheiden. Zudem müssen sie zwischen relevanten und unwichtigen Merkmalen differenzieren. Die Beobachtungen werden in einem Protokoll oder als Skizze festgehalten. Richtiges Beobachten stellt eine wichtige Teilkompetenz für das Experimentieren dar.
Erkenntnismethode - Untersuchen
Untersuchen ist das Beobachten unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln. Dabei greift der Lernende zielgerichtet in ein Objekt oder einen Naturvorgang ein und zerlegt beispielsweise das Objekt, um die inneren Zusammenhänge zu erforschen. Dies trifft auf biologische Objekte wie Blüten, Wurzeln, Stängel oder tote Insekten zu. Das Ziel des Untersuchens besteht darin, Strukturen und Zusammen-hänge zu erkennen. Für eine Untersuchung benutzt man meist Hilfsmittel wie Lupe, Mikroskop und Pinzette, aber auch Teststäbchen und Reagenzien zum Beispiel für Gewässer- und Bodenuntersuchungen.
Einfache Untersuchungen können Lernende an Blütenpflanzen vornehmen. Man erteilt den Auftrag: „Zerlege eine Blüte in seine Bestandteile und zähle, wieviel von jedem Teil vorhanden sind“ (Kelchblätter, Kronblätter, Staubblätter und Fruchtblätter). Man kann als Ergebnis einer Blütenuntersuchung ein Legebild erstellen lassen. Die Anleitung ist in Die Blüte auf der Plattform Eduki (eduki #245403) zu finden.
Auch Früchte und Samen lassen sich gut im Biologieunterricht untersuchen. Schüler und Schülerinnen entdecken dabei den inneren Aufbau. Schneidet man einen 24 Stunden in Wasser eingelegten Bohnensamen auf, erhält man zwei nährstoffreiche Bohnensamenhälften und eine kleine Keimwurzel wird sichtbar. So finden sie zum Beispiel heraus, dass im Bohnensamen schon der Keimling angelegt ist und wenn sie den Samen mit Lugol‘scher Lösung beträufeln, erkennen sie, dass der hauptsächliche Nährstoff im Samen Stärke ist.