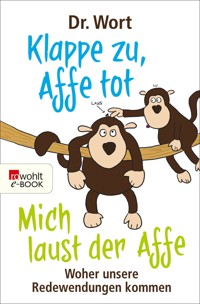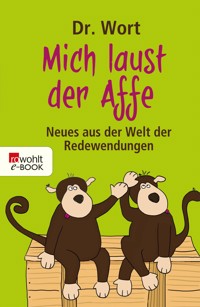
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Jeden Morgen erklärt Dr. Wort auf radio ffn Formulierungen und Ausdrücke, die wir täglich benutzen, deren Herkunft uns aber meist gänzlich unbekannt ist. Oder wussten Sie, dass die Redewendung «Das ist doch Jacke wie Hose» für «Das ist doch gleich» vor rund 400 Jahren von Schneidern geprägt wurde, als es schick wurde, Jacken und Hosen aus dem gleichen Stoff zu tragen? Über 200 neue Hörerfragen hat Dr. Wort wieder gesammelt und erläutert in seinem neuen Buch nicht nur Redewendungen, sondern auch regionale Formulierungen und etymologische Herleitungen von Wörtern – von «anschwärzen» bis «zappenduster».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Dr. Wort
Mich laust der Affe
Neues aus der Welt der Redewendungen
Über dieses Buch
Jeden Morgen erklärt Dr. Wort auf radio ffn Formulierungen und Ausdrücke, die wir täglich benutzen, deren Herkunft uns aber meist gänzlich unbekannt ist. Oder wussten Sie, dass die Redewendung «Das ist doch Jacke wie Hose» für «Das ist doch gleich» vor rund 400 Jahren von Schneidern geprägt wurde, als es chic wurde, Jacken und Hosen aus dem gleichen Stoff zu tragen?
Über 200 neue Hörerfragen hat Dr. Wort wieder gesammelt und erläutert in seinem neuen Buch nicht nur Redewendungen, sondern auch regionale Formulierungen und etymologische Herleitungen von Wörtern – von «anschwärzen» bis «zappenduster».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Ana González y Fandiño
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
(Umschlagabbildung: © FinePic, München)
ISBN 978-3-644-45561-0
Anmerkung: Die Seitenangaben im Text beziehen sich auf die Seitenzahlen der Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
A
Abergläubisch sein
Es auf jemanden oder etwas abgesehen haben
Etwas abstauben
Etwas abkupfern
Durch Abwesenheit glänzen
Ich glaub, mich laust der Affe
Allerhand
Kurz angebunden sein
Jemandem etwas anhängen
Jemanden anhimmeln
Jemanden anschwärzen
Etwas aus dem Ärmel schütteln
Armleuchter
Der Arsch geht auf Grundeis
Asche auf mein Haupt
Aufhebens machen
Etwas auseinanderklamüsern
Etwas ausgefressen haben
Mit dem Auto liegenbleiben
B
Bammel vor etwas haben
Bananenrepublik
Da steppt der Bär
In Bausch und Bogen
Bescheuert sein
Sich einen hinter die Binde gießen
Binsenweisheit
Ach du liebes bisschen!
Blaues Blut
Bohei machen
Böhmische Dörfer
Dreimal ist Bremer Recht
Volles Brett
Blauer Brief
Bulle
Bullenhitze
D
Deadline
Jemandem einen Denkzettel verpassen
Nicht ganz dicht sein
Dito oder dto.
Auf den letzten Drücker
Dulli
E
Jemanden um die Ecke bringen
Du Eierloch
Eigenbrötler
Jemandem etwas einbrocken
Jemanden einbuchten
Eingefleischt sein
Es geht ans Eingemachte
Etwas ergattern
Erlkönig
F
Nicht lange fackeln
Roter Faden
Sein Fett wegbekommen oder -kriegen
Jemanden feuern
Floskel
Flöten gehen
Auf großem Fuß leben
Stehenden Fußes
Kalte Füße bekommen
G
Gang und gäbe
Jemandem den Garaus machen
Geil
Der Gelackmeierte sein
(Gut) gewappnet sein
Dran glauben müssen
Ach du liebe Güte
H
«Hamburger Sie», «Münchener du» und «Berliner wir»
Jemanden sticht der Hafer
Alter Hase
Wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt
Wissen, wie der Hase läuft
Hasenbrot
Hedwig
Keinen Hehl aus etwas machen
Im siebten Himmel sein
Hopfen und Malz sind verloren
Holland in Not
Hosenstall
Hundemüde sein
Dicker Hund
Vom Hundertsten ins Tausendste kommen
Jacke wie Hose
K
Kaffeekränzchen
Kantersieg
Etwas auf die eigene Kappe nehmen
Mit Karacho
Karriere
Alles Käse
Für die Katz
Es regnet Katzen und Hunde
Katzenwäsche
Katzentisch
Kaventsmann
Kiez
Kiosk
Kladderadatsch
Klipp und klar
Klein beigeben
Kohldampf haben
Köter und Töle
Etwas kriegen
Krökeln
Kulturbeutel oder Kulturtasche
Die Kurve kratzen
L
Vom Leder ziehen
Jemanden hinters Licht führen
Litfaßsäule
Lügen, dass sich die Balken biegen
Spitz wie (Nachbars) Lumpi sein
Sich nicht lumpen lassen
M
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
Mahlzeit
Manschetten haben
Eine Marotte haben
Strammer Max
Von hier bis nach Meppen
In rauen Mengen
Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen
Etwas mopsen
Muffensausen haben
N
Einen Narren an jemandem gefressen haben
Nagelneu oder nigelnagelneu
Immer der Nase nach
Not am Mann
Auf Nummer sicher gehen
Dumme Nuss
O/P/Q
Okay
Über den großen Onkel gehen
Pantoffelheld
Paparazzi
Jemandem oder etwas Paroli bieten
Passen müssen
Ein Pechvogel sein
Pesen
Jemandem den Schwarzen Peter zuschieben
Etwas in petto haben
Etwas auf der Pfanne haben
Mit jemandem Pferde stehlen können
Pi mal Daumen
Pingelig sein
Plätzchen und Kekse
Pomadig sein
Um den Pudding gehen
Ein Quäntchen Glück
Aus dem Quark kommen
Quitt sein
R/S
Rabeneltern
Von der Rolle sein
Jemandem in den Rücken fallen
Saftladen
Satansbraten
Sauer macht lustig
Schabracke
Sich scheckig lachen
Scherereien haben
Jemanden auf die Schippe nehmen
Schlawiner
Schlitzohr
Jemandem ein Schnippchen schlagen
Wie am Schnürchen
So wird ein Schuh draus
Jemandem die kalte Schulter zeigen
Schwein gehabt
Spam-Mail
Etwas spitzkriegen
Spitzname
Einen Spleen haben
Splitternackt
Jemandem fällt ein Stein vom Herzen
Eine Standpauke halten
Jemanden im Stich lassen
Jemanden zur Strecke bringen
Jemandem eine Strafe aufbrummen
Sündenbock
T
Mit jemandem Tacheles reden
Iss deinen Teller leer, dann gibt’s morgen schönes Wetter
Terz machen
Scher dich zum Teufel
Auf Teufel komm raus
Toi, toi, toi
In der Tinte sitzen oder stecken
Tschüs oder Tschüss
In trockenen Tüchern sein
V
Vaterland und Muttersprache
Jemanden veräppeln
Etwas verballhornen
Sich verfranzen
Jemanden verhohnepipeln
Verschollen sein
In der Versenkung verschwinden
Etwas auf Vordermann bringen
W
Schmutzige Wäsche waschen
Mit allen Wassern gewaschen sein
Jemandem auf den Wecker gehen
Von wegen
Auf einer Wellenlänge sein oder liegen
Die Werbetrommel rühren
Wikipedia
Etwas in den Wind schlagen
Durch den Wind sein
Windjammer
Witzbold
Sich einen Wolf laufen
X/Z
Jemandem ein X für ein U vormachen
Zappenduster
Literatur
Vorwort
Seit Februar 2009 beantwortet Dr. Wort bei radio ffn täglich Fragen zur Herkunft deutscher Redewendungen, Formulierungen und Wörter. Im September 2010 erschien das Buch Klappe zu, Affe tot mit Antworten auf die 200 am häufigsten gestellten Fragen und hielt sich monatelang in den deutschen Bestsellerlisten.
Das Interesse an dieser Thematik ist bis heute ungebrochen, und so kam es zu den nächsten 200 Erklärungen. Alle eingesandten Fragen stammen von unseren Hörern, wurden also nicht von Redakteuren oder nach einem theoretischen oder didaktischen Konzept zusammengebastelt.
Auf diese Weise kam eine bunte Vielfalt an Fragen zusammen, bei der auch in dieser Auswahl ganz bewusst nicht streng zwischen Redewendungen, regionalen Formulierungen und etymologischen Herleitungen von Wörtern unterschieden wurde.
Zwei Tatsachen sollen in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben: Oft haben Eltern Fragen ihrer Kinder gemailt, und viele Menschen mit Migrationshintergrund haben um Erläuterungen sprachlicher Phänomene gebeten. Auch aus diesen Gründen wird in diesem Band wieder jeder Redewendung zunächst eine kurze Erklärung der Bedeutung vorangestellt, bevor die eigentliche Herleitung erfolgt.
Wie schon beim ersten Buch gab es Fragen, die Dr. Wort nur mit linguistischer Akribie und etymologischem Spürsinn klären konnte, andere ließen sich hingegen schnell beantworten. Sie werden allerdings immer wieder gestellt, ganz einfach weil nicht jeder radio-ffn-Hörer an jedem Morgen die Sendung verfolgen kann. Hierzu zählen unter anderem die Redewendungen «Das ist doch Jacke wie Hose» sowie «Mich laust der Affe», dem der vorliegende zweite Band seinen Titel verdankt.
Für viele Redewendungen gibt es zwei oder mehr Herleitungen, in solchen Fällen wird hier im Allgemeinen die in der Fachliteratur am häufigsten genannte und plausibelste beschrieben, in einigen Fällen wurden aber auch «konkurrierende» Erklärungen einander gegenübergestellt.
Es ist immer wieder faszinierend und überraschend, zu erfahren, wie viele der Redewendungen, die wir tagtäglich benutzen, uralte Wurzeln haben. Sie sind vor Jahrhunderten entstanden, und die Welt, aus der sie kommen, ist längst untergegangen, doch in unserer Alltagssprache haben sie überlebt.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Stöbern in dieser neuen Sammlung!
Ihr Dr. Wort
A
Abergläubisch sein
Abergläubische Menschen verhalten sich irrational: Sie gehen zum Beispiel nicht unter angelehnten Leitern durch, haben Angst vor schwarzen Katzen oder fürchten sich unter anderem vor der Zahl «13».
Das Wort «aber» verwenden wir heute, wenn wir einer Aussage nicht zustimmen und Einwände dagegen haben. Aber – da war’s schon wieder – im Mittelalter bedeutete das Wort «aber» noch viel mehr, nämlich auch «nach etwas», «hinter etwas» oder auch «Gegenteil von etwas». Und in dieser Zeit ist der Begriff Aberglaube entstanden – es war ein Glaube, der nach dem echten Glauben kam, der hinter ihm steckte, der eigentlich das Gegenteil vom wirklichen Glauben war.
Es auf jemanden oder etwas abgesehen haben
Diese Redewendung hat kurioserweise mehrere, sich teils widersprechende Bedeutungen. Im Hinblick auf Personen heißt sie entweder, dass man jemanden ständig schikaniert und drangsaliert, oder aber, dass man jemanden begehrt und scharf auf ihn ist. In Bezug auf Dinge kann sie bedeuten, dass man etwas unbedingt haben oder erreichen will.
Wenn wir etwas vorhaben, dann verfolgen wir eine bestimmte Absicht, wir «haben es auf etwas abgesehen». Die Absicht bezeichnete ursprünglich das Visier eines Gewehrs, also eine Zielvorrichtung wie etwa Kimme und Korn. Wenn man jemanden damit anpeilte, dann hatte man ihn «in Absicht», also im Visier.
Heute ist diese ursprüngliche Bedeutung aus der Waffentechnik längst in Vergessenheit geraten, und wir gebrauchen die Redewendung häufig und in allen möglichen Zusammenhängen. Man kann sogar «von etwas absehen», also etwas nicht tun. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Richter von einer Bestrafung absieht. Damit legt er das imaginäre Gewehr zur Seite und verschont den Angeklagten, er hat es nicht länger auf ihn abgesehen.
Etwas abstauben
Wenn man etwas «abgestaubt» hat, dann ist unter Umständen die Rede davon, dass man irgendeinen Gegenstand von Staub befreit hat. Wesentlich häufiger ist mit dieser Redewendung allerdings gemeint, dass man etwas sehr günstig erworben, erbettelt, vielleicht sogar gestohlen hat.
Die Redensart stammt höchstwahrscheinlich aus dem traditionellen Müllerhandwerk, und zwar aus den Zeiten, als die Bauern ihr Getreide zu einer Mühle brachten, um es zu Mehl mahlen zu lassen. Es muss wohl etliche nicht ganz ehrliche Müller gegeben haben, die einen Teil des entstandenen Getreidepulvers für sich abgezweigt und nicht in die Säcke der Bauern abgefüllt haben. Diese Gauner haben die Bauern übervorteilt und etwas für sich selbst «abgestaubt».
Etwas abkupfern
Wenn etwas «abgekupfert» ist, dann ist es ein Plagiat, eine Fälschung oder eine illegale Kopie.
Diese Redewendung geht auf den Beruf der Kupferstecher zurück. Das waren Kunsthandwerker, die vor allem vom 15. bis ins frühe 19. Jahrhundert in Malerwerkstätten Gemälde kopiert oder druckfähig gemacht haben. Diese Tätigkeit verlangte großes handwerkliches Können und war für Außenstehende in ihrer Ausführung nicht ohne weiteres nachvollziehbar.
Besonders weil diese Kupferstecher theoretisch auch Papiergeld fälschen konnten, schlugen ihnen oft Misstrauen und Geringschätzung entgegen. Aus dieser Zeit stammt auch die spöttische Anrede «Mein lieber Freund und Kupferstecher».
Durch Abwesenheit glänzen
Die Redewendung ist eine ironische Kritik an jemandem, der eigentlich anwesend sein sollte, aber nicht erschienen ist.
Die Wurzeln dieser Formulierung liegen im antiken Rom: Hier war es Brauch, dass die Familienangehörigen eines Verstorbenen bei der Beerdigung den Trauerzug anführten und dabei Bilder der gemeinsamen Vorfahren vor sich hertrugen. Der im 19. Jahrhundert überaus beliebte französische Dramatiker Marie-Joseph Chénier hat die Formulierung von den auf diesen Bildern gerade durch ihre Abwesenheit glänzenden Ahnen dann in einem seiner Stücke verwendet, woraufhin sie recht schnell an Popularität gewann.
Ein weiterer Beleg findet sich beim römischen Geschichtsschreiber Tacitus: Bei der Beerdigung von Brutus’ Schwester Julia fehlten sowohl Brutus als auch Cassius (Gemahl der Julia), da sie sich als Mörder Caesars nicht blicken lassen konnten. In einer Quelle von Tacitus heißt es: «Aber Cassius und Brutus leuchteten gerade dadurch hervor, dass ihre Bilder nicht zu sehen waren.»
Ich glaub, mich laust der Affe
Diese Redewendung ist ein Ausdruck der Verblüffung und der Überraschung. Sie ist verwandt mit ähnlichen Formulierungen, in denen unmögliches oder zumindest extrem unwahrscheinliches Verhalten von Tieren vorkommt. (Vgl. Dr. Wort, Klappe zu, Affe tot, S. 165)
Jeder Zoobesucher kennt das gesellige Verhalten von Affen, die gegenseitige Fellpflege betreiben, indem sie abgestorbene Hautschuppen entfernen und häufig auch Salzkristalle knabbern, die sie im Fell des anderen gefunden haben. Läuse spielen bei diesen sozialen Ritualen im Übrigen kaum eine Rolle.
Schon vor Jahrhunderten haben Menschen in Deutschland dieses Ritual beobachten können, zum Beispiel bei den Affen umherziehender Schausteller oder auf Jahrmärkten. Es mag sein, dass der eine oder andere Affe auch mal einen der Zuschauer durch «Lausen» verwöhnt hat, aber auch wenn nicht, war es zumindest eine ungewöhnliche und bizarre Ansicht, und so ist die Redewendung in die Alltagssprache eingegangen und bis heute weit verbreitet.
Allerhand
«Das ist ja allerhand!», ruft man aus, wenn man seine Entrüstung über ein Verhalten oder einen Vorgang ausdrücken möchte, den man missbilligt. In einer zweiten Bedeutung wird das Wort «allerhand» auch als unbestimmtes Zahlwort benutzt, das eine Ansammlung verschiedener Dinge bezeichnet, so zum Beispiel: Auf dem Tisch lag allerhand Werkzeug herum.
Schon im 16. Jahrhundert ist eine Formulierung üblich gewesen, mit der man verschiedene Dinge unterschiedlicher Herkunft zusammengefasst hat: «Diese Dinge sind aller hande.» Damit wurde ausgedrückt, dass diese Dinge aus allerlei verschiedenen Händen stammten. Dieses «aller hande» ist dann später zusammengezogen worden zu dem uns heute geläufigen «allerhand». Und auch wir benutzen das Wort «allerhand» nicht, wenn zum Beispiel 20 völlig identische Tassen auf dem Tisch stehen, allerhand Tassen sind das nur, wenn es sich um ein buntes Durcheinander handelt.
Ganz ähnlich verhält es sich mit dem entrüsteten Ausruf «Das ist ja allerhand!». Hier hat jemand nicht nur etwas Unerhörtes getan, sondern sich gleich eine ganze Reihe verschiedener Frechheiten geleistet, quasi einen bunten Strauß an Unverschämtheiten.
Kurz angebunden sein
«Kurz angebunden» ist man, wenn man sich mürrisch, abweisend und unfreundlich verhält und im Gespräch nur das Allernötigste von sich gibt.
Schon Martin Luther hat diese Redewendung gebraucht, und sie ist auch heute noch üblich. Sie geht höchstwahrscheinlich zurück auf die früher weit verbreiteten Hofhunde der Bauern, die in der Regel relativ kurz angebunden oder angekettet wurden. Und solche Hunde reagieren besonders aggressiv und wütend auf Eindringlinge und sind in der Tat oft gefährlich und bissig.
Zwar nicht bissig, aber zumindest unfreundlich verhalten sich auch Menschen, die kurz angebunden sind.
Jemandem etwas anhängen
Wenn man jemandem «etwas anhängen» will, dann erzählt man Schlechtes über ihn, betreibt üble Nachrede oder bezichtigt ihn zu Unrecht.
Die Redewendung geht zurück auf den früheren Brauch, Straftätern Zettel anzuhängen, auf denen ihre Vergehen zu lesen waren. Zusätzlich oder anstelle dessen wurden auch oft Gegenstände benutzt, die symbolisch das Delikt darstellten, so zum Beispiel bei einem Dieb der gestohlene Gegenstand, bei Säufern eine Flasche und bei bösartigen Frauen ein Besen (als Anspielung auf einen Hexenbesen).
Noch vor wenigen Jahrzehnten machten die Nazis gern und häufig Gebrauch von diesem entwürdigenden Ritual des Anhängens – sozusagen als Revival finsterer Zeiten –, wenn im Zuge der Judenverfolgung Menschen mit entsprechenden diffamierenden Schildern behängt wurden.
Jemanden anhimmeln
Wer jemanden «anhimmelt», der schwärmt heftig für diese Person, verehrt sie in übertriebener Weise, ist quasi ein Extremfan.
Man könnte meinen, die Redewendung kommt daher, dass man zu einem Menschen aufschaut, also in Richtung Himmel. Das ist auch nicht ganz falsch, aber die Formulierung hat noch einen tieferen, religiösen Ursprung.
Gläubige Christen, denen daran gelegen ist, die Zehn Gebote genau zu befolgen, dürfen den Namen Gottes nicht achtlos oder missbräuchlich benutzen. Und so war es ihnen zumindest früher nicht möglich, davon zu sprechen, dass jemand einen anderen Menschen so sehr verehrt, dass er ihn sprichwörtlich vergöttert. Jetzt kam der Himmel ins Spiel, und zwar als sogenanntes Hüllwort, von Fachleuten auch Euphemismus genannt. Man hat das Tabuwort «Gott» kurzerhand durch den Himmel ersetzt, und statt jemanden zu vergöttern, hat man ihn einfach angehimmelt.
Jemanden anschwärzen
Wenn man jemanden verpetzt, verrät, verleumdet oder schlecht macht, dann «schwärzt man ihn an», zum Beispiel beim Chef oder beim Lehrer.
Die Farbe Schwarz steht im westlichen Kulturkreis für ganz gegensätzliche Dinge. Einerseits ist es die Farbe der Würde und der Feierlichkeit – man denke nur an die schwarzen Limousinen der Politiker –, andererseits ist Schwarz aber auch die Farbe des Todes, der Trauer und des Teufels. Darüber hinaus bezeichnet «Schwarz» im alltäglichen Sprachgebrauch verbotene Tätigkeiten, zum Beispiel Schwarzarbeiten, Schwarzfahren oder Schwarzbrennen, die illegale Alkoholherstellung.
Beim Anschwärzen geht es eindeutig um genau diese negativen Aspekte. Die Redewendung existiert in vielen Sprachen und ist hervorgegangen aus den Formulierungen «jemanden schwarz machen» oder «jemanden schwarz malen». Da schwingt jemand bildhaft einen großen Pinsel mit schwarzer Farbe und malt sein Opfer an, bis es für alle sichtbar so richtig angeschwärzt ist.
Etwas aus dem Ärmel schütteln
Wer etwas «aus dem Ärmel schüttelt», dem fällt eine Aufgabe leicht. Er kann sie ohne Mühe erledigen, spielerisch und anscheinend unvorbereitet.
Die Kleidung im späten Mittelalter war in der Regel sehr weit geschnitten, und das galt auch für die Ärmel. Man konnte sie als Taschen benutzen, zum Beispiel für Geld, Papiere und andere kleinere Dinge.