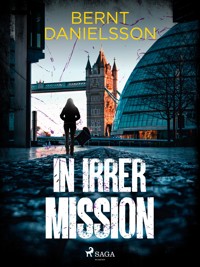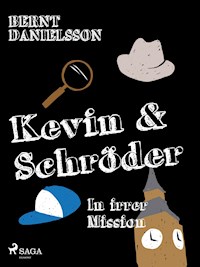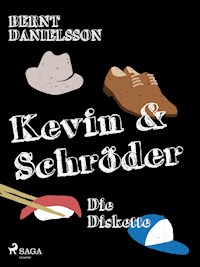Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der 16-jährige Thomas genießt seine Ferien. Den Urlaub verbringt er zum ersten Mal alleine im Sommerhaus. Dann lernt er Michelle kennen, eine junge Fotografin. An einem langen Abend mit gutem Essen und tollen Gesprächen verliebt sich Thomas Hals über Kopf in die Unbekannte. Auch in seinem Leben soll sich einiges ändern. Zum ersten Mal schmiedet er soetwas wie Zukunftspläne: Nein, ein Spießer wie seine Eltern möchte er auf keinen Fall werden. Viel lieber möchte er ein Leben wie Michelle führen: unabhängig und frei. Doch wer ist Michelle? Thomas beschließt ihr bei einigen Aufgaben zu helfen und merkt erst viel später, dass er damit etwas Kriminelles tut. Sein Traum entwickelt sich für ihn zum Albtraum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernt Danielsson
Michelle
Aus dem Schwedischenvon Birgitta Kicherer
Saga
Natürlich wird mir wieder mal kein Schwein glauben. Alle werden nur herablassend grinsen, als würden sie einem Gehirnamputierten zuhören.
Wenn meine Mutter zufällig guter Laune ist, wird sie vielleicht den Kopf schütteln und sagen:
„Ach ja, ich sag’s ja, was du dir immer alles ausdenkst.“
Wenn sie dagegen mieser Laune ist und wieder mal ‚Migräne‘ gehabt hat, wird sie den Kopf schütteln, die Augenbrauen runzeln, mich bekümmert angucken und seufzen:
„Mußt du denn immer wieder so abscheulich lügen? Ehrlich währt am längsten, das weißt du doch!“
Beim Big Boß ist es egal, wie er aufgelegt ist, er wird sich sowieso bloß die Bartstoppeln kraulen und grunzen:
„Hör doch mit dieser verdammten Schwindelei auf!“
Von Cammis Reaktion gar nicht zu reden...
Aber okay – wenn ich ehrlich sein soll, es stimmt schon, daß ich früher manchmal ein bißchen dick aufgetragen hab.
Als ich klein war, hieß es immer: „Der Junge hat ja so eine lebhafte Phantasie“, und dann legten alle den Kopf schief und lächelten mich an.
Als ich älter wurde, bekam ich zu hören, ich solle mir nicht so viel ausdenken. Und gleichzeitig hörten sie auf, mich anzulächeln.
Dann als Teenager war keine Rede mehr von ‚Phantasien‘ oder ‚Einfällen‘. O nein, ab da waren es schlicht und einfach Lügen.
Und dabei ist es geblieben.
Wenn ich ehrlich sein soll, hab ich immer noch nicht so recht kapiert, was zwischen einer ‚Lüge‘ und einem ‚Einfall‘ für ein Unterschied sein soll. Und überhaupt – was ist ‚Wahrheit‘ eigentlich? Und wann wird ‚lebhafte Phantasie‘ zur Lüge?
Aber, es stimmt schon – ich hab tatsächlich so einiges zusammengeflunkert. Und da sind manche Leute ziemlich sauer geworden. In Zukunft wird sich das wohl ändern...
Seit dem letzten Sommer... seit Michelle...
Glaube ich wenigstens.
Also, ich meine, wer weiß – vielleicht fange ich jetzt erst an, wie wild zu lügen, zu phantasieren und mir Sachen auszudenken, gerade wegen Michelle (oder wie sie eigentlich hieß – oder heißt).
Ich weiß nicht.
So was kann man nie genau wissen.
Mittsommer
Wenn das hier ein Film wäre, würde er so anfangen:
Der Zuschauerraum wird dunkel, der Vorhang geht hoch – die Kamera fegt über spiegelblankes Wasser. Ein früher Sommermorgen – das sieht man an den Farben, am Licht. Die Kamera ist vorn an der Schnauze eines Hubschraubers anmontiert (aber das sieht man natürlich nicht), der auf die Schären nördlich von Stockholm zuhält.
Die Musik setzt sofort ein: ein stampfender Baß, von spröden, glockenähnlichen Synthiklängen umspielt. Dann ein kurzer, prägnanter Akkord auf einem anderen Synthi, ein Streicherklang – und der Vorspann beginnt mit großen roten Buchstaben.
Die Wasseroberfläche wird immer mehr von einer stillen Brise gekräuselt, die landeinwärts streicht. Kleine Felseninseln tauchen auf und flitzen rasch am Betrachter vorbei. Nach und nach wachsen sie und werden zu richtigen Inseln, grüne Bäume und Büsche tauchen auf und Häuser, kleine Bootshäuser an morschen alten Stegen und prächtige, frischrenovierte Jugendstilvillen.
Vor einem kleinen rotgestrichenen Sommerhaus mit weißen Ecken sitzt eine Familie und frühstückt neben einer Fahnenstange, auf der die schwedische Fahne in der Brise flattert.
Die Filmmusik legt jetzt richtig los, farbenprächtige Synthiteppiche werden ausgerollt, und im Vordergrund röhrt ein Altsaxophon.
Die Kamera gleitet in eine weite, offene Bucht hinaus. Ganz hinten erhebt sich eine bewaldete Felswand steil aus dem Wasser. Mitten in dem dunklen Grün leuchtet ein hellbraunes Rechteck.
Als das Kameraauge sich nähert, entpuppt sich das Rechteck als ein Holzhaus, das hoch oben auf dem Felsen liegt. Das Haus wird immer größer und bleibt im Mittelpunkt der Leinwand.
Jetzt entdeckt der Zuschauer eine Veranda, die an der ganzen Vorderseite entlangläuft. Die Veranda ist leer, und man kann durch die großen Fensterfronten direkt in ein Zimmer reinschauen.
Im selben Augenblick, als der Zuschauer bereits damit rechnet, daß die Kamera gleich durchs Fenster kracht, steigt der Hubschrauber geschmeidig in die Höhe und streicht dicht über die roten Dachziegel hinweg.
Auf der Rückseite des Hauses wird er langsamer und senkt sich über einen großen Garten. Der Garten ist voller grünschimmernder Büsche, Apfelbäume und Birken, links steht ein üppiger Goldregen mit knallgelben Blütentrauben. Direkt dahinter leuchtet ein riesiger, blauvioletter Rhododendronbusch auf. Die Sonne scheint hinter der Hausecke hervor und durchleuchtet die tausend zarten Blätter einer Fliederhecke. Die schräg fallenden Sonnenstrahlen werfen Schatten auf den Rasen. Der Hubschrauber landet. Die Kamera folgt einer Treppe aus Schieferplatten vom Haus zu einer rotgestrichenen Garage runter. Ein fast zugewachsener Weg führt vom unteren Ende der Garage auf eine größere asphaltierte Straße hinaus.
In diesem Moment endet der Vorspann. Der Name des Regisseurs verschwindet, und die Musik verklingt, während gleichzeitig sämtliche Geräusche des Sommervormittags hörbar werden:
Die schwache Brise tuschelt in Millionen von Blättern, aus allen Richtungen dringt Vogelgezwitscher, heisere Meisenjungen piepsen pausenlos nach Futter und stressen ihre Eltern, die im Pendelverkehr unterwegs sind, aus der Ferne hört man Möwen kreischen, ebenso das Schnaufen eines Schärendampfers, das dann von einem vorbeibrüllenden Motorboot übertönt wird.
Die Kamera verharrt auf dem zugewachsenen kurzen Weg vor der Garagentür.
Dann ist ein Automotor zu hören, zuerst schwach aus dem linken Lautsprecher, er wird immer lauter, und gleich darauf biegt ein weißer Audi 100 CC Kombi ins Bild und bremst heftig vor den Garagentoren.
Der Motor verstummt.
Die Autofenster sind dunkel, und es ist unmöglich, die Personen im Auto zu erkennen, doch da – die Vordertür an der Fahrerseite geht auf, und ein untersetzter Mann steigt aus. Er blinzelt in den starken Sonnenschein und setzt eine Sonnenbrille auf. Er ist ziemlich kurz geraten und kräftig gebaut (um es freundlich auszudrücken), hat Bartstoppeln und trägt ein unglaublich scheußliches kurzärmeliges Hemd.
Das ist mein alter Herr.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wie alt er ist, so um die Fünfzig, glaube ich. Im Urlaub weigert er sich, sich zu rasieren, und heute hat er Urlaub. Sonst arbeitet er in einer kleinen Firma, die irgendwas mit Computern zu tun hat.
Jetzt steht er da und scheint nicht so recht zu wissen, was er tun soll. Da ihm offensichtlich nichts einfällt, legt er seine behaarten Unterarme aufs Autodach und tut erst mal nichts.
Dann geht die Beifahrertür auf, und meine Mutter steigt aus. Sie ist ein paar Jahre jünger als mein Vater und auch nicht sehr groß, aber immerhin ein paar Zentimeter länger als er. Sie sieht ein bißchen tantig aus, allerdings wie eine ziemlich frischgebackene Tante, sie ist nämlich immer noch recht schlank und straff, was wohl daher kommt, daß sie immer so nervös ist, praktisch also aus purer Nervosität abnimmt.
Früher war sie Lehrerin, aber seit wir vor ein, zwei Jahren in unser Reihenhaus gezogen sind, arbeitet sie als Studienberaterin, und das bedeutet, daß sie meistens daheim hockt und auf einem unserer vierzehn Computer herumspielt. Aber ich muß ehrlich zugeben – eigentlich hab ich keinen blassen Schimmer, was sie treibt.
„Ach! Ist das ein herrliches Mittsommerwetter!“ ruft sie mit einem leicht übertriebenen Seufzer aus, holt tief Luft und läßt die Nasenflügel beben. Mit anderen Worten, sie klingt genau wie eine typische Mutter.
Mein Vater sagt nichts, trommelt nur einen kurzen Wirbel aufs Autodach und grunzt dazu.
Mit anderen Worten, er klingt genau wie ein typischer Vater.
Dann geht die hintere Tür auf der Seite meiner Mutter auf, und eine vierzehnjährige Puppe klettert raus, mit wilden, langen Haaren, die frisch blondgefärbt und absichtlich zerzaust sind. Mitten ins Haargestrüpp hat sie natürlich eine Sonnenbrille gepflanzt – wie es sich gehört.
Sie hat hautenge weiße Jeans an, die mitten am Schienbein aufhören, dazu knallrote Wildlederpumps mit hohen Absätzen. Ein sehr knappes gelbes T-Shirt schmiegt sich an ihren Oberkörper. Man kann ohne Übertreibung behaupten, daß sie echt scharf aussieht, um nicht zu sagen ziemlich ordinär (wie Omi bei unserer Abfahrt bemerkte).
Sie sieht sehr viel älter aus als vierzehn – ich würde achtzehn schätzen, aber wenn es darum geht, Leute einzuschätzen, bin ich eine echte Niete. Vor allem, wenn es darum geht, das Alter von Mädchen zu erraten, liege ich immer total falsch – und wenn sie außerdem geschminkt sind, ist es sowieso völlig unmöglich, und geschminkt ist Cammi ja immer.
Dieses leckere Stück ist meine Schwester und heißt eigentlich Camilla.
Körperlich gesehen ist im letzten Jahr einiges mit Cammi passiert – zur größten Verzweiflung meiner alten Herrschaften. Daß sie außerdem dafür sorgt, alles vorzuführen, was mit ihr passiert ist, und tatsächlich echt gut aussieht, macht die Sache nicht gerade besser.
Sie ist genauso groß wie meine Mutter, aber damit hören auch sämtliche Ähnlichkeiten auf, sowohl die inneren als auch die äußeren.
Und dann:
Täterätätätää!!!
Die Autotür numero vier geht auf, und aus dem Auto steigt ‚The Tall Dark Hero‘.
Mit anderen Worten – ich.
Lang und dunkel stimmt, und wenn das hier wirklich ein Film wäre, würde man sofort denken: So ’ne Fehlbesetzung!
Im Vergleich zu meinen Eltern und Cammi bin ich nämlich sehr groß und außerdem habe ich viel dunklere Haare als die drei. Obendrein hab ich Locken – und die übrigen drei haben absolute Schnittlauchlocken, sogar Cammi, obwohl die ja immer so viel mit ihren Haaren anstellt, daß man das nicht sieht.
Leider kann ich nicht behaupten, daß ich direkt wie ein ‚hero‘ aussehe. Ich fühle mich auch nicht wie einer, obwohl ich das gern täte.
Ich bin gut zwei Jahre älter als Cammi; wenn man uns zusammen sieht, hält man das zwar nicht für möglich, denn obwohl ich größer bin als sie, sieht sie viel älter aus – auf jeden Fall von außen.
Der Schein trügt selbstverständlich, denn in den letzten Jahren sind mit mir genauso viele umwälzende Sachen passiert, allerdings haben sich die meisten sehr im Inneren abgespielt, abgesehen von einer peinlichen Andeutung von Flaum zwischen der Nase und der Oberlippe.
Da stehen wir also.
Die Familie Pihlsten.
Ich mache ein allgemein muffiges Gesicht, das tue ich immer. Und außerdem kneife ich die Augen zu, wegen der Sonne, dadurch sieht man die Falten auf meiner Stirn deutlicher. Ich bilde mir ein, etwas älter auszusehen, wenn ich die Augenbrauen runzle, und daher laufe ich immer möglichst sauertöpfisch durch die Gegend. In Wirklichkeit bin ich im Moment eher erwartungsvoll. Und das, obwohl es Mittsommer ist und obwohl ich weiß, daß ich den ganzen Abend mit meinen Eltern, ihren Freunden und Cammi verbringen muß.
Gleichzeitig bin ich ein wenig nervös. Ähnlich wie früher vor Weihnachten – so ein Kribbeln im Bauch. Das sieht man mir natürlich nicht an.
Meine Mutter sieht sich um und seufzt noch einmal über das ‚hinreißende, zauberhafte‘ Mittsommergrün.
„Aber wenn es so warm bleibt und kein Regen kommt, wird alles rasch ausgetrocknet sein“, sagt sie, geht nach hinten und macht die Kofferraumklappe auf. Mit viel Mühe gelingt es ihr, zwei Koffer aus dem vollgestopften Kofferraum herauszuzerren.
Keiner von uns rührt einen Finger, um ihr zu helfen. Mein Vater lehnt weiterhin am Autodach und sieht zu, wie sie stöhnt, ächzt und schnauft. Nachdem sie den zweiten Koffer rausgewuchtet hat, sagt er:
„Laß die Koffer doch drin. Ich stell das Auto über Nacht in die Garage.“ Und damit hebt er träge die linke Hand und zeigt auf die Garagentüren.
„Ha... als ob das was nützen würde!“ entgegnet meine Mutter. „So ein Schloß ist für die doch ein Kinderspiel! Und ich hab nicht vor, es irgendwelchen Dieben leicht zu machen und mir meine Sachen einfach klauen zu lassen.“
Cammi sieht mich an und verdreht ihre großen, sorgfältig geschminkten Augen. Dann spitzt sie spöttisch und gelangweilt ihre knallroten Lippen. Ich verstehe genau, was sie meint.
Plötzlich beginnt die ganze Familie Pihlsten, wie in einem alten Stummfilm hin und her zu rennen. Wir schleppen eine Menge Plastiktüten ins Haus, die Cammi und mich auf der ganzen Fahrt bedrängt haben.
Mein Vater hebt ein paar klirrende Tüten heraus und stellt sie äußerst behutsam an den Fuß der Schiefertreppe, die sich zu dem braunen Holzhaus hinaufwindet.
Leider gehört das Haus nicht uns. Ich hätte viel lieber alle meine Sommerferien hier verbracht als in dem engen umgebauten Bootshaus unten in Schonen, das wir seit Urzeiten mieten.
Nein, dieses elegante Holzhaus gehört meinem Onkel – dem Bruder meines Vaters, vielmehr gehört es seiner Frau, genau wie das Segelboot, die drei Autos und die Villa in Helsingborg. Mein Onkel heißt Thorbjörn, und seine Frau, meine Tante also, heißt Charlotte.
An diesem Mittsommertag waren Thorbjörn und Charlotte (oder Tobbe und Chatti, wie sie sich selbst nennen) irgendwo in Südfrankreich und würden erst in zwei Wochen nach Hause kommen. Und bis dahin würde ich völlig solo dort oben wohnen – das heißt, nachdem meine Eltern und Cammi morgen glücklich abgereist wären.
Und das war der Grund, warum ich so gespannt war und warum ich mich mitten in der Sommerhitze vorweihnachtlich fühlte. Am liebsten wäre es mir natürlich gewesen, wenn die übrigen Pihlstens sofort nach Schonen abgezischt wären, aber so viel Glück hatte ich dann doch nicht – bis zum folgenden Tag würde ich sie noch ertragen müssen.
Es war ein kleines Wunder, daß ich tatsächlich ganz allein hier residieren durfte. Anfangs war meine Mutter natürlich strikt dagegen, solche Dummheiten kämen ja überhaupt nicht in Frage. Sie bildet sich ein, daß ich immer noch sieben sei und völlig unfähig, für mich allein zu sorgen.
Mein alter Herr war auch nicht gerade begeistert von der Idee.
„Du wirst natürlich all deine vergammelten Kumpane und eine Menge Weiber anschleppen und rumsaufen und alles kurz und klein schlagen und das Haus abbrennen.“
Natürlich sagte er das mit einem Grinsen, aber ich habe den Verdacht, daß trotz allem eine gehörige Portion Ernst hinter den Worten lag.
„Total daneben getippt“, antwortete ich und versuchte, mich zu beherrschen. „Ich hab vor, dort ganz allein zu bleiben.“
„Lüg doch nicht“, brummte er.
„Warum um alles in der Welt willst du denn ganz alleine dort sein?“ fragte meine Mutter und machte ein verständnisloses Gesicht.
„Weil ich allein sein will, ist doch klar“, sagte ich.
Da schüttelte sie nur den Kopf und begriff gar nichts mehr.
Schließlich konnte ich mich trotz aller Proteste doch durchsetzen. Die einzigen, die keine Einwände hatten, waren Tobbe und Chatti.
„Na, klar doch, mein Junge!“ dröhnte Tobbe gönnerhaft am Telefon. „Menschenskind! Und du – tu uns einen Gefallen, ja? Mach die Gefriertruhe und die Speisekammer leer. Dann brauchst du schon kein Geld fürs Essen auszugeben, mit den Vorräten könnte man glatt eine Armee versorgen. Nur – beim Weinkeller würd ich mich ein bißchen bremsen, ja? Ha, ha. Also, schau das Ganze als ein Geburtstagsgeschenk von Tobbe und Chatti an.“
„Hab aber erst am 18. Dezember Geburtstag.“
„Na, um so besser“, sagte er, ohne zu erklären, was er damit meinte. „Und, wie steht’s denn so? Haste dir schon eine kleine Freundin zugelegt? Die dir dort oben vielleicht Gesellschaft leistet, was? Klar – kann ja gar nicht anders sein! Viel Glück, mein Junge! Aber vergiß eins nicht! Du weißt schon – erst die Gummihaube überstülpen, bevor du einfährst! Ha-ha-ho-ho!!!“
So ist er nun mal, aber wenn man sich nicht allzu lange in seiner Nähe aufhalten muß, ist er trotzdem ganz brauchbar.
Selbst wenn niemand mir zu glauben schien (Cammi sowieso nicht), ich hatte tatsächlich vor, die ganze Zeit hier draußen allein zu verbringen. Und das wollte ich aus zwei Gründen:
Erstens: Noch nie in meinem Leben war ich mehr als acht Stunden am Stück allein gewesen. Nicht ein einziges Mal in meinem ganzen Leben, was natürlich nicht besonders lang ist. Aber trotzdem.
Unfaßlich, aber wahr.
Die wenigen Male, wo ich mehrere Stunden hintereinander allein war, bin ich von der Schule daheim geblieben, weil ich krank war (oder behauptete, es zu sein) und meine Eltern bei der Arbeit waren. Aber selbst diese Tage klappten meistens nicht, weil Cammi früher von der Schule nach Hause kam und wie immer eine ganze Blase von Kumpels mitbrachte.
Bei uns daheim ging es meistens zu wie auf einem Bahnhof – ein ewiges Hin- und Hergerenne, Geratsche und Geplapper. Kaum ein Tag verging, ohne daß jemand zu Besuch war. Und die Gäste mußten dann prompt Kaffeeundkuchen oder Essenundwein haben, logo – sie verlangten es zwar nicht offen heraus, sagten aber nie nein. Die Leute quollen nur so bei uns ins Haus – Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn, Verwandte von Verwandten, neue Freunde und alte Freunde, Bekannte von Bekannten und sonstiges Gemüse.
Wenn es ein seltenes Mal vorkam, daß niemand an der Tür klingelte, wurden Cammi und ich ins Auto gesteckt, und dann fuhr mein Alter los, um andere Leute zu überfallen.
Manchmal frage ich mich, ob meine beiden Alten überhaupt je einen einzigen Abend allein verbracht haben – also, ich meine, nur die beiden miteinander.
Ich glaube kaum. Auf jeden Fall nicht, seit ich mich daran erinnern kann. Manchmal habe ich fast das Gefühl, sie fürchten sich davor, allein zu sein.
Das einzige, was Cammi von meiner Mutter geerbt zu haben scheint, ist diese Angst vor dem Alleinsein. Wenn sie länger als eine Stunde in wachem Zustand alleine in ihrem Zimmer sitzen muß, wird sie total hysterisch. Dann ruft sie eine Freundin an, und wenn die erste nicht daheim ist, macht sie weiter, bis irgend jemand anbeißt, und dann zischt sie los, oder die Freundin kommt zu uns nach Hause.
Wenn wirklich Not am Mann ist (das heißt, wenn es schon sehr spät am Abend ist), ruft sie mich...
Bei mir ist das Gegenteil der Fall – im Laufe der letzten beiden Jahre ist das Gefühl immer stärker geworden, daß ich mich nur dann nicht allein fühle, wenn ich alleine bin. Dann fühle ich mich cool und relaxed und kann mir die tollsten Tagträume ausdenken und bin echt hero-mäßig.
Die Vorstellung, daß ich jetzt so lange allein sein sollte, war allerdings gleichzeitig auch erschreckend – vierzehn Tage. Und vierzehn Nächte... Ich wußte nicht, ob ich es schaffen würde. Wenn ich alleine war, überfielen mich nämlich die scheußlichsten alptraumhaften Phantasievorstellungen... Na ja, sehr kompliziert, das alles. Jetzt würde ich mich eben testen müssen.
Und zweitens: Ich wollte Zeit haben, über das Leben nachzudenken.
Ja, genau das: Über das Leben nachdenken.
Nicht über das Leben, das ich im Moment führte, natürlich nicht, sondern über das, was kommen würde. Das, was irgendwo existierte und auf mich wartete, das Leben, das vor mir lag. Wenn ich ganz allein wäre und mich dabei wohl fühlte, würde ich vielleicht herausfinden, was ich wirklich werden wollte und was ich mit diesem Leben anfangen wollte, das noch gar nicht angefangen hatte.
Die große Frage war, ob ich ein weltberühmter und erfolgreicher Künstler oder Schriftsteller, oder ob ich ganz einfach ein sehr radikaler Multimilliardär werden sollte, der enorme Summen investierte, um diese verdorbene Welt zu verbessern, während er gleichzeitig auf seinen Luxusjachten ein Luxusleben führte. Mir schien das eine gut Kombination zu sein. Denn die Welt war sowohl verdorben als auch schlecht, das hatte ich bereits im Alter von sieben Jahren eingesehen, als ich anfing, etwas von dem zu begreifen, was in den Nachrichtensendungen gesagt wurde.
Aber gleichzeitig erschien es mir doch ziemlich sinnlos – die Welt würde ja doch nicht besser werden, egal wie reich man war und wieviel Geld man investierte. Vielleicht wäre es doch besser, wirklich etwas selbst zu machen, malen oder schreiben und selbst irgendwie ein Vermögen zu verdienen, einfach das Gefühl zu haben, daß man selbst etwas schaffte – so ein bißchen lieber Gott sein, im Taschenformat sozusagen.
Wie auch immer: ich kam wohl nicht darum herum, mich ziemlich bald zu entscheiden – irgendwie mußte man das, was man tun wollte – malen oder schreiben oder reich werden – doch rechtzeitig trainieren.
Ja, ich sah sogar ein, daß es vielleicht notwendig werden würde, anfänglich einen stinknormalen Beruf auszuüben, um mich ‚versorgen‘ zu können. Man muß sich ja ‚versorgen‘ können, wie mein Vater immer sagt.
Sich ‚versorgen‘. Wenn das nicht sorgenvoll klingt!
Nun ja, ich wollte wie gesagt Zeit und Ruhe haben, um über das Leben nachzudenken, weil ich darauf vorbereitet sein wollte, wenn es anfing. Irgendwann müßte es ja so weit sein, denn noch hatte es nicht angefangen, davon war ich überzeugt. Aber bald, dachte ich, bald wird es dunkel im Salon und der Vorhang vorne gleitet lautlos auseinander und der Film ‚Das Leben‘ kann anfangen.
Das, worin ich jetzt gerade steckte, war ja offensichtlich nur ein stinkfader, trüber, schwarzweißer Kurzfilm, der als Vorfilm gezeigt wurde.
Das hier kann ja nicht mal die Werbung sein, dachte ich, denn wo bleiben dann die hüftwackelnden Bikinibräute mit den Haarmähnen, die nach Wiesenkräutern duften, mit den erfrischenden Kaugummis und den Surfbrettern unterm Arm?
Ich halte mich nur an die Wahrheit
Es war kurz nach eins, als die ersten Wolken auftauchten.
Anfangs war es nur eine sehr dünne Kette aus kleinen Wölkchen, die eher an Sahnetupfer auf hellblauem Marzipan erinnerten. Aber sie vermehrten sich rasch, wuchsen, wurden höher und breiter und marschierten zielstrebig in unsere Richtung.
„Das gibt bestimmt Regen“, sagte Cammi und nahm die Sonnenbrille ab.
Sie erhob sich aus dem Liegestuhl auf der Terrasse, den sie sofort beschlagnahmt hatte, streckte den Arm nach ihrem gelben T-Shirt aus und schlängelte sich hinein. Als der blonde Haarbusch durch die Halsöffnung gekommen war, schaute sie mit zusammengekniffenen Augen zu der dicken Wolke hoch, die ihre strebsamen Bemühungen, braun und möglichst noch brauner zu werden, soeben unterbunden hatte.
„Wer wird denn so pessimistisch sein!“ sagte mein Vater und stellte mit einem dumpfen Plumps einen Sack Grillkohle ab.
„Mal sehen, ob Mama in der Küche Hilfe braucht“, sagte Cammi und verschwand durch die Terrassentür.
Mein Vater werkelte wie wild an dem Grill herum. Da der Tobbe und Chatti gehörte, war er natürlich ein sehr fortschrittliches High-Tech-Modell mit zahllosen Schläuchen, Meßinstrumenten und Steuerungen. In meinen Augen sah er eher wie eine rollende Intensivstation aus.
Natürlich mußte gegrillt werden. Schließlich war ja Mittsommer, und wenn die Familie Pihlsten ein Gesetz hatte, dann dieses – am Mittsommerabend mußte man grillen.
Unten in Schonen hatten wir eine billigere Version, einen dieser runden Grills auf drei Beinen, die wie ausrangierte alte Roboter aus dem ‚Krieg der Sterne‘ aussehen. Manchmal glaube ich fast, daß sie das tatsächlich auch sind, als Grill scheinen sie nämlich nie zu funktionieren. Alles schmeckt nur nach Ruß und nach Zündflüssigkeit.
Aber vielleicht liegt das auch an meinem Alten.
Es würde sehr interessant werden festzustellen, wie Tobbes und Chattis High-Tech-Grillstation mit den Steaks für die ganze Gesellschaft fertig werden würde, denn selbstverständlich wurden Gäste erwartet. Die besten Freunde meiner Eltern, Ulf und Eva, waren schon unterwegs.
Das klingt ja nicht besonders schlimm – Ulf und Eva. Zwei Personen. Aber so harmlos war es eben nicht. Ulf und Eva bedeuteten in Wirklichkeit sieben Lebewesen.
Erstens Ulf und Eva selbst, dann ihre zwölfjährigen Kotzbrocken von Zwillingen, Anna und Anders, ihr fünfjähriger Nachzügler Louise und zwei unglaublich lästige, unerzogene Hunde namens Bill und Bull.
Mann, das war vielleicht eine Pest!
Ehrlich gesagt, waren die fast noch gräßlicher als wir.
Für manche Erwachsene scheint der Sinn des Lebens darin zu liegen, sich am laufenden Band Kinder, Katzen und Hunde anzuschaffen und dann pausenlos mit anderen, genauso chaotischen Familien zu verkehren. Da läuft dann ein ewiges, kompliziertes Hin und Her mit tausend Verwicklungen und endlosem Organisieren, da werden Abendessen, Feste, Urlaube und Ausflüge veranstaltet, da muß man Babysitter, Hundesitter und Katzensitter besorgen, die Wohnung gegen ein Reihenhaus tauschen und das Reihenhaus gegen ein besseres Reihenhaus oder sogar gegen ein Einfamilienhaus, neue Gebrauchtwagen kaufen, in denen alles verstaut werden muß, und dann hat man zu guter Letzt doch die Hälfte daheim vergessen.
Werde ich mich auch einmal auf so ein Chaos einlassen? O heiliger Moses! Werd ich auch mal so werden wie mein Alter und Uffe? Mit Kindern und Job und Auto und Ratenzahlungen und Verwandtentreffen? Thank you, but NO!
Manchmal werd ich ganz matt, wenn ich diese Art von Familien nur sehe. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil alles so verdammt problematisch zu sein scheint. Wenn man ihnen zuhört, stellt es sich heraus, daß sie tatsächlich andauernd Probleme haben, sie reden nämlich über nichts anderes – Probleme mit den Kindern, mit Kindergartentanten, Lehrern und Jugendleitern, mit Erkältungen, Keuchhusten und Grippe, mit Ausschlägen und Allergien und Wäsche und Zeit und Kleidern und Preisen und Steuern und Geld, Geld und noch mal Geld, und zum Schluß, aber ebenso ausführlich, dieses Wetter, das nie gut ist, so wie es ist, nein, es ist stets eine ‚Zumutung‘.
Gegen drei Uhr hatten die Wolken sich in gigantische, tieffliegende, stahlgraublauschwarze Gewitterbomber verwandelt, die als geballte Invasionsarmada zum Angriff übergingen.
„Ist das nicht typisch?“ rief meine Mutter, als sie mit einem Stapel Teller und Besteck herauskam. „Warum muß es jedesmal so werden?“ seufzte sie und warf den Wolken wütende Blicke zu.
„Keine Ahnung“, sagte ich und erhob mich vom Liegestuhl, den ich von Cammi übernommen hatte.
„Früher war Mittsommer immer so richtig schön, ich verstehe nicht, warum das jetzt nie mehr der Fall ist.“
„Na ja, wir sind ja nicht gerade am Absaufen“, entgegnete ich.
„Und ein Dach überm Kopf haben wir auch (ich zeigte zum Verandadach rauf). Und übrigens ist es nur gut, wenn es regnet und kühler wird.“