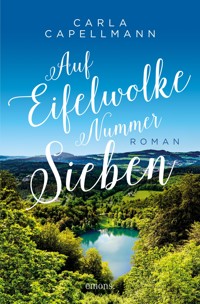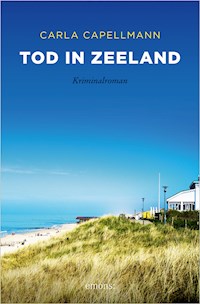Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Ein humorvoller Krimi mit Mord und Meer. Statt sich bei Onkel und Tante an der zeeländischen Nordseeküste zu erholen, schlittert Freddie geradewegs in einen Mordfall. Onkel Holger wird verdächtigt, seine Nachbarin umgebracht zu haben, Tante Gitti ist verschwunden, und Freddies Romanze mit Hoofdinspecteur Julian Doorn scheint auf Sand gebaut zu sein, seit der ausgerechnet gegen Holger ermittelt. Verzweifelt stellt Freddie eigene Nachforschungen an, doch das geht mordsmäßig schief.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Carla Capellmann, 1963 in Jülich geboren, hat Informatik mit Schwerpunkt Computerlinguistik studiert. In ihrer Krimireihe um eine ermittelnde Informatikerin verbindet sie ihre Leidenschaft für Sprachen mit ihrer Liebe zur niederländischen Nordseeküste, die sie seit ihrer Kindheit in- und auswendig kennt.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Ab S. 249 findet sich ein Glossar.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer mit einem Motiv von mauritius images/Pitopia/hfuchs
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Produktion: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-946-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Alle schlechten Eigenschaften entwickeln sich in der Familie. Das fängt mit Mord an …
Alfred Hitchcock
Prolog
Ordnungen der Liebe
»’k heb je lief, ’k heb je lief mijn hele leven lang.«
Sie nahm die Fernbedienung vom Beistelltisch und ließ das Lied noch einmal laufen. Allzu oft würde sie nicht mehr auf diesem Sofa in diesem Haus sitzen, und obwohl sie es ja selbst war, die weggehen wollte, stimmte der Gedanke sie mit einem Mal melancholisch. Wehmütig. Ja, sie hatte auch schöne Zeiten hier verbracht, aber wenn sie an die letzten Jahre dachte …
Unwillkürlich seufzte sie, musste dann über sich selbst lachen. Bald würde sie doch endlich das Leben führen, von dem sie geträumt hatte. Wärme, leuchtende Farben, ein liebender Mann.
Sie kicherte. Heute hatte sie wirklich einen Hang zur Theatralik. Das musste das Lied sein. Er hatte sie lieb. Er liebte sie. Ein liebender Mann. Sein ganzes Leben lang.
Im Raum wurde es dunkel. Schon prasselte Regen gegen die Fensterscheiben. Wild und wütend. Fast wie ein Mensch. Es erinnerte sie an … aber nein, sie wollte keine negativen Gedanken mehr zulassen. Eine Beziehung war immer das, was man aus ihr machte.
Sie angelte sich die leichte Sommerdecke aus der Ecke und kuschelte sich hinein. Hieß es nicht: Wie man sich bettet, so liegt man?
Tag 1 – Die gemeine Miesmuschel
Gemein sein. Man muss sie nur heiß genug kochen!
1
Wiedersehen – weerzien
Montagmittag
Kaum erreichte ich mein Lieblingscafé, verblasste der Spuk vom Wochenende in meinem Kopf. Mit einem befreiten Grinsen im Gesicht steuerte ich die Terrasse des Cafés an, die auf der anderen Seite der Sint Janstraat auf dem Vismarkt lag. Ich wählte einen Tisch, der nicht im Schatten der Bäume stand, ließ mich in den Korbstuhl fallen und hätte am liebsten vor Freude laut gejuchzt. So ging es mir immer, wenn ich im »Sint John« ankam. Dieses Café in Middelburg war meine Glücksdroge.
Ich bestellte eine weitere Droge. »Een koffie verkeerd, alstublieft. Und ein Toastie Java.« Mit Erdnüssen, Bananen und Ananas. Das Wasser lief mir im Mund zusammen, und ich lieferte mir ein Wettstrahlen mit der Sonne. Mochte sie Toasties etwa auch so gern wie ich? Auf der Fahrt hatte es noch geregnet, aber mit jedem weiteren Kilometer war es weniger geworden, und jetzt war perfektes Strandwetter.
Um mich herum füllten sich die Tische. Ich war mir nicht sicher gewesen, ob das »Sint John«, wie viele Geschäfte in den Niederlanden, montags erst mittags öffnete, aber koffie wurde wohl bereits früher am Tag benötigt, und inzwischen war es schon nach elf. Ich war zeitig losgefahren. Wenn es an die Nordsee ging, konnte es mir nie schnell genug gehen. Dazu kam, dass mich die Familienaufstellung gestern reichlich aufgewühlt und heute früh aus den Federn getrieben hatte. Konnte es wirklich stimmen, was die Stellvertreter meiner Eltern gesagt hatten?
Statt es erneut vergeblich bei Miriam zu versuchen, wie ich es auf der Fahrt gemacht hatte, ordnete ich Karte, Zuckerstreuer und Aschenbecher so an, wie sich die Repräsentanten meiner Kernfamilie, also meiner Mutter, meines Vaters und mir, gestern umgestellt hatten. Ich schüttelte den Kopf. Hey, ich war auf Walcheren, im weltbesten Café, okay, im besten Café von Zeeland oder zumindest von Middelburg, und dachte trotzdem über so einen Humbug nach? Woher sollten wildfremde Menschen wissen, was meine Eltern oder ich fühlten, wie wir zueinander standen?
Warum schoss ich dennoch ein Foto und schickte es Miriam mit der Frage, ob die Stellvertreter sich gestern so umgestellt hatten?
»De koffie verkeerd en de toasti.« Die Bedienung erlöste mich aus meinem Gedankenkarussell. »Eet smakelijk.«
»Bedankt.« Rasch zerstörte ich meine Familienanordnung auf dem Tisch und schaffte Platz für Teller und Tasse. Auch davon schickte ich Miriam ein Foto. Zu schade, dass sie nicht hatte mitkommen können, aber eine zweite Freundinnenfreizeit so kurz nach unserem Yogaurlaub war ihr leider nicht möglich gewesen. Ich nahm einen Schluck Kaffee, dann stürzte ich mich auf mein Toastie.
Wohlig seufzte ich wenig später auf. Ich würde nie verstehen, warum über die niederländische Küche so hergezogen wurde.
Ein Stoß in den Rücken riss mich aus meinen küchenphilosophischen Betrachtungen.
»Oh, sorry, het is een beetje eng hier.«
Ich fuhr herum. Die Stimme kannte ich doch.
Tatsächlich. Hoofdinspecteur Julian Doorn stand vor – oder vielmehr hinter – mir. Und das unmittelbar. Es war wirklich ein bisschen eng hier. Meine Nase steckte fast in seinem Jackett.
Mann, der roch immer noch so gut.
»Hallo!«, hörte ich ihn über mir, riss mich zusammen und meinen Kopf aus dem Jackett.
Er trat zur Seite, sodass ich mir nicht mehr den Nacken verrenken musste, und lächelte mich an. »Wieder zurück? Der nächste Yogaurlaub?«
»Nein, dieses Mal besuche ich Onkel und Tante und besichtige ihr neues Haus.«
»Oh, Sie haben Zeeuwses Blut?«
»Es fühlt sich zwar definitiv zeeländisch an«, ich grinste, »aber nein, die beiden sind genauso Duits wie ich. Allerdings verbringen sie schon lange jede freie Minute hier. Bislang in einem Bungalowpark, aber vor Kurzem haben sie ein Häuschen in Westkapelle gekauft und sind ganz hergezogen.«
Wir lächelten uns an. Doorn war offenbar allein hier. Jedenfalls stand niemand bei ihm, der drängelte, er solle weitergehen und ihnen endlich einen freien Tisch suchen.
»Setzen Sie sich doch.« Ich räumte meine Sachen zur Seite.
»Gern.« Ohne Umschweife nahm er Platz.
Als er saß, räusperte ich mich. »Ich habe mich noch gar nicht richtig bei Ihnen bedankt. Das wollte ich schon die ganze Zeit nachholen. Bedankt.« Ich streckte meine Hand aus.
Doorn drückte sie. »Gern geschehen.«
»Was möchten Sie? Ich lade Sie ein.«
Nachdem wir bestellt hatten, unterhielten wir uns und ließen uns auch von der Bedienung nicht stören, die unsere Getränke brachte. Unweigerlich kamen wir noch einmal auf die Geschehnisse während meines Yogaurlaubs in Domburg zu sprechen. Auf die Tote, die ich gefunden hatte, den Mordverdacht, unter dem ich gestanden hatte, und das, was danach passiert war. Wie ich es geschafft hatte, mit lila Flipflops davonzukommen. Was farblich und schuhlich gesehen nicht so ganz stimmte, aber ich ließ es dabei bewenden. Stattdessen fragte ich Doorn, ob und welche Arten von Diagrammen sie in ihren Ermittlungen nutzten. Als Informatikerin erfasste ich am liebsten alle Informationen in wohldefinierten Schaubildern.
»Die Diagramme in den Fernsehkrimis kann man ja bestenfalls als Visualisierungen bezeichnen, in denen willkürlich Bilder an eine Wand gepappt und genauso willkürlich Linien dazwischen gezogen werden.«
»Sich die Dinge vor Augen zu führen, kann schon hilfreich sein. Wenn man filmreife Fälle hat. Die Kulisse dafür hätten wir hier, aber die Fälle nicht – und das ist gut so.« Er nahm einen Schluck Kaffee. »Was für Grafiken würden Sie denn empfehlen?«
Misstrauisch sah ich ihn an, doch sein Interesse schien ehrlich. Prompt holte ich meinen Laptop aus dem Rucksack und zeigte Doorn ein Fischgrätendiagramm, erklärte die Logik dahinter und die beste Vorgehensweise.
»Richtig verstehen kann man es erst, wenn man es anwendet. Hier ist zum Beispiel das Diagramm, das ich für den Mord im Yogazentrum erstellt habe.«
»Es gibt also Gräten für die Verdächtigen mit Verästelungen für Motiv, Mittel und Gelegenheit.« Er studierte meine Grafik. »Das Opfer und Fakten zum Mord bilden den Kopf.«
»Der Fisch stinkt eben vom Kopf her.«
Doorn nickte, er war immer noch in das Diagramm vertieft. Jetzt deutete er auf die Jan-Gräte. »Sie sind wirklich gründlich vorgegangen. Sogar Ihren Freund haben Sie aufgeführt. Ist er auch hier?« Er schaute auf und sah sich um, als würde er erwarten, dass Jan just in diesem Moment vom Klo zurückkam.
»Wir sind nicht mehr zusammen.« Ich legte den Kopf in den Nacken und guckte in das strahlende Blau des Himmels. »Ich habe Schluss gemacht.«
Als ob das eine Rolle spielte. Als ob es Doorn interessierte.
Ich spürte seinen Blick auf mir und wandte mich ihm zu. Das Grau in seinen Augen schimmerte warm. Meine Finger umschlossen die inzwischen leere Kaffeetasse.
Er lächelte. »Noch een koffie verkeerd?«
»Kaffee geht immer.« Das wäre mein dritter. Waren nicht aller guten Dinge drei? Selbst wenn sie zu Herzrasen führten?
Doorn erhob sich und ging über die Straße zum Café. Er sah gut aus, auch von hinten. Besonders von hinten, wenn ich es genau nahm. Der graue Anzug betonte seine schmalen Hüften und schien sein Standard zu sein. Oder seine Arbeitskleidung. Was er wohl privat trug? Wenn er nicht gerade nichts anhatte …
Verdammt!
Atmen. Ich legte meine Hände auf den Bauch, wie ich es im Yoga gelernt hatte, spürte, wie sich dieser in die Hände wölbte, als ich einatmete. Wie er sich wieder senkte beim Ausatmen. Ein und aus.
Ich wurde ruhiger. Wahrscheinlich waren meine Gefühle nur die Nachwirkungen des Wochenendes. Von dieser Aufstellung, zu der Miriam mich geschleift hatte, nachdem ich ihr einmal zu viel vorgejammert hatte, dass all meine Beziehungen nach zwei, spätestens drei Jahren scheiterten und ich nicht verstand, warum. Durch das Familienstellen wollten wir meiner Bindungsunfähigkeit ein für alle Mal auf den Grund gehen.
Doorn trat aus dem Café und kehrte mit zwei Tassen zurück. Sofort klopfte mein Herz, als hätte es nicht nur den dritten koffie verkeerd, sondern auch seinen Kaffee bereits intus.
»Haben Ihnen schon viele Deutsche gesagt, dass Sie wie ein ›Tatort‹-Kommissar aussehen? Wie dieser ehemalige ›Tatort‹-Kommissar, meine ich. Der aus Bremen.«
»Bremen?« Doorn zog die Augenbrauen hoch. Er reichte mir meine Tasse, stellte seine ab und setzte sich. »Münster wäre besser, oder?«
Ich schüttelte den Kopf und grinste. »Was den Kommissar betrifft, ganz gewiss nicht.« Sollte ich ihm verraten, dass ich ihn insgeheim Stehl-den-Freund nannte? Aber das würde er womöglich falsch verstehen. Stattdessen unterhielten wir uns über den radelnden Kommissar, kamen über Schönwetterradfahrer und E-Bike-Radler aufs echte Radfahren. Gegen den Wind. So richtig. Eine gemeinsame Tegenwind-fiets-Tour auf dem Oosterscheldekering, schlug Doorn vor. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen.
Der Hoofdinspecteur zückte seine Visitenkarte. Ich wollte bereits protestieren. Schließlich hatte ich davon schon eine. Da schrieb er eine weitere Nummer auf die Rückseite.
»Meine Privatnummer.« Er lächelte mich an. »Soll ich dir ein fiets für die Tour mitbringen? Dann brauchst du keins auszuleihen.«
Ich lachte. »Nicht nötig. Ich habe mein Rennrad dabei.«
Er hob die Augenbrauen. Die eine, die linke, einen Tick höher als die rechte. Während der Mordermittlungen im Yogazentrum hatte es mich wahnsinnig gemacht. Jetzt fand ich es irgendwie süß. Ich hatte eindeutig zu viel Koffein im Blut. Oder lag es daran, dass er mich geduzt hatte?
»Dann sehen wir uns heute Abend um halb sechs«, sagte er. »Ich freu mich.«
»Holen Sie mich ab?«
»Du. In den Niederlanden duzen wir uns gern. Ich heiße Julian.« Er beugte sich vor.
»Freddie«, stotterte ich. Als ob er das nicht wüsste. Seine Wange schob sich an meine. Erst auf die eine, dann auf die andere Seite. Wieder bekam ich eine Nase voll von diesem Geruch, den ich mir am liebsten in Flaschen abgefüllt hätte.
»Bis später.«
Und dann war er weg.
Einatmen, ausatmen, runterkühlen. Ich war hier, um Holger und Gitti zu besuchen und dabei in Ruhe – und allein – über meine Beziehungen nachzudenken. Nicht, um eine neue anzufangen. Aber hey, wann hatte man schon mal die Gelegenheit, einem echten Kommissar Diagramme für Mordermittlungen zu erläutern?
»Möchten Sie noch etwas?« Die Bedienung sammelte die leeren Tassen ein und sah mich fragend an.
»Nee, dank u, de rekening alstublieft.«
Ich verstaute Julians Visitenkarte und zahlte. Julian. Da steckte Jan drin. Ob mir das was sagen sollte?
Dass ich mir nichts einbilden sollte, schalt ich mich selbst und packte meine Sachen ein. In Julian steckte auch Uli, und alle Ulis, die ich kannte, waren sehr nett. Okay, alle Ulis, die ich kannte, waren weiblich.
»We are family …«
Natürlich hatte ich das Smartphone gerade mit meinem Portemonnaie im Rucksack verstaut und wollte aufstehen, als es klingelte. »We are family«, schallte es noch einmal, bevor ich das Handy wieder befreit hatte und über den Annahme-Button wischte. Rasch zerrte ich die In-Ears heraus, fummelte sie in meine Ohren und stöpselte das andere Ende ins Smartphone.
»Freddie? Huhu, ist da wer?«
»Miri, endlich!«
»Na, das ist ja wohl mein Text. Beste Freundin vermisst.« Miriam lachte. »Bist du schon in Westkapelle? Und was ist überhaupt los? Mein Handy ist gar nicht mit dem Zählen deiner Anrufversuche hinterhergekommen. Es ist doch nichts passiert?«
»Nein, nein, alles gut. Ich wollte dich nur fragen, ob du dich daran erinnern kannst, was der Stellvertreter von meinem Vater gesagt hat, als meine Mutter, also ihre Stellvertreterin, näher an ihn rangerückt ist.«
»Gar nichts. Er hat den Arm um sie gelegt.«
»Ja schon. Danach, meine ich. Als der Aufstellungsleiter ihn nach seinen Gefühlen gefragt hat.« Gespannt hielt ich das Handy so, dass ich aufs Display sehen konnte, dabei skypten wir doch gar nicht. Ich schüttelte den Kopf über mich selbst und erhob mich.
Während ich Richtung Parkplatz ging, ließ ich mit Miriam die Erlebnisse vom Vortag noch mal Revue passieren. Nicht dass wir das nicht gestern Abend schon gemacht hätten. Ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Zumindest keinem, das ich hören wollte.
»Schreib am besten alles auf«, riet Miriam mir. »Noch sind deine Erinnerungen frisch. Ich mache dasselbe, und heute Abend telefonieren wir dann in Ruhe. Okay? Und frag deinen Onkel und deine Tante, wenn du schon nicht mit deinen Eltern reden willst.«
Vielen Dank. Das war der Teil, den ich nicht hören wollte.
Ich erreichte den Parkplatz und verabschiedete mich. Es wurde Zeit, dass ich nach Westkapelle fuhr. Holger und Gitti waren zwar viel entspannter als meine Eltern, aber sie rechneten wahrscheinlich doch damit, dass ich zum Mittagessen da war. Auch wenn ich ihnen gesagt hatte, dass sie nicht mit dem Essen auf mich warten sollten.
Ich verließ Middelburg Richtung Zoutelande und genoss es, mal wieder hier entlangzufahren. In letzter Zeit war ich oft in Domburg oder Oostkapelle gewesen. Umso mehr freute ich mich, die Strecke aus Kindheitstagen wiederzusehen.
Links tauchten die Kuppen der Dünen auf, die sich von Vlissingen über Zoutelande bis Westkapelle zogen. Bei ihrem Anblick hatte ich früher immer gebettelt, gleich dorthin zu fahren. Ich wollte auf die Sandberge klettern und auf der anderen Seite hinabspringen und zum Meer jagen. Holger und Gitti hatten bestimmt ihre liebe Mühe mit mir gehabt. Dennoch durfte ich in den Ferien häufig mit in den Bungalowpark in Westkapelle, in den sie so oft fuhren, dass sie schließlich zu Dauermietern dort wurden. Doch damit war nun Schluss. Ich war mächtig gespannt auf das Haus, das sie gekauft hatten. Direkt hinterm Deich liege es, hatten sie mir stolz erzählt. Man brauche nur draufzusteigen und könne das Meer sehen. Westkapelle lag quasi auf Meereshöhe. Wäre der Deich nicht, der das Dorf schützte, würde der Ort geflutet. So wie im Zweiten Weltkrieg, damals, um die Deutschen loszuwerden. Heute wohnten einige von genau denen dort, viele besuchten es immer wieder gern.
Sehnsüchtig hielt ich nach dem Leuchtturm Ausschau. Dem richtigen Leuchtturm von Westkapelle, dem großen im Ort, dem aus Backstein, aus dem der rote Eisenaufbau herausragte. Der eigentlich ein Kirchturm war. Der einen nachts mit seinem immer wiederkehrenden Lichtstrahl so wunderbar behütet in den Schlaf sinken ließ.
Da war er. Ich atmete tief durch und spürte, wie sich ein Lächeln auf meinem Gesicht ausbreitete. Links tauchte der kreek auf. Fast konnte ich mich an dem großen Brackwassersee rennen und spielen sehen. Ein Wohnkomplex nahm mir die Sicht. Den hatte es damals noch nicht gegeben.
Jetzt ging es geradewegs auf den Leuchtturm zu. Dann folgte ich der abbiegenden Hauptstraße nach links, rollte durch den Ort, bis ich schließlich rechts abbog und nach Holgers und Gittis Haus Ausschau hielt.
Noch bevor ich es erreichte, musste ich anhalten. Ein Wagen der niederländischen politie, ein Notarzt- und ein Rettungswagen verstopften die Straße. Ich gab mir gar nicht erst die Mühe, mein Auto an den Rand zu fahren – hier würde so schnell niemand durchkommen –, und stieg aus. Mein Herz wummerte. Hoffentlich war mit Holger und Gitti alles in Ordnung.
Ein paar Anwohner standen auf dem Bürgersteig und musterten mich stumm, als ich mich an ihnen vorbeidrängte. Dann bat mich ein Streifenpolizist, doch bitte einen anderen Weg zu nehmen.
»Mein Onkel und meine Tante wohnen hier.« Ich gestikulierte Richtung Straßensperre. »Hausnummer 78. Sorry.Spreekt u Duits?«
Er nickte.
Sogleich machte ich einen Schritt vor.
»Nee, dat gaat niet.« Er hob die Hand. »Das geht nicht. Sie müssen hier warten. Een momentje, alstublieft.«
»Was ist denn los? Geht es meinen Verwandten gut? Meneer und mevrouw Herzmann.«
»Die Sanitäter sind bei van der Have rein.« Einer der Anwohner in Hausschuhen und Schürze stellte sich neben mich und deutete auf das Haus, das rechts von dem von Holger und Gitti lag. »Ich denke, sie kümmern sich um Nelleke. Ich hoffe nur, es ist nichts Ernstes.«
»Was denn sonst?«, fragte eine Frauenstimme hinter mir.
Gerade wollte ich mich nach ihr umschauen, da öffnete sich die Tür des Rettungswagens. Sofort starrten wir alle dorthin. Ein Sanitäter sprang heraus und streckte dann helfend die Hand aus. Gestützt von einem zweiten Helfer kletterte mein Onkel aus dem Wagen.
Ich schrie auf. »Holger!«
»Freddielein.« Seine Stimme klang reichlich wacklig.
»Entschuldigung.« Ich zwängte mich an dem Polizisten vorbei und raste zu meinem Onkel. »Was ist mit dir? Ist was mit Gitti? Wo ist sie?«
Holger wurde noch weißer im Gesicht, wenn das denn möglich war. Tränen liefen über seine Wangen.
Verdammt! Ich schluckte.
»Er is oké.« Der Sanitäter tätschelte Holgers Arm. »Der Anblick von eine doden kann einen schon aus den Schuhen hauen. Und diese hat echt niet lekker ausgesehen.«
»Eine Tote?« Ich sah zum Haus und ballte die Hände, presste die Daumen dabei so fest, dass Alles-ist-gut-Saft aus ihnen heraustropfen musste. »Um wen handelt es sich denn?«
Bedauernd schüttelte der Sanitäter den Kopf. »Een vrouw. Mehr weiß ik niet.«
Ein Schauder lief mir über den Rücken. Schon wieder war jemand gestorben, kaum dass ich auf Walcheren auftauchte. Hoffentlich war es nicht Gitti. Sie hatten sich doch gerade erst das Haus hier gekauft. Ja, okay, Menschen starben. Das war … der Lauf der Natur. Aber Gitti war doch viel zu jung. Vielleicht ein Unfall?
Ich presste die Lippen zusammen und drückte Holger, als ob das helfen könnte, dass es nicht Gitti war.
2
Familie – familie
Montagnachmittag
»Gestern habe ich noch mit ihr gesprochen, und jetzt ist sie tot.« Holger hob den Kopf, ließ ihn aber gleich wieder sinken.
Er saß in seinem Lieblingssessel, den ich noch aus Bungalowparkzeiten kannte. Ich hätte ihn ja lieber aufs Sofa gepackt, aber er hatte sich partout nicht hinlegen wollen, und so hatten die beiden Sanitäter ihm in den Sessel im Wohnzimmer geholfen. Mir hatten sie versichert, dass er nur ein wenig Ruhe brauche. Für den Notfall hatten sie mir noch eine Nummer in die Hand gedrückt und waren gegangen. Seitdem versuchte ich, Holger zu beruhigen und gleichzeitig nicht selbst durchzudrehen.
»Wer ist tot? Wirklich Nelleke? Die vom Bungalowpark?« Ich reichte ihm ein Glas Wasser, das ich aus der Küche geholt hatte.
Er nahm es und schluckte gehorsam. »Sie hat gesagt, dass sie heute Vormittag nicht da sei. Deswegen bin ich hintenrum nach nebenan. Gleich in die Küche, wo ich das Regalbrett anbringen wollte, und da …«
»Trink«, sagte ich und überlegte, ob ich ihm nicht besser einen Schnaps geben sollte. »Dann war Nelleke also eure Nachbarin?«
Holger nickte nur.
»Und wo ist Gitti?«, fragte ich schnell, um endlich Gewissheit zu bekommen, dass es meiner Tante gut ging.
»In ihrem Atelier. Wie jeden Morgen.« Holger stellte das Glas ab und machte Anstalten aufzustehen. »Du kennst sie doch.«
»Du meinst, sie hat von alledem nichts mitbekommen und klebt Muscheln irgendwo drauf oder feilt an Treibholz?« Ich sprang auf. »Wo ist denn ihr Atelier?«
Holger war wieder in den Sessel zurückgefallen und deutete zum Garten hin. »Sie weiß Bescheid. Ich habe es ihr erzählt, bevor ich den Notarzt … Oh Gott, es müssen die Muscheln gewesen sein.«
»Welche Muscheln?« Verwirrt starrte ich ihn an.
»Gitti hat gestern welche mitgebracht.«
»Sie bringt doch immer Muscheln mit.« Wenn jemand eine leidenschaftliche Sammlerin war, dann Gitti. Das hatte mich schon als Kind frustriert. Egal, wie schön die Muschel aussah, die ich gefunden hatte, meine Tante übertrumpfte mich immer mit noch schöneren, kleineren, größeren, ausgefalleneren. Bislang jedoch noch keiner tödlichen. Ich biss mir auf die Unterlippe.
»Ja, nein, nicht solche. Welche zum Essen.«
»Miesmuscheln? Gitti? Und das, wo ihr nicht mal zusehen mögt, wenn ich welche esse. Geschweige denn, dass ihr sie selbst probiert.«
Holger stöhnte auf. »Sie waren ja auch für Nelleke. Und jetzt ist sie tot. Nachdem sie Gittis Muscheln gegessen hat.« Er sackte noch tiefer in sich zusammen, wenn das denn ging.
»Das ist doch nicht Gittis Schuld! Schließlich hat sie die Muscheln nicht selbst aus dem Meer geangelt, oder? Wer sagt denn überhaupt, dass es eine Muschelvergiftung war?«
Stirnrunzelnd sah ich durch das Fenster in den Garten. Hockte Gitti tatsächlich noch in ihrem Atelier, obwohl Holger ihr erzählt hatte, was nebenan passiert war? Hatte sie es vielleicht gar nicht registriert und wieder einmal alles um sich herum über ihrer Kunst vergessen?
Ich legte meine Hand auf Holgers Schulter und drückte sie kurz. »Warte, ich hole sie.«
»Ich kann es nicht glauben«, murmelte er mehr zu sich als zu mir. »Sie war immer so lebensfroh, die ganzen Jahre über, auch noch, als sie Kees gepflegt hat. Und jetzt das.«
Ich ließ ihn murmeln und trat durch die Terrassentür nach draußen.
Der Garten war nicht groß. Eine kleine Terrasse mit Sitzmöbeln, die ich aus dem Bungalowpark wiedererkannte. Ein Meer von Blumentöpfen und -kästen, in denen die Farben so wild wogten wie die Nordsee bei Sturmwind. Zwischen den Blumen, ach, nein, eigentlich überall – was in dem kleinen Garten nicht viel hieß – hatte Gitti ihre Strandfundstücke platziert, und natürlich waren die Übertöpfe und Kästen mit Muscheln verziert, jeder anders, alles Unikate.
Am Ende des Grundstücks befand sich ein Schuppen, daneben ein Tor zum Deich und kurz davor eine Lücke in der Hecke zum Nachbargrundstück. Das war dann wohl Holgers Abkürzung nach nebenan, und der Schuppen musste Gittis »Atelier« sein.
Immerhin hatte die kleine Holzhütte Fenster, wenn auch nicht allzu große. Dafür lagen sie einander gegenüber, sodass man durch sie hindurch auf den Deich schauen konnte. Ein Doorzon-Schuppen. So wie auch viele Wohnungen die Sonne hindurchscheinen ließen und entsprechend doorzonwoning genannt wurden. Meine Tante konnte ich allerdings nicht sehen. Warum stand die Tür zum Schuppen dann offen?
Ich runzelte die Stirn. »Gitti?«
Keine Antwort.
Nach drei großen Schritten war ich im Atelier. Viele Muscheln, viel Strandgut, viele ihrer Kunstobjekte, ein mit einem Vorhängeschloss gesicherter Schrank, aber keine Gitti. Auch nicht rechts hinter der Tür, wo sich Regenmäntel, Gummistiefel und Fischerausrüstung verbargen. War sie doch im Haus? Vielleicht oben? Aber warum hatte sie uns dann nicht schon längst gehört und war zu uns runtergekommen?
Ich verließ den Schuppen, schloss die Tür und eilte zurück ins Haus. Holger lag nun doch auf dem Sofa und hatte die Augen geschlossen. Bestimmt war es besser, ihn erst einmal ruhen zu lassen.
Leise durchquerte ich den Wohnraum und stieg die steile Treppe hinauf, doch auch oben fand ich Gitti nicht. Also wieder nach unten. Dieses Mal ging ich in die Küche. Am Kühlschrank hing wie früher im Bungalow und wie in ihrer ehemaligen Wohnung in Deutschland eine Liste mit sämtlichen Telefonnummern. Auch der von Gittis Handy. Da sie es so gut wie nie dabeihatte, hatte ich ihre Nummer nicht gespeichert. Trotzdem holte ich mein Handy aus dem Rucksack und versuchte es.
Vergeblich. Nicht einmal die Mobilbox war aktiviert. Stattdessen bekam ich die Ansage, dass der Teilnehmer nicht erreichbar sei. Rasch schickte ich eine SMS mit der Bitte, mich doch umgehend anzurufen.
Ich legte das Smartphone beiseite und stierte auf ihre Muschelbank – eine Holzbank, deren Seiten sie mit allerlei Strandgut bestückt hatte. Die Sitzfläche war eine Plexiglasplatte, darunter eine nachgebaute Muschelbank, mit Sand, Muschelschalen und blauer Farbe, dort, wo das Meer die Bank umspülte.
Wo steckte Gitti?
War sie nach dem Schock an den Strand gelaufen und machte einen ihrer ausgedehnten Spaziergänge, ihre Art, den Stress abzubauen, wie sie mir öfter erklärt hatte? Aber normalerweise meldete sie sich immer ab.
Ich rieb mir die Stirn. Oder hatten Holger und sie sich gestritten? Aber das hätte er doch erwähnt.
Entschlossen, mir keine Sorgen zu machen, ging ich zurück ins Wohnzimmer. Es würde schon alles in Ordnung sein, das war es doch immer. Die wirklich schlimmen Dinge passierten aus heiterem Himmel, die konnte man nicht vorhersehen oder wegsorgen.
Ich sah nach draußen. Heiterer Himmel. Im Unterschied zu meinem Inneren, wo die Gefühle wie Gewitterwolken aufzogen und rumorten. Ich zwang mich durchzuatmen.
Die Nachmittagssonne hatte den Raum aufgeheizt. Holger lag nach wie vor auf dem Sofa und schnarchte leise vor sich hin. Nun gut, dann würde ich eben zuerst mein Auto vernünftig parken und mein Gepäck ins Haus holen. Eigentlich ein Wunder, dass niemand geklingelt hatte, damit ich den Wagen wegsetzte. Hoffentlich war er noch da.
Ich hatte Glück. Die Straße war weiterhin durch die Polizei gesperrt. Allerdings waren Nachbarn und Gaffer verschwunden. Auf dem Weg zu meinem Auto scannte ich die Fahrzeuge, die am Straßenrand standen. Einige hatten zwar deutsche Kennzeichen, aber das von Holger und Gitti war nicht dabei.
Ich nickte, wie um mir selbst Mut zu machen. Gitti hatte garantiert einen Termin, irgendein Treffen ihrer Künstlergruppe. Als ich zugesagt hatte, sie zu besuchen, hatten wir uns darauf geeinigt, dass sie sich keine Zeit für mich zu nehmen brauchten. Auch wenn ich schon lange nicht mehr mit den beiden in den Urlaub fuhr, so war ich doch alles andere als ein Gast, um den man sich kümmern musste. Bestimmt war Gitti in Sachen Nazomerfestival unterwegs. Zu ihrer Muschel-Vorstellung dort hatten sie mich schließlich eingeladen.
Aber würde sie Holger tatsächlich in so einer Situation allein lassen? Ihre Kunst war ihr wichtig, aber mein Onkel doch auch.
Als ich an meinem Auto angekommen war, parkte ich es ordnungsgemäß und schnappte mir mein Gepäck. Nur das Rennrad ließ ich im Kofferraum. Das würde ich später holen.
Zurück im Haus war es still. Wenn man von Holger absah. Er schlief immer noch. Da man jemand, der unter Schock stand, sicher nicht wecken sollte, er aber genauso sicher frische Luft brauchte, öffnete ich Haus- und Terrassentür, um einmal richtig durchzulüften. Sehnsüchtig schaute ich auf das Tor zum Deich. Ob ich schnell zum Meer laufen konnte?
»Freddie?« Holgers Stimme rief mich ins Wohnzimmer zurück. »Mir ist kalt.« Anklagend rieb er sich die Arme. »Willst du mich umbring…?« Das Wort blieb ihm förmlich in der Kehle stecken. Wir sahen uns an.
»’tschuldigung«, sagte ich und schloss beide Türen, obwohl es draußen nicht kalt war. »Ich mache dir einen Tee, dann ist dir gleich wieder warm.«
Hey, ich hörte mich wie meine eigene Mutter an. Und genau wie sie wich ich dem eigentlichen Thema aus. Stiere und Hörner, dachte ich, und wählte für Holger einen Becher mit einer Kuh aus, während ich darauf wartete, dass das Wasser kochte. Ich fischte einen Teebeutel aus Gittis Vorräten, hängte ihn in die Tasse und füllte sie mit dem heißen Wasser. Fehlte nur noch, dass ich »auf in den Kampf, Tore-he-he-he-ro« pfiff, als ich mit der Tasse bewaffnet zurück ins Wohnzimmer kehrte.
»Wo ist Gitti?« Holger drehte mir den Kopf zu, setzte sich aber nicht auf. Er hing ganz schön in den Seilen.
»Hier, dein Tee.« Ich reichte ihm den Becher und hockte mich zu ihm aufs Sofa. »Trink erst mal was, und dann überlegen wir, wo sie sein könnte.«
»War sie nicht im Atelier?« Er guckte mich so bittend an, dass ich kurz davor war, »doch« zu sagen, »klar«.
Ich biss mir auf die Unterlippe.
»Aber sie muss hier sein. Hast du auch im Haus geguckt?«
Als ob Gitti sich wie eine Zauberschrankfrau in diesem Winzhäuschen verstecken könnte. Noch dazu, wo sie beim Versteckspiel damals immer als Erste gefunden worden war.
Ich legte meine Hand auf seinen Unterarm. »Erzähl doch einfach mal ganz genau, was ihr gemacht habt heute Morgen.«
Holger seufzte. Er hob den Kopf, nahm einen Schluck Tee, verzog das Gesicht und reichte mir den Becher. Na gut, doch einen Schnaps.
Ich ging zurück in die Küche und füllte uns beiden zwei kleine Gläser mit oude jenever.
Still stießen wir an. Dann erzählte Holger.
»Nelleke hatte mich gebeten, ein loses Regalbrett zu befestigen. Deswegen bin ich nach dem Frühstück rüber. Sie wollte zu Pilatus. Kennst du den?« Holger lächelte schwach. »Gitti macht das auch manchmal. Es regt sie auf, wenn ich Pilatus sage. Selbstverständlich weiß ich, dass es richtig Pilatos heißt.«
»Onkel Holger!« Ich sah ihn gespielt tadelnd an. »Lass mich raten. Bevor du rübergegangen bist, hast du es dir erst mal auf dem Sofa bequem gemacht, so wie jetzt.«
»Ich musste ja noch die Zeitung lesen. Kann schon sein, dass ich dabei hier gesessen habe.« Er knuffte mich. Sein Gesicht hatte wieder etwas Farbe angenommen.
»Und Gitti?«
»Ist in ihr Atelier. Hab ich dir doch schon gesagt.« Er wedelte mit der Hand. »Mach mal Platz.«
Ich rückte zur Seite, und er setzte sich auf. Endlich wirkte er ein wenig mehr wie der Onkel, den ich kannte. Der, seitdem er im Ruhestand war, noch fitter und munterer schien als zuvor.
»Du bist also rüber zu Nelleke. Und dann?«
»Sie lag im Wohnraum.« Holgers Augen richteten sich auf die Wand vor ihm, aber ich wusste, dass er die gerade nicht sah. Das Bild eines Toten brannte sich in die Netzhaut ein. Das hatte es zumindest bei mir getan.
Ich leerte mein Glas, nahm dann seine Hand in meine und rieb sie, damit sie warm wurde. Damit er das Leben spürte, wenn er vom Tod erzählte.
»Sie hatte sich zusammengerollt. Wie ein kleines Kind, dachte ich erst, aber es roch bis an die Tür, und als ich ihr Gesicht sah …« Er schluckte, doch der Kloß war zu groß. Er schluckte erneut. Eine Träne lief über seine Wange. Hastig wischte er sie weg.
»Ist schon gut.« Ich drückte ihn.
»Sie muss hingefallen sein, als sie zur Toilette wollte, und sich dabei verletzt haben, so schlimm, dass sie es nicht mal mehr ans Telefon geschafft hat. Wahrscheinlich dieser blöde Läufer, der immer wegrutscht, keine Ahnung, es war nichts zu sehen. Auch kein Blut. Nur das Erbrochene. Ich hab dann gleich ihren Puls gefühlt. Ich dachte, sie lebt noch. Sie muss doch noch leben.« Er hielt beide Hände vor den Mund und schloss kurz die Augen.
»Aber da war kein Puls?«
»Nein, sie war kalt.« Langsam ließ er die Arme sinken und sah mich traurig an. »Das ist so schrecklich. In der Küche stand noch der Topf mit den Muschelschalen. Wenn sie es doch nur bis zum Telefon geschafft hätte.«
Da hatte er recht. Aber die Konjunktivspirale führte auch bei Toten zu nichts, und vor allem nicht zurück ins Leben.
Ich riss mich zusammen. »Und dann?«, fragte ich weiter. »Hast du gleich von dort den Notruf gewählt?«
»Ja, aber das Telefon ging nicht. Also bin ich durch die Gärten zu uns gelaufen. Ich habe Gitti zugerufen, dass Nelleke was passiert ist, und bin gleich ans Telefon gestürzt. Danach bin ich raus auf die Straße, weil der Notarzt gesagt hat, ich soll da auf ihn warten.«
Als durchlebte er die Szene wieder, war Holger mit jedem Wort schneller geworden und nun völlig außer Atem.
Automatisch atmete ich selbst langsam ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Bis er ruhiger wurde.
»Warum ist Gitti denn nicht mit dir auf die Straße gekommen?«
Holger schüttelte den Kopf. »Roos hat mit mir gewartet. Sie wohnt gegenüber. Als sie mich vor dem Haus gesehen hat, wusste sie gleich, dass was nicht stimmte, hat sie gesagt.«
»Und Gitti?«
»Ich weiß es nicht.« Wie ein kleiner Junge, den die Mutter hat stehen lassen, ließ Holger den Kopf hängen.
Eine Glocke ertönte. Ich zuckte zusammen.
»Gitti, endlich.« Holger griff mit der einen Hand nach einer Packung Papiertaschentücher, die auf der Ablage des Wohnzimmertischs lag, und winkte mit der anderen zur Tür. »Machst du auf?«
»Ja klar.« Ich erhob mich, zögerte. »Aber Gitti hat doch bestimmt einen …«
Der Schlüssel ging im erneuten Ding-Dong und Holgers Schnäuzen unter. Ich eilte zur Haustür und öffnete sie.
Ein Mann in einem gelben Papageienhemd, Bermudajeans und gelben Sneakers stand vor mir und musterte mich von Kopf bis Fuß. War ich ihm nicht bunt genug gekleidet in meiner kurzen Jeans und dem einfachen blauen Top? Ich überlegte gerade, ob ich ihm die Tür wortlos vor der Nase zuschlagen sollte, als er den Mund öffnete.
»Freddie, bist du’s?«
»Was? Ja, hallo, kennen wir uns?« Hatten Holger und Gitti mich etwa in der Nachbarschaft angekündigt, um mich zu verkuppeln?
Er lächelte kurz, und für eine Sekunde erinnerte er mich vage an … Wenn ich nur wüsste, an wen. Dann wurde seine Miene wieder ernst, der Erinnerungshauch schneller verweht als so mancher Sommer.
»Gitti?«, rief Holger aus dem Wohnzimmer.
Ich drehte mich kurz von der Tür weg. »Nein, es ist …«
»Theo.« Der Mann trat näher.
Und endlich fiel das kwartje. Theo vom Bungalowpark, Nellekes Sohn, der immer mit uns spielen musste. »Zeig den Kindern doch mal, wo der Spielplatz ist.« »Geh mit Freddie mal an den Strand.« Was immer wir wollten, musste er tun. Allerdings hatte ich mir auch Sachen gewünscht, die er machen wollte. Traktor fahren. Zugegeben, das wollte ich schon auch. Aber Kuchen backen hätte ich mir für mich nie ausgesucht. Nicht mal Sandkuchen hatte ich gern gebacken. Die schmeckten schließlich niemandem. Theos Kuchen, ein richtiger Kuchen, war dann aber echt lecker geworden.
»Mensch, dass du mich gleich wiedererkannt hast! Und das, wo die Haare ab sind.« Ich wuschelte mir durch meine nordseetaugliche Einfach-nur-kurz-Frisur und grinste. Bis mir einfiel, wie unangemessen das war. Sofort sanken meine Mundwinkel.
»Mein Beileid«, sagte ich und streckte den Arm halb aus, unsicher, ob ich ihm die Hand geben oder ihn lieber umarmen sollte.
»Bedankt.« Theo senkte den Blick und betrachtete die Fußmatte, als hätte er so etwas noch nie gesehen. »Die politie hat gesagt, dass dein Onkel sie gefunden hat.«
»Ja, hat er. Aber komm doch rein.« Entschuldigend trat ich beiseite.
Theo zögerte, dann schob er sich an mir vorbei in die gute Stube.
»Theo, mein Lieber, es tut mir so leid.« Holger war aufgestanden und ging mit ausgebreiteten Armen auf Theo zu.
Der ließ die Umarmung steif über sich ergehen. Eins, zwei, anstandsdrei, schon löste er sich und deutete zur Sitzgruppe. »Darf ich?«
Holger nickte und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, während Theo mangels Fußmatte nun den Teppich fixierte. Erst als Holger sich setzte, ließ auch er sich nieder.
Ich fragte, ob jemand einen Kaffee wolle, und war erleichtert, als beide verneinten und ich nicht in die Küche musste. Nicht, dass ich sensationslüstern bin, aber ich wollte wirklich wissen, woran Nelleke gestorben war.
Zunächst war es jedoch an Theo, Antworten zu bekommen, und so erzählte Holger erneut, wie er Nelleke gefunden hatte. Theos Gesicht schien mit jedem Satz ein wenig mehr Farbe zu verlieren. Gegen das grelle Gelb seines Hemdes wirkte es inzwischen so fahl wie junger Gouda.
Holger beendete seinen Bericht und stellte die Frage, die auch mir auf der Seele brannte. »Waren es die Muscheln?«
»Ik weet het niet. Meine Mutter kennt sich mit Muscheln aus. Besser noch als mein …« Theo presste die Lippen zusammen und betrachtete die beiden Gläser und den einsamen Becher auf dem Tisch, als hätten die was damit zu tun.
»Weiß man inzwischen, wer sie besucht hat? Nicht dass noch jemand gestorben ist.« Holgers Stimme schwankte. »In der Spüle stand das Geschirr von zwei Personen.«
»Ich weiß nicht«, wiederholte sich Theo auf Deutsch, ohne die Augen vom Couchtisch abzuwenden. Der hatte wohl plötzlich magische Kräfte entwickelt.
War es indiskret zu fragen, ob Nelleke einen Freund hatte? Ihr Mann, Theos Vater, war jahrelang ein Pflegefall gewesen und erst kürzlich verstorben. Wegen seiner Beerdigung hatten Holger und Gitti extra ihre Wohnungsaufgabe in Deutschland verschoben. Diese war dann ausgerechnet in die Woche gerutscht, in der ich zum Yogaseminar nach Domburg gefahren war, sodass ich sie nicht hatte besuchen können. Theo war wirklich zu bedauern, beide Elternteile so kurz hintereinander zu verlieren.
Ich sah ihn an. »Tut mir übrigens leid, das mit deinem Vater.«
Er ließ den Kopf noch tiefer hängen. Das hatte ich ja prima hinbekommen.
»War bestimmt auch nicht einfach für deine Mutter. Vielleicht war es ja ein Schlaganfall?«
Beide Männer starrten mich an.
Manchmal war es besser, die Stille auszuhalten, anstatt das Erstbeste zu sagen, das einem in den Sinn kam.
Das fand Holger wohl auch. Jedenfalls warf er mir einen vorwurfsvollen Blick zu. »Um Himmels willen! Nelleke doch nicht. Sie ist – war – viel zu jung für so was. Sie war ja noch jünger als ich.«
Alles klar. Ich schenkte mir den Kommentar, dass auch junge Leute – und jüngere Menschen als Holger – einen Schlaganfall erleiden konnten.
»Ich …« Theo räusperte sich. Der arme Kerl. Seine Mutter war gestorben, sein Vater tot, und wir stritten uns hier über das geeignete Alter zum Sterben. Verlegen rückte ich ein Kissen zurecht.
»Ich muss dann mal wieder.« Theo strich sich über die Oberschenkel, machte aber keine Anstalten zu gehen. Bestimmt grauste es ihm davor, allein zu sein. Ob er wohl verheiratet war?
Verstohlen schaute ich auf seine Hände. Ein dicker Siegelring, der so gar nicht zu ihm passte. Na ja, der nicht zu dem zehnjährigen Theo gepasst hätte, aber seitdem waren ja auch fünfundzwanzig Jahre vergangen.
Ich riss mich zusammen und lächelte ihn an. »Du kannst gern noch bleiben. Oder jederzeit rüberkommen, wenn dir danach ist.«
Das brachte ihn zum Aufstehen.
Wie er so dastand, erinnerte er mich an den kleinen Jungen von damals. Den Kopf gesenkt, die Hände hinter dem Körper, damit sie sich dort heimlich Halt geben konnten – genau die Pose hatte er angenommen, wenn er etwas ausgefressen hatte. Theo hatte eine fatale Neigung zum Geständnis gehabt, was mir so manches – aus meiner Kindersicht völlig unnötige – Problem beschert hatte. So genial er im Austüfteln unserer Streiche gewesen war, irgendwann hatte ihn immer die Reue gepackt.
Ich zählte innerlich bis drei. Auf die Sekunde genau hob er den Kopf, ließ die Hände zur Seite gleiten und sah meinen Onkel an. Gespannt beugte ich mich vor.
»Ihr habt doch einen Schlüssel für unser Haus. Kannst du mir den leihen?« Jetzt kamen die Hände nach vorn, und er spielte mit dem Siegelring.
»Ja klar.« Holger klopfte seine Hosentaschen ab. »Hm, da ist er nicht. Wo habe ich den denn hingetan?«
»In den Schlüsselfänger?« Ich sah Richtung Diele. Auch wenn sie noch nicht lange hier wohnten, hatten sie doch bestimmt einen von Gittis Schlüsselfängern angebracht. So nannte sie ihr Schlüsselaufhänger-Kunstwerk, das sie auf Märkten verkaufte. Auch bei meinen Eltern hing ein solches Teil, eine Art Fischernetz, nur in Klein, mit Haken für die Schlüssel. Das Netz war um ein Stück Treibholz drapiert, das an der Wand befestigt wurde. Im und am Netz hatte Gitti unzählige Muscheln fixiert, was dazu führte, dass man die Schlüssel kaum fand.
»Kannst du mal gucken?« Theo ließ den Ring um den Finger kreisen, als wäre es ein Hula-Hoop-Reifen. Wenn auch ein sehr enger. »Ich kann meinen nicht finden, und ich muss mich doch um alles kümmern.«
Ich warf Holger einen fragenden Blick zu und interpretierte sein Brummen als Zustimmung. Gefolgt von Theo ging ich in die kleine Diele. Der Schlüsselfänger hing neben der Garderobe über dem Schuhschrank. Allerdings konnten weder Theo noch ich den richtigen Schlüssel entdecken. Nachdem wir jede Muschel mindestens dreimal umgedreht hatten, erklärte ich die Suche für beendet.
»Wenn Gitti zurück ist, frage ich sie danach.« Ich drehte mich zu Theo. »Gibst du mir deine Nummer? Dann ruf ich dich an.«
Sofort nestelte er sein Smartphone aus der Brusttasche seines Hemdes, und wir tauschten unsere Kontakte aus. »Wo steckt denn deine Tante? Am Strand?«
»Vermutlich. Sie ist bestimmt bald wieder da.« Und zwar ganz bald, hoffte ich. Langsam machte mir ihre Abwesenheit wirklich Sorgen.
Theo öffnete die Tür, wandte sich noch mal kurz um. »Du rufst mich an, ja?«
Ich versprach es und sah ihm nach, wie er zum Haus seiner Mutter ging. Rettungs- und Notarztwagen waren inzwischen verschwunden. Aber die Polizei war nebenan noch zugange. Ins Haus durfte Theo jedenfalls nicht, sosehr er auch auf den Türsteherbeamten einredete.
Kein gutes Zeichen. Wenn die Polizei sich so intensiv für Nellekes Tod interessierte, hieß das, dass sie ein Verbrechen nicht ausschließen konnte.
Nachdenklich betrachtete ich das Nachbarhaus. Wer hätte Nelleke umbringen sollen? Eine fröhliche, offenherzige Frau. Manchmal vielleicht etwas zu laut und zu direkt. So jedenfalls hatte ich sie in Erinnerung. Eine ganz normale Frau. Und das hier war wirklich keine Gegend, in der Mörder herumliefen.
Wohl aber Fischer. Ein bärtiger Mann, der zwar weder Gummistiefel noch Gummihosen trug, dafür jedoch eine Mütze, die dem Käpt’n eines Kutters alle Ehre gemacht hätte, trat von der Straße her auf Theo zu. Wie Käpt’n Iglo sah er aus. Nur in grimmig. Als wollte er Theo an Ort und Stelle zusammenschlagen. Wenn nicht schon Polizei da gewesen wäre, hätte ich sie glatt gerufen. Der Typ gestikulierte zum Haus hin und redete auf Theo ein. Als der Streifenpolizist neugierig zu ihnen schaute, zog er Theo ein paar Schritte weg. Wieder fuchtelte er wütend mit den Händen rum.
Hatte Nelleke irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt? Als den Besucher, mit dem sie friedlich die Muscheln gegessen hatte, konnte ich ihn mir jedenfalls nicht vorstellen.
Endlich rührte sich Theo. Auch er deutete zum Haus.
Käpt’n Grimmig sah ihn ungläubig an und brach in lautes Gelächter aus. Fehlte nur noch, dass er sich auf die Schenkel klopfte vor Freude. Ganz anders als Theo. Der stand da wie ein Spieler im WM-Finale nach einem verschossenen Strafstoß.
Ich wollte schon zu ihm rauslaufen, um ihn zu trösten, als ein weiterer Mann auftauchte. Ein gut aussehender Typ, der auch einer dieser niederländischen Fußballgötter hätte sein können, Patrick Kluivert oder Memphis Depay, lief an den Autos vorbei und eilte auf Theo zu. Einer seiner Freunde? Oder ein Bekannter Nellekes?
Fußballgott umarmte Theo und schirmte ihn von Käpt’n Grimmig ab. Der winkte ab, schaute noch mal zu Nellekes Haus rüber und trollte sich. Fußballgott legte den Arm um Theos Schulter und brachte ihn zu seinem Wagen. Es war gut, dass er sich um ihn kümmerte. So etwas sollte niemand allein durchstehen müssen.
Apropos allein.
Wo zum Teufel steckte Gitti?
3
Genogramme – genograms
Montagabend
Um Holger auf andere Gedanken zu bringen, packte ich mein Genogramm von der Familienaufstellung aus. Wir konnten ja schlecht den ganzen Abend hier sitzen, der Sonne beim Untergehen zusehen, den Mond anheulen und auf ein Lebenszeichen von Gitti warten.
Ihre zeeländischen Bekannten hatten wir alle abtelefoniert. Meine heimlichen Anrufe in den Krankenhäusern auf Walcheren hatten zu nichts geführt, in diesem Fall war ich froh über das negative Ergebnis. Zur Polizei wollte Holger nicht, zumal die Frist für die Aufgabe einer Vermisstenanzeige ja noch nicht erreicht war. Mit Mühe hatte ich ihn vorhin wenigstens dazu gebracht, ein rozijnenbroodje mit Senf und Käse zu essen, aber danach saßen wir da und wussten nicht, was wir noch tun konnten. Ich wollte ihn schon zu einer Yogastunde überreden, als mir meine Familienaufstellung wieder einfiel. Er war bestimmt eher dazu bereit, ein paar Fragen zu meinen Eltern zu beantworten, als sich im herabschauenden Hund von Gitti erwischen zu lassen.
»So ein Genogramm macht man zur Vorbereitung«, erklärte ich und schlug mein Heft vor ihm auf. »Der Kreis mit dem Punkt in der Mitte bin ich. Das Quadrat und der Kreis darüber sind Vater und Mutter. Und du bist das Quadrat gleich daneben.« Gittis Kreis übersprang ich. Vielleicht war es doch keine gute Idee gewesen, mit dem Genogramm anzufangen. Ich sah zu Holger.
Der bemerkte meinen Blick und brummelte. »Sieht aus wie ein Stammbaum. Warum muss man dafür gleich wieder einen neuen Namen erfinden, den keiner versteht?«
»Na ja.« Ich betrachtete das Schaubild. »Da sind schon noch ein paar zusätzliche Informationen drin. Siehst du hier die kurze gestrichelte Linie vom Vaterquadrat zu diesem Fremdkreis?«
»Nein, dazu bräuchte ich meine Lesebrille, aber ich glaub dir, dass sie da ist.« Er sah nicht mal auf mein Heft. Fehlte nur noch, dass er zur Fernbedienung griff und mich aus- und stattdessen den Fernseher einschaltete.
Einatmen, ausatmen, ruhig bleiben. Holger hatte gerade erst eine Leiche gefunden, und seine Frau war verschwunden. Da war es nachvollziehbar, dass ihn gestrichelte Linien und komische Kreise wenig interessierten. Aber ich ließ nicht locker.
»Das stellt einen Seitensprung dar«, sagte ich.
»Was? Wie bitte?« Entsetzt stierte er mich an.
Wow! Mit so einem durchschlagenden Erfolg hatte ich nicht gerechnet.