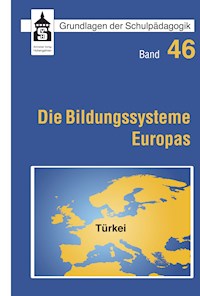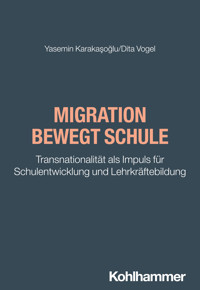
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Migration wird oft als ein mit der Zuwanderung nach Deutschland abgeschlossener Prozess betrachtet, dabei stellt für einen substantiellen Teil der SchülerInnen auch ein zukünftiges Leben im Ausland eine realistische Option dar - für kurze Zeit oder auf Dauer, aus Interesse oder gezwungenermaßen, während der Schulzeit oder danach. Mit transnationaler Mobilität adressieren die Autorinnen diese vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven als mit und durch Schule zu gestalten. Im Anschluss an eine theoretische und historische Einführung werden Impulse für Schulentwicklung und Bildung vorgestellt, die im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts in Kooperation mit Schulen im In- und Ausland entstanden sind. Illustrierte Handouts und Comics bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten für die LehrerInnenbildung und Schulentwicklung. Prof. Dr. Yasemin Karakasoglu und Senior Researcher Dr. Dita Vogel forschen zu Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Bremen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Einleitung
Ausgangspunkt
Zielgruppen
Positionierung der Autorinnen
Dank
Stil
Teil 1: Grundlagen
1 Leitende Begriffe und konzeptionelle Grundlagen
1.1 Transnationalität, Migration(en) und Mobilität
1.2 Schule in der Migrationsgesellschaft
2 Schulfunktionen im Kontext von transnationaler Mobilität
2.1 Sinnsystem-Reproduktionsfunktion
2.2 Kohäsionsfunktion
2.3 Politische Stabilisierungsfunktion
2.4 Qualifizierungsfunktion
2.5 Legitimierungsfunktion
2.6 Betreuungsfunktion
2.7 Transnationalität als Entwicklungschance
2.8 Bearbeitungsmöglichkeiten
3 Ein Rückblick auf Migrationsgeschichte und transnational relevante Beschlüsse der Kultusministerkonferenz
3.1 Migrationen prägen die Bevölkerung Deutschlands
3.2 Ein Rückblick in Phasen
1949 – 1961 Von der Gründung der deutschen Staaten bis zum Mauerbau: Gesonderte Schulen und unterschiedliche Regelungen für deutsche und ausländische Kinder
1961 – 1973 Vom Mauerbau bis zur Ölkrise – rechtliche Gleichstellung mit Verzögerungen und Einführung von Vorbereitungsklassen zum Deutschlernen
1973 – 1989 Von der Ölkrise bis zum Mauerfall: Rückkehr zur Rückkehrorientierung und Verantwortungsabweisung
1989 – 2003 Vom Mauerfall bis zur EU-Osterweiterung: Deutschlernen und gemeinsames Leben in kultureller Vielfalt
2003 – 2013 Von der EU-Osterweiterung bis zur Flucht über die Balkanroute: Internationalität für alle und defizitorientierte Zielgruppenförderung für Kinder mit Migrationshintergrund
2014 – 2022 Von Flucht über die Balkanroute bis zum Ukrainekrieg: zwei Perspektiven auf mitgebrachte Sprach- und Fachkenntnisse
3.3 Zentrale Aspekte
3.4 Bearbeitungsmöglichkeiten
Teil 2: Impulse zu ausgewählten Aspekten
4 Sechs Vignetten zu transnationaler Mobilität und wie sie diskutiert wurden
4.1 Die Arbeit mit Fallvignetten
4.2 Die Auswahl der Beispiele für die Vignetten
4.3 Erste Auslandserfahrungen in der Schulzeit gewinnen (Vignette Lisa)
4.4 Familienbedingt temporär ins Ausland (Vignette Felix)
4.5 Nach der Schule im Herkunftsland der Eltern studieren? (Vignette Maria)
4.6 Offene Planung schon bei der Einreise mit einem aus beruflichen Gründen migrierenden Elternteil (Vignette Thiago)
4.7 Im Jugendalter Zugewanderter mit Bleibewunsch bei ungewisser Bleibeperspektive (Vignette Amir)
4.8 Begrenzte Schulerfahrungen in drei Ländern und Abschiebungsandrohung (Vignette Jelena)
4.9 Bearbeitungsmöglichkeiten
5 Zur Bedeutung einer migrationssensiblen Haltung für die pädagogische Professionalität von Lehrkräften
5.1 Grundlegendes zu Haltung als Bestandteil pädagogischer Professionalität in der Schule der Migratonsgesellschaft
5.2 Die Sprache von Lehrer*innen als Ausdruck von Haltung
Haltung als pädagogischer Kompass
5.3 Beispiele für pädagogischen Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt
5.4 Stereotypen, Rassismen und Bildungschancen
5.5 Bearbeitungsmöglichkeiten
6 Multiprofessionalität und Multilingualität von Kollegien
6.1 Multiprofessionell ja – aber auch ein Team?
6.2 Kooperationsräume
6.3 Multiprofessionalität zur Ausdifferenzierung des Unterrichts
6.4 Multiprofessionalität zur Adressierung vielfältiger Persönlichkeitsentwicklungs- und Erziehungsbedarfe
6.5 Multilingualität
6.6 Einbeziehung von multilingualen und als mehrkulturell wahrgenommenen Professionellen in der Schule
6.7 Beispiele multiprofessioneller Kooperation an engagierten Schulen im Projekt TraMiS
6.8 Bearbeitungsmöglichkeiten
7 Aufnahmemodelle für Zugewanderte
7.1 Aufnahmemodelle – worauf es ankommen könnte
7.2 Ein integriertes Aufnahmemodell
7.3 Was wir über Wirkungen (nicht) wissen
7.4 Aufnahmemodelle in Aktion – Schlaglichter aus TraMiS-Schulen
7.5 Bearbeitungsmöglichkeiten
8 Zeugnisrelevante Anerkennung von migrationsbedingt relevanten Sprachen
8.1 Sprachenfächer und Schulabschlüsse
8.2 Fremdsprachenunterricht und Mehrsprachigkeit – quantitative Bedeutung
8.3 Veränderungsmöglichkeiten
8.4 Bearbeitungsmöglichkeiten
9 Befristete individuelle Auslandsaufenthalte
9.1 Temporäre Auslandsaufenthalte während der Schulbiographie – Umfang unbekannt
9.2 Institutionell organisierte Mobilität zu Lernzwecken – angestrebte Effekte
9.3 Temporäre Auslandsaufenthalte in Herkunftsland von Familienmitgliedern
9.4 Entwicklungsperspektiven für Schulen
9.5 Bearbeitungsmöglichkeiten
10 Schule-Eltern-Kommunikation in der Migrationsgesellschaft
10.1 Schule und Eltern in Recht und Bildungspolitik
10.2 Kommunikation als zentral in der Schule-Eltern-Beziehung
10.3 Eltern mit Einwanderungsgeschichte – eine besondere Gruppe?
10.4 Schule-Eltern-Kommunikation in Aktion: Schlaglichter aus TraMiS-Schulen
10.5 Bearbeitungsmöglichkeiten
11 Ausblick: Transnationale Mobilität und Migration als Motoren der Schulentwicklung
12 Epilog zum Forschungs- und Entwicklungsprojekt TraMiS
Vorgehensweise
Anhang
Literatur
Brennpunkt Schule
Herausgegeben von Fred Berger, Doris Lindner, Wilfried Schubarth, Sebastian Wachs und Alexander Wettstein
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände dieser Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/brennpunkt-schule
Die Autorinnnen
Prof. Dr. phil. Yasemin Karakaşoğlu ist Leiterin des Arbeitsbereichs Bildung in der Migrationsgesellschaft/Interkulturelle Bildung und Hochschullehrerin am Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Universität Bremen.
Dr. Dita Vogel forscht und lehrt als Senior Researcher im Arbeitsbereich Bildung in der Migrationsgesellschaft/Interkulturelle Bildung an der Universität Bremen.
Yasemin Karakaşoğlu, Dita Vogel
Migration bewegt Schule
Transnationalität als Impuls für Schulentwicklung und Lehrkräftebildung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-037218-4
E-Book-Formate:pdf:ISBN 978-3-17-037219-1epub:ISBN 978-3-17-037220-7
Einleitung
Mit diesem Buch möchten wir Impulse setzen für eine Lehrer*innenbildung und Schulentwicklung, die migrationsgesellschaftliche Veränderungen von Schule nicht nur aus der Perspektive von Migration – verstanden als eigene Zuwanderung bzw. in der Vergangenheit liegende familiäre Migrationserfahrung – betrachtet. Wir wollen dazu beitragen, den Blick zu erweitern auf die Normalität transnationaler Mobilität als Erfahrung von Schüler*innen, die in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegen kann und damit das Selbstverständnis von Schule grundlegend betrifft. Wir möchten die Aufmerksamkeit auf damit verbundene Transformationsanforderungen an Schule und Lehrer*innenbildung legen.
Ausgangspunkt
Ausgangspunkt der Überlegungen zur transnationalen Mobilitätsperspektive in diesem Buch war unsere Wahrnehmung eines Widerspruchs: Migration ist in Deutschland durch wachsende Bevölkerungsanteile mit unterschiedlichen Migrationsbezügen bei gleichzeitig beachtlicher Fluktuation gekennzeichnet, aber die Konzepte zur schulischen Integration haben sich bislang meist auf singuläre Dimensionen von Wanderung ausgerichtet. In den Anfängen der Bundesrepublik wurde davon ausgegangen, dass ausländische Staatsangehörige das Land bald wieder verlassen und der deutsche Staat kaum Verantwortung für die befristet anwesenden Kinder übernehmen muss. Inzwischen ist die schulische Bildungspolitik so ausgerichtet, als würden alle Kinder auf Dauer in Deutschland bleiben, so dass der Staat keine Verantwortung für den Nutzen der Bildung im Fall einer Rückkehr oder Weiterwanderung trägt. Im Fokus ist die »Integration«, verstanden als Anpassung von Zugewanderten an die etablierte Ordnung der Schule, die den Nationalstaat Deutschland als Erfahrungshorizont, als Ausgangs- und Zielperspektive von Bildung definiert.
Damit wird nicht nur die Lebensrealität all derjenigen Kinder und Jugendlichen nicht adäquat berücksichtigt, die nach vorheriger Zuwanderung zurückkehren oder weiterwandern wollen oder müssen, sondern auch derjenigen, die einen befristeten Auslandsaufenthalt planen oder sich die Option eines Lebens in zwei oder mehr Ländern offen halten wollen oder sollen. Das betrifft z. B. auch in Deutschland geborene und aufgewachsene Schüler*innen, deren Eltern mit ihnen in Zukunft zeitweise oder dauerhaft ins Ausland gehen wollen oder die sich das selbst für ihre Zukunft vorstellen. Wie dieser Widerspruch aufgelöst werden kann, erfordert theoretische und empirische Forschung – eine Forderung, die auch in internationalen Fachdebatten geäußert wird (Zapata-Barrero 2017, 15).
Ein inklusiver, migrationsgesellschaftlich informierter Ansatz müsste eine Anpassung der Schule an die transnationalen Bildungswelten der Schüler*innen berücksichtigen, die durch eine Orientierung der Bildungsvorstellungen an mehr als einem Land geprägt sind. Diesen Ansatz verfolgen wir in diesem Buch. Dazu lassen sich viele Fragen stellen, zu deren Beantwortung dieses Buch Anstöße liefern will, z. B.: Was bedeuten transnationale Bildungswelten für das Selbstverständnis von Schulen und ihren Bildungsauftrag? Wie kann für die Thematik angemessen sensibilisiert werden? Welches Wissen brauchen Professionelle und welche Haltung müssten sie einnehmen? Wie müssten Teams aussehen? Wie müssten Lehrpläne, Prüf- und Aufnahmeprozesse überdacht werden? Was bedeutet das für die Schule-Eltern-Kommunikation?
Zielgruppen
Erste Zielgruppe des Buchs sind pädagogisch Professionelle in Schulen, die an Schulentwicklungsprozessen im Kontext Migration, Mehrsprachigkeit und transnationale Mobilität interessiert sind. Das Buch kann zum Beispiel in Schulentwicklungsgruppen oder als Unterstützung für schulinterne Fortbildungen genutzt werden. Darüber hinaus soll es Material für die Lehrer*innenbildung in allen Phasen bieten. Die einzelnen Kapitel sind so konzipiert, dass sie sich auch als Module für themenspezifische Workshops, Lerneinheiten und Seminare eignen.
Das Buch besteht aus zwei Hauptteilen sowie einem Ausblick und einem Epilog. Im Teil 1 werden grundlegende Aspekte zum Verständnis des Themas gelegt und Hinweise auf weiterführende Literatur gegeben. In Teil 2 werden Impulse zur Schulentwicklung und Bildungspolitik vorgestellt, die sich aus der erweiterten Perspektive transnationaler Mobilität als Entwicklungsbedarfe für Schule darstellen. Diese Impulse bilden keine, das möchten wir betonen, umfassende oder gar erschöpfende Bestandsaufnahme aller Entwicklungsbedarfe in der Schule der Migrationsgesellschaft – das würde die Möglichkeiten dieses überschaubaren Bandes übersteigen.
Vielmehr konzentriert sich das Buch auf Aspekte, die wir im Kontext transnationaler Mobilität als zentral betrachten. In jedem Kapitel wird zunächst anhand eines Comics oder Handouts1 zur Reflexion über den dargestellten Sachverhalt aufgefordert. Dann folgt ein einführender Text in die Thematik. Die Kapitel werden mit Ideen zur Bearbeitung des Themas in Lehre und/oder Schulentwicklung abgeschlossen, der je nach Kontext angepasst werden kann.
Positionierung der Autorinnen
Wir sind zwei Autorinnen, die in der deutschen Migrationsgesellschaft biographisch wie fachlich unterschiedlich positioniert sind und die seit den 1990er Jahren ihre Entwicklungen forschend beobachtet und begleitet haben. Viele unserer Projekte sind dadurch gekennzeichnet, dass wir direkt mit pädagogischen Praktiker*innen und bildungspolitischen Akteur*innen an konkreten Schulentwicklungsvorhaben mitwirken. Da wir Selbstreflexion und Positionierung in allen lehrenden und forschenden Berufen für wichtig halten (▸ Kap. 6), möchten wir in einer persönlichen Form einige Anmerkungen zu unserer jeweiligen Verbundenheit mit der Thematik voranstellen.
Vorangestellt sei das, was uns beide verbindet. Dazu gehört, dass wir aus anderen akademischen Disziplinen im Zuge unserer akademischen Laufbahn zur erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung gefunden haben. Wir forschen multi-methodisch, inspiriert durch unterschiedliche theoretische Bezüge und überwiegend unter Verwendung qualitativer Methoden. Dabei interessieren uns besonders bildungspolitisch bedeutsame Fragen der Migrationsgesellschaft, die wir in kritisch-konstruktiver Weise forschend und entwickelnd aufgreifen. Wir möchten damit einen (hoffentlich) relevanten Beitrag zum Verständnis und zur Entwicklung von Handlungsperspektiven mit der und für die pädagogische Praxis leisten.
Yasemin Karakaşoğlu: Ich komme aus einem deutsch-türkischen Elternhaus und bin zweisprachig aufgewachsen. Bereits in jungen Jahren bin ich innerhalb Deutschlands vielfach umgezogen und habe im Grundschulalter eine Pendelmigration zwischen Deutschland und der Türkei erlebt. All meine Sommer verbringe ich seitdem dort. Zweisprachigkeit prägt auch mein heutiges, transnationales Familienleben. Diese Orientierung hat mich immer begleitet. In Hamburg und zwischenzeitlich als Gaststudentin auch in Ankara habe ich Turkologie mit den Nebenfächern Germanistik und Politikwissenschaft studiert. Meine ersten beruflichen Erfahrungen sammelte ich an einem Forschungsinstitut zur Türkei und türkischen Migration nach Deutschland. Den Wechsel zur erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung vollzog ich im Rahmen der Erstellung meiner Dissertation zu religiösen Orientierungen und Erziehungsvorstellungen bei Lehramts- und Pädagogik-Studentinnen im Ruhrgebiet. Meine wissenschaftliche Arbeit als Professorin und Leiterin des Arbeitsbereiches Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Bremen, in deren Mittelpunkt Schulentwicklung und pädagogische Professionalität in der Migrationsgesellschaft steht, verstehe ich auch als Teil meines gesellschaftspolitischen Engagements.
Dita Vogel: Ich bin in einem Dorf am Rande einer westdeutschen Großstadt monolingual deutsch aufgewachsen. Meine Mutter hat ihr Leben lang in ihrem Geburtsort gewohnt. Die Familie meines Vaters ist durch Flucht und Migration während und nach dem zweiten Weltkrieg geprägt. Als ich Anfang der 1990er Jahre nach einer journalistischen Ausbildung und einem Studium der Volkswirtschaftslehre mit historischem Schwerpunkt an der Universität Bremen promoviert habe, lag mein Büro über einer Turnhalle, in der Asylsuchende untergebracht waren. Seitdem habe ich überwiegend interdisziplinär und international vergleichend zu Migrationsfragen geforscht, u. a. zu Arbeitsmarktintegration und gesellschaftlichem Engagement von Zugewanderten, irregulärer Migration und Migrationspolitik. Eine erziehungswissenschaftliche Perspektive konnte ich mir zunächst in der Zusammenarbeit mit Rudolf Leiprecht an der Universität Oldenburg und ab 2012 mit Yasemin Karakaşoğlu an der Universität Bremen aneignen und darin meinen heutigen Schwerpunkt auf bildungspolitische und rechtliche Rahmenbedingungen für Migration und Mehrsprachigkeit in Sekundarschulen entwickeln.
Dank
Große Teile dieses Buchs basieren auf der Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Projekt Transnationale Mobilität in Schule (TraMiS)2, zu dem wir deshalb einen detaillierten Epilog angehängt haben. Die hier präsentierten Erkenntnisse hätten wir ohne die aktive Mitwirkung von Kooperationspartner*innen in diesem Projekt nicht erreichen können.
Daher möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal dafür bedanken, dass Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen aus Kooperationsschulen in Deutschland, Kanada, den USA, Italien und Schweden ihre Sichtweisen auf transnationale Mobilität, Migration und Mehrsprachigkeit und ihre Ideen für schulische Veränderungsmöglichkeiten mit uns geteilt haben. Dank gilt auch der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie der Freudenbergstiftung sowie den Critical Friends aus Wissenschaft und pädagogischer Praxis, die uns mit ihrem Rat im gesamten Projekt begleitet haben.3 Das gilt auch für das Team des Arbeitsbereichs Bildung in der Migrationsgesellschaft, das immer wieder eigene Expertise und auch Arbeitszeit eingebracht hat.
Unserer besonderer Dank geht an die beiden hochmotivierten Projektmitarbeiter Torben Dittmer und Matthias Linnemann, die am gesamten Forschungsprozess und der Erstellung der Projekt-Materialien beteiligt waren. Mit ihrem Einverständnis haben wir in diesem Buch auf gemeinsam erstellte Materialien zurückgegriffen.
Abschließend möchten wir den Herausgeber*innen der Reihe danken, die uns zu einer Veröffentlichung in diesem Rahmen eingeladen haben und den Fertigstellungsprozess mit viel Geduld begleitet haben.
Stil
Wir haben uns bemüht, die kurzen Kapitel für dieses Buch anschaulich und anregend zu schreiben, so dass Professionelle aus der Praxis sie lesen und nutzen mögen. Uns ist bewusst, dass wir dabei nicht auf alle Kolleg*innen in der Wissenschaft hinweisen konnten, die zu den Themen relevante theoretische Ausführungen und Studien publiziert haben. Vielen Kapiteln liegen jedoch längere Arbeitspapiere oder Aufsätze zugrunde, die wir an anderer Stelle publiziert haben und die eine vertiefte wissenschaftliche Beschäftigung mit den Themen sowohl abbilden wie ermöglichen.
Wir wünschen den Lesenden, dass sie für sich persönlich, für ihre Lehre in Schule und Hochschule, für ihre Schulentwicklungsgruppe oder für sich als bildungspolitisch aktiver Mensch in diesem Buch inspirierende Anregungen und weiterführende Informationen finden, die sie produktiv nutzen können.
Endnoten
1https://arindacraciun.com/
2Das Forschungs- und Entwicklungsprojekts Transnationale Mobilität in Schulen wurde von 2/2018 – 4/2021 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Programm ›Migration und gesellschaftlicher Wandel‹ (01UM1803Y) gefördert.
3Insbesondere Elina Stock, Referentin beim Hauptvorstand der GEW, Pia Gerber, Geschäftsführerin der Freudenberg Stiftung, Prof. Dr. Viola Georgi, Professorin für Diversity Education an der Universität Hildesheim, Dr. Marguerite Lukes, Research Director of the Internationals Network for Public Schools; New York, Prof. Dr. Paul Mecheril, Professor für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Migration an der Universität Bielefeld, Petra Perplies, Leitung des Landesinstituts für Schule in Bremen, Prof. Dr. Anatoli Rakhkochkine, Professor für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Diversity Education und internationale Bildungsforschung an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Beate Seusing, MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen
Teil 1:Grundlagen
Im Teil 1 werden grundlegende Aspekte zum Verständnis des Themas gelegt und Hinweise auf weiterführende Literatur gegeben.
1 Leitende Begriffe und konzeptionelle Grundlagen
In diesem Kapitel geht es darum, nachvollziehbar zu machen, warum wir auf bestimmte Begriffe und leitende Konzepte zurückgreifen und an welche Fachdiskurse wir mit unseren Ausführungen anschließen. Denn wir bewegen uns mit schulischer Bildung und Schulentwicklung unter den Bedingungen transnationaler Mobilität und Migration – wie im Folgenden zu zeigen sein wird – in einem breiten, sehr dynamischen und wissenschaftlich wie politisch durchaus umkämpften Forschungs- und Praxisfeld der erziehungswissenschaftlichen Migrationsforschung und der Schulentwicklung. Die Bezüge sollen hier angemessen gewürdigt werden, da wir an vielen Stellen dieses Buches wieder auf sie zurückgreifen.
1.1 Transnationalität, Migration(en) und Mobilität
Dass wir von transnationaler Mobilität als zentralem Konzept sprechen, ist keineswegs selbstverständlich. Zwar wurde bereits seit den 1990er Jahren die Perspektive der Transnationalität in der Migrationsforschung eingeführt (Glick Schiller, Basch und Blanc-Szanton 1992). In der deutschen erziehungswissenschaftlichen Debatte wurde sie jedoch erst rund ein Jahrzehnt später aufgegriffen (Gogolin und Pries 2004; Adick 2005) und ist dort inzwischen theoretisch wie empirisch etabliert (vgl. dazu die Beiträge in Heinrich/Hummrich 2023). Diese Perspektive geht davon aus, dass es nicht nur zeitlich und räumlich befristete sowie maßgeblich auf Einwanderung ausgerichtete Migrationen gibt, sondern dass auch Mehrfachmigrationen einen »Normalzustand« der Lebensorientierung von Menschen weltweit darstellen. Diese Praxis wird als Transmigration bezeichnet. Mehrfachmigration führe dann zur Herausbildung von auf Dauer angelegten transnationalen Sozialräumen (Gogolin und Pries 2004), die als »neue soziale Alltags- und Lebenswelten quer zu der Ankunfts- und der Herkunftsgesellschaft« vorgestellt werden – also als ein zwei Gesellschaften sozial und kulturell verbindendes Phänomen, an dem einzelne Menschen in unterschiedlichem Umfang teilhaben können, z. B. über zwei oder mehrere Staaten übergreifende Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen oder soziale Netzwerke.
Die Rede von der Ankunfts- und Herkunftsgesellschaft ist allerdings immer noch der Vorstellung verhaftet, dass Migration grundsätzlich eine eindeutige Richtung mit Anfangs- und Endpunkt hat. Dabei erscheint es uns – um ein illustratives Beispiel zu wählen – durchaus nachvollziehbar, dass es in Familien, die z. B. seit Generationen im Sommer in Deutschland leben und Eisdielen betreiben und im Winter in den Dolomiten leben, zumindest nicht für alle Kinder eine eindeutige Antwort auf die Frage nach der Herkunftsgesellschaft geben muss.4 Für die Wahrnehmung von Herausforderungen in Schulen durch transnationale Mobilität steht im Vordergrund, dass Wanderung zwischen verschiedenen (National-)Staaten nicht eine einmalige und endgültige Angelegenheit sein und Schule sich auf diese Lebensrealität einstellen muss. Ergänzend sei angemerkt, dass transnationale Räume nicht zwingend nur durch Migration entstehen müssen, sondern dass auch Grenzräume und digitale Räume Anlässe zu transnationalen Orientierungen geben können.
Migrationen (im Plural, da es sehr unterschiedliche Formen gibt, s. u.) werden als eine Verlagerung des Wohnsitzes im Raum beschrieben. Meist wird der Begriff verwendet, wenn nationalstaatliche politische Grenzen überschritten werden. Migrant*innen überschreiten aber auch ökonomische, kulturelle, sprachliche und symbolische Grenzen meist nationalstaatlich verfasster Gesellschaften und irritieren so nicht selten die Vorstellung einer Unhinterfragbarkeit dieser Grenzen. Spezifische Formen von Migration werden als Ein- oder Auswanderung, Pendel-, Ketten-, Transmigration, temporäre und zirkuläre Migration, Fluchtmigration und irreguläre bzw. illegalisierte Migration adressiert, je nach angenommener Dauer, Wiederholung und Rechtsstatus.
Mehrfachmigrationen stoßen im deutschen schulischen Kontext vielfach auf Unkenntnis und Unverständnis bei Lehrkräften, so dass mitgebrachte Sprachkenntnisse und Wissensressourcen bislang eher nicht wahrgenommen werden und der Wunsch, Bezüge zu transnationalen Bildungswelten aufrecht zu erhalten, etwa über den Erhalt und Ausbau von anderswo erworbenen Sprachen und Rückbezüge auf anderswo erworbene Wissensbestände, auf Ablehnung stößt (Bukus 2015, 82). Für Kinder und Jugendliche, die vor dem russischen Angriffskrieg seit 2022 aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, wurde teilweise ermöglicht, ukrainische Abschlüsse auch in Deutschland weiterverfolgen zu können und Fachunterricht teilweise auch auf Ukrainisch zu erhalten. Ob und wie das auch auf andere Schüler*innengruppen erweitert wird, ist derzeit nicht absehbar. In der generellen bildungspolitischen Debatte in Deutschland bleibt die Perspektive auf Migration meist beschränkt auf unidirektionale »Einwanderung« (J. Schroeder und Seukwa 2018; Karakaşoğlu und Vogel 2020) und die pädagogische Anforderung beschränkt auf eine »Integration« in das Bestehende, so dass vor allem eine Beherrschung der deutschen Sprache und Kenntnisse kultureller und politischer Institutionen sowie historisch relevanter Ereignisse für den heutigen Raum des Staats Deutschland erwartet werden.
Dabei wird oft nicht ausreichend berücksichtigt, wie sich dieser soziale Raum unter dem Einfluss von Migrationen verändert. Mit dem Migrationshistoriker Jochen Oltmer (2012, 15; 2012) stellen wir fest: Migrationen tragen »zu Transformationsprozessen bei – sie verändern die Zusammensetzung von Bevölkerungen, modifizieren ökonomische und soziale Strukturen, religiöse Praktiken oder künstlerische Ausdrucksformen«.
Wie wir in Kapitel 4 (▸ Kap. 4) zeigen werden, ist die gegenwärtige Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland stark durch Migration(en) geprägt, so dass es angemessen ist, von Deutschland als einer »Migrationsgesellschaft« zu sprechen. Die Migrationsgesellschaft, zu der sich Deutschland in den vergangenen 70 Jahren gewandelt hat, ist gekennzeichnet durch eine Vervielfältigung, Übersetzung und Vermischung von Sprachen, Religionen und anderen kulturellen Ausdrucksformen, durch die Entgrenzung von Zukunftsorientierungen, durch neue ›hybride‹ individuelle und kollektive Identitäten, neue Formen transnationaler Zugehörigkeiten, Selbst- und Fremdzuschreibungen (Ein-/Ausgrenzung) in gesellschaftlichen Macht- und Hierarchieverhältnissen und nicht zuletzt durch Strukturen und Prozesse von Diskriminierung und Rassismus, aber auch deren Bekämpfung (Karakaşoğlu und Mecheril 2019).
Mobilität wird umfassender als Migration in einem weiten Sinn für die räumliche Bewegung von Menschen über Grenzen von Staaten verwendet. Die Statistikabteilung der Vereinten Nationen nutzt internationale Mobilität als Oberbegriff für alle räumlichen Bewegungen u. a. von Personen über Staatsgrenzen. Wenn jemand seinen Wohnort mit der tatsächlichen oder beabsichtigten Dauer von mindestens einem Jahr verlagert, wird die Person als Immigrant im statistischen Sinn bezeichnet (United Nations 2017, 7). In der dazugehörigen Statistik geht es um die Messung von in der Vergangenheit liegenden Vorgängen.
Mobilität verweist auf die Anerkennung der dynamischen und oft fluiden Natur von Migrationen (Triandafyllidou und Gropas 2014, 8). Die Verwendung von Mobilität betont, dass Migration ein offener Prozess ist, der zu vielfältigen Verbindungen zwischen Ländern führt und wiederholte Bewegungen mit unterschiedlicher Länge beinhalten kann (Pries 2012, 392). Im Gegensatz zu Migration ist der Begriff Mobilität und sind die mit ihm verbundenen Phänomene »durchweg positiv konnotiert« (Lehnert und Lemberger 2014, 45). Er steht z. B. für Aufbruch, Innovation, Flexibilität, Zukunftsorientierung.
Wenn wir von transnationaler Mobilität sprechen, beziehen wir Erwartungen an die Zukunft ein: dass Menschen zukünftige Migration in andere Länder als eine Möglichkeit der Zukunftsgestaltung betrachten oder aufgrund ihres aktuellen Aufenthaltsstatus zu betrachten gezwungen sind. Die Verwendung von Mobilität betont, dass grenzüberschreitende Migration zum mentalen Möglichkeitsraum gehört, unabhängig davon, ob sie konkret geplant oder tatsächlich möglich ist (Karakaşoğlu und Vogel 2019, 96).
Diese Erweiterung ist für erziehungswissenschaftliche Perspektiven hochgradig relevant, denn Bildung hat immer einen Zukunftsbezug. Bildungspolitische Debatten thematisieren, was Kinder und Jugendliche für die Zukunft lernen sollen. Was als sinnvoll erachtet wird, hängt auch davon ab, welche Lebensorte in den Zukunftserwartungen der Schüler*innen, der Eltern und des Staates als relevant und legitim angesehen werden.
Abbildung 1 fasst einige zentrale Aspekte vereinfacht zusammen und thematisiert, dass sich Schulen auf die Vielfalt und Unabgeschlossenheit von Migrationsprozessen einstellen müssen.
Abb. 1:Migration und Mobilität (Quelle: Transnationale Mobilität in Schulen. Impulse, Februar 2021; https://tramis.de/wp-content/uploads/2021/02/08_Handout_Migration-und-transnationale-Mobilita%CC%88t_fin.pdf)
1.2 Schule in der Migrationsgesellschaft
Schulen in Deutschland haben sich – das ist unsere zentrale These und Ausgangpunkt für die hier vorgestellten Ideen zur Schulentwicklung – noch nicht bzw. nicht ausreichend mit dieser umfassenden migrationsgesellschaftlichen Transformation auseinandergesetzt. Neu-Zugewanderte und Schüler*innen, die in ihrer Zukunftsperspektive nicht (allein) auf Deutschland ausgerichtet sind, treffen in der Schule in Deutschland (und an vielen anderen Orten der Welt) auf eine Institution, die auf Kontinuität im selben System angelegt ist, wie Schroeder und Seukwa treffend formuliert haben:
In der altersphasenspezifischen Gliederung des Bildungssystems vom Kindergarten bis zur Seniorenbildung bauen die einzelnen Bildungssegmente aufeinander auf, und gesellschaftlich wird erwartet, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Bildungssystem ohne Unterbrechung durchlaufen (zeitliche Kontinuität). [...] in Nationalgesellschaften wird stillschweigend davon ausgegangen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein einziges Bildungssystem – nämlich das des Landes der Geburt – durchlaufen (räumliche Kontinuität). (J. Schroeder und Seukwa 2018, 141)
Bevor wir in Kapitel 3 (▸ Kap. 3) ausarbeiten, wie die Funktionen von Schule transnational erweitert werden könnten, seien hier zentrale Ansätze der erziehungswissenschaftlichen Forschung und Lehre aufgegriffen, auf deren Erkenntnissen wir aufbauen.
Lange Zeit wurde Forschung und Lehre zum Themenfeld Migration und Bildung vor allem unter der Bezeichnung Interkulturelle Bildung durchgeführt, womit die Kategorie ›Kultur‹ zentral gesetzt wurde. Wir verstehen Kultur als »als ein bestimmtes Repertoire von Bedeutungsmustern und Zeichensystemen (Werte, Normen, Bräuche und andere Verhaltensregeln, allgemeine Wissensbestände und ›Selbstverständlichkeiten‹, Traditionen, Rituale, Routinen, Glaubensvorstellungen, Mythen usw.), über das Gruppen oder Gesellschaften verfügen« (Leiprecht 2004, 11). Dieses Repertoire, das gleichwohl nicht statisch ist, sondern sich stetig an neue Gegebenheiten anpassen kann, stiftet Gemeinschaft, hat Orientierungsfunktion, macht das Leben verstehbar und bedeutungsvoll.
Migrationen haben das Potential, kulturelle Selbstverständlichkeiten zu irritieren und in Frage zu stellen. Das gilt schon für die Migration vom Land in die Stadt oder von Schleswig-Holstein nach Bayern, aber erst recht für Migration über die Grenzen nationalstaatlich verfasster Räume. Solche Irritationen können Konflikte erzeugen, die aber zugleich Möglichkeiten für individuelles und gesellschaftliches Wachstum bieten, wenn Kultur als menschliches Konstrukt begriffen wird, das von einzelnen und Gruppen weiterentwickelt werden kann.
Eine alleinige Fokussierung auf Kultur als zentraler Differenzkategorie in der Migrationsgesellschaft, wie sie die Bezeichnung Interkulturelle Bildung nahelegt, birgt jedoch Risiken, denn dabei werden die Effekte sozialer Ungleichheit und migrationsgesellschaftlicher Macht- und Hierarchiebeziehungen ausgeblendet. Postkoloniale und rassismuskritische Ansätze kritisieren die in frühen Konzepten Interkultureller Bildung verbreitete Konstruktion von hierarchisierenden Dichotomien in »deutsch« und »nicht-deutsch«, »wir« und »nicht-wir«, »einheimisch« oder »eigen« und »fremd« bzw. »anders« (Mecheril et al. 2010, 13). Als rassismuskritische und die Folgen von Postkolonialität berücksichtigende Alternative zu Interkultureller Bildung versteht sich in Deutschland der Ansatz der Migrationspädagogik (Mecheril et al. 2010) bzw. – für den angloamerikanischen Kontext – derjenige der Critical Race Theory (Gillborn et al. 2018). Wir sehen in der Adressierung von Rassismus als strukturelles Problem, das in Bildungssystemen reproduziert wird, einen Mehrwert dieser Ansätze gegenüber klassischen Konzepten Interkultureller Bildung. Zugleich fordern dezidiert kritische Varianten Interkultureller Bildung (u. a. von Hormel und Scherr 2004) durchaus dazu auf, »Kultur als identitätspolitisch umkämpfte Zone sichtbar und zum Gegenstand von Forschung zu machen, ihre ständige Bearbeitung und Veränderung im Rahmen kultureller Praxis zu berücksichtigen sowie Formate intersektionaler Überschneidungen und Auseinandersetzungen mit anderen Differenzmarkierungen – wie Klasse, Ethnizität, ›Rasse‹, Geschlecht – bei der Betrachtung kultureller Prozesse zentral zu stellen« (Römhild 2018, 19). Ein solches Verständnis einer kritischen interkulturellen Bildung betrachten wir als wichtigen Bestandteil allgemeiner Bildung in der Migrationsgesellschaft.
Wir gehen für unsere Schulentwicklungsüberlegungen davon aus, dass die transnationalen Erfahrungen der Vergangenheit und Optionen der Zukunft eingebettet sein müssen in ein inklusives Verständnis von Schule. In der inklusiven Pädagogik ist allgemein die Anpassung der Schule an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden Programm (Wocken 2010), auch wenn Inklusion in öffentlichen Debatten und administrativen Umsetzungen im deutschen Kontext oft darauf reduziert wird, Kinder mit besonderen Bedarfen aufgrund von körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen in Regelschulen zu unterrichten. Inklusive Bildung bezeichnet ein sehr viel weiteres und nicht auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtetes Verständnis, einen Prozess der Adressierung der diversen Bedarfe aller Kinder und Jugendlichen einer Altersgruppe als strukturelle Verankerung und damit als Verantwortung des Regelsystems der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (UNESCO 2009, 8).
Ein weiterer normativer Bezugspunkt sind für uns die Debatten um Globales Lernen/Transformative Bildung. Dies betrifft insbesondere die Bildungsinhalte, die durch Schule vermittelt werden. Kern der Überlegungen ist, dass eine nationalstaatliche Beschränkung der Inhalte und Methoden von schulisch vermittelter Bildung globale ökologische, wirtschaftliche, politische und kulturelle Zusammenhänge, damit auch das Machtgefälle zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden ausblendet. Gefordert wird aus der Perspektive transformativer Bildung die Vermittlung einer systemisch begründeten, weltbürgerlichen Perspektive, die prägnant in dem Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung, anknüpfend an die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN-Sustainable Development Goals), formuliert werden. Es geht dabei um die »Wechselwirkung globaler Abhängigkeiten und Verantwortungen« (Overwien 2018, 252) und das Bewusstsein für die persönliche Beteiligung an Transformationsprozessen der Weltgesellschaft. Im an das Globale Lernen anschließenden Diskurs über transformative Bildung »wird davon ausgegangen, dass ein Nachdenken über und Handeln für Nachhaltigkeit kulturell und biographisch in den Identitäten von Lernenden stark verankert ist und Lernende daher von Methoden profitieren, die sie dazu befähigen, einen selbstorganisierten Prozess der Auseinandersetzung mit Wissen, Werten und Emotionen im Kontext der Nachhaltigkeit aufzunehmen« (Singer-Brodowski 2016, 16). In diesem Sinne wird im folgenden Kapitel über die Funktionen von Schule in der Migrationsgesellschaft nachgedacht.
2 Schulfunktionen im Kontext von transnationaler Mobilität
»Die gefährlichsten Schulwege der Welt« heißt eine Serie von Dokumentationen, in denen Kinder begleitet werden, die lange und gefährliche Wege z. B. über Flüsse, Seen und Berge zurücklegen, um zu einem Gebäude zu gelangen, indem sie mit anderen Kindern unter Anleitung einer Lehrerin oder eines Lehrers lernen. Im Fokus stehen die Gefahren und die Anstrengungen der Kinder, um diese zu überwinden – im Hintergrund ist eine grundlegende Annahme: Schulische Bildung ist diese Anstrengungen wert und erfüllt eine Funktion für Kinder und Eltern.5 Dass es fast überall auf der Welt ein öffentlich organisiertes und zumindest teilweise öffentlich finanziertes Bildungswesen gibt, verweist darauf, dass Schulen nicht nur Funktionen für Schüler*innen und ihre Eltern, sondern auch für Kollektive wie Kommunen oder Nationalstaaten erfüllen. Funktionen können manifeste im Sinne von erwünschten und rechtlich anerkannten Leistungen für andere Systeme betreffen oder latente Leistungen, die aus den Wirkungen hergeleitet werden können.
Zum Nachdenken über die Funktionen von Schule nehmen wir auf das viel zitierte Buch von Fend (2008) Bezug, das ein hilfreiches theoretisches Gerüst liefert. Das Bildungssystem erfüllt nach Fend »aus gesamtgesellschaftlicher Sicht« »vor allem die Funktion der Reproduktion und Innovation von Strukturen von Gesellschaft und Kultur beim biologischen Austausch der Mitglieder« (Fend 2008, 49). Die Zusammensetzung einer Bevölkerung ändert sich aber nicht nur durch Geburten und Todesfälle, sondern auch durch Migration. Eine weitere Verengung: Die gesellschaftlichen Funktionen von Schule werden als Funktionen für eine nationale Gesellschaft gedacht, in der ein »inneres Gefühl der Zusammengehörigkeit, des gemeinsamen Schicksals und der gemeinsamen Verpflichtungen« die Grundlage für die Existenzfähigkeit des Staates bilden (Fend 2008, 47).
Im Folgenden präsentieren wir Überlegungen, wie Schulfunktionen unter Berücksichtigung von Migration und Mobilität sowie räumlich umfassender gedacht werden müssen – lokal, regional, national und vor allem auch transnational –, bevor wir abschließend reflektieren, welche Implikationen damit für die Schulentwicklung verbunden sind.
In Tabelle 1 werden gesellschaftliche Schulfunktionen weiter ausdifferenziert und individuelle Funktionen zugeordnet. Außerdem wird jeder Funktion eine normative Orientierung und ein primäres schulisches Handlungsfeld zugeordnet.
Tab. 1:Funktionen des Schulsystems in einem demokratischen Staat (Quelle: Eigene Darstellung, Weiterentwicklung auf der Basis von Fend 2008, 49 – 54)
Gesellschaftliche Funktion
Individuelle Funktion
Normative Orientierung
Primäre schulische Handlungsbereiche
Sinnsystem-Reproduktionsfunktion:
Erhalt und Weiterentwicklung von Sinnsystemen
Kommunikations-fähigkeit, persönliche Autonomie, Selbstwirksamkeit
Verstehen, Verständigung
Unterricht, schulisches Sozialleben
Kohäsionsfunktion:
Erzeugung von gesellschaftlichem Zusammenhalt
Zugehörigkeit, Identität
Empathie, Solidarität
Sozial- und kulturwissenschaftliche Unterrichtsfächer, Schulkultur und -profile
Politische Stabilisierungsfunktion:
Akzeptanz von Demokratie und Rechtsstaat
Fähigkeit zur politischen Willensbildung und Partizipation
Konflikt- und Reflexionsfähigkeit, Toleranz, Akzeptanz demokratischer Entscheidungen
Politische Bildung, schulische Mitwirkungsmöglichkeiten
Qualifizierungsfunktion:
Voraussetzungen für wirtschaftlichen Wohlstand
Handlungswissen für Berufsorientierung und -einstieg, Beruf und eigenständige Lebensführung
Selbständigkeit, Wohlstand, gutes Leben
Fachunterricht, Vermittlung von Praxisorientierung und -erfahrungen
Legitimierungsfunktion:
Rechtfertigung des Zugangs zu Positionen
Erfahrung der Selbstwirksamkeit, Orientierung für die Lebensplanung
Chancengleichheit, Leistungsgerechtigkeit
Feedback, Prüfungen, Benotung, Abschlüsse
Betreuungsfunktion:
Freistellung von Erziehungsberechtigten für andere Aufgaben
Schutz
Sicherheit, Wohlstand
Erziehung, Aufsicht, Betreuungs-programme
2.1 Sinnsystem-Reproduktionsfunktion
Bei der Sinnsystem-Reproduktionsfunktion geht es darum, dass Signale und Symbole verstanden werden – in einer Sprache, in einer Schrift, aber z. B. auch in der Mathematik oder z. B. das Periodensystem in der Chemie oder die Symbolik in Landkarten. Auch im alltagspraktischen Bereich gibt es Sinnsysteme, die gelernt werden können, z. B. Uhrzeiten und Kalender, Fahrpläne oder Verkehrszeichen. Durch das Erlernen von Sinnsystemen werden Kinder und Jugendliche in spezifischen Räumen kommunikations- und handlungsfähig. Sinnsysteme haben einen unterschiedlichen Grad an räumlicher Verbreitung und – bei länderübergreifendem Gebrauch – Transnationalität.
Damit Zugewanderte von Anfang an ihre fachlichen Lernprozesse fortsetzen können, müssen sie an bereits erlernten Sinnsystemen anknüpfen können. Eine Diagnostik des Lernstands, Unterricht in einer bekannten Sprache oder sprachsensibler Fachunterricht unter Nutzung von Ressourcen in bekannten sprachlichen und fachlichen Sinnsystemen sind Ansätze, um dies zu ermöglichen. Z. B. sollten Lehrkräfte auf thematisch übersichtlich beschriebene Online-Ressourcen für ihr Fach in einer Vielzahl von Sprachen zurückgreifen können, damit neue Schüler*innen Fachinhalte auch in einer besser beherrschten Sprache nachlesen können. Einiges gibt es bereits Online6, wobei niedrigschwellige Beschreibungen, die eine Zuordnung zu Lernstoffen ermöglichen, teils fehlen.
Wenn transnationale Mobilität als Zukunftsperspektive mit bedacht wird, liegt das Erlernen von grenzüberschreitenden Sinnsystemen nahe – z. B. Mathematik, »Weltsprachen« wie Englisch zur vielseitig einsetzbaren Verständigung oder das kompetente Erlernen der Familiensprache(n) als Bildungssprache(n), um im transnationalen Beziehungsraum kommunikationsfähig zu sein.
2.2 Kohäsionsfunktion
Unter der gesellschaftlichen Kohäsionsfunktion wird hier verstanden, dass Kinder und Jugendliche in der Schule lernen, sich als Teil einer größeren Gruppe von ihnen nicht persönlich bekannten Menschen zu fühlen, die bestimmte Verhaltensnormen anerkennen und Wissensbestände teilen und sich bei Bedarf zu unterstützen bereit sind. Die leitende Norm ist die Solidarität. Kohäsion bedeutet auf der individuellen Ebene, dass die einzelnen sich zugehörig fühlen und Zugehörigkeiten in ihre Identität integrieren können. Schulkultur und -profile können beeinflussen, ob sich die Schüler*innen in der Schule und damit auch der Gesellschaft zugehörig fühlen.
Unterrichtsbereiche, die für die Kohäsionsfunktion besonders relevant sind, sind der Unterricht in den sozial- und kulturwissenschaftlichen Fächern. Sie können für lokale Räume wichtige orientierende und identitätsstiftende Aktivitäten beinhalten (z. B. den Stadtteil kennenlernen), sich auf einen Staat (z. B. Unterricht zu deutscher Geschichte), auf einen Sprachraum (englischsprachige Literatur) oder auf einen überstaatlichen Zusammenhang (z. B. Europabildung, globale Bildung) beziehen. Sie können weltweit in bestimmten Gruppen oder Schichten verbreitet sein (z. B. Musikrichtungen oder Religionen) oder auf weltweite Organisationsformen verweisen (z. B. Vereinte Nationen). Schulkulturen und -profile können in unterschiedlichem Maß transnational orientiert und eingebunden sein. Im Projekt TraMiS (▸ Kap. 12