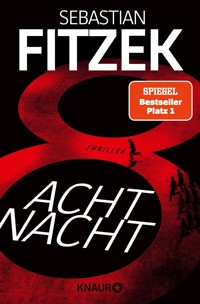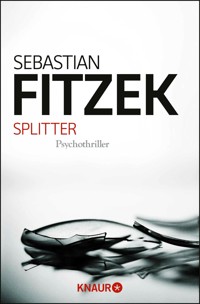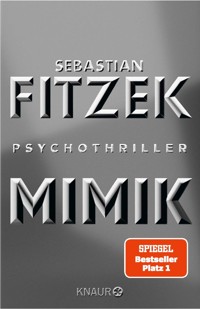
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Fürchte dich nicht! Außer vor dir selbst … Sebastian Fitzeks herausragender Psychothriller um eine Mimikresonanz-Expertin, die sich in größter Not selbst nicht mehr trauen kann Ein winziges Zucken im Mundwinkel, die kleinste Veränderung in der Pupille reichen ihr, um das wahre Ich eines Menschen zu "lesen": Hannah Herbst ist Deutschlands erfahrenste Mimikresonanz-Expertin, spezialisiert auf die geheimen Signale des menschlichen Körpers. Als Beraterin der Polizei hat sie schon etliche Gewaltverbrecher überführt. Doch ausgerechnet als sie nach einer Operation mit den Folgen eines Gedächtnisverlustes zu kämpfen hat, wird sie mit dem schrecklichsten Fall ihrer Karriere konfrontiert: Eine bislang völlig unbescholtene Frau hat gestanden, ihre Familie bestialisch ermordet zu haben. Nur ihr kleiner Sohn Paul hat überlebt. Nach ihrem Geständnis gelingt der Mutter die Flucht aus dem Gefängnis. Ist sie auf der Suche nach ihrem Sohn, um ihre "Todesmission" zu vollenden? Hannah Herbst hat nur das kurze Geständnis-Video, um die Mutter zu überführen und Paul zu retten. Das Problem: Die Mörderin auf dem Video ist Hannah selbst! Ihr einziger Ausweg führt tief in ihr Innerstes ... Mit fachlicher Beratung von Dirk Eilert, dem führenden Mimik- und Körpersprache-Experten im deutschsprachigen Raum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Mimik
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Mit fachlicher Beratung von Dirk Eilert, des führenden Mimik- und Körpersprache-Experten im deutschsprachigen Raum
Über dieses Buch
Ein winziges Zucken im Mundwinkel, die kleinste Veränderung in der Pupille reichen ihr, um das wahre Ich eines Menschen zu »lesen«: Hannah Herbst ist Deutschlands erfahrenste Mimik-Resonanz-Expertin und hat als Beraterin der Polizei schon etliche Gewaltverbrecher überführt. Ausgerechnet als sie nach einer Operation mit den Folgen eines Gedächtnisverlustes zu kämpfen hat, wird sie mit dem schrecklichsten Fall ihrer Karriere konfrontiert: Eine völlig unbescholtene Frau hat gestanden, ihre Familie bestialisch ermordet zu haben. Es gibt ein Geständnisvideo, das Hannah Herbst schnellstens analysieren muss, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Doch es gibt ein Problem: Die Mörderin im Video … ist sie selbst.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Mimik
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Blankenthals Theorie
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Zum Buch & Danksagung
Leseprobe: Dirk Eilert – Was dein Gesicht verrät
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar«
Für Regina Ziegler
Wir kennen uns nie ganz, und über Nacht sind wir andre geworden, schlechter oder besser.
Theodor Fontane
Prolog
Mir ist kalt, Mama.«
»Das geht vorbei.«
Die Sechsjährige zitterte. Sie hätte eine Strumpfhose anziehen sollen, doch daheim war es so warm gewesen. Wieso konnte man sich vor dem Rausgehen immer so schlecht vorstellen, wie kalt es schon nach wenigen Minuten draußen werden konnte?
Besonders, wenn man sich lange nicht bewegt hatte.
»Können wir nach Hause?«
»Gefällt dir unser Ausflug nicht?«
»Es ist so hart auf den Steinen.«
»Das geht vorüber«, sagte ihre Mutter, doch das Mädchen bezweifelte es. Morgen hatte sie sicher überall blaue Flecken.
»Bleib einfach liegen.«
»Wie lange noch?«
»Bis ich es dir sage.«
Mamas Stimme klang zittrig, als würde sie selbst frieren, es aber nicht zugeben wollen. Wobei sie den ganzen Tag schon so seltsam geklungen hatte. Vielleicht war sie wieder im Krankenhaus gewesen und hatte schlechte Nachrichten bekommen. Beim ersten Mal, als sie für Wochen weg gewesen war und ihr die Haare ausfielen, hatte sie sich auch so komisch angehört. Als wäre sie wütend und traurig zugleich. Vielleicht spürte sie ja auch die Vibrationen, die sich auf Brustkorb und Stimmbänder übertrugen?
»Mama?«, fragte sie, als sie sich sicher war, dass die Schwingungen, die ihren Körper erfassten, nicht nur Einbildung waren.
»Ja?«
»Ich höre ein komisches Geräusch.«
»Nicht beachten.«
Aber wieso denn nicht? Seit einer halben Stunde geschah nichts, außer dass sich die Arme und Beine am Körper immer fremder anfühlten, so kalt und taub waren sie. Sie wartete noch eine Weile, dann sagte sie: »Das Geräusch. Es wird lauter.«
»Hab keine Angst. Bleib einfach liegen.«
Mama nahm ihre Hand. Aber nicht so wie früher. Eher, wie man einen Gegenstand anfasst. Besitzergreifend.
Sie drehte sich in der Dunkelheit zu ihrer Mutter, die sie ihrerseits ansah. Mondlicht fiel in Mamas Augen, und sie meinte, sich in ihnen zu spiegeln. Im ersten Moment hätte die Kleine nicht sagen können, wovor sie mehr Angst hatte: vor dem, was sie im Gesicht ihrer Mutter sah. Oder vor dem, was sie sagte.
»Eins darfst du nie vergessen.«
»Was denn, Mama?«
»Du bist aus mir hervorgegangen. Mein eigen Fleisch und Blut.«
Die Kälte der Nacht bildete mit dem Frost in Mamas Augen eine verstörende Einheit. Das Mädchen wollte wegschauen, konnte aber nicht, als wären die Pupillen ihrer Mutter Magnete, die ihren Blick energisch anzogen.
»Wo ist deine Liebe hin?«, wollte sie fragen. »Mit der du mich früher immer angesehen hast.« Jetzt erinnerten sie die Augen ihrer Mutter an einen gefrorenen See.
Die Vibrationen lenkten sie ab. Sie wanderten jetzt durch ihren gesamten Körper, als ihre Mutter befahl: »Schließ die Augen! Und was auch immer passiert, mach sie erst wieder auf, wenn ich es dir sage.«
Sie gehorchte ihr angsterfüllt. Denn sie hatte noch etwas im Blick ihrer Mutter gesehen, von dem sie sich ihr Leben lang würde abwenden wollen.
Sie lagen stumm nebeneinander, während das Geräusch lauter und die Vibrationen immer unangenehmer wurden.
Mit einem Mal sagte ihre Mama im Befehlston: »Aber vergiss niemals: Du und ich, wir sind gleich! Ein und dieselbe Person!«
Sie hatte die Worte gerufen, obwohl sie einander doch so nahe waren, aber das Geräusch und die Vibrationen zwangen sie dazu. Alles um sie herum klang mittlerweile so bedrohlich, dass das Mädchen sich der Anweisung ihrer Mutter widersetzte und die Augen öffnete. Sie sah in einen Himmel, der viel heller war als noch vor wenigen Minuten, als sie sich hier draußen hingelegt hatten.
»Mama?« Sie drehte sich zu ihr, konnte ihr Gesicht aber nicht mehr erkennen, so sehr wurde sie geblendet.
Sie wollte schreien und davonlaufen und weinen, und das alles gleichzeitig.
Doch für das meiste davon war es zu spät.
Sie war zu träge, um aufzustehen.
Die Kälte des Gleisbetts, in dem sie lag, hatte Arme und Beine gelähmt. Und die Scheinwerfer des durch die Dunkelheit auf sie zurasenden Güterzuges waren viel, viel zu nah.
Kapitel 1
27 Jahre späterHannah Herbst
Ruhig.
Zu ruhig.
Um diese Zeit konnte Hannah das kindliche Gelächter und Gekreische normalerweise schon auf der Straße hören, zumindest wenn sie das Glück hatte, einen Parkplatz in der Nähe der Kita Zwergenwald zu finden. Manchmal musste sie mehrmals um den Block fahren, bis etwas frei wurde, obwohl die meisten Bewohner über eine Garage direkt auf ihrem Villengrundstück verfügten. Zur Stoßzeit aber, wenn die Fußballspieler zu den nahe gelegenen Sportplätzen drängten und die Schüler der benachbarten Waldorfschule auf ihr Elternshuttle warteten, konnte es sich im vornehmen Westend in zweiter Reihe stauen wie beim Lieferverkehr auf dem Kottbusser Damm. Heute aber hatte Hannah angekündigt, Paul früher abzuholen, und genoss daher die freie Auswahl an Parkmöglichkeiten direkt vor dem Flachdachbau des evangelischen Kindergartens.
Ungewöhnlich war auch, dass das Tor nicht richtig zugezogen war. Beunruhigt fasste Hannah sich an die Kehle. Etwas stimmte hier nicht, und dieses Etwas schien sich ihr mit kalten Fingern um den Hals zu legen.
Noch nie hatte sie ohne vorherige Eingabe eines PIN-Codes den Vorgarten der Kita betreten können. Jeder hielt sich an diese Sicherheitsvorkehrung und wartete beim Rein- und Rausgehen, bis der Summer nicht mehr brummte und das Tor fest ins Schloss gefallen war, damit kein Kind auf die Straße rennen konnte.
Ob sie auf einem Ausflug sind?
Aber dann hätte Myrte, die Leiterin, doch etwas gesagt, als sie ihr am Morgen von dem großen Tag erzählt hatte. Sie wollten mit der gesamten Familie zu einer Ausstellungseröffnung von Richards neuen Bildern nach Dresden fahren. Dafür nahmen sie auch Kyra, Richards Tochter aus erster Ehe, etwas früher aus der Schule.
Stille, auch als sie die Tür zur Zwischendiele öffnete.
Hannah studierte im Windfang der Kita die Aushänge und fand einen Hinweis auf Wolf Schlagmann, den neuen Praktikanten, der von den Kindern »Wolle« genannt werden wollte. Neben seinem Foto hing ein Blatt mit der Ankündigung der Wiederaufnahme der musikalischen Früherziehung. Kita-Schwimmen war erst morgen. Für heute stand nichts Besonderes im Plan.
Hannah öffnete die nächste Tür, hinter der sich der Garderobenbereich befand. Für ein Dutzend Kleinkinder waren hier mehr oder weniger sorgsam die Jäckchen aufgehängt, die Wechselwäsche in den Fächern verstaut und die Schühchen darunter abgestellt.
Hier war es mit der Stille vorbei. Dennoch zog sich die unsichtbare Schlinge um ihren Hals noch stärker zu. Denn die Geräusche, die jetzt an ihr Ohr drangen, hatte Hannah noch nie zuvor in der Kita gehört. Sie passten auch nicht zu einem Ort, an dem Kinder fröhlich sein sollten. Sicher, es gab Wutanfälle, Heulkrämpfe und Tränen, wenn eines der Kinder stolperte und sich das Knie aufschlug zum Beispiel. Was aber sollte dieses ununterbrochene Zischen verursachen, das sich bei näherem Hinhören aus mindestens drei Ebenen zusammensetzte: Flüstern, Wimmern und Schluchzen?
Hannah ging durch den Garderobenbereich auf das Herzstück der Kita zu, öffnete eine allerletzte Tür und sah den wahnsinnigen Geiselnehmer etwa in der Sekunde, in der sie ihn auch hörte.
»Sagt mir, wer es war!«, schrie er. »Sonst bringe ich euch beide um!«
Kapitel 2
Der vielleicht fünfundzwanzigjährige dürre Kerl stand in der Mitte des Mehrzweckraums, der zwischen den Gruppenräumen und der Küche lag. Um diese Zeit wurde er zum Mittagessen benutzt. Der Duft von Rosmarinkartoffeln und Kichererbsen hing in der Luft. Die Teller standen gefüllt auf den kleinen Tischchen. Die Kinder, die von ihnen hätten essen sollen, hockten jedoch beim Klavier, vor das sich Myrte und Anja gekauert hatten und am Boden kniend schützend die Arme um die Kleinen breiteten.
Daher das zischende Flüstern: »Seht nicht hin, schaut weg, seht zu Boden«, sagten sie den Kindern leise ins Ohr, während auch sie selbst es kaum wagten, hochzuschauen.
Der Geiselnehmer stand in der Mitte des Raums, an der Stelle, an der im Dezember immer ein Weihnachtsbaum aufgestellt wurde. Er hatte zwei Kinder in seiner Gewalt, beide jeweils mit einem Arm am Kragen gepackt.
Hirn-Schluckauf, so würde Hannah später ihrem Mann Richard das Pulsieren beschreiben, das sie in ihrem Kopf bei dem Anblick der lebensbedrohenden Gefahr spürte. Ein Gefühl, als würden sich Milliarden Zellen unter ihrer Schädeldecke in unregelmäßigen Abständen ruckartig verkrampfen und so den Gedankenfluss immer wieder unterbrechen.
Das Mädchen in der Gewalt des Täters war … genau … Samira, die Dunkelhaarige mit den strahlend grünen Augen, die immer eine Schleife im Haar trug. Heute eine rote, passend zu ihrem Mickey-Mouse-Kleidchen. Sie war es, die so herzzerreißend schluchzte und wimmerte.
Der Junge daneben war stumm, obwohl er es war, gegen dessen Schläfe der Waffenlauf des Geiselnehmers stieß. Anders als bei Samira musste Hannah hier nicht lange über den Vornamen nachdenken. Denn es war Paul. Ihr fünfjähriger Sohn.
Kapitel 3
O Gott!«, presste sie fast lautlos hervor, die unsichtbaren Hände um ihren Hals ließen ihr kaum noch Luft zum Atmen. Niemand nahm von ihr Notiz. Nicht die Erzieherinnen, nicht Paul, auch nicht der bewaffnete Geiselnehmer.
»Wer von euch hat diese Lügen erzählt?«, schrie er irgendwo in den Raum hinein.
Hannah hatte das Gefühl, als wollte sich ein Gedankenschwall förmlich aus ihrem Kopf herauspressen.
Ich kenne ihn. Habe ihn gerade erst gesehen.
Wolfs – »ihr könnt mich Wolle nennen« – Gesicht war zur Fratze verzerrt und hatte kaum noch etwas mit dem lächelnden Bewerbungsfoto gemein, das Hannah eben erst am Schwarzen Brett studiert hatte.
Die Online-News-Magazine würden schon in wenigen Stunden darüber schreiben, wofür die Zeitungen noch bis zum nächsten Tag brauchten: wie der »Kita-Killer« mit einer Waffe in den Kindergarten eingedrungen war, um sich dort wie ein Amokläufer zu benehmen.
Wer hat Angst vorm bösen Wolle?, würde sich ein Redakteur später nicht entblöden, in einer Titelüberschrift zu fragen.
Wolf »Wolle« Schlagmann war von einem der Kinder – man würde nie erfahren, von welchem – beschuldigt worden, beim Anschubsen auf der Schaukel betatscht worden zu sein. Das war bereits vor Tagen geschehen. Die Kindergartenleitung hatte den Praktikanten bis zur Klärung der Vorfälle suspendiert und unglücklicherweise nicht nur vergessen, den Steckbrief vom Schwarzen Brett zu nehmen, sondern ihm auch noch eine Nachricht auf die Mailbox gesprochen. Die war von Wolles hochschwangerer Frau abgehört worden. Da es in der Ehe ohnehin gerade kriselte, gab es einen Grund mehr, den werdenden Vater aus der gemeinsamen Wohnung zu schmeißen. Gleichzeitig verbreitete sie das Gerücht unter ihren Freunden, und es machte die Runde auf der Fachschule für Sozialpädagogik, an der Wolle seine Ausbildung absolvierte. Verlassen und verleumdet, wähnte er sich privat wie beruflich am Ende. Ob er sich einem Kind wirklich unsittlich genähert hatte, sollte sich niemals aufklären. Dass jemand mit einem derartigen Hang zu exzessiven Aggressionsschüben nie mehr beruflich in die Nähe von Kindern kommen sollte, stand jedoch völlig außer Frage. Er hatte ganz offensichtlich eine krankhafte gewalttätige Ader, und seine Wut machte ihn zudem blind und wahllos. Samira und Paul waren keine bewusst ausgesuchten Geiseln. Sie hatten lediglich das Pech gehabt, ihm als Erstes in die Arme zu laufen.
Paul.
Er starrte in Hannahs Richtung, aber durch sie hindurch. Wie betäubt. Sie winkte ihm, schüttelte den Kopf. Nicht zu stark, denn die Aufmerksamkeit des Geiselnehmers wollte sie um keinen Preis der Welt wecken.
Gut. Er sieht mich.
Hannah schaltete in einen nonverbalen Kommunikationsmodus. Ihre beste Freundin Telda hatte einmal gesagt, es käme der Telepathie gleich, wie sie mit Menschen, die ihr nahestanden, kommunizieren konnte, ohne dabei ihre Stimmbänder zu benutzen. Wobei es dafür auch einen sensiblen Gegenpart brauchte wie Paul, mit dem sie immer und immer wieder geübt hatte, seitdem er begonnen hatte, sich für den Beruf seiner Mutter zu interessieren.
»Ich beschütze dich!«, signalisierte sie ihm, indem sie zweimal hintereinander die Lider fest aufeinanderpresste und erst nach einer Sekunde wieder öffnete.
»Mami, was machst du eigentlich beruflich?«, hatte Paul vor etwa einem Jahr zum ersten Mal gefragt, und sie hatte geantwortet: »Ich lese in Gesichtern.«
Er hatte seine sommersprossige Nase vorgestreckt und schelmisch grinsend gefragt: »Und? Was liest du in meinem?«
»Freude, Neugierde … und dass dein Zimmer wieder ein Schlachtfeld ist!«
Da war Paul gerade vier Jahre alt geworden, und schon da hatte er es genauer wissen wollen. Und sie hatte es ihm genauer erklärt. Dass sie als Mimikresonanz-Expertin auf die geringsten Veränderungen in der Gesichtsmuskulatur achtete. Auf die Bewegungen von Lippen und Kinn, Augen und Nase, Brauen und Stirn. Mikroexpressionen, die man nicht steuern konnte, selbst wenn man es ausgiebig trainierte – und die schneller als ein Wimpernschlag wieder vorbei waren.
»So erkennst du, ob jemand lügt?«
»Oder ob er Angst hat, sich ekelt, Freude oder Trauer empfindet.«
Oder Hilflosigkeit, gekoppelt mit der Bereitschaft, anzugreifen. Wie Wolle gerade. Dem sie ansah, dass er glaubte, nichts mehr zu verlieren zu haben. Das waren die Gefährlichsten.
»Mimirosentanz?«, hatte Paulchen wiederholt. »Wozu braucht man den Quatsch?«
Er hatte gekichert, als sie ihm den Finger durchs T-Shirt in den Bauchnabel steckte und ihn als »Frechzwerg« betitelte. Sie tat das viel zu oft, einfach weil sie sein Prusten so niedlich fand, das sich noch immer wie ein Babyglucksen anhörte, hell und kieksend.
»Ich arbeite unter anderem für die Polizei oder die Gerichte. Manchmal sind sie sich nicht sicher, ob ein Mensch wirklich böse ist. Dann bin ich dabei, wenn sie mit ihm reden, und achte darauf, ob der Ausdruck in seinem Gesicht zu dem passt, was er sagt oder macht.«
Bei Wolle gab es keinen Zweifel. Bei ihm passten alle Anzeichen zusammen.
Die hochzuckenden Augenbrauen-Innenseiten: Hilflosigkeit. Der stechende Blick: Wut. Er stand kurz davor, zu explodieren. Kurz davor, mehrere Leben auf einmal zu beenden. Die Frage war nur, welches zuerst?
Pauls oder Samiras?
Sie musste handeln. Jetzt!
»Hey«, rief Hannah, und nun wurde sie bemerkt. Der Geiselnehmer sah kurz zu ihr hinüber, Paulchens Blick blieb länger an ihr haften.
Gut, gut so.
»Erinnere dich an das, was ich dir gezeigt habe!«, formte sie lautlos mit den Lippen und legte den Zeigefinger an ihre Schläfe. »Erinnere dich!«
Paul atmete schwer, aber er nickte. Las in ihren Augen, was sie ihm mitteilen wollte.
Richard hatte es für verfrüht gehalten, aber ihrer Meinung nach konnte man mit der Empathieförderung bei Kindern gar nicht früh genug beginnen. Nichts anderes war das Mimikstudium im Grunde – man lernte die Gefühle seines Gegenübers zu deuten, ohne dass dieses etwas sagen musste. Und so wie Richard Paul Fahrradfahren und Fotografieren beigebracht hatte, hatte Hannah ihn mit den Grundzügen der Körpersprache vertraut gemacht.
»Was haben wir geübt?«
Paul nickte wieder. Er hatte verstanden. Es in ihrem Blick gelesen. Hannah dankte Gott, dass sie so früh damit begonnen hatte, seine Sinne zu schärfen.
Sie zeigte auf ihre Augen, dann auf Wolle.
Ja, genau. Sieh ihn an! Schau nicht weg! Suche Blickkontakt!
Lektion 1: Aufrichtigkeit! Augenkontakt standhalten.
Das, womit man im Leben ihrer Meinung nach am weitesten kam, war die Wahrheit. Und die erkannte man bei Menschen nicht an ihren Worten, sondern an ihrer Mimik.
»Nichts wirkt aufrichtiger, als einem Blick standzuhalten und dabei offen seine Gefühle zu zeigen«, hatte sie Paul beigebracht.
Bei einem Gespräch mit einem Freund, später bei der Unterhaltung mit einer Lehrerin und dann, wenn es irgendwann so weit war, beim ersten Date. An all diese Situationen hatte Hannah bei Paulchens Schulungen gedacht. Nicht an einen Überlebenskampf in der Kita.
Ja, das ist gut. Genau so.
Ihr Herz klopfte in ihrem Brustkorb wie eine Faust gegen eine Zimmertür, als sie sah, dass Paul den Mann am Ärmel seines Hemdes zupfte.
»He?«
Wolle sah zu ihrem Sohn hinab. Die Pistole jetzt genau zwischen dessen Augen gerichtet. Und dennoch machte Paul keinen Fehler. Ihm gelang es, wozu Samira nicht in der Lage war. Deren Augen schwammen vor Tränen, ihr Körper wurde von ihren Schluchzern regelrecht durchgeschüttelt. Ein Laie, der so verblendet war wie Wolle, mochte das nicht allein als Todesangst und Hilflosigkeit, sondern als ein Zeichen von Schuldgefühlen deuten. Pauls Mimik hingegen ließ ihn so unschuldig wie einen Engel wirken. Traurig, ängstlich, aber ehrlich. Und da es dem Jungen gelang, dem hypnotisch stechenden Wutblick des verzweifelten, gewaltbereiten Mannes standzuhalten, traf dieser eine Entscheidung. Keine bewusste. Es war eher intuitiv, dass der Erzieher Paul Glauben schenkte, als er sagte: »Ich habe nichts gemacht, Wolle.«
Habe ich billigend ihren Tod in Kauf genommen?, fragte sich Hannah noch Jahre später, wenn sie daran zurückdachte. Hatte sie aktiv eine Triage vorgenommen? Ihr Kind mithilfe dessen, was sie über Mimik wusste, unschuldiger erscheinen lassen als das andere? Damit der Kelch an Paulchen vorüber und der Schuss nicht in seinen, sondern in den Kopf von Samira ging?
Denn gegen sie richtete sich von dieser Sekunde an Wolles gesamte Wut. Wolle ließ Paul los, der jedoch nicht weglief, obwohl Hannah ihn zu sich winkte. Dann zu sich schrie. Aber ihr Sohn blieb stehen. Fixierte jetzt nicht länger die Augen des Geiselnehmers, sondern dessen Pistole, deren Lauf nach einem kurzen Schwenk nun auf Samiras Schläfe lag.
Hannah hörte nicht, wie der Abzug sich löste. Auch keinen Schuss. Dennoch verbreitete sich auf einmal Blut auf dem Vinylboden.
Das sollte sich später klären. Auch woher das Taschenmesser kam, das Paul niemals aus Richards Schreibtischschubfach nehmen, geschweige denn mit in die Kita hätte bringen dürfen.
»Ich wollte mit Marek Holz schnitzen«, sollte Paul später zu Protokoll geben.
Stattdessen hatte er den ersten Moment genutzt, in dem sich Wolle nicht mehr für ihn interessierte, um ihm die Klinge in den Oberschenkel zu stechen. Und somit Samiras Leben in letzter Sekunde zu retten, die bereits zu Hause in Sicherheit war, als die Ärzte im Virchow noch um das Leben des Erziehers kämpften.
Das Vinyl des Kitabodens war leicht zu reinigen. Schon am nächsten Morgen deutete nichts mehr auf den geistig gestörten Täter hin, der beinahe ein Kind erschossen hätte.
Das Blut floss nur noch in Hannahs Erinnerungen.
Die schrecklichen Bilder verloren nach und nach ihre Intensität. Aber es sollte noch sieben Jahre dauern, bis Hannah von ihnen nicht mehr im Schlaf verfolgt wurde.
Und das auch nur, weil sie durch die Bilder eines noch sehr viel entsetzlicheren Albtraums ersetzt wurden, der sich in der Nacht vom zwölften auf den dreizehnten Oktober im Hause der Familie Herbst ereignete.
Kapitel 4
Sieben Jahre späterHaus der Familie Hannah, Richard, Paul und Kyra Herbst12. auf 13. Oktober
Ein Massenmörder sagte einmal, einen Menschen zu töten sei einfach. Mit der Tat zu leben wäre das Schwierige.
Mal sehen, ob das stimmt.
Der erste Stich, direkt ins Herz, kostete fast übermenschlich große Überwindung. Auch wenn es schnell vorbei war und Kyra gar nichts davon mitbekam. Nur ein letzter Seufzer der Fünfzehnjährigen.
Als Nächstes war der Vater an der Reihe. Er starb lauter. Doch die Stille, die nach dem letzten Atemzug einsetzte, war ohrenbetäubender als sein Todeskampf zuvor.
In der Dunkelheit des Schlafzimmers breitete sich der Geruch von Eisen aus. Verklebte die Flimmerhärchen in der Nase. Die Spuren des Mondlichts, die sich durch die Fensterflächen im ersten Stock verirrten, tauchten die Szenerie in einen quecksilbrigen Schein. Malten die Schatten tanzender Äste auf den hellen Teppich, der gierig das auf dem Weg zum Flur vom Messer tropfende Blut aufsaugte.
Wie lustig doch die Tür zum zweiten Kinderzimmer aussah. Mit grüner Tafelfolie beklebt, mit schwarzem Edding beschriftet:
Seit meinem 12. Geburtstag gilt das Anklopfgebot!
Gezeichnet: Paul
Also dann. Es ist schon spät, und Töten ist anstrengend. Ein herzhaftes Gähnen übertönte das leise Knarzen der sich langsam öffnenden Tür zum dunklen Kinderzimmer.
In dem sich das letzte Ziel für diese Nacht befand.
Kapitel 5
13. OktoberHeute
Feuertote sind Rauchtote.«
Mit diesem Satz im Kopf wachte sie auf und begann unwillkürlich, die Luft stoßweise durch die Nase einzuatmen. Als wollte sie sich vergewissern, dass das Gebäude nicht in Flammen stand und der Qualm bereits in ihr Zimmer strömte.
Doch da war nichts. Da war kein Brandgeruch, kein Rauch bahnte sich seinen Weg durch den Spalt unter der Eingangstür rechts von ihr über den fadenscheinigen Teppich, der einst einmal cremefarben und hochflorig gewesen sein musste, jetzt aber wie ein schmutziger Fußabtreter aussah: grau und von vielen Füßen platt getreten.
»Bei einem Brand sterben die meisten Menschen nicht in den Flammen. Sie ersticken im giftigen Qualm.«
Nun denn, sie hatte eine vollkommen klare Sicht: auf die milchgläserne Lampe, die an eine alte Salatschüssel erinnerte, lieblos an die gespachtelte Decke geschraubt. Fleckig wie die Tagesdecke, auf der sie lag und die sich farblich kaum von den zugezogenen Vorhängen auf ihrer Seite unterschied. Manteldicke braune Stoffplanen, die kein Licht durchließen, sodass sie nicht wusste, ob es Nacht war oder die Vorhänge einfach nur extrem gut verdunkelten. Vielleicht – und das war nur einer von vielen Gedanken, die sie verstörten –, vielleicht befinden sich auch gar keine Fenster dahinter?
Vielleicht waren die Vorhänge nur eine Attrappe, so wie die Plastikorchideen in der Vase auf der Kommode. Der Fernseher daneben hingegen war echt. Er lief mit einem seltsam monotonen Grundrauschen, wobei sie ihn aktuell mehr als einzige Licht- denn als Informationsquelle wahrnahm. Sein Bildschirm war für den Abstand zum Bett zu klein dimensioniert. Um zu sehen, was auf ihm gezeigt wurde, hätte sie den Kopf heben müssen, wozu sie wohl gerade noch genügend Kraft aufgebracht hätte. Besser noch wäre es, wenn sie sich im Bett aufsetzte, allein für ihren verrücktspielenden Kreislauf. Doch das schaffte sie nicht. Aus dem einfachen Grund, weil die Kabelbinder, mit denen sie gefesselt war, ihr nicht genügend Bewegungsspielraum dafür ließen.
Das Kopfteil ihres Bettes war mit schmutzig grauem Kunstleder überzogen. Ein Edelstahlrohr bildete den Abschluss. Vielleicht aus optischen Gründen, vielleicht, damit auf dem Kopfende abgelegte Gegenstände nicht auf die Matratze herabfallen konnten. Wozu auch immer es ursprünglich gedacht gewesen war, irgendjemand hatte es jetzt genutzt, um sie daran zu fixieren, wobei er die Schlingen der Kabelbinder so fest zugezogen hatte, dass es ihr noch nicht einmal möglich war, die Hände am Rohr entlang seitlich zueinanderzuführen. Somit befand sie sich in einer liegenden Jesus-am-Kreuz-Position, wobei ihr Kopf auf der Matratze ruhte, während ihre Arme jeweils einen halben Meter über dem Oberkörper schwebten.
»Ein einziger in Flammen gesetzter Büropapierkorb kann mehrere Tausend Kubikmeter Rauch erzeugen.«
Offenbar lief im Fernsehen gerade ein Magazinbeitrag zum Thema Brandschutz in den eigenen vier Wänden. Es ging um Rauchmelder, die durchschnittliche Anfahrtszeit der Feuerwehr und das Phänomen, dass Menschen, die Feuer sahen, von den Flammen oft so fasziniert waren, dass sie wichtige Zeit damit vergeudeten, wie hypnotisiert die zerstörerische Gewalt zu bestaunen, anstatt sofort um Hilfe zu rufen.
»Hilfe!«, schrie sie nun auch. Wenn auch nur in ihren Gedanken. Sie strampelte mit ihren nicht fixierten Beinen die Tagesdecke zum Fußende, als würde das irgendeinen Sinn ergeben.
Aber was an dieser Situation war denn überhaupt sinnvoll?
Aufgewacht an einem ihr fremden Ort, gefesselt an ein ihr fremdes Bett in einer ihr unbekannten Umgebung, die so anonym und austauschbar eingerichtet war, dass es sich wahrscheinlich um ein billiges Hotelzimmer handelte. Mit einem klaren, völlig ungetrübten Blick auf die trostlose Ausstattung: eine stoffbezogene Stehlampe, dunkle Holzpaneele an den Wänden, ein Aquarell von einem Waldweg schief an der Wand neben einer Tür, die vermutlich zum Badezimmer führte. Sie sah alles, und doch fühlte sie sich so orientierungslos, als stünde sie inmitten einer giftigen Nebelwolke, die sich – und das war ein weiterer grauenhafter Gedanke – von nun an überallhin mit ihr mitbewegen würde, sollte sie sich jemals von ihren Fesseln befreien können. Denn der toxische Qualm füllte nicht ihre Umgebung, das war ihr klar, als sie die Augen schloss und sie sofort das Gefühl überkam, sich in sich selbst umherirrend zu verlieren. Der Nebel des Vergessens (wie sie ihn ab sofort nannte) befand sich in ihr selbst, flutete ihren Verstand.
Erstickt mein Bewusstsein!
Ein röchelndes, angsterfülltes Stöhnen löste sich aus ihrer staubtrockenen Kehle. Ein Ausdruck der schrecklichen Erkenntnis, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch psychisch hilflos und ausgeliefert war.
Sie schloss die Augen und versuchte, sich zu erinnern, doch da war wieder nur der Nebel des Vergessens. Sie fühlte sich wie eine Autofahrerin, die im dichten Dunst immer langsamer fuhr, weil sie um sich herum alles nur noch andeutungsweise sah. Die Rücklichter der Vorausfahrenden, die schemenhaften Schatten an der Seite, die alles Mögliche sein konnten: Bäume, Leitplanken, liegen gebliebene Fahrzeuge. Man sah irgendetwas, aber wie sehr man sich auch anstrengte, wie energisch man die Augen zusammenkniff, man konnte nicht mehr als eine Ahnung erhaschen. Genau so erging es ihr auf ihrer Gedankenfahrt. Sie wusste, irgendwo in dem undurchdringlichen Qualm lagen ihre Erinnerungen daran, wer oder was sie war und wie sie hierhergekommen war, in diesem Zustand: barfuß, nur mit einem groben Baumwollnachthemd bekleidet, in ein Hotelzimmer verschleppt. Mit Schmerzen, die von irgendeinem Punkt ihres Körpers, den sie noch nicht lokalisiert hatte, in alle Richtungen ausstrahlten.
Und je mehr sie sich anstrengte, ihre Erinnerungen von der undurchdringlichen Nebelhülle zu befreien, desto weiter schien sich all das, was sie als Mensch definierte, von ihr zu entfernen: Name, Alter, Beruf, Familienstand, Herkunft …
Ich weiß nicht, wer, wo oder was ich bin, dachte sie, und wäre da nicht diese Stimme gewesen, die so angenehm und beruhigend aus dem Fernseher zu ihr sprach, hätte sie vermutlich den letzten Anker in der Realität verloren und wäre vollends auf die offene See des Vergessens getrieben.
»… unterbrechen wir das laufende Programm für eine Liveschaltung zur Pressekonferenz der Berliner Polizei.«
In der Pause, die der TV-Moderator ließ, hörte sie ein quietschendes Geräusch, wie wenn ein Wasserhahn zugedreht wurde. Im selben Atemzug erstarb das Rauschen, das doch nicht vom Fernseher herrührte.
Sie sah nach links zu der Tür, hinter der sie das Badezimmer vermutete. Dann versuchte sie, ihren Körper in dieselbe Richtung wie ihren Kopf zu drehen, musste aber schreiend aufgeben.
Schon die leichte Seitwärtsbewegung auf dem Bett hatte eine Stoßwelle gleißender, fiebriger Schmerzen ausgelöst, die von ihrer Leistengegend nach oben züngelten.
Verdammt, ich hab den Brandherd gefunden.
Links, über der Hüfte, unter dem Rippenbogen.
Hatten dort die Flammen ihren Ursprung, von dem der bewusstseinsvernebelnde Rauch bis in ihr Gehirn aufstieg?
Der Nebel des Vergessens?
Sie blickte an sich herab. Sah die Ausbeulung unter ihrem Nachthemd.
Was zum Teufel …?
Es fühlte sich an wie eine klaffende Wunde, die Erhebung unter dem Nachthemd sprach dafür, dass sie mit einem Verband versorgt war. Ausreichend Schmerzmittel hatte man ihr offenbar aber nicht verabreicht. Allein sich wieder flach auf dem Bett auszustrecken tat höllisch weh.
»Guten Tag, meine Damen und Herren, danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Eins vorweg: Sinn und Zweck dieser Pressekonferenz ist es nicht, die Bevölkerung zu verunsichern, dennoch sehen wir es als unsere Pflicht an, die Allgemeinheit vor Lutz Blankenthal zu warnen. Auch als der ›Chirurg‹ bekannt.«
Sie hob den Kopf und sah im Fernseher einen hageren Mann mit eingefallenem Gesicht, unter ihm ein eingeblendeter Schriftzug: Kriminalhauptkommissar Philipp Stoya.
Okay, lesen kann ich also. Und ich stecke in dem verletzten Körper einer erwachsenen, auf ein Hotelbett gefesselten Frau, fasste sie die paar Bruchstücke zusammen, die sie bislang über sich in Erfahrung gebracht hatte.
»Gestern Abend gelang Blankenthal auf spektakuläre Weise die Flucht aus der Gefängnisklinik Buch in Pankow. Bei dem Siebenundfünfzigjährigen handelt es sich um einen höchst manipulativen, ergo sehr gefährlichen Täter, dem sich keiner – und das ist unsere ausdrückliche Bitte – in den Weg stellen sollte. Wenn Sie ihn sehen, spielen Sie nicht den Helden. Bringen Sie sich nicht in Gefahr, sondern rufen Sie sofort die Polizei. Hier eine Aufnahme von Blankenthal jüngeren Datums.«
Sie versuchte, sich an den gefesselten Händen rücklings so weit nach oben zu ziehen, dass sie zwar nicht aufrecht sitzen, wohl aber am Kopfteil des Bettrahmens angelehnt liegen konnte. Der durch diese erneute Positionsveränderung ausgelöste Schmerz war schier unerträglich. Er fühlte sich an, als hätten krallenartige Finger sich dort, wo sie das Pflaster vermutete, in die Haut gebohrt, um an dieser Stelle das Fleisch wie Packpapier mit bloßen Händen vom Körper zu reißen.
Immerhin hatte sie nicht das Bewusstsein verloren und nun einen besseren Blick auf das Foto des flüchtigen Täters, das – abgesehen von einer Spalte mit Aktienkursen am rechten Bildschirmrand – fast den gesamten Fernseher einnahm.
Sie sah nur den Kopf des Ausbrechers, aber würde der Porträtausschnitt sich vergrößern lassen, hätte sie sich nicht gewundert, wenn das Vollbild den Mittfünfziger auf einer Segeljacht stehend gezeigt hätte; die kräftigen Hände am Steuerrad, das markante, etwas zu große Kinn dem auffrischenden Wind entgegengestemmt, der ihm die grauen, im Nacken gelockten Haare aus der faltigen Denkerstirn blies. Hätte sie den Gesuchten allein anhand des Bildes mit drei Wörtern beschreiben müssen, wären es seriös, sportlich und selbstbewusst. Der leitende Ermittler der Berliner Mordkommission fand drei komplett gegensätzliche Bezeichnungen, wenngleich sie ebenfalls mit S begannen: »Lutz Blankenthal ist ein Schwerverbrecher, ein Soziopath und Sadist.«
Das Kameralivebild wechselte zu der Ansicht eines Konferenztisches, der in einem turnhallenähnlichen Saal auf einer Bühne vor mindestens zwei Dutzend Reportern stand.
»Er hat es geschafft, ohne jemals Abitur gemacht, geschweige denn Medizin studiert zu haben, mehrere Arztposten in unterschiedlichen Krankenhäusern zu beziehen, unter anderem als Chefchirurg einer Privatklinik in Potsdam. Er hat Dutzende von Experten getäuscht, vor allem aber seine Patienten, die ihm ihr Leben anvertraut und es teilweise verloren haben. Machen Sie nicht denselben Fehler und fallen auf sein charismatisches Auftreten und sein seriöses Äußeres herein. Hinter der sympathischen Fassade lauert ein hochgradig sadistischer Psychopath. Blankenthal empfindet Erregung an geöffneten Menschenkörpern. Er ist kein schelmischer Betrüger, der sich einen Doktortitel erschlichen und seine Vorgesetzten zum Narren gehalten hat. Blankenthal schneidet seine Opfer zum Vergnügen auf, zum Teil ohne Betäubung, nur um sich an dem Anblick ihres Innersten zu ergötzen.«
Sie schrie wieder auf. Diesmal nicht vor Schmerz, auch wenn sie bei den letzten Worten des Ermittlers das pulsierende Ziehen ihrer Wunde noch stärker gespürt hatte. Jetzt hatte sie der Schreck zusammenzucken lassen. Denn die Tür zu ihrer Linken, hinter der es gerade noch geklappert hatte, öffnete sich, und es schob sich ein Schwall feuchtwarmer, nach Duschgel riechender Badezimmerluft in den Raum.
Und mit ihr ein Schatten. Nur schemenhaft erkennbar in dem bläulichen Licht, das vom Fernseher abstrahlte. Wo Kommissar Stoya gerade weiter referierte:
»Gestern wurde Blankenthal mit dem Verdacht auf Schlaganfall in die Gefängnisklinik eingeliefert, wobei wir davon ausgehen, dass er seine Symptome simuliert hat und in Wahrheit kerngesund ist. In der Klinik gelang es ihm, seine Bewacher und die behandelnde Ärztin zu überwältigen. Er brach einen Spind mit medizinischer Kleidung auf und verkleidete sich erneut als Chirurg. Auf die Umstände seiner daran anschließenden Flucht gehe ich gleich gesondert ein. Sie ist in jedem Fall ein Beweis seiner buchstäblich mörderischen Intelligenz.«
Das war der Moment, als ihr klar wurde, wer der Schatten war, der mit der feuchten Luft aus dem Bad seinen Weg an ihr Bett gefunden hatte. Ein frisch geduschter Mann, nur mit einem Laken um die Hüfte bekleidet, den man sich gut auf einer Hochseejacht vorstellen konnte, würde er nicht halb nackt, sondern in Segelklamotten vor ihr stehen.
»Leider muss ich Sie außerdem darüber informieren, dass der ›Chirurg‹ auf seiner Flucht noch eine weitere …«
Der Mann stellte den Fernseher mitten im Satz des Polizeibeamten leiser.
»Wer sind Sie?«, fragte sie, obwohl sie seinen Namen gerade erst mehrfach hintereinander im Fernsehen gehört hatte. Ihre Stimme klang halb krächzend, halb flüsternd. Sie fühlte, wie sich ihre Nasenflügel blähten, spürte eine erhöhte Muskelspannung am ganzen Körper. Zittern.
Typische Angstsignale, dachte sie unwillkürlich. Evolutionär bedingt, wie ihre feuchten Handinnenflächen, mit denen man als Steinzeitmensch auf der Flucht besser Halt an Felsen und Bäumen fand. Mehr Grip. Deswegen befeuchten wir noch heute unsere Finger vorm Umblättern, hörte sie ihre innere Stimme erklären.
Der Mann im Zimmer sagte derweil laut und deutlich: »Mein Name ist Lutz Blankenthal. Schön, dass Sie endlich aufgewacht sind. Dann können wir ja gleich beginnen, Frau Herbst.«
Kapitel 6
Er schaltete den Fernseher ab. Dann bückte er sich vor dem Fußende des Bettes. Sie hörte das Geräusch eines Reißverschlusses.
Großer Gott, was hat er vor? Will er mich aufschneiden? Ohne Betäubung, so wie seine anderen Opfer?
Sie schloss die Augen. Stöhnte. Öffnete sie wieder, doch der Albtraum war nicht vorbei. Der »Chirurg« stand wieder vor ihr. Ohne Skalpell, dafür mit einer schwarzen Sporttasche in der Hand.
»Ich geh mich kurz umziehen«, sagte er.
Umziehen? Wofür?
Hatte er im Bad gerade ein perverses Desinfektionsritual hinter sich? Legte er jetzt seinen OP-Kittel an?
»Was, was … wollen Sie von mir?«
Bin ich die Ärztin, die er überwältigt hat? Frau Herbst?
»Wo bin ich?«
»In einem Hotelzimmer.«
Das sehe ich. Aber wieso? Wie bin ich hierhergekommen? Da sie ihr eigenes Überleben im Augenblick mehr interessierte als die Ursache dieses Wahnsinns, brüllte sie, so laut es ihre brüchige Stimme erlaubte: »Machen Sie mich los. Sofort!« Hilflos rüttelte sie an ihren Fesseln.
Blankenthal schüttelte energisch den Kopf. »Nein, das kann ich nicht.« Mit der Tasche in der Hand wandte er sich wieder Richtung Badezimmer.
O Gott, er ist wirklich wahnsinnig. Und ich bin ihm ausgeliefert, ohne zu wissen, wer ich überhaupt bin.
Mit einem Mal fühlte sie sich komplett kraftlos, als hätte allein der schwache Versuch, sich aufzubäumen, ihre letzten Reserven verbraucht. Aber wer wusste schon, was sie in den vergangenen Stunden alles hatte durchstehen müssen?
»Tun Sie mir nichts, bitte«, flehte sie ihn an.
Blankenthal blieb stehen. Für einen winzigen Moment fror seine komplette Mimik und Gestik ein. Ein Moment, den sie wie in Zeitlupe wahrnahm. Nur für den Bruchteil einer Sekunde wirkte der Mann wie erstarrt. Freeze-Effekt – eine unbewusste Orientierungsreaktion, hörte sie wieder ihre eigene Stimme und wunderte sich, weshalb ihr diese Details auffielen.
»Ich soll Ihnen nichts antun?«
Blankenthal löste sich aus der Starre und kam zu ihr zurück. Er beugte sich über sie. War ihr auf einmal so nah, dass sie das frische, nach Holz und Tabak duftende Eau de Toilette riechen konnte, das er im Bad aufgetragen haben musste.
»Ich glaube, Sie verstehen hier etwas falsch«, sagte er und blickte ihr tief in die Augen. Sie spiegelte sich in seinen von tiefblauer Regenbogenhaut umrandeten Pupillen. Leider war ihr Abbild zu klein, als dass sie sich selbst darin hätte erkennen können. Denn sogar daran hatte sie keine Erinnerung mehr: Grundgütiger, ich weiß nicht einmal mehr, wie ich aussehe.
»Bitte lösen Sie die Fesseln«, flehte sie, und mittlerweile war es ihr komplett gleichgültig, wie ängstlich und erbärmlich sie sich anhörte … denn genau das bin ich: voller Angst und ohne Hoffnung auf Erbarmen.
»Bitte, ich will nach Hause!«
Wo immer das auch ist.
»Das geht nicht. Ich kann Sie nicht losbinden«, widersprach Blankenthal erneut, wieder mit dieser seltsamen Klarheit in der Stimme.
»Aber wieso denn nicht?«
Hatte sie schon längst an der Abbruchkante gestanden, direkt auf der Klippe der Verzweiflung, gab seine Antwort ihr jetzt den letzten Stoß:
»Weil ich«, sagte Blankenthal, und seine Stimme wurde ernst und schwer, »weil ich viel zu große Angst vor Ihnen habe.«
Kapitel 7
Vor mir?«
Wäre das eine Komödie gewesen, hätte die Geschichte eines Serientäters, der Angst vor seinem entführten Opfer hatte, vielleicht die Aussicht auf einen heiteren Kinoabend geboten. Nur leider war das kein Film, in dem sie steckte. Und ihre Wunde, die Schmerzen, die Fesseln und nicht zuletzt ihr kompletter Gedächtnisverlust ließen es hoffnungslos erscheinen, dass es für all das hier eine amüsante Erklärung geben könnte.
»Sie spielen mit mir?«, fragte sie. Wie die Katze, die die angeschleppte Maus als Ball missbrauchte und sie durch das Wohnzimmer stupste, bevor sie sie am Ende doch fraß.
»Wie bitte?« Blankenthal zog die buschigen, ebenfalls angegrauten Augenbrauen nach oben. Seine Augen weiteten sich. Ein Signal echter Überraschung.
»Das ist ein makabrer Scherz, ja?«, fragte sie ihn.
Er schüttelte den Kopf. »Ich verstehe nicht.«
Jetzt reicht’s. Sie bäumte sich auf, drückte den Rücken durch, so weit es ihre Fesseln erlaubten. Für einen Moment spürte sie keine Schmerzen mehr, nur noch Wut: »Nein. ICH verstehe nicht. ICH bin IHNEN ausgeliefert.«
Einem Schwerverbrecher, Sadisten und Soziopathen.
»SIE haben Menschen getötet.«
Sie aufgeschlitzt.
»SIE haben mich verschleppt und sehr wahrscheinlich verletzt. SIE halten mich gefangen. Und jetzt behaupten Sie, dass Sie Angst vor mir haben?«
Erschöpft ließ sie den Kopf zurück auf die Matratze sinken. Langsam wurden ihre Arme taub. Ihr Herz schien Probleme zu haben, das Blut aus dem flach auf dem Bett liegenden Körper in die nach oben geketteten Extremitäten zu pumpen. Möglicherweise schnürten die Kabelbinder die Blutversorgung schon ab den Handgelenken ab.
»Sie sind hier eindeutig der Gestörte«, sprach sie weiter, die warnende innere Stimme ignorierend, die ihr riet, den offenbar Geisteskranken vor ihr nicht weiter zu reizen.
Doch obwohl sie ihn beleidigt hatte, wirkte Blankenthal keineswegs verärgert. Eher resigniert. Er nickte traurig und stellte die Tasche ab, in der sich hoffentlich Wechselwäsche befand, die er sich irgendwo nach dem Ausbruch organisiert hatte. Vielleicht war sie aber auch mit Skalpellen, Knochensägen und Wundklammern gefüllt.
»Es tut mir leid, dass Sie das Gerede über mich mitbekommen haben.« Blankenthal deutete zum Fernseher. Sie bemerkte, dass sein Körper perfekt trainiert war. Kein Gramm Fett zu viel, keine Rettungsringe, dafür stark ausgeprägte Bauch- und Brustmuskeln.
»Ich wollte wissen, was in den Nachrichten über uns läuft, und habe versäumt, den Fernseher auszuschalten, bevor ich duschen ging, Frau Herbst.«
Herbst.
Schon wieder dieser Nachname.
Er klang vertraut, und dennoch war sie sich unsicher. Vielleicht kannte sie ihn nur wegen der Jahreszeit, die er benannte. Vielleicht hieß sie wirklich so.
Herbst.
Daran konnte sie sich wie an so vieles nicht erinnern.
»Ich weiß nicht genau, was Sie über mich gehört haben, aber es war vermutlich die Lüge, die sie alle über mich erzählen«, sagte Blankenthal.
Sie seufzte.
Unfassbar, dass ich diese Unterhaltung tatsächlich führe.
»Dann sind Sie nicht aus einer Gefängnisklinik ausgebrochen?«
»Das schon. Aber ich war zu Unrecht im Knast. Ich bin kein Perverser. Ich habe niemals einen unschuldigen Menschen absichtlich getötet.« Sein Blick wurde noch energischer. »Ganz im Unterschied zu Ihnen, Hannah Herbst!«
Kapitel 8
Das war das erste von vielen Malen, dass sie sich wünschte, der Nebel des Vergessens würde nicht nur die Vergangenheit, sondern auch ihre Gegenwart ersticken.
»Ich?«
Blankenthal nickte.
»Ich habe getötet?«
»Was denken Sie denn, weshalb Sie in der Gefängnisklinik waren?«
»Weil ich die Ärztin bin, die Sie auf Ihrer Flucht überwältigt und vermutlich verletzt haben.«
»Wie bitte?« Blankenthal lachte ungläubig auf. »Wollen Sie mich veräppeln? Sie sind keine Ärztin. Und die Wunde, derentwegen Sie im Knast operiert werden sollten, haben Sie sich selbst zugefügt.«
»Sie erzählen kompletten Mist.«
»Wieso sollte ich?«
»Keine Ahnung, Doktor«, blaffte sie zurück und musste einen Hustenreiz unterdrücken. Jedes Wort brannte in ihrer ausgetrockneten Kehle. »Sie sind offiziell geisteskrank. Ich habe es eben in den Nachrichten gehört. Die ganze Nation weiß das.«
Er atmete tief aus. Eine Ader pochte an seiner Schläfe. »Sie sollten nicht glauben, was man in den Medien über mich erzählt.«
»Dann sind Sie also kein falscher Chirurg, der sich an geöffneten Menschenkörpern aufgeilt?«
»Um Himmels willen, nein. Ich bin ein Betrüger. Hier bekenne ich mich schuldig. Ich habe nie studiert, dennoch verfüge ich über bessere Operationstechniken und einen größeren medizinischen Sachverstand als die meisten meiner offiziell promovierten Kollegen.«
»Aber Sie haben Menschen getötet!«
Er nickte traurig. »Die zwei Patienten haben es nicht anders verdient. Sie waren Gewaltverbrecher der schlimmsten Sorte. Offiziell eine Stütze der Gesellschaft, angesehene Bürger, aber ich habe vor der Operation mit ihren Frauen reden dürfen. Und ich habe die Wunden gesehen, die sie ihnen und ihren Kindern zugefügt haben. Also habe ich der Gesellschaft einen Dienst erwiesen, indem ich bei der Operation nicht die größte Sorgfalt walten ließ.« Blankenthals mächtiger Adamsapfel hüpfte schwer, als er schluckte. »Aber ich habe sie nicht wegen eines krankhaften Triebs oder Ähnlichem aufgeschnitten …« Er schluckte erneut. »Das war eine Lüge der Ermittler, die bewusst zu den Boulevardmedien durchgestochen wurde. Der junge Staatsanwalt wollte sich mit seinem ersten großen Fall auf meine Kosten profilieren. Er hat die Opfer zu Helden und mich zum Monster aufgebaut, um Profit aus einer spektakulären Verurteilung zu ziehen.«
»Und das soll ich Ihnen abnehmen?« Wäre sie dazu in der Lage gewesen, hätte sie ihm einen Vogel gezeigt.
»Wie sollte ich ausgerechnet Ihnen etwas vormachen, Frau Herbst?«
»Wie meinen Sie das?«
»Sie sind von uns beiden hier die Expertin. Selbst wenn ich es wollte, ich könnte Sie nicht anlügen.«
Sie spürte eine unangenehme Hitzewallung, so als hätte Blankenthal einen Heizstrahler auf sie gerichtet. »Ich verstehe nicht. Was für eine Expertin soll ich sein?«
Er zog die linke Augenbraue hoch und warf ihr einen misstrauischen Blick zu. Dabei trat er näher ans Bett, schaltete die Nachttischlampe ein und beugte sich über sie. »Sie können sich tatsächlich an nichts erinnern?«
»Nein!«
Er sah ihr mit einem so fokussierten Blick in die Augen, dass sie sich instinktiv wegdrehen musste.
»Hm«, grunzte er. »Könnte stimmen.«
»Was?«
Er bückte sich, um wenig später mit einem Klemmbrett in der Hand wieder aufzutauchen, das er seiner Tasche entnommen haben musste.
»Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern?«, hakte Blankenthal nach.
Schienen. Ein sich näherndes Licht. Rattern. Ein Gesicht … Mama?
»Ich, ich weiß nicht …«
Sie stocherte im Nebel des Vergessens, indem sie unter den Lidern die Augen bewegte, als scannte sie einen imaginären Raum ab, den Raum ihrer Erinnerungen. Ihr geistiger Blick traf dabei auf einzelne, zusammenhanglose Fragmente. Erinnerungen, die weit, weit zurückliegen mussten: Steine im Gleisbett, eine Pferdestatue, deren Kopf ein Lampenschirm war, Blut auf einem Vinylboden, der Bauchnabel eines Kindes, den sie kitzelte, glucksendes Kichern …
»Es ist alles so unklar.«
Er nickte, als überraschte ihn diese Antwort nicht sonderlich. Dann blätterte er die erste Seite von dem Klemmbrett nach hinten und begann von der folgenden abzulesen:
»›Anamnese von Hannah Herbst, vierzig Jahre alt, Adresse: Egestorffstraße 119 in 12307 Berlin. Keine Vorerkrankungen, keine regelmäßige Medikamenteneinnahme. Leidet nach eigenen Angaben an einer Betäubungsmittelunverträglichkeit, die bei der Geburt ihres Sohnes (Kaiserschnitt) festgestellt und bei einer Blinddarmoperation vor drei Jahren bestätigt wurde.‹ Sagt Ihnen das etwas?«
Nein.
»Was ist das für eine Akte?«
»Sie steckte an Ihrem Bett.«
»An welchem Bett?«
Blankenthal trat einen Schritt zurück und musterte sie eine Zeit lang, bevor er ihr die Frage beantwortete. »Noch mal: Sie wurden am Tag meines Ausbruchs in der Gefängnisklinik operiert, wegen einer selbst zugefügten Stichwunde, mit der Sie sich die Milz perforiert haben.« Blankenthal hob in einer entschuldigenden Geste beide Arme. »Glauben Sie mir. Hätte ich gewusst, wer Sie sind, hätte ich mir jemand anderen für meine Flucht ausgesucht.«
»UND WER BIN ICH, VERDAMMT?«
Der »Chirurg« trat wieder an das Bett heran, rüttelte an ihrer linken Hand, wohl um sich zu vergewissern, dass die Fesseln noch hielten.
»Sie waren meine Tarnung. Niemand kennt besser als ich die autoritäre Wirkung einer Uniform. Ich steckte im Kittel eines Chirurgen und trug Mundschutz und Haarmaske, als ich Sie aus dem Aufwachraum schob, in den Sie verbracht worden waren. Der Ausweis der Neuroradiologin, die ich vor dem MRT leider niederschlagen musste, öffnete mir alle Türen. Schließlich musste ich Sie nur noch in den Transporter schaffen, der Sie nach der OP zurück ins Frauengefängnis im Wedding bringen sollte.«
»Ich glaube Ihnen kein Wort.«
Er zuckte mit den Achseln.
»Glauben Sie, was Sie wollen. Ich sage die Wahrheit. Und die ist sehr plausibel, ganz im Gegensatz zu Ihrer Geschichte, Frau Herbst.«
Meine Geschichte? Was zum Teufel meint er damit schon wieder?
»Als ich Sie aus der Klinik schob, hab ich den Jungs vom Krankentransport glaubhaft versichert, dass ich als behandelnder Arzt mitfahren müsste, weil Sie auf die Betäubung schlecht reagiert hätten. War nicht sehr schwer, die Grünschnäbel zu überzeugen. Einige Kilometer von der Klinik entfernt schlug ich den Beifahrer mit dem Defibrillator bewusstlos und zwang seinen Kollegen zum Anhalten, bevor ich ihn ebenfalls ins Reich der Träume geschickt habe.«
»Wenn das stimmt, wieso haben Sie mich nicht zurückgelassen?«
Wie hat er es danach überhaupt geschafft, mich bewusstlos von A nach B zu transportieren?
Und wo war dieses B überhaupt?
In Berlin? Brandenburg? Belgien?
»Sie haben vollkommen recht. Eigentlich wollte ich alleine hierherflüchten«, erklärte er. »Doch die beiden vorne in der Fahrerkabine sprachen während der Fahrt über Sie. Und so erfuhr ich, was Sie getan haben, Frau Herbst.«
»Was?«
Blankenthal seufzte und nahm ein Smartphone in die Hand, das wohl neben dem Fernseher gelegen hatte. Er aktivierte den Bildschirm und kam näher an das Bett heran.
»Sie halten mich ja eh für einen Lügner. Am besten also, Sie sehen es mit eigenen Augen.«
Kapitel 9
Vernehmung von Hannah Herbst, Untersuchungsgefängnis Moabit, B.HH.789Z/19. Heute ist der 13. Oktober zweitausend…«
Das genaue Datum, das der Mann auf der Videoaufnahme im Handy sagte, verpasste sie, da ihre Gedanken abschweiften.
Ich wurde verhört? Weswegen?
»Die Befragung führt Kriminalhauptkommissar Fadil Matar.«
Auf dem Handy, das Blankenthal ihr in einem Abstand von zwanzig Zentimetern vor die Augen hielt, konnte sie nicht erkennen, ob der Beamte hinter oder neben der Kamera saß. Der Polizist hielt sich auf der Aufnahme unsichtbar im Hintergrund. In Thrillern (daran konnte sie sich aus irgendeinem Grund sehr gut erinnern) sah man bei Vernehmungsvideos sehr oft körnige Aufnahmen; lichtentsättigte Bilder, die an die Qualität von Überwachungskameras an Tankstellen erinnerten. Wohl, weil auf alt getrimmte Videos mit einem gruseligen Super-8-Effekt die Spannung verstärken sollten. Diese Aufnahme hingegen war erstklassig. Nur die Beleuchtung hätte etwas professioneller sein können. Dunkle Schatten lagen auf dem Gesicht der elendsmüden Frau, die ihre Ellenbogen auf einem schlichten Tisch mit mausgrauer Resopaloberfläche abstützte. Der Tisch stand vor einer geweißten Backsteinmauerwand.
Bin ich das? Sehe ich so aus?
Sie war versucht, den Blick abzuwenden. Die Frau zu betrachten löste in ihr ein Unbehagen aus, was nicht daran liegen konnte, dass sie eine besonders unangenehme Erscheinung war, im Gegenteil. Ihr Gesicht war vermutlich eines, das man unter normalen Umständen gerne ansah. Nicht, weil es besonders hübsch war, wohl aber, weil es freundlich wirkte. Die Augen waren von einem stechenden Blau, was sie als sehr außergewöhnlich empfand, bei dem haselnussbraunen Grundton der Haare. Sie fielen offen über die Schultern eines anthrazitfarbenen, geschäftsmäßig wirkenden Blazers, den sie über einer weißen Bluse mit Button-down-Kragen trug.