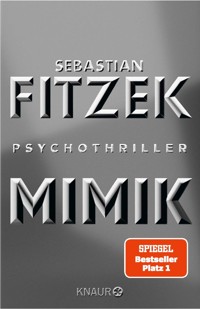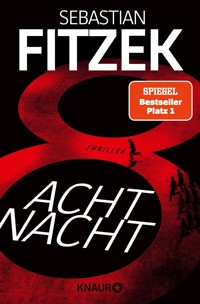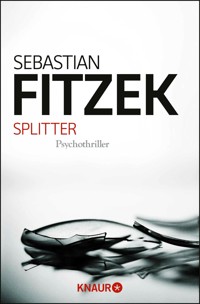9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die spektakuläre Geschichte um einen Serienmörder, der die Augen seiner Opfer sammelt Er spielt das älteste Spiel der Welt: Verstecken. Er spielt es mit deinen Kindern. Er gibt dir 45 Stunden, sie zu finden. Doch deine Suche wird ewig dauern. Erst tötet er die Mutter, dann verschleppt er das Kind und gibt dem Vater 45 Stunden Zeit für die Suche. Das ist seine Methode. Nach Ablauf der Frist stirbt das Opfer in seinem Versteck. Doch damit ist das Grauen nicht vorbei: Den aufgefundenen Kinderleichen fehlt jeweils das linke Auge. Bislang hat der "Augensammler" keine brauchbare Spur hinterlassen. Da meldet sich eine mysteriöse Zeugin: Alina Gregoriev, eine blinde Physiotherapeutin, die behauptet, durch bloße Körperberührungen in die Vergangenheit ihrer Patienten sehen zu können. Und gestern habe sie womöglich den Augensammler behandelt … Bestsellerautor Sebastian Fitzeks erste Thriller-Reihe! Dieser Serienkiller-Thriller punktet mit knallharter Action und unerwarteten Wendungen. "Der Augensammler" ist ein absolutes Must-read für alle Thriller-Fans, die auf der Suche nach einem atemlosen Lesevergnügen sind. "Der Psychothriller Der Augensammler geht bis an die Grenzen des Erträglichen, weniger der Grausamkeiten als der seelischen Höchstspannung wegen. Ein echter Pageturner!" Focus
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Der Augensammler
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Er spielt das älteste Spiel der Welt: Verstecken. Er spielt es mit deinen Kindern. Er gibt dir 45 Stunden, sie zu finden. Doch deine Suche wird ewig dauern. Erst tötet er die Mutter, dann verschleppt er das Kind und gibt dem Vater 45 Stunden Zeit für die Suche. Das ist seine Methode. Nach Ablauf der Frist stirbt das Opfer in seinem Versteck. Doch damit ist das Grauen nicht vorbei: Den aufgefundenen Kinderleichen fehlt jeweils das linke Auge.
Bislang hat der »Augensammler« keine brauchbare Spur hinterlassen. Da meldet sich eine mysteriöse Zeugin: Alina Gregoriev, eine blinde Physiotherapeutin, die behauptet, durch bloße Körperberührungen in die Vergangenheit ihrer Patienten sehen zu können. Und gestern habe sie womöglich den Augensammler behandelt …
Inhaltsübersicht
Sachdienlicher Hinweis
Widmung
Motto
Epilog
Letztes Kapitel. Das Ende
83. Kapitel
82. Kapitel
81. Kapitel
80. Kapitel
79. Kapitel
78. Kapitel
77. Kapitel
76. Kapitel
75. Kapitel
74. Kapitel
73. Kapitel
72. Kapitel
71. Kapitel
70. Kapitel
69. Kapitel
68. Kapitel
67. Kapitel
66. Kapitel
65. Kapitel
64. Kapitel
63. Kapitel
62. Kapitel
61. Kapitel
60. Kapitel
59. Kapitel
58. Kapitel
57. Kapitel
56. Kapitel
55. Kapitel
54. Kapitel
53. Kapitel
52. Kapitel
51. Kapitel
50. Kapitel
49. Kapitel
48. Kapitel
47. Kapitel
46. Kapitel
45. Kapitel
44. Kapitel
43. Kapitel
42. Kapitel
41. Kapitel
40. Kapitel
39. Kapitel
38. Kapitel
37. Kapitel
36. Kapitel
35. Kapitel
34. Kapitel
33. Kapitel
32. Kapitel
31. Kapitel
Blinder als blind …
30. Kapitel
29. Kapitel
28. Kapitel
27. Kapitel
26. Kapitel
25. Kapitel
24. Kapitel
23. Kapitel
22. Kapitel
21. Kapitel
20. Kapitel
19. Kapitel
18. Kapitel
17. Kapitel
16. Kapitel
15. Kapitel
14. Kapitel
13. Kapitel
12. Kapitel
11. Kapitel
10. Kapitel
9. Kapitel
8. Kapitel
7. Kapitel
6. Kapitel
5. Kapitel
4. Kapitel
3. Kapitel
2. Kapitel
1. Kapitel
Prolog
Erstes Kapitel. Der Anfang
Zum Buch und Danksagung
Interview mit Sebastian Fitzek zu»Der Augensammler«
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar«
Sachdienlicher Hinweis: Die Kapitelnummern dieses Thrillers laufen rückwärts! Das ist Absicht und kein Fehler. Sollten Sie dieses eBook umtauschen wollen, müssen Sie sich eine andere Ausrede einfallen lassen. Ansonsten gilt: Nein, bitte nicht nach hinten springen (hinten ist da, wo die Danksagung steht), sondern wie gewohnt (von oben nach unten) lesen. Der Sinn der Rückwärtsnumerierung erschließt sich am Ende des Thrillers und wird daher hier nicht verraten. Viel Spaß beim Lesen Ihr Sebastian Fitzek
In Erinnerung an Rüdiger Kreklau
Es sind die Phantasten, die die Welt verändern,und nicht die Erbsenzähler.
Spielen ist Experimentieren mit dem Zufall.
Novalis
It’s the end where I begin.
The Script
Epilog
Alexander Zorbach (Ich)
Es gibt Geschichten, die sind wie tödliche Spiralen und graben sich mit rostigen Widerhaken tiefer und tiefer in das Bewusstsein dessen, der sie sich anhören muss. Ich nenne sie Perpetuum morbile. Geschichten, die niemals begonnen haben und auch niemals enden werden, denn sie handeln vom ewigen Sterben.
Manchmal werden sie einem von einer gewissenlosen Person erzählt, die sich an dem Entsetzen in den Augen ihres Zuhörers ergötzt und an den Alpträumen, die sie mit Sicherheit auslösen werden – nachts, wenn man alleine im Bett liegt und die Decke anstarrt, weil man nicht schlafen kann.
Hin und wieder findet man solch ein Perpetuum morbile zwischen zwei Buchdeckeln, so dass man ihm entfliehen kann, indem man das Buch zuschlägt. Ein Ratschlag, den ich Ihnen jetzt schon geben möchte: Lesen Sie nicht weiter!
Ich weiß nicht, wie Sie an diese Zeilen geraten sind. Ich weiß nur, dass sie nicht für Sie bestimmt sind. Das Protokoll des Grauens sollte niemandem in die Hände fallen. Nicht einmal Ihrem größten Feind.
Glauben Sie mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich konnte die Augen nicht schließen. Das Buch nicht weglegen. Denn die Geschichte des Mannes, dessen Tränen wie Blutstropfen aus den Augen quellen – die Geschichte des Mannes, der das verdrehte Bündel menschlichen Fleisches an sich presst, das nur wenige Minuten zuvor noch geatmet, geliebt und gelebt hat – diese Geschichte ist kein Film, keine Legende, kein Buch.
Sie ist mein Schicksal.
Mein Leben.
Denn der Mann, der am Höhepunkt seiner Qualen erkennen musste, dass das Sterben erst begonnen hat – dieser Mann bin ich.
Letztes Kapitel. Das Ende
»Schlaf, Kindlein, schlaf.
Der Vater hüt’ die Schaf …«
»Sagen Sie ihr, sie muss damit aufhören«, brüllte die Stimme des Einsatzleiters in mein rechtes Ohr.
»Die Mutter schüttelt’s Bäumelein.
Da fällt herab ein Träumelein …«
»Sie soll sofort aufhören, dieses verdammte Lied zu singen.«
»Ja, ja. Ist mir klar. Ich weiß schon, was ich zu tun habe«, antwortete ich über das winzige Funkmikrophon, das der Techniker des mobilen Einsatzkommandos mir vor wenigen Minuten an mein Hemd gepappt hatte und über das ich nun mit dem Einsatzleiter die Verbindung hielt. »Wenn Sie mich weiter so anschreien, reiße ich mir den verdammten Knopf aus dem Ohr, verstanden?«
Ich näherte mich der Mitte der Brücke, die über die A100 führte. Die Stadtautobahn, elf Meter unter uns, war mittlerweile in beiden Richtungen gesperrt – mehr, um die Autofahrer zu schützen als die verwirrte Frau, die eine Omnibuslänge von mir entfernt stand.
»Angelique?«, rief ich laut ihren Namen. Dank des kurzen Briefings, das ich in der provisorischen Kommandozentrale erhalten hatte, wusste ich, dass sie siebenunddreißig Jahre alt war, zwei Vorstrafen wegen versuchter Kindesentführung hatte und von den letzten zehn Jahren mindestens sieben in einer geschlossenen Anstalt hatte verbringen müssen. Leider hatte ein verständnisvoller Psychologe vor vier Wochen ein Gutachten erstellt, das ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft empfahl.
Schönen Dank, Herr Kollege. Jetzt haben wir den Salat!
»Ich komme etwas näher, wenn Sie nichts dagegen haben«, sagte ich und hob die Hände. Keine Reaktion. Sie lehnte an dem verrosteten Geländer, die Arme vor dem Oberkörper zu einer Wiege verschränkt. Hin und wieder schwankte sie leicht nach vorne, so dass ihre Ellbogen über die Brüstung ragten.
Ich zitterte ebenso vor Anspannung wie vor Kälte. Zwar lagen die Temperaturen für den Monat Dezember noch erstaunlich weit über dem Gefrierpunkt, doch die gefühlte Temperatur konnte mühelos mit der von Jakutsk mithalten. Drei Minuten hier draußen im Wind, und mir fielen fast die Ohren ab.
»Hallo, Angelique?«
Schotter knirschte unter meinen schweren Stiefeln, und sie drehte zum ersten Mal den Kopf zu mir; ganz langsam, wie in Zeitlupe.
»Mein Name ist Alexander Zorbach, und ich würde gerne mit Ihnen sprechen.«
Denn das ist mein Job. Ich bin heute der Verhandlungsführer.
»Ist es nicht wunderschön?«, fragte sie im gleichen Singsang, in dem sie eben noch das Kinderlied intoniert hatte.
Schlaf, Kindlein, schlaf …
»Ist mein Baby nicht wunder-, wunderschön?«
Ich bestätigte es ihr, obwohl ich aus der Entfernung kaum erkennen konnte, was sie da an ihren schmächtigen Oberkörper presste. Es hätte ebenso eine Kissenrolle sein können, ein zusammengefaltetes Laken oder eine Stoffpuppe. Doch so viel Glück war uns nicht beschieden. Die Wärmebildkamera hatte es bestätigt. In ihren Armen lag etwas Lebendiges, etwas Warmes. Noch konnte ich es nicht sehen, dafür aber hören.
Das sechs Monate alte Baby schrie. Etwas entkräftet, aber immerhin schrie es noch.
Das war bis jetzt die beste Nachricht des Tages.
Die schlechte war, dass der Säugling nur noch wenige Minuten zu leben hatte.
Und zwar selbst dann, wenn die geistig verwirrte Frau ihn nicht von der Brücke werfen würde.
Verdammt, Angelique. Du hast dir diesmal in jeglicher Hinsicht das falsche Baby ausgesucht.
»Wie heißt denn der süße Fratz?«, versuchte ich erneut ein Gespräch mit ihr in Gang zu bringen.
Wegen einer verpfuschten Abtreibung konnte die Frau keine Kinder bekommen. Eine Tatsache, über der sie den Verstand verloren hatte. Nun hatte sie bereits zum dritten Mal ein fremdes Baby entführt, um es als ihr eigenes auszugeben. Und zum dritten Mal war sie von Passanten in der Nähe des Krankenhauses entdeckt worden. Heute hatte es nur eine halbe Stunde gedauert, bis einem Fahrradkurier die barfüßige Frau mit dem weinenden Baby auf der Brücke aufgefallen war.
»Es hat noch keinen Namen«, sagte Angelique. Ihr Verdrängungsprozess war so weit fortgeschritten, dass sie in diesem Augenblick fest davon ausging, das Kind in ihren Armen wäre tatsächlich ihr eigen Fleisch und Blut. Ich wusste, es war sinnlos, sie vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Was sieben Jahre Intensivtherapie nicht erreicht hatten, würde mir in sieben Minuten ganz sicher nicht gelingen – aber das war auch gar nicht meine Absicht.
»Was halten Sie von ›Hans‹?«, schlug ich vor. Mein Abstand zu ihr betrug jetzt höchstens noch zehn Meter.
»Hans?« Sie löste einen Arm von dem Bündel und öffnete die Wickeldecke. Erleichtert hörte ich, wie das Baby anfing zu plärren.
»Hans klingt schön«, sagte Angelique selbstvergessen. Sie trat einen kleinen Schritt zurück und stand nun nicht mehr so nah an dem Geländer. »Wie ›Hans im Glück‹.«
»Ja«, pflichtete ich ihr bei und setzte vorsichtig einen weiteren Schritt nach vorne.
Neun Meter.
»Oder wie der Hans aus dem anderen Märchen.«
Sie drehte sich zu mir und sah mich fragend an. »Welches andere Märchen?«
»Na das von der Nymphe Undine.«
Um genau zu sein, war das eher eine germanische Sage als ein Märchen, aber das war im Augenblick irrelevant.
»Undine?« Sie zog die Mundwinkel herab. »Kenn ich nicht.«
»Nein? Ach, dann muss ich es Ihnen erzählen. Es ist wunderschön.«
»Was haben Sie vor? Sind Sie jetzt völlig übergeschnappt?«, schrie der Einsatzleiter in meinem rechten Ohr, was ich ignorierte.
Acht Meter. Schritt für Schritt arbeitete ich mich in ihren Strafraum vor.
»Undine war ein gottgleiches Wesen, eine Nymphe, so wunderschön wie keine Zweite. Sie verliebte sich unsterblich in den Ritter Hans.«
»Hörst du, mein Süßer? Du bist ein Ritter!«
Das Baby quittierte das mit einem lauten Schrei.
Es atmete also noch. Gott sei Dank.
»Ja, aber der Ritter war so schön, dass ihm alle Frauen hinterherliefen«, fuhr ich fort. »Und leider verliebte er sich in eine andere Frau und verließ Undine.«
Sieben Meter.
Ich wartete, bis ich das Baby wieder plärren hörte, dann fuhr ich fort. »Darüber war Undines Vater, der Meeresgott Poseidon, so erzürnt, dass er Hans verfluchte.«
»Ein Fluch?« Angelique hielt in ihrer Wiegebewegung inne.
»Ja. Fortan konnte Hans nicht mehr unbewusst von alleine atmen. Er musste sich darauf konzentrieren.«
Ich sog geräuschvoll die kalte Luft in meine Lungen und stieß sie beim Sprechen stoßweise wieder aus. »Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen.« Mein Brustkorb hob und senkte sich demonstrativ.
»Würde Hans nur ein einziges Mal nicht daran denken zu atmen, müsste er sterben.«
Sechs Meter.
»Wie endet das Märchen?«, fragte Angelique misstrauisch, als ich mich bis auf eine Autolänge vorgetastet hatte. Dabei schien ihr jedoch weniger meine Nähe als die Wendung zu missfallen, die das Märchen genommen hatte.
»Hans tut alles, um nicht einzuschlafen. Er kämpft gegen die Müdigkeit an, aber am Ende fallen ihm doch die Augen zu.«
»Er stirbt?«, fragte sie tonlos. Jede Freude war aus dem ausgezehrten Gesicht gewichen.
»Ja. Denn im Schlaf wird er unweigerlich vergessen zu atmen. Und das bedeutet seinen Tod.«
In meinem Ohr knackte es, doch dieses eine Mal hielt der Einsatzleiter den Mund. Hier draußen war nun nichts zu hören außer dem entfernten Rauschen des Stadtverkehrs. Ein Schwarm schwarzer Vögel zog hoch über unseren Köpfen Richtung Osten.
»Das ist aber kein schönes Märchen.« Angelique wankte etwas nach vorne, wiegte jetzt mit dem gesamten Körper das eng an sie gepresste Baby. »Nicht schön.«
Ich streckte ihr die Hand entgegen und kam noch näher. »Nein, ist es nicht. Und eigentlich ist es auch gar kein Märchen!«
»Sondern?«
Ich machte eine Pause, wartete wieder darauf, dass ich irgendein Lebenszeichen des Kleinen hörte. Doch da war nichts mehr. Nur Stille. Mein Mund war wie ausgedörrt, als ich es ihr sagte. »Es ist die Wahrheit.«
»Die Wahrheit?«
Sie schüttelte energisch den Kopf, als ahne sie bereits, was ich jetzt sagen wollte.
»Angelique, hören Sie mir bitte zu. Das Baby in Ihren Händen leidet am Undine-Syndrom, einer Krankheit, benannt nach dem Märchen, das ich Ihnen eben erzählt habe.«
»Nein!«
Doch.
Die Tragik war, dass ich ihr keine taktische Lüge auftischte. Das Undine-Syndrom ist eine seltene Störung des zentralen Nervensystems, bei der die betroffenen Kinder ersticken, wenn sie sich nicht willentlich auf ihre Atmung konzentrieren. Eine schwere, lebensgefährliche Krankheit. Bei Tim (so hieß der Säugling wirklich) reichte die Atemaktivität in seinen Wachphasen noch aus, um den kleinen Körper mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Nur wenn er schlief, musste er beatmet werden.
»Es ist mein Kind«, protestierte Angelique wieder mit ihrer Schlafliedstimme.
Schlaf, Kindlein, schlaf …
»Sehen Sie nur, wie friedlich es in meinen Armen schlummert.«
O Gott, nein. Sie hatte recht. Das Baby gab keinen Ton mehr von sich.
Der Vater hüt’ die Schaf.
»Ja, es ist Ihr Baby, Angelique«, sagte ich eindringlich und näherte mich einen weiteren Meter. »Das bestreitet niemand. Aber es darf nicht einschlafen, hören Sie? Sonst stirbt es, so wie der Hans im Märchen.«
»Nein, nein, nein!« Sie schüttelte trotzig den Kopf. »Mein Baby ist nicht böse gewesen. Es wurde nicht verflucht.«
»Nein, das wurde es ganz sicher nicht. Aber es ist krank. Geben Sie ihn mir bitte, damit die Ärzte Ihren Jungen wieder gesund machen können.«
Jetzt war ich so nah bei ihr, dass ich den süßlich-ranzigen Duft ihrer ungewaschenen Haare roch. Den Geruch der geistigen und körperlichen Verwahrlosung, der jede Faser ihres billigen Jogginganzugs durchtränkte.
Sie drehte sich zu mir, und zum ersten Mal konnte ich einen Blick auf das Baby werfen. Auf sein leicht gerötetes, auf sein winziges … auf sein schlafendes Gesicht. Erschrocken sah ich zu Angelique. Und da setzte es bei mir aus.
»Scheiße, nein, tun Sie das nicht!«, brüllte die Stimme des Einsatzleiters in meinem Ohr, die ich zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr hörte. »Runter damit. Runter!«
Diese und die folgenden Sätze entnahm ich später dem Einsatzprotokoll, das mir der Leiter der Untersuchungskommission vorlegte.
Heute, sieben Jahre nach dem Tag, der mein Leben zerstörte, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich es wirklich gesehen hatte.
Es.
Dieses Etwas in ihrem Blick. Den Ausdruck reinster, völlig verzweifelter Selbsterkenntnis. Aber damals war ich mir sicher.
Nennen Sie es Vorahnung, Intuition, Hellsichtigkeit. Es ist, was es ist, und ich spürte es mit all meinen Sinnen: In der Sekunde, in der sich Angelique zu mir drehte, war ihr ihre psychische Störung bewusst geworden. Sie hatte sich selbst erkannt. Wusste, dass sie krank war. Dass ihr das Baby nicht gehörte. Und dass ich es ihr niemals wieder zurückgeben würde, sobald ich es erst in meinen Händen hielt.
»Hören Sie auf. Machen Sie keinen Scheiß, Mann.«
Ich hatte genügend Erfahrung durch mein Boxtraining, um zu wissen, worauf man bei einem Gegner achten muss, wenn man seine Bewegungen im Voraus erahnen will. Auf seine Schultern! Und Angeliques Schultern bewegten sich in eine Richtung, die nur eine einzige Interpretation zuließ, zumal sie jetzt langsam die Arme öffnete.
Drei Meter. Nur noch drei verdammte Meter.
Sie wollte das Baby von der Brücke schleudern.
»Waffe fallen lassen. Ich wiederhole: Waffe sofort fallen lassen.«
Und deshalb achtete ich nicht auf die Stimme in meinem Kopf, sondern richtete die Pistole direkt auf ihre Stirn.
Und schoss.
Meist ist das der Moment, in dem ich schreiend aufwache und mich für eine Sekunde freue, dass das alles nur ein Alptraum gewesen ist. Bis ich die Hand ausstrecke und auf der Betthälfte neben mir ins Leere taste. Bis mir einfällt, dass diese Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben. Sie sorgten dafür, dass ich meinen Job, meine Familie und die Fähigkeit verlor, eine Nacht durchzuschlafen, ohne von den Alpträumen geweckt zu werden.
Seit jenem Schuss lebe ich in Angst. Eine klare, kalte und alles durchdringende Angst; das Konzentrat, aus dem sich meine Träume speisen.
Damals auf der Brücke habe ich einen Menschen getötet.
Und sosehr ich es mir auch einrede, dass ich eine andere Seele dafür retten konnte, so sicher bin ich mir, dass diese Gleichung nicht aufgeht. Denn was, wenn ich mich damals geirrt habe? Was, wenn Angelique niemals vorgehabt hatte, dem Baby etwas anzutun? Vielleicht hatte sie die Arme nur geöffnet, um mir das Kind zu reichen? In der Sekunde, in der das Geschoss, das ich auf sie feuerte, ihren Schädel durchdrang. So schnell, dass ihr Gehirn nicht einmal mehr einen Impuls senden konnte, die Arme noch weiter zu lockern. So schnell, dass ich das Baby auffangen konnte, bevor es ihr aus den toten Händen glitt.
Was also, wenn ich damals auf der Brücke einen unschuldigen Menschen getötet habe?
Dann, so viel war sicher, würde ich eines Tages für meinen Fehler bezahlen müssen.
Das wusste ich. Mir war nur nicht klar gewesen, dass dieser Tag so bald kommen würde.
83. Kapitel
Und wieder besuchte ich mit meinem Sohn diesen Ort, von dem es hieß, es gäbe für ein Kind in Berlin keinen besseren zum Sterben.
»Wirklich? Der Helikopter?«, fragte ich und deutete mit dem Kinn auf den geöffneten Pappkarton, den ich den langen Flur hinuntertrug. »Hast du dir das gut überlegt? Immerhin ist es ein Captain-Jack-Heli mit Powerboost.«
Julian nickte eifrig, während er mit beiden Händen eine prall gefüllte Ikea-Tragetasche über das Linoleum zog.
Ich hatte ihm mehrfach meine Hilfe angeboten, aber er wollte den schweren Sack unbedingt alleine durch das Krankenhaus schleppen. Typischer Fall von »Ich bin schon stark genug«-Phantasien, die alle Jungen irgendwann einmal erfassen, irgendwo zwischen der »Ich will aber nicht alleine«- und der »Ihr könnt mich alle mal«-Phase.
Das Einzige, was ich tun konnte, ohne seinen Stolz zu verletzen, war, etwas langsamer zu gehen.
»Das Ding brauche ich nicht mehr!«, sagte Julian bestimmt.
Dann fing er an zu husten. Erst klang es so, als hätte er sich nur verschluckt, dann wurde sein Husten immer kehliger.
»Alles in Ordnung, Kleiner?« Ich setzte die Kiste ab.
Schon als ich ihn von zu Hause abgeholt hatte, war mir sein gerötetes Gesicht aufgefallen, doch Julian hatte die schwere Tüte ganz allein in den Garten gewuchtet, und so hatte ich angenommen, seine verschwitzte Hand und die feuchten Locken, die ihm im Nacken klebten, wären auf diese Anstrengung zurückzuführen.
»Hast du etwa immer noch diese Erkältung?«, fragte ich besorgt.
»Ist schon wieder gut, Papi.« Er wehrte meine Hand ab, mit der ich nach seiner Stirn tasten wollte.
Dann hustete er wieder, aber es klang tatsächlich etwas besser als zuvor.
»War Mami mit dir mal beim Arzt?«
Vielleicht sollten wir dich hier durchchecken lassen, wenn wir schon mal in einem Krankenhaus sind.
Julian schüttelte den Kopf.
»Nein, nur …« Er stockte, und ich fühlte Wut in mir aufsteigen.
»Nur was?«
Er wandte sich schuldbewusst von mir ab und griff nach den Tragegriffen der Tasche.
»Moment mal, ihr seid doch nicht etwa wieder bei diesem Schamanen gewesen?«
Er nickte zaghaft, als würde er mir gestehen, etwas angestellt zu haben. Nur dass ihn in diesem Fall überhaupt keine Schuld traf. Es war seine Mutter, die sich immer mehr auf esoterische Abwege begab und unseren Sohn lieber zu einem indischen Wunderguru als zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt schleppte.
Vor langer Zeit, als ich mich gerade in Nicci verliebte, hatte ich mich noch über ihre Spleens amüsiert, fand es sogar unterhaltsam, wenn sie mir die Zukunft aus den Linien meiner Hand lesen wollte oder mir offenbarte, dass sie in einem früheren Leben eine griechische Sklavin gewesen war. Doch mit den Jahren wurden aus ihren harmlosen Verschrobenheiten handfeste Macken, die gewiss auch ihren Teil dazu beigetragen haben, dass ich mich erst seelisch und dann körperlich von ihr löste. Zumindest will ich mir das gerne einreden, um nicht die Alleinschuld am Scheitern unserer Ehe zu tragen.
»Was hat dieser Quacksa…, dieser Schamane denn gesagt?«, fragte ich und schloss zu meinem Sohn auf. Ich musste mir Mühe geben, nicht aggressiv zu klingen. Julian hätte es auf sich bezogen, und er konnte nun wahrlich nichts dafür, dass seine Mutter weder an die Schulmedizin noch an die Evolutionstheorie glaubte.
»Er meinte, meine Chakren seien nicht richtig aufgeladen.«
»Die Chakren?«
Blut schoss mir ins Gesicht.
»Na klar, die Chakren. Warum bin ich da nicht selbst draufgekommen? Vermutlich war das auch der Grund, weshalb unser Sohn sich vor zwei Jahren das Handgelenk beim Skateboardfahren gebrochen hat«, hielt ich Nicci einen stummen Vortrag. Damals schon hatte sie den Chirurgen ernsthaft gefragt, ob eine Betäubung nicht durch Hypnose ersetzt werden könne.
»Du solltest was trinken«, sagte ich, um das Thema zu wechseln, und deutete auf den Getränkeautomaten. »Was willst du?«
»Cola«, jubelte er sofort.
Alles klar. Eine Cola.
Nicci würde mir den Kopf abreißen, so viel stand fest.
Meine Noch-Ehefrau kaufte grundsätzlich nur in Ökoläden und Biosupermärkten, eine chemiehaltige Koffeinbrause stand unter Garantie nicht auf ihrer Einkaufsliste.
Tja, aber Fencheltee gibt’s hier nun mal nicht, dachte ich und tastete meine Jackentaschen nach meinem Portemonnaie ab. Eine unerwartete Stimme hinter mir, jung und doch verbraucht, ließ mich zusammenfahren.
»Was für eine Überraschung, die Zorbachs!«
Die blonde Krankenschwester, an die ich mich wegen ihrer auffälligen Oberlippenpiercings noch dunkel von unserem Besuch im letzten Jahr erinnerte, hatte sich wie aus dem Nichts materialisiert und stand jetzt mit ihrem bunt bemalten Teewagen im Flur des Krankenhauses.
»Hallo Moni«, sagte Julian, der sie offenbar auch wiedererkannte. Sie schenkte ihm ein einstudiertes »Kleine Patienten sind meine Kumpel«-Lächeln. Dann fiel ihr Blick auf unser Gepäck.
»So viel dieses Jahr?«
Ich nickte geistesabwesend, weil ich meine Brieftasche immer noch nicht gefunden hatte.
Bitte nicht! Alle Ausweise, Kreditkarten, sogar die Key-Card, ohne die ich nicht in das Großraumbüro komme.
Ich erinnerte mich daran, dass ich sie gestern vor dem Getränkeautomaten der Redaktion noch gehabt hatte. Ich hätte schwören können, sie wieder zurück in meine Jackentasche gesteckt zu haben. Doch jetzt war sie verschwunden.
»Ja, es wird jedes Jahr mehr Spielzeug«, murmelte ich und ärgerte mich im gleichen Moment, dass ich so schuldbewusst klang. Es mochte auf den ersten Blick dem typischen Trennungsklischee entsprechen, aber tatsächlich hatte ich meinem Sohn schon immer gerne Geschenke gekauft. Wobei ein geschnitzter Holztraktor natürlich pädagogisch wertvoller gewesen wäre als die im Dunkeln leuchtende Wasserpistole, die die Schwester gerade aus der Ikea-Tüte zog. Aber »pädagogisch wertvoll« war ein Argument, mit dem mich schon meine Eltern zur Genüge gequält hatten, die es partout nicht hatten einsehen wollen, weshalb ich einen Walkman oder ein BMX-Rad brauchte, nur weil alle meine Freunde damit herumfuhren. Nennen Sie mich oberflächlich, aber meinem Sohn wollte ich dieses Außenseiterschicksal ersparen, was nicht bedeutete, dass ich ihm jeden Mist kaufte, nur damit er dazugehörte. Aber ich schickte ihn auch nicht mit leeren Händen in den darwinistischen Überlebenskampf, wie er Tag für Tag auf den Schulhöfen aufs Neue ausgefochten wird.
Moni hatte sich mittlerweile zu einer Spiderman-Puppe vorgetastet. »Ich finde es echt bewundernswert, dass du dich von all den tollen Sachen trennen willst«, sagte sie und lächelte meinen Sohn an.
»Kein Problem«, grinste Julian zurück. »Mach ich gerne.«
Womit er die Wahrheit sagte. Es war zwar meine Idee gewesen, einmal im Jahr sein Zimmer auszumisten, bevor es zum Geburtstag Spielzeugnachschub gab. Aber er war sofort darauf eingegangen.
»Wir schaffen Platz und tun was Gutes!«, hatte er meine Worte wiederholt und sich sofort ans Werk gemacht. Und so war unser »Sonnenschein-Tag« entstanden, wie wir ihn nannten. Der Tag, an dem Vater und Sohn sich aufmachten, das ausrangierte Spielzeug in das Kinderhospiz zu schleppen und es hier unter den kleinen Patienten zu verteilen.
»Die ist sicher was für Tim«, sagte die Schwester lächelnd und legte die Spiderman-Puppe zurück zu den anderen Spielsachen. Dann verabschiedete sie sich und zog weiter.
Ich sah ihr nach und merkte zu meiner Bestürzung, dass es mir nur mit Mühe gelungen war, meine Tränen zurückzuhalten.
»Alles okay?«, fragte Julian und sah mich an. Er war es schon gewohnt, dass sich sein Vater zu einer Heulsuse entwickelte, sobald er die Sonnenschein-Station in der zweiten Etage betrat. Er selbst hatte hier noch nie geweint. Wahrscheinlich, weil der Tod für ihn noch so weit weg und unvorstellbar war. Doch für mich war das Sterbehospiz für schwerstkranke Kinder eine kaum zu ertragende Umgebung. Man hätte vielleicht annehmen können, dass jemand, der schon einmal einen Menschen erschossen hatte, etwas abgestumpft wäre – zumal ich seit meiner Suspendierung vom Polizeidienst mein Geld als Polizeireporter verdienen musste. Seit vier Jahren arbeitete ich für die größte und damit blutrünstigste Zeitung der Stadt und hatte mir als Journalist mit meiner Berichterstattung über die grausamsten Gewaltverbrechen Deutschlands mittlerweile sogar so etwas wie einen Namen gemacht. Doch je mehr ich über die schrecklichsten Grausamkeiten dieser Welt schrieb, desto weniger war ich bereit, den Tod zu akzeptieren. Schon gar nicht, wenn es sich um den Tod unschuldiger Kinder handelte, die an Leukämie, Herzversagen oder dem Undine-Syndrom litten.
Tim!
»So hieß doch der Junge, den du damals gerettet hast, oder?«
Ich nickte und gab es endgültig auf, nach meinem Portemonnaie zu suchen. Wenn ich Glück hatte, lag es auf dem Sitz meines Volvos, aber höchstwahrscheinlich hatte ich es irgendwo verloren.
»Ganz genau. Aber das ist er nicht. Er trägt nur den gleichen Namen.«
Der Tim, dessen Entführerin ich erschossen hatte, schrieb mir regelmäßig Weihnachtskarten. Solche von der Sorte, zu denen Eltern einen zwingen: in krakeliger Handschrift mit Worten, die kein Kind freiwillig in den Mund nehmen würde. Karten, die man sich an den Kühlschrank klebt und dort so lange nicht beachtet, bis sie von alleine abfallen. Aber immerhin waren es Lebenszeichen, die mir zeigten, dass Tim trotz seiner schweren Krankheit ein halbwegs normales Leben zu Hause bei seinen Eltern führte und nicht den letzten Stunden in einem Kinderhospiz entgegendämmerte.
»Mama sagt, seit damals auf der Brücke bist du nicht mehr der Alte.« Julian sah mich mit großen Augen an.
Damals auf der Brücke.
Manchmal umschreiben Worte ein ganzes Universum. »Ich liebe dich« oder »Wir sind eine Familie« zum Beispiel. Eine Kombination harmloser Buchstaben, die deinem Leben einen Sinn geben. Und dann gibt es Sätze, die ihn dir wieder entreißen. »Damals auf der Brücke« fiel definitiv in die letzte Kategorie. Wenn es nicht so traurig wäre, hätte man darüber lachen können, dass wir uns im Familienkreis wie die Figuren eines Harry-Potter-Romans benahmen, wenn wir von Du-weißt-schon-wer sprachen, anstatt die Dinge beim Namen zu nennen. Angelique, die geistig verwirrte Frau, der ich das Leben genommen hatte, war mein persönlicher Voldemort geworden.
»Julian, geh du doch schon mal vor in den Aufenthaltsraum, wo die Kinder auf uns warten, okay?« Ich kniete mich hin, um mit ihm auf Augenhöhe zu sein. »Ich will nur schnell nachsehen, ob ich mein Portemonnaie im Wagen vergessen habe.«
Julian nickte stumm.
Ich folgte ihm mit meinem Blick, bis er um die Ecke verschwunden war und ich nur noch das Stampfen seiner Turnschuhe und das Schleifgeräusch der schweren Tragetasche hörte.
Dann erst drehte ich mich um, verließ das Krankenhaus und kehrte nie wieder dorthin zurück.
82. Kapitel
Der Volvo parkte im wintermorgendlichen Halbdunkel unter einer gewaltigen Kastanie vor der Klinik, deshalb steckte ich den Zündschlüssel ins Schloss, damit das Leselicht über dem Beifahrersitz funktionierte. Ich suchte überall: im Fußraum, hinten auf den Rücksitzen, unter einem Stapel alter Zeitungen neben mir. Kaum etwas hasste ich so sehr wie vollgestopfte Hosentaschen beim Fahren, und so warf ich in der Regel Schlüssel, Handy und Brieftasche auf den Nachbarsitz, bevor ich mich ans Steuer setzte. Ein Ritual, das ich diesmal offenbar durchbrochen hatte. Denn außer einem Kugelschreiber und einer angebrochenen Packung Kaugummis konnte ich nichts finden. Ich beförderte die Zeitungen in den Fußraum und sah auch zwischen den Polsterritzen nach. Nichts. Das Portemonnaie blieb verschwunden.
Nachdem ich noch einmal unter den Sitzen gesucht hatte, öffnete ich das Handschuhfach, obwohl ich mir sicher war, hier noch nie etwas anderes aufbewahrt zu haben als den Scanner, mit dem ich den Polizeifunk abhörte. Zu Beginn meiner Reporterlaufbahn hatte es mir jedes Mal einen Stich versetzt, wenn ich die Stimmen meiner ehemaligen Kollegen hören musste. Mittlerweile hatte ich mich daran gewöhnt, nicht mehr dazuzugehören. Außerdem hatte Thea Bergdorf, meine Chefin, mir den Job nur wegen meiner Insiderkenntnisse gegeben. Es war eine ungeschriebene Bedingung meines Arbeitsvertrags, den Polizeifunk zu verfolgen, wann immer ich unterwegs war. Ganz besonders an Tagen wie diesen, an denen wir mit dem Schlimmsten rechneten. Also hatte ich es so eingerichtet, dass sich der Scanner automatisch einschaltete, sobald ich den Zündschlüssel umdrehte, und deshalb blinkte das zischende Ding im Handschuhfach wie ein Weihnachtsbaum.
Ich wollte die Suche gerade beenden und endlich zu Julian zurückkehren, als ich eine Stimme hörte, die mich meine Sorge um das verschwundene Portemonnaie sofort vergessen ließ.
»… Westend, Kühler Weg, Ecke Alte Allee …«
Ich sah zum Handschuhfach, dann drehte ich den Scanner lauter.
»Wiederhole. Eins null sieben am Kühlen Weg. Mobile Einheiten der AS4 vor Ort.«
Mein Blick wanderte zu der Uhr im Armaturenbrett.
Verdammt. Nicht schon wieder.
Eins null sieben. Der offizielle Funkcode für den Fund einer Leiche.
AS4.
Die vierte Spielrunde des Augensammlers hatte begonnen.
81. Kapitel
(Noch 44 Stunden und 38 Minuten bis zum Ablauf des Ultimatums)
Dunkel. Schwarz. Nein, nicht schwarz.
Das ist das falsche Wort.
Es war ja nicht so wie der Lack von Papas neuem Wagen. Auch nicht wie diese fleckige Dunkelheit, die vor den Augen zuckt, wenn man sie plötzlich schließt. Und es war auch nicht dieses gräuliche, schummerige Schwarz, das er von der Nachtwanderung her kannte, die sie mit Frau Quandt gemacht hatten. Das hier war anders. Irgendwie dichter. Unheimlicher. Als wäre er in einem Ölfass untergetaucht und hätte die Augen aufgerissen.
Tobias schlug erneut die Lider auf.
Nichts.
Das dunkle Loch um ihn herum war noch sehr viel undurchdringlicher als der Wald, der das Ferienlager umgeben hatte, in das sie im letzten Sommer mit der Klasse gefahren waren. Anders als am Postfenn gab es hier weder Mondlicht noch den Schein der Taschenlampen, in dem sie während der Schnitzeljagd mitten durch den Grunewald den Forstweg nach Briefchen abgesucht hatten. Hier roch es nicht nach Erde, Laub und Wildschweinscheiße, und Lea, die alte Heulsuse, hielt weder seine Hand noch zuckte sie bei jedem Rascheln und Knacken zusammen. Wobei es hier auch gar keine Geräusche gab, die seiner Zwillingsschwester hätten Angst einjagen können. Hier, wo immer hier sein mochte, gab es … nichts.
Nichts, außer seiner grenzenlosen Angst, gelähmt zu sein.
Denn obwohl er wusste, dass Dunkelheit keine Arme hatte (so wie er von Dr.Hartmann, seinem Kunstlehrer, wusste, dass Schwarz keine Farbe war, sondern einfach nur das Fehlen von Licht), fühlte er sich von dem Schwarz fest im Klammergriff gepackt.
Noch immer wusste er nicht, ob er stand oder lag. Womöglich hing er sogar kopfüber, was den Druck unter der Stirn erklären würde und weshalb er sich so triselig fühlte. Oder duhn, wie sein Vater immer sagte, wenn er nach der Arbeit nach Hause kam und Mama befahl, ihm eine Badewanne einzulassen.
Toby hatte sich nie getraut zu fragen, was duhn eigentlich bedeutete. Papa mochte es nicht, wenn seine Kinder zu viel wissen wollten. Diese Lektion hatte er im Urlaub gelernt. Vor zwei Jahren, in Italien, als er es beim Abendessen gewagt hatte, noch einmal nachzufragen, ob caldo wirklich kalt heißt. Papa hatte ihn ermahnt, endlich mit seiner bescheuerten Fragerei aufzuhören, und bestimmt hätte ihn Mamas Blick warnen sollen, die Italienischkenntnisse seines Vaters besser nicht in Frage zu stellen. Doch er konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen, dass dann wohl jeder Wasserhahn im Hotel kaputt sein müsse, weil aus denen mit der Aufschrift caldo nur warmes Wasser käme. Papa war die Hand ausgerutscht. Nach jener Ohrfeige im Restaurant hatte er aufgehört, zu viele Fragen zu stellen, was sich jetzt verdammt noch mal als beschissener Fehler erwies. Nun wusste er nicht, was duhn hieß, er hatte keine Ahnung, weshalb ihm so übel war und er sich nicht mehr bewegen konnte. Füße und Kopf schienen in einer Schraubzwinge zu stecken, und die Arme spürte er gar nicht mehr. Nein, falsch. Er spürte sie nur noch bis zu den Schultern und vielleicht noch etwas darunter, wo es auf einmal so entsetzlich kribbelte, als spielte sein bester Freund Kevin mit ihm »Tausend Stecknadeln«. Kevin, dieser Angeber, der eigentlich Konrad hieß, doch jedem Prügel androhte, der ihn mit diesem »Schwulinamen« anredete.
Kevin, Konrad, Kackarsch …
Alles unterhalb der Ellbogen, also das, was normalerweise doch immer links und rechts von ihm lag, baumelte oder hing, seine Unterarme, die Handgelenke, die Hände (Scheiße, wo sind meine Hände?) – all das war verschwunden.
Er wollte schreien, doch sein Mund war zu trocken, wie überhaupt der gesamte Rachen. Alles, was er herausbrachte, war ein armseliges Krächzen.
Warum habe ich keine Schmerzen? Wieso schwimme ich nicht in Blut, wenn meine Hände abgeschnitten sind? Amputiert oder wie das heißt. Scheiße, hab ich auch nicht gefragt.
Ein abgestandener Duft drang in Tobys Nase, süßlich wie ranzige Butter, nur lange nicht so intensiv. Es dauerte eine Weile, bis er merkte, dass die Schraubzwinge, in der er lag, von Wänden umgeben sein musste, die ihm seinen schlechten Atem ins Gesicht zurückwarfen. Noch länger dauerte es, bis er zu seiner grenzenlosen Erleichterung seine Hände wiederfand. Direkt unter seinem Rücken.
Ich bin gefesselt. Nein, falsch. Ich bin eingeklemmt.
Jetzt überschlugen sich seine Gedanken.
Auf jeden Fall liege ich auf meinen Armen drauf.
Fieberhaft dachte er nach, was er zuletzt gemacht hatte, bevor er hier hereingekommen war. Hier in dieses Nichts. Doch in seinem Kopf schwappte nur eine Schmerzwelle umher, die sein Gedächtnis weggespült zu haben schien. Das Letzte, woran er sich erinnerte, war, dass sie abends im Wohnzimmer Tennis gespielt hatten mit diesem bescheuerten Computerspiel, bei dem man wie blöde vor dem Fernseher rumhüpfen musste und bei dem Lea immer gewann. Dann hatte Mama sie zu Bett gebracht. Und jetzt war er hier. Hier, in diesem Nichts.
Toby schluckte, und auf einmal war die Angst noch größer. So groß, dass er das stinkende Rinnsal zwischen seinen Beinen nicht bemerkte. Die Angst, lebendig begraben zu sein, schaffte nun das, was die Enge seines unsichtbaren Gefängnisses nicht vollständig vermocht hatte. Sie lähmte ihn.
Toby schluckte erneut und dachte, die Dunkelheit war wie ein lebendiges Wesen, das einen festhalten konnte und das nach Metall schmeckte, wenn man es hinunterschluckte.
Ihm wurde übel, so wie damals auf der langen Autofahrt, als er hatte lesen wollen und Papa sauer wurde, weil sie anhalten mussten. Er hielt die Luft an, um sich nicht übergeben zu müssen, als plötzlich …
Scheiße, was …?
Toby ließ die Zunge im Mund umherwandern und stieß auf einen Fremdkörper.
Himmel, was ist das?
Das Ding klebte am oberen Gaumen wie ein Kartoffelchip, der sich dort festgesaugt hatte. Nur seine Oberfläche war fester, glatter.
Und kühler.
Er ließ die Zunge weiter über den Gegenstand gleiten und spürte, wie sich immer mehr Speichel ansammelte. Intuitiv atmete er nur noch durch die Nase und unterdrückte den drängenden Schluckreiz. So lange, bis der Fremdkörper sich mit einem leisen Schmatzen vom Gaumen löste und ihm auf die Zunge fiel.
Und dann wusste er es. Auch wenn Toby sich nicht erinnern konnte, wie er hierhergekommen war, wer ihn verschleppt und versteckt hatte und warum er hier gefangen gehalten wurde, auch wenn er nicht die geringste Vorstellung davon besaß, was das dunkle Nichts überhaupt war, das ihn umgab, so hatte er wenigstens dieses eine Rätsel gelöst.
Ein Geldstück.
Bevor Tobias Traunstein in das dunkelste Verlies der Welt geworfen worden war, hatte ihm jemand eine Münze in den Mund gelegt.
80. Kapitel
(Noch 44 Stunden und 31 Minuten bis zum Ablauf des Ultimatums)
Du gefühlloses, unzuverlässiges, egomanisches Arschloch.«
»Du hast widerwärtig und dummdreist vergessen.«
Meine Stimme klang ruhig, viel ruhiger als sonst, wenn ich mit meiner Noch-Frau stritt. Noch, denn bei unserem letzten Zusammentreffen hatten wir die Scheidung beschlossen. Jetzt wiederholte Nicci den Satz, den sie mir an jenem Abend schon einmal an den Kopf geworfen hatte: »Manchmal frage ich mich wirklich, wie ich jemals mit dir zusammenkommen konnte!«
Gute Frage. Ich nehm den Publikumsjoker!
Ehrlich gesagt war es mir selbst völlig unklar, was Frauen an mir fanden. Allein im Hörsaal der psychologischen Fakultät, in dem Nicci und ich uns kennengelernt hatten, hatte es eine Menge Männer gegeben, die attraktiver, größer und ganz gewiss charmanter gewesen waren, als ich es bin. Dennoch hatte sie sich für mich entschieden. An meinem Äußeren konnte das nicht gelegen haben. Ich hasse es, mich auf Fotos zu sehen. Von zweihundert Schnappschüssen gibt es maximal einen, für den ich mich nicht schäme. Meist ist es das verwackelte oder schlecht ausgelichtete Bild, bei dem man nicht sieht, dass sich mein Kinn langsam verdoppeln will. Früher hat man mich wegen meines traurigen Blicks oft mit Nicolas Cage verglichen, heute teile ich mir mit ihm allenfalls noch die schüttere Frisur. Seit meinem dreißigsten Geburtstag habe ich jährlich ein Kilo Gewicht draufgelegt. Und das, obwohl ich Fast Food meide und zweimal die Woche joggen gehe. Nicci hatte es einmal auf den Punkt gebracht, als sie mich zu Beginn unserer Beziehung ein »Liebhaberobjekt« nannte. Wie ein renovierungsbedürftiger Oldtimer: alt genug, um die Abwrackprämie zu kassieren, aber trotz seiner Macken zu attraktiv, um ihn einfach gegen ein neues Modell einzutauschen. Was diesen Punkt anging, hatte sie ihre Meinung mittlerweile natürlich geändert.
»Welcher Vater lässt seinen zehnjährigen Sohn allein in einem Sterbehospiz zurück?«, fragte sie wütend.
Ich machte mir gar nicht erst die Mühe, ihr zu erklären, dass Julian sich sehr verständnisvoll gezeigt hatte, als ich ihn aus dem Auto anrief, um ihn zu bitten, die Geschenke heute alleine zu verteilen, da ein Notfall eingetreten war. Immerhin musste ich zu einem Tatort, da konnte ich schlecht einen Zehnjährigen mitschleppen.
»Und welche Mutter schickt ihren Sohn mit einer Bronchitis zum Schamanen?«, erwiderte ich.
Verdammt, was würde ich jetzt für eine Zigarette geben.
Unbewusst fasste ich mir an den rechten Oberarm, wo ich das Raucherentwöhnungspflaster aufgeklebt hatte. Den Hörer hielt ich zwischen Kinn und Nacken eingeklemmt.
»Das ist unter meinem Niveau, Alex«, sagte Nicci nach einer kurzen Pause. »Du hast Julian noch nicht einmal Geld für ein Taxi dagelassen.«
»Weil ich meine Brieftasche irgendwo verloren haben muss. Herrgott noch mal. Manchmal laufen Dinge eben nicht so glatt.«
Manchmal werden sogar Kinder entführt und ermordet.
»In deiner Welt, Alex«, erwiderte sie, »in deiner Welt geschieht ein Unglück nach dem anderen, weil du diese Schwingungen hast.«
»Bitte nicht schon wieder …«
Meine Hände zitterten, und ich versuchte, mich zu beruhigen, indem ich sie noch enger um das Lenkrad presste. Seitdem ich mit dem Rauchen aufzuhören versuchte, war meine innere Unruhe noch schlimmer geworden als zuvor.
Trotz juckendem Pflaster auf dem Trizeps.
»Das ist deine negative Energie. Du ziehst das Böse regelrecht an«, sagte sie fast mitleidig.
»Ich schreibe nur darüber. Ich berichte über die Fakten. Da draußen läuft ein Psychopath frei herum, der Familien auf eine Art und Weise zerstört, die so grausam ist, dass selbst das Schmierblatt, für das ich arbeite, sich nicht traut, alle Details abzudrucken.«
Er spielt das älteste Kinderspiel der Welt: Verstecken. Und er spielt es, bis die gesamte Familie daran zerbrochen ist. Er spielt es bis zum Tod.
Mein Blick wanderte zu der alten Tageszeitung auf dem Beifahrersitz mit der Schlagzeile, die ich selbst formuliert hatte:
Der Augensammler. Schon wieder!
Drittes Kind tot aufgefunden.
Wie schon mein früherer Beruf als Unterhändler hatte mich auch mein neuer Job bei der Zeitung oft an die Grenzen des Erträglichen geführt. Doch der Fall des Augensammlers, der die Mütter der entführten Kinder tötete und den Vätern nur wenige Stunden Zeit gab, ihre Kinder wiederzufinden, bevor sie in einem Versteck erstickten, in das sie verschleppt worden waren, hatte dem Grauen eine neue Dimension verliehen. Und der Fakt, dass der Psychopath den Kinderleichen jeweils das linke Auge entfernte, sprengte endgültig die Grenzen des Vorstellbaren.
»Negative Gedanken manifestieren sich in der Realität«, dozierte Nicci weiter. »Denk positiv, und das Positive wird dir begegnen.«
Ich hatte mittlerweile auf dem Stadtring die Ausfahrt Messedamm erreicht und zählte rückwärts von zehn herunter, doch es funktionierte nicht. Bei sieben fiel ich schon aus der Rolle.
»Positives Denken? Bist du mittlerweile vollkommen durchgeknallt? Der Augensammler hat schon drei Spielrunden hinter sich.«
Sechs Tote: drei Mütter, zwei Mädchen, ein Junge.
»Glaubst du etwa, der Irre hört damit auf, wenn ich jetzt rechts ranfahre und ein lustiges Liedchen trällere? Nein, noch besser: Vielleicht gebe ich einfach eine Bestellung an das Universum auf, so wie es in dem Buch steht, das auf deinem Nachttisch liegt.« Ich redete mich in Rage. »Oder ich rufe eine von diesen Astrologie-Hotlines an, für die du ein Vermögen verpulverst. Vielleicht kann die Hausfrau am anderen Ende der Leitung ja mal kurz in den Kaffeesatz schauen, wo der Augensammler sich versteckt?«
Ich nahm das Handy vom Ohr, um den anklopfenden Anrufer zu identifizieren.
»Bleib bitte dran«, sagte ich und nahm dankbar den zweiten Anruf entgegen.
79. Kapitel
Hallo Alex. Ich bin’s, dein Lieblingsvolontär.«
Frank Lahmann.
Hätte er mich in einem besseren Moment erwischt, hätte ich ihn gefragt: »Lieblingsvolontär? Hast du etwa gekündigt?«, doch ich war gerade nicht zum Scherzen aufgelegt, also beließ ich es bei einem knappen »Hallo«.
»Ich störe dich ja nur ungern bei deinem Mittagsschlaf, Zorbach, aber Thea fragt, ob du zur 12-Uhr-Konferenz kommst.«
Die meisten Kollegen in der Redaktion hatten Probleme mit Franks vorlauter Art, doch ich hatte einen Narren an dem einundzwanzigjährigen Grünschnabel gefressen – vielleicht, weil wir auf einer altersüberschreitenden Wellenlänge lagen. Die meisten Frischlinge, die bei uns in der Redaktion saßen, taten dies aus den falschen Gründen: Sie fanden es cool, in den Medien zu arbeiten, und hofften darauf, irgendwann ebenso im Mittelpunkt zu stehen wie die Story, an der sie arbeiteten. Bei Frank war das anders. Für ihn war Journalismus kein Beruf, sondern eine Berufung, die er vermutlich auch dann ausleben würde, wenn unsere Zeitung ihm noch weniger Geld zahlte. Bei den Überstunden, die er freiwillig anhäufte, lag sein Stundensatz aktuell auf dem Niveau eines somalischen Feldarbeiters.
Wenn ich früher in Romanen die Formulierung las: »Ich erkenne mich selbst in dir!«, hatte ich immer die Augen verdreht und den Kitsch überblättert.
Doch als ich vor vier Wochen Franks Schlafsack im Kopierraum fand, ertappte ich mich bei demselben Gedanken. Mein Volontär erinnerte mich an mich selbst in meiner Ausbildungszeit bei der Polizei. Völlig besessen, krankhaft arbeitswütig und meinem Mentor gegenüber teilweise verdammt respektlos.
»Und ich soll dir ausrichten, dass du auf der Konferenz besser ein paar Fakten präsentieren solltest, die nicht schon längst auf den Websites der Konkurrenz durch den Ticker laufen. Sonst, ich zitiere den Drachen wörtlich, ›klatscht es gewaltig, aber keinen Applaus‹.«
Frank klang noch überdrehter als sonst, wie jemand, der gerade geschlafen hat, es sich aber um keinen Preis anmerken lassen will. Vermutlich lag es an den unzähligen Tassen Kaffee, die er gewiss auch heute schon in sich hineingeschüttet hatte.
Die Redaktionskonferenz.
Ich stöhnte leise. »Richte unserer Chefredaktöse bitte aus, ich schaffe es heute nicht.«
Mal wieder …
»O Mann«, sagte er und lachte. »Es ist deine Inquisition. Aber wehe, Thea lässt ihre Wut an mir aus und schickt mich zur Jahrespressekonferenz der Fliegenfischer oder so einen Mist.«
»Das kann sie vergessen. Ich brauche dich heute.«
Frank hustete nervös. Vermutlich spähte er im Moment über seinen Monitor hinweg zum Büro der Chefredaktion und hatte eine Miene aufgesetzt, als plane er gerade eine Verschwörung.
»Was soll ich tun, Mr.President?«, flüsterte er.
»Geh zu meinem Schreibtisch. In irgendeiner Schublade, ich glaube, es ist die unterste, liegen fünfzig Euro und eine Kreditkarte. Mit einem Gummi drum herum.«
Eine Weile hörte ich nur atmosphärisches Rauschen und die typischen Geräusche einer Großraumredaktion.
»Es sind nur zwanzig Euro, du Aufschneider. Und eine grüne Amex, nicht mal die goldene.«
»Du musst mir beides sofort vorbeibringen. Ich hab meine Brieftasche verloren und kaum noch Sprit im Tank.«
»Deine Brieftasche? So ein Mist.«
Ich hörte einen Bürostuhl quietschen und sah vor meinem geistigen Auge, wie Frank sich an meinen Tisch gesetzt hatte und seine Standardtelefonhaltung einnahm: Das Handy zwischen Schlüsselbein und Kinn eingeklemmt, beide Ellbogen auf dem Tisch und die Hände hinter dem kurzgeschorenen Nacken verschränkt.
»War wenigstens ein Kinderfoto im Portemonnaie?«
Von Julian?
»Was? Nein.« Ich war etwas verwirrt.
»Das ist schlecht. Sehr schlecht.«
Er räusperte sich, ein sicheres Anzeichen für einen Monolog. Da vor mir der Fahrer eines Kleinbusses unmotiviert die Spur wechselte, war ich abgelenkt und verpasste die Gelegenheit, Franks Vortrag im Keim zu ersticken.
»Laut einer Studie der Universität Hertfordshire werden verlorene Geldbörsen eher zurückgegeben, wenn etwas Persönliches drin ist. Fotos von kleinen Kindern, der Ehefrau oder von kleinen Welpen zum Beispiel.«
»Das ist ja wirklich sehr interessant«, sagte ich, doch er schien die Ironie in meiner Stimme nicht wahrzunehmen.
»Die haben zweihundertvierzig Brieftaschen mit Absicht weggeworfen, um zu sehen, welche davon wieder zurück…«
»Frank, es reicht, ja? Ich hab wirklich keine Zeit für diesen Quatsch.«
Endlich war ich zu ihm durchgedrungen. »Schnapp dir das Geld und mach dich auf den Weg.«
Ich gab ihm die Adresse durch und schloss mit den Worten: »Und beeil dich. Ich glaube, es geht wieder los.«
Die Leitung klang auf einmal wie tot, und ich befürchtete schon, in ein Funkloch gefahren zu sein, als es am anderen Ende leise raschelte.
»Der Augensammler?«, fragte Frank.
»Ja.«
»Scheiße«, flüsterte er. Er war noch zu jung und zu frisch dabei, um solche Informationen routiniert und abgebrüht zu kommentieren. Auch das war etwas, was ich an ihm schätzte. Er wusste, wann die Zeit für dumme Sprüche vorbei war.
Ich hatte Frank vor einem Jahr aus einer Flut von Bewerbern herausgefischt und mich damit gegen Thea Bergdorf durchgesetzt, die lieber ein charmantes Püppchen von der Münchner Journalistenschule eingestellt hätte und nicht einen »Milchbubi«, wie sie mit Blick auf sein Foto bemerkt hatte. »Der sieht ja aus wie der Junge von der Zwiebackpackung, den nimmt doch keiner ernst, wenn er irgendwo auftaucht.«
Doch Frank Lahmann hatte sich als Einziger nicht mit einem Lebenslauf, sondern mit einer Story beworben. Der Bericht über schwerste Vernachlässigungen von Demenzkranken in privaten Altersheimen hatte es auf Seite vier geschafft. Außerdem war Frank das absolute Recherche-Ass, auch wenn er das nutzlose Wissen, das sich ihm beim Durchforsten der Nachrichtenagenturen, Bibliotheken und des Internets offenbarte, bei jeder passenden und auch unpassenden Gelegenheit zu Gehör bringen wollte.
»Wir treffen uns in einer Viertelstunde«, sagte ich und wechselte zu Nicci zurück, die zu meiner Überraschung noch in der Leitung wartete.
»Hör zu, es tut mir leid, dass du Julian jetzt abholen musst«, versuchte ich es nun mit einem verbindlicheren Tonfall. Der Regen fiel wieder dichter, die Temperatur lag knapp über dem Gefrierpunkt, und vor mir kroch ein Mann mit Hut. »Ich verspreche dir, es kommt nicht wieder vor. Aber jetzt muss ich wirklich meinen Job machen.«
Nicci seufzte. Auch sie schien sich in der Zwischenzeit etwas beruhigt zu haben. »Ach Alex. Was ist nur aus dir geworden? Du könntest über so vieles schreiben. Über Glück und Liebe, zum Beispiel. Oder über Menschen, die mit ihren selbstlosen Taten und Gedanken die Welt verändern.«
Ich fuhr an einer Laubenpieperkolonie vorbei, bis der Asphalt aufhörte und die Straße sich in einen schlaglöchrigen Waldweg verwandelte. Früher hatte ich hier oft Tennis gespielt, daher kannte ich mich in dieser Gegend aus. Es war nicht der direkte Weg zum Kühlen, aber in Fällen wie diesen war es von Vorteil, nicht durch die Vordertür hereinzuplatzen.
»Aber der Vorfall damals …«
Auf der Brücke …
»… hat etwas in dir zerstört. Du wurdest zwar in allen Punkten freigesprochen, doch nicht vor deinem eigenen Gericht, hab ich recht? Dabei haben wir das doch schon x-mal durchgekaut: Du hast in Notwehr gehandelt. Es war richtig. Es gibt ja sogar ein Amateurvideo, das deine Aussage bestätigt.«
Ich schüttelte den Kopf, ohne etwas zu sagen.
»Anstatt den Hinweis des Schicksals zu akzeptieren und dein Leben zu verändern, jagst du heute immer noch den Verbrechern hinterher. Vielleicht nicht mehr mit der Pistole, aber dafür mit Diktiergerät und Kugelschreiber. Du bist immer noch auf der Suche nach den Abgründen.« Niccis Stimme bebte. »Sag mir, weshalb? Was fasziniert dich so am Tod, dass du darüber dein Kind, deine Familie und sogar dich selbst vernachlässigst?«
Ich krallte meine zitternden Hände wieder fester ins Lenkrad.
»Ist es, weil du dich bestrafen willst? Suchst du das Böse, weil du dich möglicherweise selbst für einen schlechten Menschen hältst?«
Ich hielt die Luft an und sagte nichts, sondern starrte nur durch die Windschutzscheibe vor mir und dachte nach. Als ich schließlich doch noch etwas erwidern wollte, merkte ich, dass die Frau, die einst glaubte, nur der Tod würde uns scheiden, nicht mehr in der Leitung war.
Der Waldweg war zu einem Trampelpfad für Pferde geworden. Links von mir reihte sich eine spießige Kleingartenlaube an die nächste, rechts befanden sich die Tennisplätze von Tennis Borussia. Ich ignorierte das Verbotsschild für Kraftfahrzeuge jeder Art und schaukelte den Volvo langsam um die Ecke.
Das wirklich Schlimme ist, dachte ich, während ich in etwa zweihundert Metern Entfernung den Tross der Einsatzwagen erkannte, die mit eingeschaltetem Warnlicht die Zufahrt zum Kühlen Weg absperrten … das wirklich Schlimme ist, dass in Niccis verschrobener Weltanschauung ein Fünkchen Wahrheit steckt.
Ich setzte mit meinem Volvo zurück und parkte ihn an dem schlammbedeckten Maschendrahtzaun, der den Waldweg von den verwaisten Tennisplätzen abtrennte.
Nicht ohne Grund war ich so lange mit ihr zusammen gewesen – trotz der Gegensätze, trotz der ewigen Streitereien um Kindeserziehung und Lebensplanung. Wir lebten seit einem halben Jahr in Trennung, aber natürlich war sie mir immer noch näher als jeder andere erwachsene Mensch auf diesem Planeten.
Ich stieg aus, entriegelte den Kofferraumdeckel, zog meinen Einsatzkoffer unter der Sporttasche hervor und öffnete ihn.
Sie hat mich durchschaut, dachte ich, während ich die Schutzkleidung anlegte, die verhindern sollte, dass ich den Tatort kontaminierte: ein schneeweißer Kunststoffanzug und ein Paar hellgrüne Plastiküberschuhe, die ich mir über meine ausgelatschten Timberland-Stiefel streifte.
Das Böse zieht mich an.
Unwiderstehlich.
Und ich weiß nicht, weshalb.
Ich schlug den Kofferraum zu und spähte die Straße hinunter, die zum Tatort führte. Dann drehte ich mich zur Seite und verschwand im Wald.
78. Kapitel
(Noch 44 Stunden und 6 Minuten bis zum Ablauf des Ultimatums)
Stoya sah in die Augen der Toten und konnte ihre Schreie hören. Er spürte die stummen Vorwürfe, vor denen der Leiter der Gerichtsmedizin seine Studenten immer warnte: Selbst wenn es einem gelingt, genügend Abstand zwischen sich und das Entsetzen zu bringen, das auch den hartgesottensten Ermittler hin und wieder beim Anblick einer Leiche überfällt; selbst wenn man versucht, den von Menschenhand geschändeten, missbrauchten und ermordeten Körper, der wie ein Stück Müll entsorgt, den Insekten, Wild und Wetter überlassen wurde, nicht mehr als Individuum, sondern als Beweisstück zu betrachten – selbst dann kann man den Vorwurf nicht überhören, den die Leichen ihrem Finder entgegenbrüllen. Sie schreien mit den Augen.
Philipp Stoya wollte sich abwenden und die Ohren zuhalten, denn heute war der Schrei besonders laut.
Die junge Frau war barfuß und nur mit einem dünnen Morgenmantel bekleidet, unter dem sie weder Slip noch BH trug. Lucia Traunstein lag bäuchlings auf dem Rasen, wenige Schritte von einem quaderförmigen Geräteschuppen entfernt, wo ihr Mann sie am Vormittag im Garten ihrer Stadtvilla gefunden hatte. Die Beine waren weit gespreizt und gaben den Blick auf ihre vollständig rasierte Scham preis. Dennoch hatten sie es hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mit einem Sexualdelikt zu tun.
Die verschwundenen Zwillingskinder Tobias und Lea und die Stoppuhr in Lucias Hand sprachen eine andere Sprache.
Die geisteskranke Sprache des Augensammlers, dachte Stoya.
Die grausamste Mordserie der Nachkriegszeit hatte vor drei Monaten begonnen, als Peter Strahl, ein zweiundvierzigjähriger Maurer, am Wochenende seine Familie besuchen wollte, nachdem er die letzten Wochen in Frankfurt auf einer Großbaustelle gelebt hatte. Die Ehe litt seit Jahren unter den regelmäßigen Phasen der Abwesenheit des Familienvaters, der diesmal besonders lange auf Montage gewesen war. Als kleine Entschädigung hatte er seiner Frau Blumen und für Karla eine Plastikpuppe mitgebracht. Beide Geschenke sollte er niemals übergeben. Er fand seine Frau mit gebrochenem Genick im Hausflur. Ihre Faust umschloss einen Gegenstand, der sich später als Stoppuhr entpuppte; ein handelsübliches Modell, das meistverkaufte in Deutschland.
Als der Mann von der Spurensicherung die Finger von dem Sport-Chronographen lösen wollte, wurde ein Countdown ausgelöst. Die Digitalanzeige setzte sich in Bewegung. Die Zeit lief rückwärts.
Der erste Gedanke galt einer Bombe, weshalb das gesamte Treptower Mietshaus mit allen zwölf Parteien sofort geräumt wurde. Doch am Ende musste man die grausame Lektion lernen, dass sich das Ultimatum auf Karla bezogen hatte. Die Kleine war spurlos verschwunden und tauchte auch nicht mehr lebend auf. Weder der Polizei noch dem verzweifelten Vater gelang es, das Versteck zu finden, in das der Psychopath das Mädchen verschleppt hatte. Ein Versteck, in dem es nach Ablauf der 45-Stunden-Frist ermordet wurde. Davon zumindest musste man nach den Erkenntnissen der Gerichtsmedizin ausgehen. Der Fundort der kleinen Karla, ein Feld am Stadtrand von Marienfelde, war mit Sicherheit nicht der Tatort, da es dort kein Wasser gab. Die Öffentlichkeit ging davon aus, dass die Kinder in ihrem Versteck erstickt waren, was im Grunde genommen auch stimmte. Allerdings hatte man aus ermittlungstaktischen Gründen eine wesentliche Erkenntnis der Obduktion verschwiegen: Die Opfer waren ertrunken. In dem Schaum, der sich bei Ertrinkenden nach dem reflexartigen Einatmen des Wassers in der Luftröhre bildet, fanden sich Spuren verunreinigten Brauchwassers. Da diese bei allen Opfern identisch waren, ging man davon aus, dass der Augensammler alle Kinder an denselben Tatort verschleppt hatte. Die Analyse des Wassers wie auch die der Hautverunreinigung sprachen nicht für ein natürliches Gewässer, was die Suche nach dem Versteck nicht gerade einschränkte. Jedes Haus mit Swimmingpool im Keller käme in Frage.
Sogar eine verdammte Badewanne wäre ausreichend, dachte Stoya.
Fest stand nur eines: Weder Karla noch Melanie oder Robert – die kindlichen Opfer, die wenige Wochen später folgten – waren in der freien Natur getötet worden. Und dort war ihnen auch nicht das linke Auge entfernt worden …
»Ich bringe ihn um«, hörte Stoya eine gepresste Stimme hinter sich sagen, während er reglos vor der Leiche kniete. Selbst dem Tod war es nicht gelungen, Lucia jene diät- und fitnessgestählte Attraktivität zu nehmen, die man oft bei Frauen findet, deren Männer wesentlich älter, wesentlich hässlicher und – nicht zu vergessen – wesentlich reicher sind. Als Eigentümer der größten Reinigungskette Berlins hatte sich Thomas Traunstein bestimmt mehr als nur eine Villa leisten können. Und ganz sicher mehr als eine Frau wie Lucia.
»Ich bringe das Schwein um. Das schwöre ich!«
Der Kollege, der sich von hinten über ihn beugte, passte kaum unter das Planenzelt, das die Kriminaltechniker erst vor wenigen Minuten im Garten aufgebaut hatten. Mike Scholokowsky war knapp zwei Meter groß und die Sorte von Freund, die man anrief, wenn man beim Umzug jemanden benötigte, der einen Kühlschrank in den fünften Stock wuchten sollte.
»Oder sie«, murmelte Philipp Stoya leise. Seine Knie knackten, während er sich langsam aufrichtete, den Blick unverwandt auf die tote Frau gerichtet.
»Hä?«
»Du bringst ihn um, Scholle. Oder sie. Noch wissen wir nicht, welches Geschlecht der Täter hat.«
Alle Opfer, sowohl die Frauen wie auch die Kinder, waren nicht besonders groß oder kräftig. Starker Widerstand musste also nicht gebrochen werden. Das Fehlen jeglicher Kampfspuren deutete darauf hin, dass der Täter das Überraschungsmoment für sich nutzte. Derjenige, der für den Tod von Lucia Traunstein und für die Entführung von Tobias und Lea verantwortlich war, konnte männlich oder weiblich sein oder gar im Team arbeiten, so viel hatte ihnen Professor Adrian Hohlfort, der Profiler, der mit ihnen an diesem Fall arbeitete, bereits verraten. Leider nicht sehr viel mehr.
Scholle zog die Nase hoch, rieb sich das Doppelkinn und starrte auf die Frau, deren Kopf in einem grotesken 90-Grad-Winkel verdreht auf dem Rumpf saß. Genickbruch. Ein weiterer Hinweis auf das Vorgehensmuster des Augensammlers.
Die weit aufgerissenen Augen der Toten starrten erstaunt an den beiden Ermittlern vorbei in den zugezogenen Wolkenhimmel.
Nein, sie starren nicht. Sie schreien.
»Fuck, ist mir egal.« Scholle spie die Worte förmlich in die kalte Luft. »Und wenn’s eine verdammte Nonne war. Ich bring sie trotzdem um.«
Stoya nickte. Als Leiter der sechsten Mordkommission wäre es seine Pflicht gewesen, seinen Assistenten zu mehr Sachlichkeit anzuhalten. Stattdessen sagte er nur: »Und ich helfe dir dabei.«
Ich kann auch nicht mehr. Ich habe das alles so satt. Dieses Mal mussten sie die Runde des perversen Versteckspiels gewinnen und den Augensammler fassen, bevor das Ultimatum ablief und der nächste Jogger über eine erstickte Kinderleiche stolperte.
Eine Kinderleiche, der der Perverse das linke Auge entfernt hatte … O Gott, was für ein Morgen.
Stoya sah zu Scholle, der vor Wut am liebsten das Planenzelt zerrissen hätte, und musste sich wieder einmal eingestehen, dass er von anderen Motiven getrieben wurde als sein Partner.
Scholle wollte Rache. Er selbst wollte nur ein besseres Leben. Verdammt, er jagte schon seit über zwanzig Jahren irgendwelchen asozialen Schweinen hinterher, und zum Dank dafür sah er mit Mitte vierzig bereits aus wie ein verfaulter Apfel. Fleckige Haut, schrumpelige Augenringe und eine platte Stelle am Hinterkopf. Der Preis, den man für Dauerstress und Schlafentzug bezahlt. Das alles wäre kein Problem gewesen, wenn der Job wenigstens den Kontostand gebracht hätte, der Frauen in der Regel dazu verleitet, auf Äußerlichkeiten keinen Wert mehr zu legen. Aber Fehlanzeige. Er war Dauersingle, und die meisten Verbrecher, die er jagte, verdienten in einer Stunde mehr als er im ganzen Monat.
Scholle will Rache. Ich will Karriere.
Ja verdammt, im Gegensatz zu allen anderen war er sich nicht zu fein, es offen zuzugeben. Stoya wollte nicht mehr mit beiden Händen in der Scheiße wühlen. Sein Ziel war ein politischer Frühstücksdirektorenposten mit festen Arbeitszeiten, besserer Bezahlung und einem großen Schreibtisch, hinter dem man sich den Hintern platt sitzen konnte.
Sollen doch die anderen im Regen neben einer nackten Frauenleiche knien.
Im Moment allerdings war er Lichtjahre von seinem Ziel entfernt, und sollte er nicht bald einen Erfolg vorweisen können, würde er von Glück sagen können, wenn er nicht wieder eine Uniform anziehen musste. Unterschiedliche Motive hin oder her, zumindest verfolgten er und Scholle dasselbe Ziel.
»Wir müssen den Wahnsinnigen finden.«
Stoya tastete mit klammen Fingern nach dem kleinen Plastiktütchen in seiner Hosentasche. Sobald der Gerichtsmediziner eingetroffen war, der sich bereits telefonisch über die besonderen Umstände des Falles informiert hatte, würde er in die Villa gehen, in der der Ehemann von einem Psychologen betreut wurde, und sich im Badezimmer einschließen. Hoffentlich war in dem Tütchen noch genug von dem Zeug übrig, das ihn die kommenden fünfundvierzig Stunden wach halten musste …
Was zum Teufel …?
Stoya hörte die Veränderung seiner Umgebung, bevor er sie sah. Es war der Klang des Regens, der etwa zwei Meter vom Zelt entfernt nicht mehr auf den Waldboden, sondern auf eine harte Oberfläche schlug. Auf Kleidung. Genauer gesagt auf einen weißen Schutzanzug, wie ihn Beamte der Spurensicherung tragen.
»Verdammt, was macht der Arsch denn hier?«, fragte Scholle. Seine ohnmächtige Wut auf den Augensammler hatte endlich einen Blitzableiter gefunden. Der Reporter, der in Hörweite zu ihnen herüberstarrte, war seinem Kollegen schon länger ein Dorn im Auge. Alexander Zorbach hatte sich vom Grunewald her zum Grundstück vorgepirscht und stand jetzt gemeinsam mit einem Mann am Gartenzaun, der einen Kopf kleiner und sehr viel jünger wirkte als er.
Fritz, Frank oder Franz. Stoya erinnerte sich dunkel, dass Zorbach ihm seinen Assistenten einmal auf einer Pressekonferenz vorgestellt hatte.
»Verpiss dich«, brüllte Scholle und griff zum Handy, doch Stoya legte ihm beruhigend die Hand auf die Schulter.
»Bleib hier, ich klär das.«
77. Kapitel
Stoya zog sich die Kapuze seiner Daunenjacke über den Kopf und trat in den strömenden Regen. Obwohl der Ärger mit jedem Schritt wuchs, war er doch froh, für einen Moment das Elend hinter sich lassen zu können.
»Was willst du hier?«, fragte er, als er bei Zorbach am Zaun angekommen war. Dessen junger Lakai hielt sich einige Meter entfernt. »Verdammt, was machst du hier?«
Er reichte ihm nicht die Hand, und er ging auch nicht durch die Gartentür hindurch zu ihm nach draußen, damit sie unter einem der Bäume Schutz suchen konnten.